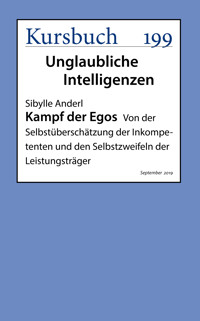Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie ist der Feuerball in unserem Teil der Galaxie, ohne sie ist kein Leben auf der Erde. Doch hat sich unser Verhältnis zu ihr in den letzten Jahren gewandelt: War sie früher das Himmelsgestirn, das Orientierung versprach und den Tag bestimmte, ist sie uns heute Drohung. Rücksichtslos brennt sie ganze Landstriche nieder und lässt die Polarkappen schmelzen, vor ihren Strahlen suchen wir Schutz – und zugleich ranken sich utopische Vorstellungen um sie, die scheinbar unendliche Energiequelle. Gemeinsam nähern sich Sibylle Anderl und Claus Leggewie dem Überwältigenden unseres Sterns als naturwissenschaftlichem und kulturgeschichtlichem Fakt. Wer etwas über die Sonne sagen will, kann über die heliozentrischen Kosmologien, Sonnengottheiten, die Funktionsweise von Halbleitern, Solar Geoengineering und Kernfusion nicht schweigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sibylle Anderl und Claus Leggewie
Die Sonne. Eine Entdeckung
Sibylle Anderl und Claus Leggewie
Die Sonne. Eine Entdeckung
Inhalt
Look up! Zur Einführung in eine Entdeckungsreise
Kapitel 1
Wie die Sonne entdeckt wurde
Die Sonne im Blick
Der Lauf der Sonne
Die imperfekte Sonne
Die endliche Sonne
Der Aufbau der Sonne
Die unruhige Sonne
Die Sonne und der Klimawandel
Moderne Missionen
Das Leben der Sonne
Die Sonne als Lebensspenderin
Kapitel 2
Sonnenaufgang: Was die Sonne bedeutet
Selbstlauf der Sonne
Die Macht der Sonne und ihre Stellvertreter auf Erden
Sol wird Christus
Der Westen besiegt den Osten
Der Fall der Sonnenkönige
Nichts Schönres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein: Der schöne Schein
Sonnenuntergang
Kapitel 3
Sonnenwende
Später Durchbruch einer alten Idee
Leichter erzeugt als gespeichert
Entdecker und Erfinder
Ein Siegeszug mit (politischen) Hürden
Innovationen sind nötig
Solares Geoengineering: die Sonne manipulieren
Eine umstrittene Strategie
Neues Interesse
Die Experimente beginnen
Eine Lösung, die Teil des Problems ist?
Sonne auf Erden: Prometheus heute
Besser als Kernspaltung
Wie man Atomkerne verschmelzen lässt
Erste Erfolge auf einem noch langen Weg
Ausblick: Zeit für Solarpunk?
Playlist
Abbildungsverzeichnis
Anmerkungen
Dank
Look up! Zur Einführung in eine Entdeckungsreise
Ist es wirklich nötig, die Sonne zu entdecken? Man sieht sie doch fast täglich. Wir denken: ja! Denn wer genauer hinschaut, findet so einiges: das jahrtausendealte Menschheitswissen über Wetter und Navigation, Ackerbau und Pflanzenzucht, Wohlbefinden und vieles mehr, was die Heutigen vergessen oder an Smartphones und Experten delegiert haben. Seit uns die Sonne immer häufiger den Schweiß auf die Stirn treibt und ganze Landstriche veröden, schaut man diese Quelle allen Lebens eher ängstlich an und versucht sich vor ihr zu schützen. Bei näherem Hinsehen entdeckt man, wie unvollkommen unser Stern ist, endlich und unruhig. Leistungsfähige Teleskope und Weltraummissionen lassen uns genauer ergründen, welche oft unerwarteten Eigenschaften die Sonne besitzt, woraus sie besteht, wie sie aufgebaut ist – und wann sie für unsere Zivilisation zur Gefahr werden kann.
Zu den astrophysikalischen Grundlagen unserer Neuentdeckung treten die ästhetischen Dimensionen von Licht, Farbe und Leben, das die Sonne spendet. Ebenso alt sind nämlich Mythen der Sonne: Im Lauf der Menschheitsgeschichte wurde sie vergöttlicht, vermenschlicht und politisiert. Ganze Kulturen bauen auf ihrer je speziellen Deutung der Himmelskörper auf und haben die Sonne mit unterschiedlichen Medien – Dichtung, Musik und vor allem bildende Künste – dargestellt. Zu entdecken sind also die Gründe für den Aufstieg und Fall der Sonnengötter und -könige und die Elemente einer solaren Gesellschaft, die ohne solche Personifizierungen auskommt.
Seit die Sonne als Nebeneffekt von Klimawandel und Artensterben wieder stärker ins Zentrum gerückt ist, wird sie auch als Krisenlöserin herangezogen. Mit Solarstrom lassen sich womöglich Energie- und Verkehrswende beschleunigen, mit solarem Geoengineering eventuell drohende Katastrophen abwenden und mit der Kernfusion freundliche Utopien einer nie versiegenden Energiequelle spinnen. Wie den Rest unserer natürlichen Umwelt wollen wir die Sonne entweder nutzen und verwerten oder sie mit Großtechnologie kontrollieren und beherrschen oder uns ihre Kraft durch die Imitation ihrer Energieerzeugung, der Kernfusion, aneignen. Alle drei Wege werden derzeit vorgeschlagen und verfolgt, aber man sollte nie vergessen, dass eine Entdeckung der Sonne ohne die Selbstentdeckung des Menschen nicht gelingen kann. Gleichzeitig gilt aber auch umgekehrt: Wir können uns selbst nicht verstehen, ohne die Sonne zu verstehen.
Kapitel1
Wie die Sonne entdeckt wurde
»When we look at the twinkling light of the stars, we need all our powers of imagination to visualize what they really are.«
Cecilia Payne-Gaposchkin, 19261
Die Sonne im Blick
Wenn wir Menschen heute in den Nachthimmel schauen, dann sehen wir dort die Planeten als besonders helle Punkte, und wir sehen unzählige Sterne. Wenn wir Glück haben (und gute Augen) auch unsere Nachbargalaxie Andromeda – und selbst bei schlechten Lichtverhältnissen sehen wir eine rasant wachsende Zahl über den Himmel eilender Satelliten und vielleicht auch ein paar blinkende Flugzeuge. Wir haben dabei zumindest eine grobe Vorstellung davon, was sich dort draußen im Kosmos abspielt, wissen vielleicht, dass die Erde der drittinnerste Planet in unserem Sonnensystem ist, dessen nächster Nachbarstern sich in der weiten Entfernung von 4,2 Lichtjahren befindet, und dass sich dieses System in 26 000 Lichtjahren Entfernung um das Zentrum einer Spiralgalaxie bewegt, die wir Milchstraße nennen. Deren Querschnitt sehen wir in dunklen Nächten als helles Band aus Sternen am Himmel, doch ist dieser Anblick angesichts verbreiteter Lichtverschmutzung selten geworden. Wir wissen heute zwar mehr über den Kosmos als je zuvor in der Menschheitsgeschichte, doch gleichzeitig ist dieses Wissen weniger denn je in unserem Alltag verankert.
Diese kosmische Alltagsentkoppelung hat auch damit zu tun, dass wir heute, anders als unsere Vorfahren, dank unserer Technologien in einer Position sind, in der wir insbesondere den Lauf der Sonne, aber auch den aller anderen Himmelskörper weitgehend ignorieren können. Die Sonne, und mit ihr das Wetter, scheint höchstens noch praktische Relevanz zu besitzen, wenn es um die Wahl der Verkehrsmittel oder der Freizeitaktivitäten geht. Doch als Informationsquelle dient uns heute nicht mehr der Blick in den Himmel, sondern unser Smartphone, das uns Navigation, Uhrzeit, Kalender und Wettervorhersage bereitstellt. Damit hat sich unser In-der-Welt-Sein im Vergleich zu den Zehntausenden Jahren der Menschheitsgeschichte vor uns radikal verändert. Unsere Vorfahren lebten im Bewusstsein der Abhängigkeit von diesem mächtigen Himmelskörper, der ihren Alltagsrhythmus ebenso bestimmte wie den Gang der Jahreszeiten. Sie richteten Gräber und Tempel nach dem Lauf der Sonne aus und kamen nicht umhin, sie aufmerksam zu beobachten, wenn sie ein gutes Leben führen wollten.
Heute laufen wir Gefahr, dieses praktische Wissen aus beobachtender Nähe zur Sonne zu verlieren – und damit unsere historisch so enge Beziehung zu unserem Heimatstern zusammen mit einem echten Gefühl für unsere Position im Kosmos. Nicht nur deshalb mag es aufschlussreich sein, mit der historisch ersten Entdeckung der Sonne zu beginnen und zu fragen: Was haben unsere Vorfahren aus der Beobachtung der Sonne über unseren Kosmos lernen können? Was sagt uns die Sonne als Bindeglied zwischen uns und dem All? Was können wir entdecken, wenn wir die Sonne ohne weitere Hilfsmittel einfach nur in ihrem jährlichen Lauf beobachten?
Der Lauf der Sonne
Die augenfälligste Wirkung der Sonne auf unser Leben besteht in den Jahreszeiten, die sich nicht nur durch unterschiedliche Tageslängen und Temperaturen auszeichnen, sondern auch durch den sich verändernden Lauf der Sonne. Wer diesen über das Jahr hinweg aufmerksam beobachtet – wozu die Wenigsten heute noch in der Lage sind –, dem fällt natürlich auf, dass die Mittagssonne vom Frühjahr bis zum Sommer auf der Nordhalbkugel jeden Tag immer höher steigt, bis sie zur Sommersonnenwende ihren höchsten Stand erreicht. Anschließend sinkt ihr höchster Punkt wieder tiefer und erreicht im Winter seine minimale Höhe, zusammen mit der kürzesten Tageslänge. Der längste und der kürzeste Tag im Jahr, Sommer- und Wintersonnenwende am 20., 21. oder 22. Juni beziehungsweise am 21. oder 22. Dezember, sind daher bemerkenswerte Daten. An ihnen besitzen Schatten beim höchsten Sonnenstand maximale oder minimale Länge. Auffällig sind außerdem diejenigen Zeitpunkte, an denen Tag und Nacht jeweils gleich lang sind und die als »Equinox«, als Tagundnachtgleiche, den Beginn von Frühling und Herbst markieren.
Nicht nur die Tageslängen und Höchststände der Sonne ändern sich über das Jahr hinweg. Der geduldige Beobachter bemerkt außerdem, dass die Orte des Sonnenauf- und untergangs am Horizont variieren – von Südost nach Nordost sowie von Südwest nach Nordwest und wieder zurück. Nur an den beiden Tagundnachtgleichen geht die Sonne genau im Osten auf und im Westen unter. Die Himmelsrichtung des Sonnenaufgangs am Horizont hängt dabei nicht nur vom Datum ab, sondern auch von der Position des Beobachters auf der Erde – genauer: von der geografischen Breite seiner Position. Während oberhalb des Polarkreises die Sonne im Hochsommer nie unter- und im tiefsten Winter nie aufgeht, variiert die Tageslänge über das Jahr am Äquator nur wenig.
Die ersten Bauern im Neolithikum ab etwa 10 000 v. Chr. waren bereits aufmerksame Sonnenbeobachter. Bei Aussaat und Ernte waren sie in deutlich stärkerem Maße von den Jahreszeiten abhängig als ihre wandernden und jagenden Vorfahren. Bauwerke der Jungsteinzeit wie etwa der irische Newgrange-Grabhügel oder das bekannte Stonehenge-Monument weisen Ausrichtungen auf, die offenbar so geplant wurden, dass sie zur Winter- oder auch Sommersonnenwende beziehungsweise zu den Tagundnachtgleichen bei Sonnenaufgang in besonderer Weise erleuchtet werden. Dadurch lieferten sie zeitliche Orientierung im Jahreslauf.
Solche architektonischen Besonderheiten findet man auch später noch weltweit in Kultstätten von praktisch allen Kulturen. Im mexikanischen Chichén Itzá etwa wird die Pyramide des Kukulkán, gebaut vermutlich um das Jahr 1000 n. Chr., um die beiden Tagundnachtgleichen zum Sonnenuntergang so beleuchtet, dass eine Schlange die Pyramide hinabzugleiten scheint.2 Die Inkastadt Machu Picchu beherbergt verschiedene Bauwerke, die auf den Sonnenstand zu den Sonnenwenden Bezug nehmen.3 Im peruanischen Chanquillo wurden im 4. Jahrhundert v. Chr. 13 Türme so errichtet, dass sie als präzise Messskala für die sich über das Jahr hinweg am Horizont verschiebenden Sonnenaufgänge dienen konnten.4 Es gibt unzählige weitere Beispiele für solche astronomischen Bauten – auch wenn deren astroarchäologische Deutung im Rückblick nicht immer einfach und oft kontrovers ist. Doch sie verdeutlichen, wie wichtig es während des größten Teils der Menschheitsgeschichte war, anhand des Laufs der Sonne die richtigen Zeitpunkte für Saat und Ernte, aber auch für heilige Rituale zu ermitteln.
Frühe Hochkulturen wie die chinesische, die ägyptische oder die babylonische berücksichtigten den Stand der Sonne nicht nur in ihren Bauwerken,5 sie erstellten auch umfangreiche Aufzeichnungen zu besonderen Himmelsereignissen und der Position der Himmelskörper. Zur Protokollierung des Sonnenstands im Jahreslauf existiert ein besonders einfaches Instrument: der Gnomon, ein senkrecht im Boden steckender Stab. Seine Verwendung ist in China und Babylonien bereits für die Zeit vor mehr als 2000 Jahren v. Chr. nachgewiesen.6 Wenn man die Schattenrichtungen zu Mittag (beziehungsweise die Winkelhalbierende zwischen zwei gleich langen Schatten, die vor und nach Mittag beobachtet wurden) markiert, kann man damit die Himmelsrichtung Norden bestimmen. Die Schattenlänge zu Mittag zeigt wiederum die Jahreszeit und in ihren Extremwerten die Sonnenwenden an – je höher die Sonne im Sommer steigt, desto kürzer der Schatten. Der Vergleich der Mittags-Schattenlängen an verschiedenen Standorten schließlich ermöglicht eine Schätzung der geografischen Breite. Sofern der Schatten noch zu anderen Tageszeiten als nur mittags protokolliert wird, wird aus dem Gnomon eine Sonnenuhr, eine Anwendung, die etwa für das Alte Ägypten dokumentiert ist.7
Dass ein Jahr, ein voller Durchlauf der vier Jahreszeiten, aus rund 365 Tagen besteht, beobachteten viele der frühen Hochkulturen. Für die Erstellung von verlässlichen Kalendern ergibt sich allerdings das Problem, dass die Jahreslänge – also die Zeit, bis Erde und Sonne nach einem Umlauf der Erde wieder die gleiche relative Position zueinander einnehmen – keinem ganzzahligen Vielfachen der Tageslänge entspricht, sondern sie beträgt 365 Tage und knapp 6 Stunden. Sofern ein Jahr als Zeitraum von 365 Sonnentagen definiert wird, also ohne Berücksichtigung der zusätzlichen sechs Stunden, verschieben sich Kalender und Jahreszeiten mit der Zeit relativ zueinander. Dass man diesen Effekt durch die Einführung eines Schalttages alle vier Jahre grob kompensieren kann, bemerkte bereits Erastosthenes von Kyrene im 3. Jahrhundert v. Chr. Im Jahr 238 v. Chr. ließ Pharao Ptolemaios III. einen solchen Schalttag einführen,8 später griff auch Julius Cäsar diese Lösung auf. Im gregorianischen Kalender wurde schließlich durch die Einführung bestimmter Schaltjahre (Jahreszahlen, die durch 4 und 100, aber nicht durch 400 teilbar sind), in denen der Schalttag entfällt, der Tatsache Rechnung getragen, dass es eben jedes Jahr nicht genau sechs Stunden sind, die zu den 365 Tagen hinzukommen, sondern nur 5 Stunden und knapp 49 Minuten.
Neben den Sonnenbeobachtungen, die den Menschen eine zeitliche Orientierung in ihrer Abhängigkeit von den Jahreszeiten ermöglichten, betraf eine weitere wichtige Klasse von Beobachtungen die Sonnen- und Mondfinsternisse. Es ist eine merkwürdige Besonderheit des Erde-Mond-Sonne-Systems, dass der relative Unterschied der scheinbaren Größen von Sonne und Mond recht genau vom relativen Unterschied von deren Entfernungen zur Erde kompensiert wird: Ihre Größe unterscheidet sich um fast den Faktor 400 und genauso ihre Entfernung. Beide Himmelskörper erscheinen daher gleich groß am Himmel – wobei das genaue Größenverhältnis zu einem gewissen Grad vom variierenden Abstand der Erde zur Sonne auf ihrer elliptischen Bahn und vom leicht variierenden Abstand des Mondes zur Erde abhängt.
Es gibt wohl kein anderes astronomisches Phänomen, das so eindrucksvoll wirkt wie eine Sonnenfinsternis, wenn mitten am Tag Dunkelheit hereinbricht. Es überrascht daher nicht, dass Sonnenfinsternisse vielfach als Zeichen bevorstehenden Unheils gedeutet wurden, und ihre Aufzeichnung und Vorhersage war in vielen Kulturen eine wichtige Aufgabe. Die ältesten Zeugnisse der Beobachtung von Sonnenfinsternissen sind einige Jahrtausende alt. Im irischen County Meath könnten in einer Grabanlage entdeckte Steingravuren als Darstellungen einer Sonnenfinsternis etwa 3300 v. Chr. gedeutet werden.9Im heutigen Syrien wurde eine Tontafel gefunden, auf der eine Sonnenfinsternis vermerkt wurde, die wohl entweder 1375 oder 1223 v. Chr. beobachtet wurde. Etwa 1200 v. Chr. wurden im chinesischen Anyang von Schriftgelehrten Sonnenfinsternisse auf Ochsenschulterblättern und Schildkrötenpanzern festgehalten. Auch bei den Mayas und in der Pueblo-Kultur wurden entsprechende Aufzeichnungen gefunden, die sich als Protokolle von Sonnenfinsternissen deuten lassen.
Heute wissen wir (wie auch schon die Griechen in den letzten Jahrhunderten v. Chr.), dass die Finsternisse auftreten, wenn Sonne, Erde und Mond sich in einer geraden Linie befinden, sodass sich der Mond vor die Sonne schiebt – bei Mondfinsternissen ist es der Erdschatten, der auf den Vollmond fällt. Da aber die Bahnebenen des Mondes relativ zu der Bahnebene der Erde um die Sonne geneigt sind, passiert das nicht bei jedem Voll- und Neumond, sondern nur, wenn der Mond durch die Ebene der Erdbahn tritt und die drei Himmelskörper tatsächlich mit ausreichender Genauigkeit auf einer Linie stehen. Der Kernbereich des Mondschattens fällt außerdem immer nur auf einen schmalen, einige Hundert Kilometer breiten Streifen auf der Erde: Sonnenfinsternisse sind kein globales Phänomen. Für unsere Vorfahren hieß das: Die Vorhersage von Sonnenfinsternissen war eine überaus schwierige Herausforderung.
Trotzdem versuchten sich Menschen schon früh an dieser Aufgabe.10 Ein beobachtbares Anzeichen einer möglichen Finsternis ist die räumliche Nähe von Sonne und Mond bei Voll- oder Neumond. Für eine längerfristige Vorhersage braucht man aber historische Aufzeichnungen vergangener Finsternisse, um darin nach mathematischen Regelmäßigkeiten zu suchen. Am umfassendsten wurde das von den Babyloniern betrieben. Zwischen 700 und 50 v. Chr. dokumentierten sie viele Hunderte dieser Ereignisse und sagten auf dieser Grundlage deren Auftreten voraus. Wie genau sie das anstellten, ist nicht in allen Einzelheiten klar, aber tatsächlich gibt es verschiedene Zyklen, die dafür genutzt werden können, etwa die Saros-Periode: Demnach wiederholt sich eine Finsternis nach 223 Mondzyklen, also nach etwa 18 Jahren. Es gibt noch weitere Zyklen mit anderen Perioden. Alle Finsternisreihen enthalten jeweils eine endliche Anzahl von Finsternissen, die zunächst partiell sind und im Fortschreiten der Reihe total werden, bevor sie wieder zu partiellen Finsternissen werden. Die Saros-Reihen sind deswegen besonders zuverlässig, weil sie sich über so viele Jahrhunderte erstrecken, dass sie über Generationen hinweg Gültigkeit bewahren. Auch von anderen Kulturen wie den Maya und ebenso von den antiken Griechen weiß man, dass sie diese Zyklen kannten.
Insbesondere die antiken Griechen versuchten anhand theoretischer Überlegungen auf unseren Platz im Kosmos zu schließen, und dabei spielten die Finsternisse eine wichtige Rolle. Als Grundlage dienten ihnen die erwähnten längerfristigen Beobachtungen der Sonne und auch anderer Himmelskörper – viele Einsichten hatten sie von den Babyloniern übernommen. Dass die Erde eine Kugel ist, zeigt sich bereits an der Kreisform des Erdschattens, wenn dieser auf den Mond fällt. Man kann das aber ebenso aus der Tatsache erschließen, dass die Schatten, die von der Sonne zum selben Zeitpunkt an Orten verschiedener geografischer Breite geworfen werden, verschieden lang sind. Erastosthenes von Kyrene nutzte diese Erkenntnis der unterschiedlichen Schattenlängen dafür, unter Verwendung der bekannten Distanz zwischen den Orten Kyrene und Alexandria, mit hoher Genauigkeit den Erdumfang zu berechnen.
Aristarchos von Samos ist ein weiterer griechischer Astronom des 3. Jahrhunderts v. Chr., der große Bekanntheit damit erlangte, wie viel er aus der reinen Beobachtung von Sonne und Mond abzuleiten vermochte. Konkret versuchte er auf der Grundlage geometrischer Überlegungen die Distanzen und Größen von Sonne und Mond zu bestimmen. Für die Ableitung der relativen Distanzen von Sonne und Mond nutzte er die Feststellung, dass bei Halbmond Sonne und Erde vom Mond aus gesehen einen rechten Winkel bilden. Indem er zu diesem Zeitpunkt von der Erde aus auch den Winkel zwischen Mond und Sonne ausmaß, konnte er die relativen Seitenlängen des Dreiecks bestimmen – heute würde man das trigonometrisch mithilfe des inversen Cosinus bewerkstelligen. Das Problem ist allerdings, dass die Sonne so weit entfernt ist, dass Mond und Sonne ebenfalls fast im rechten Winkel erscheinen und die Messung daher überaus genau sein muss. Aristarchos maß einen Winkel von 87 Grad und schloss daraus, dass die Sonne 19-mal weiter von der Erde entfernt ist als der Mond und damit, aufgrund der gleichen scheinbaren Größe, auch 19-mal so groß wie der Mond. Tatsächlich beträgt der Faktor fast 400. Angesichts der Genialität der Methode und der Schwierigkeit der Messung mag man ihm diesen Fehler verzeihen.
Anhand der Beobachtung, wie viel Zeit der Mond bei einer Mondfinsternis dafür benötigt, in den Erdschatten zu treten, und wie viel Zeit er im Erdschatten verbringt, kam Aristarchos, wiederum geometrisch, außerdem zu den relativen Größenverhältnissen von Erde und Mond, die er angesichts der vorliegenden Schätzung des Erddurchmessers dafür nutzen konnte, auf absolute Distanzen und Größen zu schließen. Aristarchos gilt zudem als früher Verfechter des heliozentrischen Weltbildes und soll sogar die kontraintuitive These vertreten haben, dass die Erde sich dreht. Allerdings setzten sich beide Vorstellungen bekanntlich erst sehr viel später dauerhaft durch, als Kopernikus, Kepler und Galilei die griechische Methode weiterführten, indem sie die vorliegenden Beobachtungsdaten mithilfe geometrisch motivierter Modelle des Kosmos deuteten.
Heute wissen wir, dass sich die Erde um die Sonne dreht, dass ihre Achse nicht senkrecht auf ihrer Bahnebene, der Ekliptik, steht, sondern dieser gegenüber um derzeit 23,44 Grad geneigt ist. Wir wissen, dass diese Neigung für die Jahreszeiten verantwortlich ist, weil die Sonne während eines halben Umlaufs der Erde oberhalb des Äquators steht – und somit eher von Norden auf die Erde scheint – und während der anderen Hälfte unterhalb und damit den Süden bevorzugt. Wir wissen, dass sich die Erdachse selbst langsam über 25 800 Jahre auf einem Kegelmantel dreht, ein Phänomen das man als Präzession bezeichnet. Das führt dazu, dass sich der Fixsternhimmel relativ zum Jahresverlauf langsam ändert – eine Tatsache, die unter anderem nach sich zieht, dass die astrologischen Sternbilder heute zu anderen Zeiten am Nachthimmel sichtbar sind als vor einigen Tausend Jahren. Wir wissen außerdem, dass die Erde sich nicht auf einer Kreisbahn, sondern einer Ellipse um die Sonne bewegt, und zwar langsamer in Sonnennähe und schneller, wenn sie weiter entfernt ist. Dadurch scheint sich die Sonne zu verschiedenen Jahreszeiten verschieden schnell am Himmel zu bewegen und erscheint zudem leicht unterschiedlich groß.11
Ihre zentrale Bedeutung für unser Leben macht die Sonne zum wichtigsten Himmelskörper. Kein anderer kommt ihr im Einfluss auf uns auch nur nahe. Diese Sonderstellung spiegelt sich zudem darin wider, dass ihr detaillierteres Studium besondere Herausforderungen mit sich bringt: Bereits mit dem bloßen Auge sollte man niemals direkt in die Sonne schauen, wenn man keine Schädigungen der Netzhaut riskieren möchte. Umso mehr gilt das für die Nutzung moderner Teleskope, die typischerweise darauf ausgerichtet sind, schwache Lichtquellen aufzulösen. Wer solch ein empfindliches Instrument ungeschützt auf die Sonne richtet, wird die implementierte Technik zerstören. Die solare Astrophysik besitzt daher heute ihre eigenen Detektoren und Observatorien; Weltraummissionen, die in ihre Nähe fliegen, müssen viel Aufwand in den Schutz der Messgeräte investieren. Gleichzeitig ist die Sonne für die Astrophysik ein einzigartiges Studienobjekt, denn als uns nächster Stern bietet sie die Gelegenheit, stellare Prozesse im Detail in unserer Nachbarschaft zu beobachten. Denn der nächste Stern, Proxima Centauri, ist 4,2 Lichtjahre entfernt, knapp 270 000-mal so weit wie unsere Sonne. Sie ist insofern zentrale Grundlage für unser Verständnis von Sternen überhaupt. Und obwohl die Erforschung der Sonne im Rahmen von Physik und Chemie bereits mehr als 200 Jahre andauert, birgt sie noch heute viele Rätsel und offene Fragen.
Abb.
1
:
Erdbahn um die Sonne mit verschiedenen Einfallswinkeln der Sonnenstrahlung
Die imperfekte Sonne
Für Aristoteles und seine anhaltend einflussreiche Lehre über den Aufbau des Kosmos war die perfekte und ebenmäßige Sphäre die natürliche Form der Himmelskörper und somit auch der Sonne. Im Gegensatz dazu beobachteten bereits seit 800 v. Chr. chinesische Astronomen mit bloßem Auge durch Rauch oder Nebel hindurch, dass die Sonne immer wieder dunkle Flecken aufweist. In China und Korea wurden diese Flecken seitdem regelmäßig kartiert.12 Der englische Mönch Johannes von Worcester war der erste westliche Beobachter, der 1128 in seinen Chroniken dunkle Flecken vor der Sonne bemerkte. Als dann Anfang des 17. Jahrhunderts das Teleskop erfunden wurde, rückten die Sonnenflecken erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Thomas Harriot fertigte von ihnen am 8. Dezember 1610 die ersten Zeichnungen an, bevor in den folgenden Jahren auch David und Johannes Fabricius, Christoph Scheiner und Galileo Galilei dieses Phänomen sahen. Die Deutung der Beobachtungen war allerdings zunächst umstritten. Die meisten Beobachter rechneten die Verdunkelungen Planeten zu, die vor der Sonne vorbeiziehen. Galilei war einer der wenigen, der fest davon überzeugt war, dass die dunklen Stellen sich auf der Oberfläche der Sonne befinden müssen. Er sollte Recht behalten.
Die Erweiterung der menschlichen Sinne mithilfe von Teleskopen enthüllte noch weitere Oberflächenphänomene auf der Sonne: An den Rändern erscheint sie dunkler als im Zentrum, besonders hell ist sie in der Nähe von Gruppen von Sonnenflecken, und auch die Sonnenflecken selbst unterscheiden sich in ihrer Helligkeit. Ihr Inneres, die Umbra, ist deutlich dunkler als der Außenbereich, die Penumbra. Auch dass die gesamte Sonne rotiert und ihre Achse etwas geneigt ist, belegten bereits die ersten Teleskopbeobachtungen.
Abb.
2
:
Christoph Scheiner, Beobachtung der Sonnenflecken, 1625
Beobachtungen der Sonne während verschiedener Verdunkelungen im 18. Jahrhundert bestätigten, was für ein überaus dynamischer Himmelskörper die Sonne ist.13 1706 bemerkte der britische Kapitän Henry Stanyan während einer Sonnenfinsternis von Bern aus einen roten Streifen, der für eine Dauer von sechs bis sieben Sekunden plötzlich vom Rand der Sonne ausging – eine Sonneneruption, wie wir heute wissen. Es war die erste konkrete Beobachtung der Sonnenatmosphäre, dem Bereich zwischen der »Oberfläche« der Sonne, von dem der größte Teil der uns erreichenden Strahlung ausgeht, und der Korona. Letztere wird ebenfalls nur bei Sonnenfinsternissen als heller Strahlenkranz sichtbar und war schon sehr viel früher, unter anderem im antiken Griechenland von Plutarch, beschrieben worden. Die Existenz der »roten Flammen« wurde nur neun Jahre später, 1715, von dem Astronomen Edmond Halley bei einer weiteren Finsternis bestätigt – auch wenn zu diesem Zeitpunkt wiederum umstritten war, ob dies Phänomene waren, die der Sonne zuzurechnen waren, oder ob sie nicht eher vom Mond ausgingen. Diese Frage wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts geklärt, als erste Bilder der solaren Chromosphäre vorlagen.
Während sich also die Anzeichen verdichteten, dass die Sonne alles andere als eine homogene und perfekte Sphäre war, brachte das 19. Jahrhundert noch in anderer Hinsicht eine Vereinheitlichung des menschlichen Blicks auf Erde und Sonne. 1814 bemerkte der Physiker Joseph Fraunhofer, dass das Spektrum der Sonne, das entsteht, wenn man Sonnenlicht durch ein Prisma fallen lässt, viele Hundert dunkle Linien aufweist.14 Nachdem deren Ursprung zunächst unklar war, fanden 1860 die Heidelberger Physiker Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen eine Erklärung. Sie sahen, dass die Linien bei genau den Wellenlängen auftauchen, bei denen zuvor Emissionslinien verschiedener mit dem Gasbrenner erhitzter Substanzen im Labor beobachtet worden waren. Anders gesagt: Spektrallinien sind gewissermaßen Fingerabdrücke chemischer Substanzen. Wenn man gewisse Substanzen erhitzt, entsteht Licht einer bestimmten Farbe. Wenn man aber Licht durch Gas aus bestimmten Atomen hindurchscheinen lässt, wird Licht