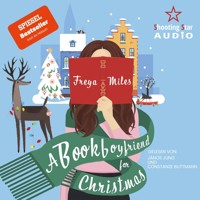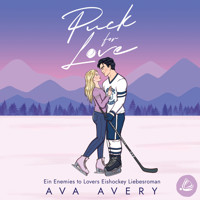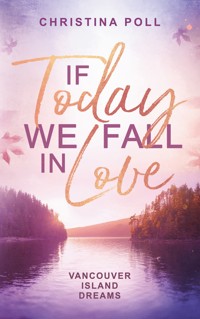Die soziologische Rolle von Alkoholmissbrauch in der deutschen Gesellschaft E-Book
Johannes Sebastian Pott
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Soziologie - Medizin und Gesundheit, Note: 1,3, APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft in Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract: In der heutigen Zeit gewinnen Suchterkrankungen immer mehr an Bedeutung für die Gesellschaft. Es gibt zunehmend mehr Erkrankte und damit auch ein stetig wachsendes Bedürfnis von Unternehmen sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Es gibt viele unterschiedliche Suchtarten, dazu zählen nicht nur die Abhängigkeit von Substanzen, sondern auch von Glücksspiel, Kommunikation und vielem mehr. In dieser Arbeit soll vor allem die Thematik des Alkoholmissbrauchs näher beschrieben und am Fallbeispiel der Personalführung eines Universitätsklinikums näher erläutert werden. Zu diesem Zweck wird zu Beginn der Alkoholmissbrauch in Deutschland im Allgemeinen erklärt. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Erkenntnisse aus der soziologischen Theorie auf den Alkoholmissbrauch angewandt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Alkoholmissbrauch in der deutschen Gesellschaft
3. Alkoholmissbrauch auf der Makroebene
4. Prävalenz von Alkoholmissbrauch in unterschiedlichen Personengruppen
5. Einfluss sozialer Faktoren auf den Alkoholmissbrauch
6. Soziologische Rollentheorie im Kontext zu Alkoholmissbrauch
7. Die soziologische Organisationstheorie und der Alkoholmissbrauch
8. Fazit
9. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der heutigen Zeit gewinnen Suchterkrankungen immer mehr an Bedeutung für die Gesellschaft. Es gibt zunehmend mehr Erkrankte und damit auch ein stetig wachsendes Bedürfnis von Unternehmen sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
Es gibt viele unterschiedliche Suchtarten, dazu zählen nicht nur die Abhängigkeit von Substanzen, sondern auch von Glücksspiel, Kommunikation und vielem mehr.[1]
In dieser Arbeit soll vor allem die Thematik des Alkoholmissbrauchs näher beschrieben und am Fallbeispiel der Personalführung eines Universitätsklinikums näher erläutert werden.
Zu diesem Zweck wird zu Beginn der Alkoholmissbrauch in Deutschland im Allgemeinen erklärt. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Erkenntnisse aus der soziologischen Theorie auf den Alkoholmissbrauch angewandt.
2. Alkoholmissbrauch in der deutschen Gesellschaft
Alkohol ist die in Deutschland am stärksten verbreite Droge des Alltags[2], so lassen sich alleine hierzulande ca. 73.000 Todesfälle pro Jahr auf den Alkoholkonsum zurückführen, 9,5 Millionen Menschen in Deutschland trinken Alkohol in solchen Mengen, dass eine potentielle Gesundheitsgefährdung gegeben ist und 1,3 Millionen Menschen sind alkoholabhängig.[3]
Zwar ist der Konsum an reinem Alkohol pro Kopf und Jahr in den letzten Jahren in Deutschland leicht rückläufig gewesen, man darf sich jedoch nicht von diesen Zahlen blenden lassen, da sie noch keine Aussage über den problematischen Konsum mancher Bevölkerungsgruppen treffen.[4]
Um Aussagen über die Qualität des Konsums treffen zu können, wird das Konsumverhalten einzelner Individuen an Hand von Befragungen ermittelt. Generell lässt sich hier festhalten, dass der meiste Alkoholkonsum auf einem ungefährlichen Konsumniveau stattfindet. In den Regionen des gefährlichen Konsumniveaus sind generell prozentual mehr Männer als Frauen vertreten. Der Altersgipfel liegt unabhängig vom Geschlecht jeweils in der Altersklasse von 45 – 54 Jahren.[5] Beunruhigend ist aber auch die Entwicklung des Alkoholskonsums bei Jugendlichen in Deutschland, so zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg des Konsums von alkoholischen Getränken sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen[6], was in der Zukunft eine weitere Verschlimmerung des Problems des Alkoholismus erwarten lässt.[7] So betreiben etwa die Hälfte aller Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren mindestens einmal im Monat einen riskanten Alkoholkonsum, was eine äußerst besorgniserregende Entwicklung darstellt. Sinnvolle Präventionskampagnen, wie Beispielsweise die Kampagne „Kenn Dein Limit“ der PKV, die speziell die Gruppe der Jugendlichen ansprechen sollen, laufen bisher häufig ins Leere, möglicherweise weil nicht repräsentative Gruppen von Jugendlichen angesprochen werden sollen.
Ein zentrales Problem des Alkoholmissbrauchs stellt sicherlich die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Droge und der häufig schleichende Prozess der beginnenden Sucht dar. So ist Alkohol von Familienfeiern und anderen Festivitäten kaum wegzudenken, auch eine größere Menge an Alkohol wird hier durchaus toleriert und ist auch in weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert.[8] Des Weiteren ist zunehmender Alkoholkonsum auch ein Phänomen unserer heutigen Gesellschaft, da Alkohol nur in großen Mengen produziert und konsumiert werden kann, wenn genügend Lebensmittel zur Verfügung stehen, das heißt das der tägliche Bedarf abgedeckt wird.[9] In unserer heutigen Überfluss- und Leistungsgesellschaft könnte man also einen Multiplikatoreffekt für Suchtkrankheiten im Allgemeinen diagnostizieren, denn auf der einen Seite steht der Druck der stetig steigenden Erwartungen an das Individuum und auf der anderen Seite das Individuum, welches versucht diesem gesellschaftlichen Druck gerecht zu werden und durch bewusstseinserweiternde Substanzen zu entkommen.
Im Bezug auf einen Konnex zwischen Alkoholismus und Sozialschicht beziehungsweise Beruf ist noch festzuhalten, dass die Datenlage an deutschen Studien bisher noch relativ dünn ist. Dennoch lässt sich feststellen, dass die Angehörigen der unteren sozialen Schichten den höchsten Anteil an Alkoholkranken aufweisen. Bezogen auf die Gesundheitsberufe sind die englischsprachigen Länder uns in ihren Studien um einiges voraus. So wird dort eine Lebenszeitprävalenz von Alkoholmissbrauch von 2,5 % bei Ärzten angenommen.[10]
Alles in allem lässt sich festhalten, dass Alkoholismus die am weitesten verbreitete Suchtform in der deutschen Gesellschaft darstellt. Es wird mehr Alkohol von Männer als von Frauen konsumiert und die Konsumspitze liegt bei beiden Geschlechtern in den mittleren Alterklassen. Auch wenn der Konsum insgesamt rückläufig ist, kann man auf Grund der Datenlage davon ausgehen, dass sich das Alkoholproblem auch in die jüngeren Generationen verlagern wird. Im Bezug auf Gesundheitsberufe und Alkoholismus sind bisher wenig Studien im deutschsprachigen Raum vorhanden.
3. Alkoholmissbrauch auf der Makroebene
Die Makroebene beschreibt die Gesellschaft als Ganzes, in ihr steht nicht das Individuum im Mittelpunkt, sondern das Miteinander mehrerer Individuen sowie die Regeln, Normen und Werte, die unser gesellschaftliches Leben bestimmen.
Alkohol ist in unserer Gesellschaft schon seit langer Zeit verankert und akzeptiert. Bereits die alten Griechen und Römer, ja sogar die Ägypter, beschäftigten sich mit Alkoholkonsum und den unangenehmen Folgen des übermäßigen Konsums.[11] Auch im Mittelalter war starker Alkoholkonsum keine Seltenheit, selbst die Kinder wurden in den Gesellschaften der damaligen Zeit schon früh an den Alkohol herangeführt.
Politische Brisanz bekam die Thematik des Alkoholkonsums zum ersten Mal mit dem Versuch die Prohibition von Alkohol in den USA Mitte des 19. Jahrhunderts durchzusetzen. Als Grund für diesen Versuch darf angeführt werden, dass zeitgleich von verschiedenen Autoren die Sucht als Krankheit zum ersten Mal definiert wurde.[12] Aus diesem Grund und dem vermuteten Zusammenhang vieler Verbrechen mit übermäßigem Alkoholkonsum wurde in einigen Bundesstaaten der USA und in einzelnen Städten ein komplettes Alkoholverbot verhängt. Diese Versuche den Alkoholkonsum gesetzlich zu unterbinden hielten unterschiedlich lange an. Eine Renaissance erlebte die Prohibition in den USA noch einmal zu Zeiten der Wirtschaftskrise (1929), als man sich von einem Verbot des Alkoholkonsums eine gesteigerte Wirtschaftsleistung erhoffte. Trotz aller in sie gesetzten Erwartung lieferte die Prohibition nicht den gewünschten Erfolg, kurzfristig kam es zwar zu einem Rückgang des Alkoholkonsums, aber auf die längere Frist betracht profitierte in erster Linie der Schwarzmarkt von dem Verbot.
Dennoch hatte das Verbot einen längerfristigen Einfluss auf den Alkoholkonsum, auch nach der Aufhebung der Prohibition dauerte es lange bis der Konsum wieder die selbe Menge wie vor dem Verbot erreichte. In der retrospektiven Betrachtung wird vermutet, dass der Alkohol zu Zeit der Prohibition die Rolle eines Sündenbocks für zahlreiche gesellschaftliche Probleme übernehmen musste und es daher „en vogue“ war den Alkohol zu verbieten um damit „wirtschaftliche und gesellschaftspolitische“ Interessen zu erreichen.[13]
Auch heute spielt Alkohol in unserer Gesellschaft eine große Rolle und in der aktuellen Diskussion zum Thema „Binge Drinking“ zeigt sich auch die dem Thema immer noch innewohnende gesellschaftspolitische Brisanz der Thematik.