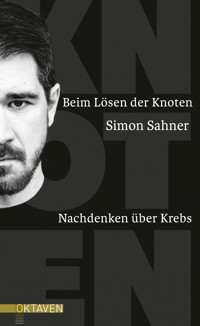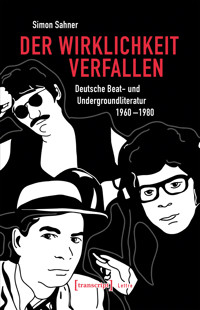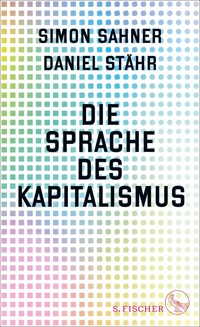
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir müssen anders über Geld und Wirtschaft sprechen, wenn wir zu einem gerechteren Miteinander gelangen wollen: Der Literaturwissenschaftler Simon Sahner und der Ökonom Daniel Stähr gehen der Sprache des Kapitalismus auf den Grund. Preise steigen nicht von alleine. Es gibt jemanden, der sie erhöht. Das zu verstehen, ist entscheidend. Sprache schafft Realitäten und festigt Machtstrukturen. Das gilt nicht nur für Diskriminierungsformen wie Rassismus oder Sexismus, sondern auch für unser Wirtschaftssystem, den Kapitalismus. Wenn Ökonomen, Unternehmen und die Politik Finanzkrisen als Tsunamis und Stürme bezeichnen, suggerieren sie ihre und unsere Machtlosigkeit. Es gibt aber Akteure im kapitalistischen System und es gibt Möglichkeiten, auf andere Weise über Geld und Wirtschaft zu sprechen und davon zu erzählen. Anhand von zahlreichen Metaphern und Sprachbildern, einschlägigen Beispielen aus Film und Literatur sowie den Selbsterzählungen von Unternehmern wie Steve Jobs oder Elon Musk analysieren Simon Sahner und Daniel Stähr die Sprache des Kapitalismus und seine Geschichten. Was steckt hinter Begriffen wie »Rettungsschirm«, »Gratismentalität« und »too big to fail«? Wieso erfreut sich die Figur des »Unternehmergenies« so großer Beliebtheit? Und: Wie können wir neue Narrative schaffen, um uns aus der scheinbaren kapitalistischen Alternativlosigkeit zu befreien und Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Simon Sahner | Daniel Stähr
Die Sprache des Kapitalismus
Über dieses Buch
Preise steigen nicht von alleine. Es gibt jemanden, der sie erhöht. Das zu verstehen, ist entscheidend, denn auch im Kapitalismus schafft Sprache Realitäten. Wenn Ökonomen, Unternehmen und die Politik Finanzkrisen als Tsunamis und Stürme bezeichnen, suggerieren sie ihre und unsere Machtlosigkeit. Es gibt aber Akteure im kapitalistischen System und es gibt Möglichkeiten, anders über Geld und Wirtschaft zu sprechen und anders davon zu erzählen.
Der Kulturwissenschaftler Simon Sahner und der Ökonom Daniel Stähr verbinden ihre Expertisen, um der Sprache des Kapitalismus und seinen (Selbst-)Erzählungen auf den Grund zu gehen: Was steckt hinter Begriffen wie »Rettungsschirm«, »Gratismentalität« und »too big to fail«? Wie können wir neue Narrative schaffen, um uns aus der scheinbaren kapitalistischen Alternativlosigkeit zu befreien und Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Simon Sahner, geboren 1989, ist freier Autor, Literatur- und Kulturwissenschaftler und Mitherausgeber des feuilletonistischen Online-Magazins »54books«. 2023 erschien sein Buch »Beim Lösen der Knoten – Nachdenken über Krebs«. Simon Sahner lebt in Freiburg.
Daniel Stähr, geboren 1990, ist Ökonom und Essayist. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FernUniversität Hagen, wo er zum Thema »Narrative Economics« promoviert. Seit 2022 erscheint seine Kolumne »Geldgeschichten« bei »54books«. Daniel Stähr lebt in Frankfurt am Main.
KAPITEL 1Preise steigen nicht … – was wir unter der Sprache des Kapitalismus verstehen
»Es gibt Erklärungen. Es gab sie schon immer; für jedes Menschheitsproblem gibt es eine bekannte Lösung – passend, plausibel, und falsch.«[1]
Henry Louis Mencken
Am 12. Juni 2005 hielt Steve Jobs, damals CEO von Apple, eine Rede bei der Graduiertenfeier der Universität Stanford. Die sogenannte Commencement Speech, bei der berühmte Persönlichkeiten den Absolvent*innen inspirierende Gedanken mit auf den weiteren Lebensweg geben, hat an US-amerikanischen Universitäten Tradition. Viele dieser Reden finden weit über das ursprüngliche Publikum hinaus Verbreitung. So auch die von Steve Jobs. Drei Geschichten, so begann er, wolle er erzählen, nur drei Geschichten aus seinem Leben: »Das ist alles. Kein großes Ding.«[2] Auch wenn er tatsächlich nur drei Geschichten erzählte, stimmte das natürlich nicht wirklich. Geschichten sind immer ein »großes Ding«, gerade in einem solchen Kontext. Und Steve Jobs erzählte sie zeitlebens meisterhaft. Seine Produktpräsentationen im schwarzen Rollkragenpullover gerieten r egelmäßig zur Predigt, in der er an die ganz großen Narrative der Menschheitsgeschichte anknüpfte. Gerade als der Apple-CEO vor zukunftsfreudigen Absolvent*innen einer renommierten Universität über die Herausforderungen und Chancen des Lebens sprach, waren seine Geschichten Erzählungen über das Leben als Firmengründer, als Tech-Prophet und als Selfmademan. In seiner Rede berichtete Jobs zunächst, dass er sein Studium abgebrochen hat, sich eine Zeitlang mit Pfandflaschensammeln durchkämpfen musste und ihn genau das auf den richtigen Weg führte. In der zweiten Story erzählte er von der Gründung der Firma Apple, davon, dass er dadurch früh gefunden habe, was er liebt, es verloren habe und wiederbekam. Die dritte Geschichte handelte von der Vergänglichkeit des Lebens, von seiner Krebserkrankung, von der er damals dachte, er habe sie überwunden. Inspirierend ist das ohne Frage. Aber Erzählungen handeln oft von mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Steve Jobs’ Geschichten sind auch Geschichten des Kapitalismus. Denn Jobs spricht die Sprache des Kapitalismus.
Als Sprache des Kapitalismus bezeichnen wir bestimmte Sprachbilder und Metaphern, Redewendungen und Phrasen, Mythen und Erzählungen sowie einzelne Begriffe, mit denen ökonomische Zusammenhänge beschrieben und erzählt werden. Diese Sprache ist im Laufe der vergangenen Jahrhunderte in unser Denken, unser Erzählen und unser Sprechen eingedrungen, so dass sie längst auch unser Privatleben und unsere Beziehungen erfasst hat – sie ist Teil unseres Alltags. Es ist eine Sprache, die der Kapitalismus hervorgebracht und weiterentwickelt hat und die unter anderem unsere Vorstellung davon, was es heißt zu wirtschaften, enorm beeinflusst. Sie durchdringt alle Bereiche unseres Zusammenlebens: unser Arbeits- und Privatleben, unsere individuellen Entscheidungen und nicht zuletzt die großen gesellschaftlichen Fragen und Debatten. Das zeigt sich, wenn wir eine Altersvorsorge abschließen oder ein Auto kaufen ebenso wie im politischen Umgang mit Krisen. Es ist eine Sprache, die wir automatisch sprechen und verstehen, wenn wir im Kapitalismus sozialisiert worden sind oder lange in ihm gelebt haben. Es ist eine Sprache, die wir oft nicht wahrnehmen und über die wir nicht mehr nachdenken müssen, weil sie für uns zur Alltagssprache geworden ist. In ihr werden sprachliche Bilder entworfen, Metaphern geschmiedet, Geschichten erzählt und Mythen weitergetragen.
Ein besonders wirkmächtiger Mythos, den Jobs auch in seiner Rede pflegt, ist die berühmte Erzählung vom Tellerwäscher, der zum Millionär wurde. Zentral in seinen drei Geschichten ist das, was er erreicht, nachdem er als Studienabbrecher und Pfandsammler in der Garage seiner Eltern Apple gegründet hat. Gelungen ist ihm dies, so behauptet er, aus eigener Kraft – kein Sozialstaat, keine finanzielle Förderung, nicht einmal die Unterstützung anderer Menschen spielen in der Erzählung seines Aufstiegs eine zentrale Rolle. Folgt man diesem Narrativ, hat Jobs es letztlich allein geschafft, durch Leistung und Innovation vom Bordstein zur Skyline aufzusteigen – der kapitalistische Traum (und der US-amerikanische). Es gibt unzählige solcher Selbsterzählungen von Gewinner*innen innerhalb des kapitalistischen Systems. Die meisten davon sind unvollständig und verbergen Entscheidendes, viele sind schlicht und ergreifend falsch. Warum sind sie dennoch so erfolgreich?
Sprache stand und steht seit einigen Jahren immer wieder auf dem Prüfstand. Wir haben, angestoßen durch die Arbeit vieler Aktivist*innen, unsere Sprache auf sehr viele Untiefen hin abgesucht. Es wird darüber debattiert, wo in unserer Sprache sexistische, rassistische, queerfeindliche und/oder ableistische – kurz: diskriminierende – Sichtweisen und Vorstellungen eingegraben sind. Manchmal so tief, dass vor allem privilegierte Menschen ohne Diskriminierungserfahrungen sie jahrzehnte- und jahrhundertelang nicht erkannt haben, nicht erkennen wollten oder sie vielleicht auch einfach bewusst ignoriert haben. Das Problem an dieser Art von sprachlichen Mustern ist ihre Macht, Realitäten nicht nur zu beschreiben, sondern sie auch zu schaffen. Das simpelste und vielleicht meistdiskutierteste Beispiel dafür ist das generische Maskulinum und sein Gegenteil, die inklusiv gendernde Sprache. Wenn wir immer nur von Ärzten und Krankenschwestern sprechen statt von Ärzt*innen und Pflegekräften, sind Menschen in weißen Kitteln und hoher Position in Krankenhäusern in unserer Vorstellung männlich und Menschen, die Pflegearbeit leisten, weiblich. Diese Vorstellungen beeinflussen unser Denken und Handeln.
Das Bewusstsein für die diskriminierende Wirkung von Sprache wurde in den vergangenen Jahren also endlich großflächig geweckt. Bis heute wird ausgehandelt, wie wir damit umgehen. Neben diesen wichtigen Debatten, in die wir uns nicht hineindrängen wollen, braucht es eine weitere. Wir müssen darüber sprechen, wie der Kapitalismus in unserer Sprache wirkt.
Wir wollen den sprachlichen Mustern und Spuren nachgehen, die der Kapitalismus hervorgebracht hat und die ihn gleichzeitig stützen. Wie funktioniert die Sprache des Kapitalismus? Welche Begriffe werden verwendet, in welchen Metaphern wird gesprochen, und an welche Sprachbilder haben wir uns gewöhnt? Welche Akteur*innen bedienen sich dieser Sprache in besonderem Maße und profitieren von ihr? Was erzählen sie über Kapitalismus, welchen rhetorischen Strategien folgen ihre Narrative, und wie beeinflussen diese Strategien ihr Auftreten in der Öffentlichkeit?
Wir sprechen in einer Sprache über unser Wirtschaftssystem, die die Funktionsweise ökonomischer Prozesse verschleiert, Handlungsmöglichkeiten unsichtbar macht und dadurch bestehende Machtstrukturen festigt. In den folgenden Kapiteln werden wir anhand zahlreicher Beispiele zeigen, wie wir durch diesen Sprachgebrauch in eine passive Position gedrängt werden. Gleichzeitig erzeugt dieses Sprechen falsche oder irreführende Vorstellungen davon, wie unser Wirtschaftssystem und seine Abläufe funktionieren. Das führt dazu, dass wir unsere eigene Rolle in diesem System falsch einschätzen. Um ein Beispiel zu nennen, auf das wir noch öfter zurückkommen werden, weil es so prägnant wie einfach zu verstehen ist: Wir sind es gewohnt, davon zu sprechen und zu hören, dass Preise – zum Beispiel für Gas im Herbst 2022 oder für Lebensmittel durch die Inflation – steigen. Fakt ist aber, dass Preise erhöht werden oder – im Fall der Finanzmärkte – durch menschengemachte Algorithmen steigen. Was sie nicht tun, ist einfach von sich aus zu steigen, um dann mit Mühe und Not davon abgehalten zu werden, damit wir uns im Winter das Heizen und den Glühwein leisten können. Ein kleiner Unterschied mit großer Wirkung. Wenn wir davon sprechen, dass Preise steigen, wird verschleiert, dass es Gründe dafür gibt und jemand oder etwas die Verantwortung trägt. Steigende Preise verbergen im Gegensatz zu Preisen, die erhöht werden, dass es Menschen gibt, die davon profitieren und vielleicht sogar ein Interesse daran haben, dass Konsument*innen sich nicht fragen, wer für die hohen Preise verantwortlich ist. Heutzutage reicht es vielen Medien nicht mehr, Preise steigen zu lassen. Nein, inzwischen explodieren die Preise sogar. Selbst die Tagesschau hat in den vergangenen Jahren in ihrer Berichterstattung über die Preise für Zucker, Baumaterialien oder Gas Preisexplosionen heraufbeschworen.[3]Und im Sommer 2022 stellte sie ganz lapidar fest: Preisexplosionen überall.[4]
Das heißt nicht, dass diese Sprache immer bewusst verwendet wird oder dass sie Teil einer Verschwörung ist, um ahnungslose Bürger*innen hinters Licht zu führen. Wir unterstellen nicht allen Personen, die in diesen Mustern kommunizieren, dass sie raffgierige und unsoziale Kapitalist*innen seien, die unschuldige Verbraucher*innen unwissend halten wollen. Im Gegenteil: Wir alle sprechen die Sprache des Kapitalismus, erzählen seine Geschichten und merken es teilweise nicht einmal. Umso wichtiger ist es, dass wir lernen, die Sprache des Kapitalismus zu verstehen.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist, dass Systeme Strukturen entwickeln, die dazu dienen, das jeweilige System zu erhalten. Man könnte diese Strukturen als Stützpfeiler betrachten, auf denen das System steht und die es stabil halten. Nicht jede dieser Säulen ist in gleicher Weise tragend, aber wenn eine davon zu bröckeln beginnt oder porös wird, wird das System nach und nach instabil und muss sich verändern, um weiter bestehen zu können. Manchmal bricht es dann auch zusammen. Systeme werden immer dann zu Veränderungen gezwungen, wenn Menschen, die mit oder in diesem System leben, ihre Perspektive und ihren Umgang damit verändern – und das geschieht häufig durch Sprache.
Das System des Patriarchats beginnt beispielsweise seit einigen Jahren mehr und mehr zu bröckeln und wird sich dadurch vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft aufgelöst haben. Der Grund dafür ist nicht zuletzt ein stärkeres Bewusstsein für die Sprache, die jene patriarchalen Strukturen gefestigt hat. Das rassistische System, auf dem unsere westliche Gesellschaft über Jahrhunderte aufgebaut wurde, wird hoffentlich ebenfalls immer schwächer werden. Den größten Anteil daran hat die Aufklärungsarbeit von aktivistisch arbeitenden Schwarzen Menschen und People of Color (PoC), die immer wieder auf die rassistischen Erzählungen und Sprachbilder in unserer Alltagssprache aufmerksam machen. Das Lied der »Drei Chinesen mit dem Kontrabass«, das auf der rassistischen Vorstellung basiert, Menschen aus Asien sprächen seltsam, wird deswegen wahrscheinlich bald aus den meisten Kitas verschwunden sein.
Und wie mit Blick auf das Patriarchat und rassistische Strukturen die Frage gestellt werden muss, wem Sprache dient und welche Ideologien sich hinter ihr verbergen, gilt das auch für den Kapitalismus. Das zeigt sich mit geradezu dramatischer Relevanz, wenn es um den Umgang mit der Klimakatastrophe geht. Es gehört inzwischen zum guten Ton und zur Marketingstrategie großer Unternehmen und wirtschaftsfreundlicher Politiker*innen, sich selbst als führende Klimaschützer*innen zu inszenieren. Und das funktioniert besonders gut durch Sprache und ihre Bilder. Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat die CDU Ende Januar 2023 zur »wahren Klimaschutzpartei«[5]erklärt, und die SPD warb 2021 im Bundestagswahlkampf mit dem Slogan »Kanzler für Klimaschutz« für Olaf Scholz.[6]Finanzminister Christian Lindner und die FDP sprechen immer wieder von »Technologieoffenheit«[7], mit der der Klimaschutz anzugehen sei, und RWE ernennt sich mit dem Buzzword »Growing Green« zum »weltweit führenden Anbieter im Bereich Erneuerbare Energien«.[8] Was hier wirkt, ist vor allem Sprache, und das in erster Linie als grüne Kulisse, hinter der weiterhin das Streben nach Profiten und Wachstum lauert.
Die Idee des »Growing Green« oder »Green Growth« – eines grünen Wachstums – ist nicht nur aufgrund der Alliteration sprachlich reizvoll, sondern vermittelt auch das wohlige Gefühl, es könne trotz Klimakatastrophe immer so weitergehen, wenn es nur grün weitergeht. Die Kohlekraftwerke, die RWE betreibt und die Milliardengewinne sichern, sowie die Bilder aus Lützerath, die im Frühjahr 2023 gezeigt haben, wie man bei RWE über Klimaschützer*innen denkt, deuten aber eher auf ein anderes Konzept hin, das man »Growing Grey« nennen könnte.
Der Ausdruck »Technologieoffenheit«, den die FDP oft verwendet, soll wiederum suggerieren, dass stetes ökonomisches Wachstum und die scheinbar grenzenlose Innovationskraft des Kapitalismus die eigentlichen Antriebskräfte des Klimaschutzes sein könnten. Begriffe wie »Offenheit«, das »Erkunden« alternativer Mobilitätskonzepte und Floskeln der Art von »Ein Denken, das nach vorne gerichtet ist und nicht im Status quo verharrt«[9] spannen sprachlich-assoziative Netze: Sie vermitteln, dass die Suche nach Möglichkeiten, ökonomisches Wachstum und Klimaschutz zu verbinden, von Offenheit, Neugier und Innovation geprägt sei. Vor allem liberale Sprecher*innen erwecken so den Eindruck, dass sich die größten Herausforderungen der Menschheit von alleine auflösen, wenn die Politik die Märkte nur machen lässt und sich mit Vorschriften und Richtlinien möglichst zurückhält. Dass sich die größten Innovationen der Menschheitsgeschichte allerdings zuverlässig aus staatlich finanzierter Forschung ergeben und politische Institutionen als aktiv handelnde Akteure benötigen, wird so verschleiert.[10] Ein solcher Sprachgebrauch liefert insbesondere Politiker*innen ein Alibi, selbst nichts unternehmen zu müssen, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Bei den Wähler*innen entsteht dazu der Eindruck, dass alles schon irgendwie gutgehen wird, wenn wir nur »offen genug« bleiben. Diese Art des Sprechens muss in Frage gestellt werden.
Sprache, die nicht hinterfragt, analysiert und verändert wird, stabilisiert Systeme, die oft wenigen Menschen sehr viele Vorteile und vielen Menschen noch mehr Nachteile bringen. Das gilt auch für die Sprache des Kapitalismus. Indem wir die Sprache, in der das System Kapitalismus spricht und sich selbst erzählt, in Frage stellen, wollen wir ein Bewusstsein dafür schaffen, wie Sprache und Erzählungen zur Funktionsweise des Kapitalismus beitragen. Wir wollen zeigen, dass diese Art des Sprechens ein Grund dafür ist, dass wir nicht öfter nach dem »Warum« fragen oder gar überlegen, was man anders machen könnte. Wir wollen zeigen, wie man das Sprechen über Kapitalismus verändern kann, und so an einer Säule des Systems Kapitalismus sägen. Denn ein anderes Sprechen über ökonomische Zusammenhänge ist nicht nur möglich, sondern kann auch ein anderes und gerechteres Zusammenleben bewirken. Wie auch immer wir diese Form des Zusammenlebens am Ende als System nennen.
Beim Schreiben dieses Buches gab es immer wieder Momente, in denen wir feststellen mussten, dass wir selbst in die sprachliche Falle des Kapitalismus getappt sind, obwohl wir eigentlich gerade dabei waren, sie zu analysieren und zu kritisieren. Das liegt daran, dass der Kapitalismus nicht einfach nur ein Wirtschaftssystem ist. Er ist ein essenzieller Teil unserer aller Leben. Er durchdringt unseren Alltag, unsere Kommunikation, unsere Beziehungen, unsere Freizeit und selbstverständlich auch unseren Berufsalltag. Das fängt bereits bei der Aufteilung unseres Tages in freie Zeit und Arbeit an. Dahinter steckt der Gegensatz von Zeit, die zu unserer freien Verfügung steht, und Zeit, in der wir etwas tun, was wir eigentlich nicht tun wollen, aber tun müssen, um an Geld zu kommen: Arbeit für ein Unternehmen oder eine Institution. Die Freizeit ist zusätzlich dazu vorgesehen, um uns für die anstehende Arbeit zu erholen. Genau genommen ist Freizeit also nur bedingt freie Zeit: Wir müssen darauf achten, sie so zu nutzen, dass wir am nächsten Tag oder einige Zeit später wieder in der Lage sind, Lohnarbeit zu verrichten. Und so ist die Frage nach der gerechten Verteilung von Freizeit, im Sinne von Zeit, über die Menschen wirklich eigenständig frei entscheiden können, nicht weniger relevant als die nach der gerechten Verteilung von Vermögen.[11]
Der Kapitalismus durchdringt alle Bereiche unseres Lebens, er macht selbst vor jener Zeit nicht halt, die uns am privatesten erscheint: der Zeit, in der wir schlafen. Wer viel schläft, hat weniger Zeit, produktiv zu sein, als derjenige, der wenig schläft. Aber wer zu wenig schläft, ist nicht in der Lage, das zu leisten, was seine Lohnarbeit von ihm fordert. Auch wann wir schlafen, ist den Abläufen einer kapitalistisch strukturierten Lebens- und Arbeitsweise untergeordnet. Würde jeder Mensch zu den Zeiten schlafen, die für ihn am gesündesten und passendsten sind, auch je nach Jahreszeit, wäre ein Arbeitsalltag, wie er in vielen Unternehmen und Institutionen herrscht, undenkbar. Wir haben unseren Schlaf an das Produktivitätsdiktat des Kapitalismus angepasst.
Sogar unsere Vorstellung von Romantik und Liebe, die vermeintlich letzte Festung der Privatheit, ist durchzogen von kapitalistischen Strukturen. Die Soziologin Eva Illouz hat dargelegt, wie eng Romantik und Konsum miteinander verwoben sind und wie sehr der Kapitalismus auf den Bereich Einfluss genommen hat, der in unserer Vorstellung der intimste Teil unseres Lebens ist und dessen Idealbild allein von unseren Wünschen und Bedürfnissen bestimmt werden soll. So stellt Illouz fest: »Die moderne romantische Liebe ist alles andere als ein vor dem Marktplatz sicherer ›Hafen‹, sondern vielmehr eine Praxis, die aufs engste mit der politischen Ökonomie des Spätkapitalismus verbunden ist.« Alle, die schon einmal gestresst nach einem passenden Geschenk für eine geliebte Person gesucht haben, wissen sofort, was hier gemeint ist.[12]
Kapitalismus ist überall, wir arbeiten, schlafen und lieben kapitalistisch – und wir sprechen kapitalistisch. Angesichts der Tatsache, dass kapitalistische Strukturen tief verwurzelt im Alltagsleben der meisten Menschen sind, ist es daher kaum verwunderlich, dass sich eine Sprache des Kapitalismus entwickelt hat, die diese Strukturen nicht nur abbildet, sondern sie auch festigt und damit einen Beitrag dazu leistet, dass der Kapitalismus als System erhalten bleibt. Das Perfide an dieser Sprache ist, dass wir sie in vielen Fällen verwenden, ohne dass wir damit aktiv das kapitalistische System festigen oder auch nur erhalten wollen. Wer im Gespräch am Frühstückstisch sagt, dass die Preise für Gas mal wieder gestiegen sind, und deswegen Sorge hat, sich das Heizen im Winter nicht leisten zu können, tut das nicht, um den Kapitalismus zu stärken. Zwar verwenden manche Menschen diese Sprache bewusst, aber die meisten benutzen sie, ohne es zu bemerken, aus dem einfachen Grund, dass der Kapitalismus unseren Alltag und unser Denken strukturiert und dominiert. Deswegen wird dieses Buch den Kapitalismus auch nicht hier und jetzt abschaffen, das ist für den Moment – selbst wenn das vielleicht so klingt – erst einmal nicht unser Ziel. Das wäre nicht nur vermessen und naiv, sondern auch gefährlich. Ein System, das so fest in unserer Lebensrealität verankert ist, dass es sich sogar in der Sprache unseres Alltags festgesetzt hat, ohne dass wir es bemerken, kann nicht von heute auf morgen verschwinden.
Durch eine Analyse der Sprache des Kapitalismus wollen wir den Blick auf unsere ökonomische Realität schärfen, um so ein besseres Verständnis dafür zu schaffen, wie Kapitalismus heutzutage funktioniert und unseren Alltag als Bewohner*innen eines reichen europäischen Landes beeinflusst. Nur so können kritische Denkprozesse in Gang gesetzt und ökonomische Zustände, die uns selbstverständlich erscheinen, in Frage gestellt werden. Es ist nämlich vollkommen offensichtlich, dass der Kapitalismus, so wie er zurzeit funktioniert, keine gerechten Lebensumstände geschaffen hat, unter denen eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen denkbar wäre. Diese Feststellung haben vor uns schon viele andere gemacht,[13] und genau wie wir sahen sich diese Menschen mit einem beliebten Gegenargument konfrontiert: So schlimm kann der Kapitalismus ja nicht sein, wenn er dazu geführt hat, dass es den meisten Menschen in Deutschland, Europa und den USA heute wesentlich besser geht als noch vor hundert Jahren.
Dagegen können mehrere Argumente ins Feld geführt werden. Zum einen ist die Behauptung, dass der Lebensstandard vieler Menschen in einem Wirtschafts- und/oder Gesellschaftssystem gestiegen sei, kein tragfähiges Argument für das jeweilige System. Mit dem gleichen Argument begründete beispielsweise der US-amerikanische Anwalt und Sozialtheoretiker George Fitzhugh im 19. Jahrhundert seine Befürwortung der Sklaverei in den Südstaaten. Er behauptete, dass der Lebensstandard der versklavten Menschen höher sei als der vieler Arbeiter*innen in freien Gesellschaften, in denen die Menschen in kapitalistischen Strukturen arbeiten mussten, um überleben zu können.[14] Sich allein auf den gestiegenen Lebensstandard als Maßstab für die Qualität eines Systems zu berufen ist schlicht und ergreifend unsinnig. Zum Zweiten hat sich eine zentrale Grundannahme des Kapitalismus – jeder Mensch kann durch Leistung und Anstrengung zu Wohlstand gelangen – als falsch erwiesen. Die krasse Einkommensdifferenz zwischen Angestellten und Vorstandsvorsitzenden in zahlreichen Unternehmen, die in keiner Weise durch die jeweilige Arbeitsleistung gerechtfertigt werden kann, ist dafür ein klares Indiz. Die dem Kapitalismus inhärente Ungerechtigkeit wird insbesondere dann offensichtlich, wenn wir den Blick nicht nur auf Europa und Nordamerika richten. Der heutige Wohlstand in vielen westlichen Nationen lastet auf den Schultern insbesonderer afrikanischer und lateinamerikanischer Länder. Die Tatsache, dass viele dieser Länder auch Jahrzehnte nachdem sie unabhängig geworden sind, noch immer in wirtschaftlichen, sozialen und politischen Schwierigkeiten stecken, ist eine direkte Folge des Kapitalismus. Und drittens waren die Zeiten, in denen das kapitalistische System den größten Zuwachs an Lebensqualität geliefert hat, von stärkerer Regulierung und höheren Steuern geprägt. Wie der französische Ökonom Thomas Piketty gezeigt hat, waren unter anderem die hohe Besteuerung von Unternehmensgewinnen und sehr hohen Einkommen, der Ausbau des Sozialstaates und die Organisation von Arbeiter*innen in Europa und Nordamerika in den 1950er bis 1970er Jahren zu einem großen Teil dafür verantwortlich, dass viele Menschen von dem wirtschaftlichen Aufschwung dieser Zeit profitierten.[15] Alle menschlichen Fortschritte und Innovationen ausschließlich einem Wirtschaftssystem zuzuschreiben, ist am Ende nicht nur unredlich, sondern schlicht und ergreifend wenig überzeugend.
Doch selbst wenn man dem Ideal des fairen kapitalistischen Wettbewerbs vertrauen würde, kann der Kapitalismus kein zukunftsfähiges System sein. Ulrike Herrmann hat in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus überzeugend dargelegt, warum ein auf permanentes Wachstum ausgerichtetes System wie der Kapitalismus nicht vereinbar mit der auf lange Sicht überlebensnotwendigen Eindämmung der Klimakatastrophe ist.[16]
Warum wird also nicht längst an Alternativen gearbeitet? Warum ist es nicht das erste Ziel der Politik, den aktuellen Kapitalismus zu überwinden? Der Kapitalismus erscheint alternativlos. Dabei ist dieses System menschheitsgeschichtlich gesehen noch nicht einmal seinen Kinderschuhen entwachsen. Wieso gehen also sehr viele Menschen davon aus, dass der Kapitalismus niemals wieder verschwinden wird oder sich nicht so sehr verändern könnte, dass wir nicht mehr von »Kapitalismus« sprechen?
Der Kapitalismus hat im großen »Kampf der Systeme« des 20. Jahrhunderts in der allgemeinen Wahrnehmung unbestritten gewonnen oder wenigstens überlebt. Mit dem Ende der Sowjetunion sind in den 1990er Jahren auch die meisten anderen sozialistischen Staaten verschwunden.[17]China bezeichnet sich zwar bis heute als sozialistisch, ist aber zweifellos einer der mächtigsten Akteure auf dem kapitalistischen Weltmarkt. Expert*innen sprechen im Fall Chinas heute von Staatskapitalismus. Die kapitalistisch organisierten Demokratien des sogenannten Westens, die sich teilweise erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet haben, bestehen hingegen bis heute.
Entscheidend ist vor allem, wie wir über diese Entwicklung und das Ende des Kalten Krieges sprechen. Wenn es um die Konfrontation zwischen kapitalistischen und sozialistischen Staaten im 20. Jahrhundert geht, ist bis heute oft vom »Kampf der Systeme« die Rede.[18] Damit ist gemeint, dass die Welt in dieser Zeit in die konkurrierenden Ideologien des Kapitalismus und des Kommunismus aufgeteilt gewesen sei. Hinter dem Ausdruck steht eine folgenschwere Erzählung: Sie handelt von Gewalt und Zerstörung, von Wohlstand und Armut, von Freiheit und Diktatur. Sie umfasst zahlreiche Kriege und hat weitere kleinere Narrative von Held*innen hervorgebracht; vielleicht ist es die größte Erzählung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie berichtet aber in erster Linie von einem Wettstreit zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Die Idee eines Wettstreits besteht darin, dass es am Ende einen Sieger gibt. Und das schien mit dem Zerfall der Sowjetunion der Kapitalismus zu sein.
Zur gleichen Zeit, genauer gesagt im Jahr 1992, erschien das bis heute weltbekannte Buch Das Ende der Geschichte des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama, das auf einem Artikel basierte, den der Autor bereits 1989 in der Zeitschrift The National Interest veröffentlichte. Darin stellte er die These auf, dass die Menschheitsgeschichte auf ein Ziel zulaufe und dass dieses Ziel mit dem Sieg der liberalen Demokratien über die totalitären Staaten faschistischer und kommunistischer Ideologie so gut wie erreicht sei.[19] Das politische System der liberalen Demokratien schließt hier auch die freie Marktwirtschaft, also den Kapitalismus, mit ein.
»Kampf der Systeme«, »Das Ende der Geschichte« – es sind solche prägnanten Floskeln, die verdecken, dass Fukuyama nicht naiv war und auch bei ihm der offenbar siegreiche Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte und aller Alternativen darstellt. Aber oft überleben vor allem die groben Thesen die Diskurszyklen und nicht die eingehenden Analysen, die dahinterstehen. Im Fall Fukuyamas wurde allerdings seine Analyse ebenso wie seine These schon in den 1990er Jahren einer ausführlichen Kritik unterzogen. Inzwischen ist klar, dass ein Ende der Geschichte, wie immer es vielleicht einmal aussehen mag, um 1990 mitnichten erreicht war. Entscheidend ist vielmehr, dass sich diese Redewendung festgesetzt hat und eine Erzählung bildet, deren Botschaft darin besteht, dass der Kapitalismus und seine freie Marktwirtschaft die einzig praktikable und umsetzbare Wirtschaftsform darstellen. Schließlich haben sie ja den Wettkampf gewonnen.
Die Vorstellung eines siegreichen Kapitalismus im entscheidenden, die Geschichte beendenden Wettstreit ist einer der Gründe, warum wir uns eine Alternative zu unserem derzeitigen Wirtschaftssystem kaum vorstellen können. Wenn schließlich doch einmal auf ein mögliches Ende des Kapitalismus verwiesen wird, kommt deswegen häufig der Vorwurf, dass man sich wohl die sozialistischen Systeme des 20. Jahrhunderts zurückwünsche. Es ist einer der größten Erfolge des Kapitalismus, dass er sein eigenes Ende unvorstellbar gemacht hat und als Alternative nur existierende Systeme zulässt, die keinen Bestand hatten. Dabei sind wir uns sicher, dass ein postkapitalistisches System, wie auch immer es aussehen mag, wenig mit den in der Vergangenheit existierenden sozialistischen Systemen zu tun haben wird.
All diese Erzählungen, die der Kapitalismus hervorbringt, müssen immer wieder in Frage gestellt werden. Zum einen, weil sich neue Entwicklungen und Erkenntnisse ergeben, die ihre Gültigkeit in Zweifel ziehen könnten. Zum anderen aber auch, weil manche dieser Erzählungen schlicht nicht korrekt sind. Beispielsweise erläutert der Anthropologe David Graeber in seinem 2011 erschienenen Buch Schulden – Die ersten 5000 Jahre, warum die lange etablierte Erklärung dafür, wie das System »Geld« entstanden sei und wie zuvor Handel getrieben wurde, nicht stimmte. Die klassische Tauschgesellschaft, in der die Menschen eines Dorfes in einem langwierigen und mühsamen Akt von Haus zu Haus ziehen, um jemand zu finden, der Eier gegen Brot, oder das Reparieren des Hauses gegen ein neues Hemd tauscht, existierte nie. Diese Behauptung ist ein beliebtes Strohmann-Argument in den Wirtschaftswissenschaften, um die Einführung von Geld zu begründen – eine vollkommen fiktionale Erklärung.[20] Das Beispiel wirft ein faszinierendes Licht darauf, wie sich Theorien in unsere alltägliche Vorstellung davon, wie etwas funktioniert, einschleichen und dann als Fakt gelten. Nicht weil sie richtig sind oder uns durch Abstraktion hilfreiches Wissen vermitteln, sondern einfach, weil sie sich so gut erzählen lassen.
Das gilt nicht nur für Erzählungen des Kapitalismus. Unsere Kultur ist voller Behauptungen, die jahrzehnte- oder jahrhundertelang als unumstößliche Wahrheiten angesehen wurden, aus dem einfachen Grund, dass sie bestimmte Dinge auf eine leicht verständliche Weise erklären und somit für Ordnung sorgen. Dazu gehört die Vorstellung, dass es ausschließlich ein binäres Geschlechtersystem gibt, das genau zwei Geschlechtskategorien kennt, genauso wie die Tatsache, dass selbst manche Mediziner*innen noch vor wenigen Jahrzehnten behaupteten, Krebs sei eine Krankheit, die unter anderem durch unterdrückte Emotionen entstehen könne. Der sprachliche Umgang mit Krebs und anderen Krankheiten ist übrigens ein Bereich, in dem ein solches Vorhaben, wie wir es hier anstellen wollen, schon einmal umgesetzt wurde. Ende der 1970er Jahre beschrieb die US-amerikanische Essayistin Susan Sontag in ihrem Buch Krankheit als Metapher, wie relevant Sprache und Erzählungen für unsere Wahrnehmung und unseren Umgang mit Krankheiten – insbesondere Tuberkulose und Krebs – sind. Dabei stieß sie auf zahlreiche Behauptungen über Krebs, zum Beispiel, dass es »im allgemeinen eine anhaltende Gefühlsunterdrückung, die die Krankheit verursacht«[21], gäbe. Diese und andere Vorstellungen beruhten vor allem auf moralischen und gesellschaftlichen Mythen, die jedoch keinerlei Grundlage in medizinischen Fakten hatten. Solche Behauptungen gibt es in nahezu allen Bereichen, auch in der Wirtschaft. Sie müssen in Zweifel gezogen und dekonstruiert werden, um eine Perspektive zu fördern, die möglichst frei von als Fakten getarnten Ideologien ist.
Diese Erzählungen und die Sprache, aus der sie bestehen, zu analysieren, ist keine kleine Herausforderung, und keiner von uns beiden könnte sie ohne den anderen angehen. Deswegen kam es nach einer Diskussion an einem Sommerabend zu dieser vielleicht ungewöhnlichen Zusammenarbeit zwischen einem Geistes- und Kulturwissenschaftler und einem Ökonomen. Beide Disziplinen können für sich genommen nur einen Teil der Schwierigkeiten meistern, die dieses Unterfangen mit sich bringt. Die Geistes- und Kulturwissenschaften liefern Methoden und das Wissen, um die Auswirkungen von Sprache, Narrativen und ihren Folgen sowie kulturhistorischen Zusammenhängen zu erläutern. Damit lässt sich beispielsweise erklären, wie Metaphern funktionieren, warum sie in der zwischenmenschlichen Kommunikation nützlich sind und welche rhetorischen Aufgaben sie erfüllen. Mit Hilfe dieses wissenschaftlichen Hintergrunds kann nachvollzogen werden, wie Erzählungen entstehen, wie sie sich verbreiten und welche Folgen sie für unseren Zugang zur Welt haben. Um das alles aber auf die Sprache des Kapitalismus zu beziehen, braucht es das Wissen und das Verständnis von ökonomischen Zusammenhängen und Wirtschaftsgeschichte, die die Ökonomik liefern kann. Denn erst dadurch werden die Hinter-gründe und Zusammenhänge klar, die der Sprache des Kapitalismus zugrunde liegen. Gemeinsam, so hoffen wir, können wir dieser Sprache auf den Grund gehen und zu einem besseren Verständnis ihrer Auswirkung auf unseren Alltag kommen.
KAPITEL 2Der kranke Mann und der Tsunami – Metaphern bestimmen unser Verständnis ökonomischer Phänomene
»Die Ökonomik ist metaphorisch. Dennoch haben auch die Skeptiker nicht ganz unrecht. Nicht alle ökonomischen Metaphern sind wichtig. Wir können nicht einfach sagen ›eine Metapher ist eine Metapher ist eine Metapher‹. Einige Metaphern sind von Bedeutung, manche nicht.«[1]
Arjo Klamer und Thomas C. Leonard
Drei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit:
Erstens: Angesichts hoher Arbeitslosenzahlen und geringer ökonomischer Wachstumsraten galt Deutschland in den 1990er und frühen 2000er Jahren medial als »der kranke Mann Europas«. Mit der Verbesserung seiner wirtschaftlichen Kennziffern konnte dieser angeschlagene Mann das Krankenhaus verlassen, und andere nahmen seinen Platz ein. Italien, Spanien, Großbritannien oder Schweden – es gibt kaum ein Land Europas, das nicht schon einmal zum kranken Mann erklärt wurde. Als sich die wirtschaftliche Lage Deutschlands nach der Coronapandemie und dem Krieg in der Ukraine seit 2022 wieder verschlechterte, ging es schnurstracks zurück ins Krankenhaus. Nicht nur die Wirtschaftszeitung The Economist fragte im August 2023: Ist Deutschland wieder einmal »der kranke Mann Europas«?[2]
Zweitens: Infolge der hohen Gaspreise rufe der Verband der kommunalen Unternehmen nach einem »Rettungsschirm«, schrieb im September 2022 der Spiegel.[3] Solche Rettungsschirme werden immer wieder lautstark für verschiedene Institutionen gefordert, zuletzt etwa für Krankenhäuser oder die hauseigenen Banken der deutschen Automobilhersteller.[4] Während der europäischen Staatsschuldenkrise wurden Rettungsschirme nicht nur für einzelne Unternehmen, sondern sogar für ganze Staaten gespannt.[5]
Drittens: Ebenfalls 2022 stellt der Energieökonom Lion Hirth angesichts immer höherer Energiepreise alarmiert fest, dass uns ein »Tsunami« bevorstünde. Mehr als ein Jahrzehnt vor ihm verkündete bereits der Internationale Währungsfonds (IWF), dass es sich bei der Finanzkrise 2008 um einen »perfekten Sturm« gehandelt habe.[6]
Kranke Männer allerorten, Rettungsschirme, perfekte Stürme und Tsunamis – metaphorisch geht es hoch her, wenn Medien, Expert*innen und anderweitig Beteiligte über wirtschaftliche Fragen debattieren. Fast könnte man meinen, die Finanzwelt sei nicht nur im übertragenen Sinne eine eigene Biosphäre. (Schon wieder eine Metapher.) Metaphern spielen in unserer alltäglichen Kommunikation und insbesondere in der Vermittlung von Nachrichten eine entscheidende Rolle. Das trifft ganz besonders auch auf Vorgänge im ökonomischen Bereich zu. Die Sprache des Kapitalismus ist eine Sprache, die stark mit metaphorischen Sprachbildern arbeitet. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wirtschaftliche Vorgänge häufig sehr abstrakt sind. Sichtbar sind meistens nur die Folgen von Finanzkrisen, hohen Preisen oder riskanten Spekulationen. Die Ereignisse selbst kann man häufig nur anhand von Zahlen beobachten. Deswegen sind Metaphern eine hilfreiche Strategie der Sprache des Kapitalismus, komplexe Abläufe so zu verpacken, dass sie vermeintlich leicht verständlich werden.
Genau das ist auch die eigentliche Funktion von Metaphern. Sie verwandeln Vorgänge oder Dinge, die schwer zu beschreiben sind oder die wir nicht sehen können, in griffige Bilder, statt uns mit abstrakten Zahlen und unübersichtlichen Datenmengen allein zu lassen. Ihr eigentlicher Sinn und Zweck besteht darin, ein besseres Verständnis für etwas zu vermitteln. Das ist der Idealfall. Das Problem mit sprachlichen Bildern ist oft, dass wir uns an sie gewöhnen und irgendwann aufhören, sie in Frage zu stellen. Wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, was genau wir gerade sagen und welche Konsequenzen Metaphern haben können.
Deswegen ist in der Sprachwissenschaft auch von sogenannten toten Metaphern die Rede, sprachliche Bilder, die derart in unseren alltäglichen Gebrauch übergegangen sind, dass wir ihren Ursprung als Metaphern beinahe vergessen haben. An ihnen kann man erkennen, wie essenziell Metaphern für unseren Umgang mit Sprache sind: Ein Fluss liegt in seinem Flussbett, der Baum trägt eine Krone, Schuhe haben eine Zunge. Im Deutschen existiert kein anderes Wort als Tischbein für das, was die Platte der meisten Tische etwa 75 Zentimeter über dem Boden hält. Dabei haben genau genommen nur Lebewesen Beine. Ein Tisch hat ein Bein lediglich im übertragenen Sinn, es handelt sich um eine Metapher. Dennoch fehlt den meisten von uns wahrscheinlich die sprachliche Phantasie, sich einen anderen Begriff für diesen Gegenstand vorzustellen. Während es kaum eine Rolle spielt, wie wir etwas bezeichnen, das dafür sorgt, dass wir nicht alles auf dem Boden ablegen müssen, haben Metaphern in der Finanzwelt reale Konsequenzen. In der Sprache des Kapitalismus bezeichnen sie weniger Ereignisse oder Dinge, für die es keine anderen Begriffe gibt, sondern dienen dazu, die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Facette eines Phänomens oder einer Situation zu lenken – oder von ihr abzulenken. Hier tritt die rhetorische Funktion von Metaphern besonders zutage: Sie sind ein starkes Instrument, um die Zuhörenden von den eigenen Interessen zu überzeugen oder die Wahrnehmung bestimmter Umstände zu beeinflussen. Das reicht von einzelnen Begriffen, wie der Bezeichnung einer herausfordernden ökonomischen Situation als »Tsunami«, bis hin zu ganzen Erzählungen, die für etwas anderes stehen, wie die Geschichten von Steve Jobs, die man als Allegorien bezeichnet, also Metaphern, die mehr als nur ein Begriff sind, der etwas umschreibt. Metaphern sind damit ein zentrales Element der Sprache des Kapitalismus. In dieser Sprache hat sich ein eigener metaphorischer Wortschatz entwickelt, der unser Verständnis davon, wie unsere Wirtschaft funktioniert, prägt.
Die Metaphern, von denen im Folgenden die Rede sein wird, sind im linguistischen Sinne nicht tot, sie sind geradezu quicklebendig. Und doch haben wir uns so sehr an einige dieser gängigen Sprachbilder gewöhnt, dass wir auf den ersten Blick nicht mehr erkennen, wie sie wirken und welche Folgen sie haben. Schauen wir uns eine der bereits erwähnten Metaphern mal genauer an.
Das Bild des »Tsunamis« dürfte bei den meisten Menschen wohl eine starke emotionale Reaktion hervorrufen. Die oft durch Erdbeben ausgelösten Flutwellen, die mit ungeheurer Wucht auf Land treffen und alles mitreißen, was sich in ihrem Weg befindet, stellen eine der unberechenbarsten Gefahren dar, denen der Mensch und seine Errungenschaften durch die Natur ausgesetzt sind. Die Wassermassen, die scheinbar ohne jede Vorwarnung am Horizont auftauchen und sich rasant auf Strand und Küstenstädte zubewegen, sind nicht nur aufgrund ihrer tatsächlichen Zerstörungskraft erschreckend. Sie erinnern uns auch an Mythen versunkener Städte wie das antike Atlantis und im christlich-jüdischen Kontext gar an die alles verschlingende Sintflut. Ein Tsunami rührt an eine der menschlichen Urängste: der Angst davor, vom Meer verschluckt zu werden.
Besonders geprägt wurde diese Angst in den vergangenen zwei Jahrzehnten durch zwei Tsunamis, denen weltweit extreme Aufmerksamkeit zuteilwurde und die nicht nur großes menschliches Leid erzeugt, sondern auch unsere Zukunft verändert haben. Am 26. Dezember 2004 ereignete sich im Indischen Ozean das zum damaligen Zeitpunkt drittstärkste Erdbeben, seit es Aufzeichnungen gibt. Die dadurch ausgelösten, gigantischen Flutwellen trafen zahlreiche Küstenabschnitte, unter anderem in Thailand und Indonesien. Über 200000 Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben, mehr als eine Million wurden obdachlos. Videoaufnahmen von arglosen Personen, die am Strand von einer riesigen Welle überrascht wurden, gingen um die Welt. Die Faszination für das Naturschauspiel, die man den Menschen am Strand zunächst ansieht, wird in kürzester Zeit zu Unsicherheit. Die Kameras beginnen zu wackeln, die Menschen versuchen wegzurennen. Panik bricht aus. Die Welle stürzt auf den Strand und reißt alles mit sich. Die Bilder solcher Katastrophen setzen sich im kollektiven Gedächtnis fest. Bilder, die auch bei der zweiten großen Tsunami-Katastrophe des 21. Jahrhunderts entstanden sind. Am 11. März 2011 verursachte ein Erdbeben in Japan einen Tsunami. Videos und Fotos zeigen zerstörte Städte und Flutwellen, die mit gewaltiger Kraft auf das Land prallen. Die Wassermassen trafen außerdem das Atomkraftwerk in Fukushima und führten zu einer nuklearen Katastrophe, die im Endeffekt den Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie besiegeln sollte. Die Bilder der im Wasser stehenden Kühltürme sind auch heute noch allen präsent, die damals die Nachrichten im Fernsehen verfolgt haben.
Wenn der Ökonom Lion Hirth ankündigt, uns stünde angesichts der wirtschaftlichen Lage ein Tsunami bevor, wenn die Vorsitzende der Mittelschichts- und Wirtschaftsunion Gitta Connemann warnt, die Unternehmen würden von einem »Energie-Tsunami getroffen«[7], und der Verbraucherschützer Udo Sieverding mahnt, den »Mietern droht ein Tsunami«[8], dann weckt das bei vielen Menschen die Erinnerungen an die schrecklichen Bilder aus den Jahren 2004 und 2011. Gewollt oder ungewollt. Die Tsunami-Metapher belegt eindrucksvoll, was sich in zahlreichen Fällen zeigt: Metaphern sind nicht neutral. Sie dienen nicht nur der bildlichen Vereinfachung eines komplexen Sachverhalts, sondern sind sprachliche Instrumente, um die Wahrnehmung des Publikums zu beeinflussen. Was alle drei genannten Verwendungen des Tsunami-Bildes gemeinsam haben, ist die Warnung vor einem katastrophalen, ökonomischen Ereignis, das mit zerstörerischer Kraft verheerende Folgen mit sich bringen wird. Wie Wellen, die durch unvorstellbar mächtige Bewegungen am unzugänglichen Meeresgrund entstehen, haben sich die Energiepreise aufgetürmt und sind über arglosen Verbraucher*innen und Unternehmen zusammengebrochen. Hilflos, so die mitgelieferte Erzählung, seien wir alle diesen unbeherrschbaren Mächten ausgesetzt. Wir können allenfalls hoffen, dass die gewählten Politiker*innen Schutzmaßnahmen ergreifen und, um im Bild der Metapher zu bleiben, Hilfspakete als Sandsäcke aufschichten, um den Aufprall abzuwehren und unsere Wirtschaft zu retten.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: