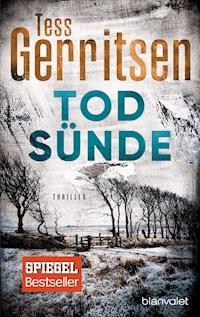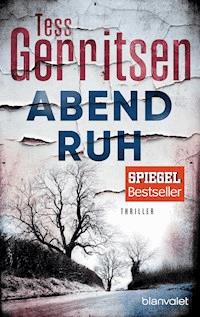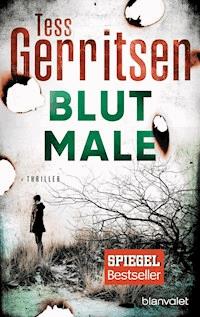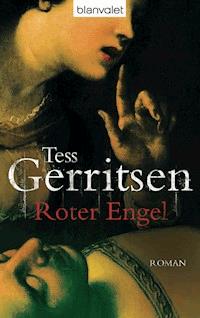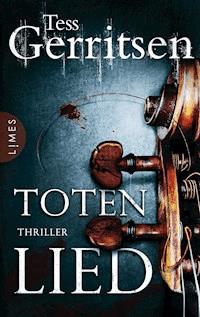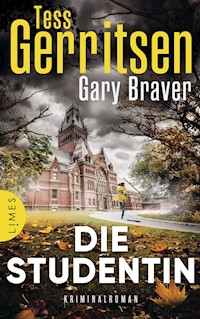
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der brandneue Pageturner aus der Feder der Bestsellerautoren Tess Gerritsen und Gary Braver – ein Spannungshochkaräter über Obsession, Versuchung und menschliche Schwächen.
Taryn Moore ist jung, attraktiv und brillant – warum sollte sie sich umbringen? Detective Frankie Loomis spürt sofort, dass mehr hinter der Geschichte steckt, als sie den Tatort des vermeintlichen Selbstmords untersucht. Die Studentin hat sich aus dem Fenster ihres Apartments gestürzt. Doch ihr Handy ist spurlos verschwunden. Hat es jemand verschwinden lassen, um Spuren zu vertuschen?
Für den Englischprofessor Jack Dorian war Taryn die vollendete Versuchung: intelligent, aufmerksam und zu hundert Prozent tabu. Doch Taryn hatte auch eine dunkle Seite, eine Neigung zu obsessiver Liebe – auch für Jack. Und mit ihrem Tod haben seine Probleme erst richtig begonnen.
Loomis‘ Ermittlungen enthüllen pikante Geheimnisse. Schnell wird klar, dass Jack Dorian mehr weiß, als er offenbart. Doch hat er auch einen kaltblütigen Mord auf dem Gewissen?
Weitere Stand-alone-Krimis von Tess Gerritsen:
»Gute Nacht, Peggy Sue«
»Kalte Herzen«
»Roter Engel«
»Trügerische Ruhe«
»In der Schwebe«
»Leichenraub«
»Totenlied«
»Das Schattenhaus«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Taryn Moore ist jung, attraktiv und brillant – warum sollte sie sich umbringen? Detective Frankie Loomis spürt sofort, dass mehr hinter der Geschichte steckt, als sie den Tatort des vermeintlichen Selbstmords untersucht. Die Studentin hat sich aus dem Fenster ihres Apartments gestürzt. Doch ihr Handy ist spurlos verschwunden. Hat es jemand verschwinden lassen, um Spuren zu vertuschen?
Für den Englischprofessor Jack Dorian war Taryn die vollendete Versuchung: intelligent, aufmerksam und zu hundert Prozent tabu. Doch Taryn hatte auch eine dunkle Seite, eine Neigung zu obsessiver Liebe – auch für Jack. Und mit ihrem Tod haben seine Probleme erst richtig begonnen.
Loomis‘ Ermittlungen enthüllen pikante Geheimnisse. Schnell wird klar, dass Jack Dorian mehr weiß, als er offenbart. Doch hat er auch einen kaltblütigen Mord auf dem Gewissen?
Tess Gerritsen
Knallharte Thriller und unter die Haut gehende Spannungsromane, dafür steht die internationale Bestsellerautorin Tess Gerritsen. Ihre Thriller-Reihe um das Bostoner Ermittlerduo Rizzoli & Isles wurde erfolgreich als TV-Serie verfilmt und ist von der SPIEGEL-Bestsellerliste nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus feiert sie auch mit ihren Stand-alone-Romanen große Erfolge. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Maine
Weitere Informationen unter: www.tess-gerritsen.de
Gary Braver
Gary Braver ist wie sein Protagonist aus »Die Studentin« Englischprofessor an der Northeastern University in Boston. Neben einigen Fachbüchern hat er acht Medizinthriller geschrieben, die zu Bestsellern wurden und für die er mehrere Preise erhielt, darunter den renommierten Massachusetts Book Award. Mit seiner Frau lebt er in der Nähe von Boston.
Von Tess Gerritsen bereits erschienen
Gute Nacht, Peggy Sue · Kalte Herzen· Roter Engel · Trügerische Ruhe · In der Schwebe· Leichenraub · Totenlied
Die Rizzoli-&-Isles-Thriller
Die Chirurgin · Der Meister · Todsünde · Schwesternmord · Scheintot· Blutmale · Grabkammer · Totengrund · Grabesstille · Abendruh· Der Schneeleopard · Blutzeuge
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Tess Gerritsen und Gary Braver
Die Studentin
KriminalromanDeutsch von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Choose Me« bei Thomas & Mercer, Seattle.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2021
by Tess Gerritsen and Gary Braver
Published by Arrangement with TESS GERRITSEN INC. and Gary Braver
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © Stephen Mulcahey/Arcangel; Nevill Mountford-Hoare/Plainpicture; www.buerosued.de
JA · Herstellung: sam/er
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27964-6V003
www.limes-verlag.de
Für Kathleen und Jacob
DANACH
1
Frankie
Es gibt Dutzende Arten, sich das Leben zu nehmen, und in ihren zweiunddreißig Dienstjahren beim Boston PD sind sie Detective Frances »Frankie« Loomis wahrscheinlich alle schon begegnet. Da war die sechsfache Mutter, die sich, als ihr das Chaos des Alltags über den Kopf wuchs, im Bad einschloss, sich die Pulsadern aufschnitt und in einer Wanne mit warmem Wasser friedlich in die Bewusstlosigkeit hinüberdämmerte. Da war der bankrotte Geschäftsmann, der seinen 500-Dollar-Straußenledergürtel an einem Türgriff befestigte, sich die Schlinge um den Hals legte und sich einfach hinsetzte, um sich von seinem eigenen Gewicht schmerzlos ins Jenseits befördern zu lassen. Da war die Schauspielerin, die ihre besten Jahre hinter sich hatte und an den schwindenden Aussichten auf neue Rollen verzweifelte, weshalb sie eine Handvoll Hydromorphon-Tabletten schluckte, ein rosa Seidennachthemd anzog und sich auf ihrem Bett drapierte, sanft dahinschlummernd wie Dornröschen. Diese Menschen wählten diskrete, unspektakuläre Todesarten und waren so rücksichtsvoll, den Lebenden nur ein Minimum an unangenehmen Aufräumarbeiten zu hinterlassen.
Anders als diese junge Frau.
Sie ist bereits im Leichensack in die Rechtsmedizin gebracht worden, und bald wird der Regen ihr Blut vom Gehsteig abgewaschen haben, aber noch kann Frankie es in wässrigen Bahnen zum Rinnstein fließen sehen. Im flackernden Blaulicht der Streifenwagen glänzen diese blutigen Schlieren schwarz wie Öl. Es ist jetzt 5.45 Uhr, eine Stunde vor Sonnenaufgang, und sie fragt sich, wie lange die junge Frau schon hier gelegen hat, bevor der aufmerksame Lyft-Fahrer, der auf dem Heimweg hier vorbeikam, nachdem er um 3.15 Uhr einen Fahrgast abgesetzt hatte, den Körper entdeckte und begriff, dass es nicht nur ein Bündel Kleider war, das auf dem Gehsteig herumlag.
Frankie richtet sich aus der Hocke auf und späht durch den Regen zum Balkon der Wohnung hinauf. Ein Sturz aus dem vierten Stock in die Tiefe, das ist allemal ausreichend, um die Verletzungen zu erklären: die ausgeschlagenen Zähne, das eingedrückte Gesicht. Grausige Details, die der jungen Frau wohl nicht in den Sinn kamen, als sie über die Brüstung kletterte und zum tödlichen Sprung auf das Pflaster ansetzte. Frankie ist Mutter von achtzehnjährigen Zwillingstöchtern, deshalb weiß sie aus eigener Erfahrung, wie katastrophal impulsiv junge Leute sein können. Wenn diese junge Frau doch nur lange genug innegehalten hätte, um die Alternativen zum Selbstmord zu erwägen. Wenn sie doch nur überlegt hätte, was mit einem menschlichen Körper passiert, wenn er aus großer Höhe auf Beton landet, und was ein solcher Aufprall mit einem hübschen Gesicht und makellosen Zähnen anrichtet.
»Ich denke, wir sind hier fertig. Lass uns nach Hause fahren«, sagt ihr Partner, MacClellan. Er hält einen rosa Regenschirm in der Hand, der offensichtlich seiner Frau gehört, und zittert unter der triefenden Stoffhaube mit Paisleymuster. »Meine Schuhe sind klatschnass.«
»Hat irgendjemand ihr Handy gefunden?«, fragt sie.
»Nein.«
»Gehen wir noch mal rauf und sehen in ihrer Wohnung nach.«
»Muss das sein?«
»Ihr Handy muss doch irgendwo in der Nähe sein.«
»Vielleicht hatte sie keins.«
»Ich bitte dich, Mac. Den jungen Leuten in ihrem Alter ist das Handy doch quasi an der Hand angewachsen.«
»Vielleicht hat sie es verloren. Oder irgendein Arschloch ist zufällig vorbeigekommen, nachdem sie gesprungen ist, und hat es einfach eingesteckt.«
Frankie blickt auf den verblassenden Kranz aus Blut hinunter, der die Stelle markiert, wo der Kopf der jungen Frau aufgeschlagen ist. Anders als ein menschlicher Körper kann ein Mobiltelefon in einer Hartschale einen Fall aus dem vierten Stock durchaus unbeschadet überstehen. Vielleicht hat Mac ja recht. Vielleicht ist ein Passant vorbeigekommen – jemand, dessen erster Gedanke nicht war, Hilfe zu leisten oder die Polizei zu rufen, sondern die Wertsachen des Opfers an sich zu nehmen. Es sollte sie nicht überraschen – in drei Jahrzehnten Polizeidienst ist Frankies Glaube an das Gute im Menschen mit unschöner Regelmäßigkeit erschüttert worden.
Sie deutet auf eine Überwachungskamera an einem Gebäude auf der anderen Straßenseite. »Falls sich jemand mit ihrem Handy davongemacht hat, müsste die Kamera dort es erfasst haben.«
»Ja, kann sein«, brummt Mac und niest – offenbar ist ihm in seinem Elend so ziemlich alles egal. »Ich nehme mir das Video später gleich vor.«
»Gehen wir noch mal rauf. Vielleicht haben wir ja etwas übersehen.«
»Ich seh nur noch mein Bett, das sehnsüchtig auf mich wartet«, jammert Mac, doch er fügt sich in sein Schicksal und folgt ihr um die Ecke des Wohnblocks zum Eingang.
Der Aufzug ist so betagt wie das Haus selbst und zudem quälend langsam. Während er im Schneckentempo zum vierten Stock hinaufruckelt, stehen Frankie und Mac schweigend da, zu erschöpft und niedergeschlagen, um auch nur ein Wort zu sprechen. Das kalte Wetter hat Macs Rosazea verstärkt, und im grellen Licht des Aufzugs leuchten seine Nase und seine Wangen knallrot. Sie weiß, dass er bei dem Thema empfindlich ist, und so vermeidet sie es, ihn anzusehen, blickt nur starr geradeaus und zählt die Stockwerke, bis die Tür sich endlich quietschend öffnet. Ein Streifenpolizist hält an der Tür von Wohnung 510 Wache, ein todlangweiliger Job um diese frühe Stunde. Er winkt den beiden Detectives matt zu. Noch ein Kollege, der lieber zu Hause im warmen Bett wäre.
In der Wohnung der Toten durchsucht Frankie noch einmal das Wohnzimmer – diesmal jedoch gründlicher und mit dem geübten Auge einer Mutter. Sie hat Erfahrung darin, die verräterischen Hinweise auf die kleinen Sünden ihrer Töchter zu entdecken: die nassen Stiefel im Schrank, nachdem sie sich an einem regnerischen Abend aus dem Haus geschlichen haben. Der unverkennbare Geruch nach Marihuana, der in einem Kaschmirpulli hängt. Der rätselhafte sprunghafte Anstieg der Kilometerzahl auf dem Tacho ihres Subaru. Die Zwillinge beklagen sich, dass sie mehr von einer Gefängniswärterin als von einer Polizistin hätte, aber das ist vermutlich der Grund, weshalb die Mädchen ihre turbulenten Teenagerjahre bislang unbeschadet überstanden haben. Frankie hat immer geglaubt, wenn es ihr gelänge, sie beide am Leben zu halten, bis sie erwachsen sind, hätte sie ihren Job als Mutter erledigt, aber wem wollte sie da etwas vormachen? Der Job einer Mutter ist nie erledigt. Selbst wenn sie uralt werden sollte, werden ihre Töchter ihr noch den Nachtschlaf rauben, auch wenn sie schon auf die siebzig zugehen.
Frankie hat ihren Rundgang schnell abgeschlossen. Es ist eine kleine Wohnung, spartanisch ausgestattet mit Möbeln, die allesamt gebraucht aussehen. Das Sofa hat eindeutig schon mehr als nur ein paar Besitzer gehabt, und der Holzfußboden ist zerschrammt und zerkratzt von den Generationen von Studentinnen und Studenten, die Möbel herein- und hinausgeschleppt haben. Auf dem Schreibtisch stehen ein leeres Weinglas und ein Laptop, den Frankie schon eingeschaltet hat, nur um festzustellen, dass er passwortgesichert ist. Daneben liegt der Ausdruck eines Referats für ein Seminar an der Commonwealth University: »Furien und Megären: Gewalt und die verschmähte Frau.«
Geschrieben von der jungen Frau, die hier gewohnt hat. Und die jetzt auf dem Weg in ein Kühlfach in der Rechtsmedizin ist.
Frankie und Mac haben bereits die Handtasche der Toten durchsucht, und in ihrer Brieftasche haben sie einen Studentenausweis von der Commonwealth gefunden, einen in Maine ausgestellten Führerschein sowie achtzehn Dollar in bar. Sie wissen, dass die Tote zweiundzwanzig Jahre alt ist und aus Hobart, Maine, stammt. Sie ist eins achtundsechzig groß, wiegt fünfundfünfzig Kilo und hat braunes Haar und braune Augen.
Frankie geht in die Küche, wo sie vorhin schon eine Einzelportion Käsemakkaroni Marke »Marie Callender’s« in der Mikrowelle gefunden haben – lauwarm, aber ungeöffnet. Frankie findet es seltsam, dass die junge Frau eine Mahlzeit aufgewärmt hat, die sie dann gar nicht gegessen hat. Was ist in der Zwischenzeit passiert, was sie veranlasste, ihr Essen stehen zu lassen, auf den Balkon hinauszutreten und in den Tod zu springen? Eine schlimme Nachricht? Ein erschütternder Telefonanruf? Auf der Arbeitsfläche liegt ein Fachbuch, dessen Einband das Gesicht einer Frau zeigt. Ihre Haare stehen in Flammen, ihr Mund ist zu einem wütenden Schrei aufgerissen.
Medea: Die Frau hinter dem Mythos.
Frankie weiß, dass sie mit dem Mythos von Medea vertraut sein sollte, aber ihre Collegezeit liegt Jahrzehnte zurück, und sie erinnert sich nur noch, dass es irgendetwas mit Rache zu tun hat. Zwischen den Seiten des Buches findet sie einen Brief. Es ist die Zulassung zum Graduiertenprogramm für den kommenden Herbst, verschickt vom English Department der Commonwealth University.
Noch ein weiteres Detail, das Frankie stutzig macht.
Sie geht zurück zur Balkontür, die jetzt geschlossen ist. Als der Hausverwalter sie in die Wohnung ließ, stand diese Tür weit offen, und der Wind hatte Regen und Graupel hereingeweht. Noch jetzt sieht man die feuchten Stellen auf dem Holzboden glitzern. Sie öffnet die Tür, tritt hinaus und bleibt unter dem Schutz des oberen Balkonvorsprungs stehen. Unten parken zwei Streifenwagen des Boston PD; das hypnotisierende Flackern ihres Blaulichts spiegelt sich in den Fenstern der Häuser auf der anderen Straßenseite. In einer Stunde wird es hell, dann werden die Streifenwagen verschwunden sein, und der Regen wird den Gehsteig reingewaschen haben. Keiner der Passanten wird ahnen, dass er über die Stelle hinwegschreitet, an der erst wenige Stunden zuvor das Leben einer jungen Frau verloschen ist.
Mac tritt zu ihr auf den Balkon. »Sie war offenbar ein hübsches Mädchen. Wirklich schade um sie«, sagt er und seufzt.
»Es wäre auch schade um sie, wenn sie hässlich gewesen wäre, Mac.«
»Ja, du hast ja recht.«
»Und sie war gerade an der Graduate School angenommen worden. Das Zulassungsschreiben liegt auf der Arbeitsplatte in der Küche.«
»O Mann, echt? Was geht in den Köpfen von diesen jungen Leuten eigentlich vor?«
Frankie blickt hinaus in den silbrig glitzernden Regenvorhang. »Die Frage stelle ich mir unentwegt.«
»Deine Töchter sind wenigstens vernünftig. Die würden so was niemals machen.«
Nein, das kann Frankie sich nicht vorstellen. Selbstmord ist eine Art von Kapitulation, und ihre Zwillinge sind Kämpferinnen, willensstark und rebellisch. Sie späht auf die Straße hinunter. »Mein Gott, das geht ganz schön tief runter.«
»Ich schau lieber gar nicht hin.«
»Sie muss verzweifelt gewesen sein.«
»Dann hast du also auch keinen Zweifel, dass es Selbstmord war?«
Frankie starrt auf die Straße, während sie überlegt, was es eigentlich genau ist, was sie so stört. Warum ihr Instinkt ihr zuflüstert: Du hast etwas übersehen. Wende dich noch nicht ab.
»Ihr Handy«, sagt sie. »Wo ist es?«
Es klopft an der Tür. Sie drehen sich beide um, als der Streifenpolizist den Kopf zur Wohnungstür hereinsteckt. »Detective Loomis? Ich hätte hier eine Nachbarin – möchten Sie mit ihr sprechen?«
Auf dem Flur steht eine junge Frau mit asiatischen Zügen, die ihnen erklärt, dass sie gleich nebenan wohnt. Sie ist mit Bademantel und Flip-Flops bekleidet – offenbar ist sie gerade erst aufgestanden. Immer wieder geht ihr Blick zu der geschlossenen Wohnungstür der Toten, als ob sich dahinter irgendein unaussprechliches Grauen verbergen würde.
Frankie zückt ihren Notizblock. »Und Sie heißen?«
»Helen Ng. Das schreibt sich N-g. Ich studiere an der Commonwealth, genau wie sie.«
»Kannten Sie Ihre Nachbarin gut?«
»Nur flüchtig. Ich bin erst vor fünf Monaten hier eingezogen.« Sie hält inne und blickt auf die geschlossene Tür. »Mein Gott, ich kann es gar nicht glauben.«
»Dass sie sich das Leben nehmen würde?«
»Dass es direkt nebenan passiert ist. Wenn meine Eltern das hören, drehen sie bestimmt durch. Sie werden sagen, dass ich wieder zu ihnen ziehen soll.«
»Wo wohnen Ihre Eltern?«
»Nicht weit von hier, in Quincy. Sie wollten, dass ich Geld spare und zur Uni pendle, aber das ist doch keine richtige College-Erfahrung. Es ist nicht dasselbe, wie eine eigene Wohnung zu haben und …«
»Erzählen Sie uns etwas über Ihre Nachbarin«, unterbricht Frankie sie.
Helen denkt kurz nach und zuckt dann ratlos mit den Schultern. »Ich weiß, dass sie im vierten Jahr ist – war. Kommt aus irgendeinem kleinen Ort oben in Maine. Sie war meistens nicht sehr gesprächig.«
»Haben Sie gestern Abend irgendetwas Ungewöhnliches gehört?«
»Nein. Aber ich bin erkältet, deswegen habe ich zwei Benadryl genommen. Ich bin erst vorhin aufgewacht, als ich den Polizeifunk auf dem Flur gehört habe.« Helens Blick geht wieder zur Wohnungstür. »Hat sie einen Abschiedsbrief oder so hinterlassen? Hat sie gesagt, warum sie es getan hat?«
»Wissen Sie einen Grund?«
»Na ja, vor ein paar Wochen hat sie schon ziemlich deprimiert gewirkt, nach der Trennung von ihrem Freund. Aber ich dachte, sie wäre darüber hinweg.«
»Wer war ihr Freund?«
»Er heißt Liam. Ich habe ihn ein paarmal hier gesehen, als sie noch zusammen waren.«
»Wissen Sie seinen Nachnamen?«
»Ich erinnere mich nicht, aber ich weiß, dass er aus ihrem Heimatort stammt. Er studiert auch an der Commonwealth.« Helen hält einen Moment inne. »Haben Sie ihre Mutter angerufen? Weiß sie es schon?«
Frankie und Mac wechseln einen Blick. Das ist ein Anruf, den keiner von beiden machen möchte, und Frankie weiß genau, wie Mac sich vor der Aufgabe drücken wird. Du bist eine Frau, du bist besser mit solchen Dingen, das ist seine übliche Ausrede. Mac hat keine Kinder, deshalb kann er sich im Gegensatz zu Frankie nicht wirklich vorstellen, was für ein entsetzlicher Schlag eine solche Nachricht ist. Er kann sich auch nicht vorstellen, wie schwer ihr solche Anrufe fallen.
Mac hat sich die Angaben ebenfalls notiert, und jetzt blickt er von seinem Notizbuch auf. »Also, dieser Ex-Freund heißt Liam, er ist aus Maine, und er studiert an der Commonwealth?«
»Richtig. Im vierten Jahr.«
»Dürfte nicht allzu schwierig sein, ihn zu finden.« Er klappt sein Notizbuch zu. »Damit ist die Sache wohl erledigt«, meint Mac, und Frankie weiß, was der Blick bedeutet, den er ihr zuwirft. Ihr Freund hat sie verlassen. Sie war deprimiert. Was brauchen wir mehr?
Nachdem sie den Ort der Tragödie verlassen haben, muss Frankie eigentlich dringend nach Hause. Sie braucht eine Dusche, sie braucht ihr Frühstück, und sie will ihren Zwillingen Hallo sagen – falls sie überhaupt schon wach sind. Und dennoch kann sie nicht umhin, auf der Heimfahrt nach Allston einen Umweg zu machen. Es ist nur ein paar Häuserblocks abseits ihrer Strecke, und an den meisten Tagen kann sie der Versuchung widerstehen, das Haus noch einmal zu sehen. Doch an diesem Morgen scheint ihr Subaru aus eigenem Antrieb von der normalen Route abzuweichen, und wieder einmal ertappt sie sich dabei, wie sie gegenüber dem Backsteinbau in Packard’s Corner am Straßenrand parkt und zu der Wohnung im vierten Stock hinaufstarrt, wo die Frau immer noch wohnt.
Frankie kennt den Namen der Frau, sie weiß, wo sie arbeitet und wie viele Strafmandate für Falschparken sie schon kassiert hat. Diese Fakten sollten für sie nicht mehr von Bedeutung sein, aber sie sind es dennoch. Sie hat diese Details keinem Menschen anvertraut – nicht ihren Kollegen im Morddezernat, nicht einmal ihren eigenen Töchtern. Nein, dieses Wissen behält sie für sich, weil allein die Tatsache, dass sie von der Existenz dieser Frau weiß, einfach zu demütigend ist.
Deshalb sitzt Frankie an diesem regnerischen Aprilmorgen allein in ihrem Auto und beobachtet eine Wohnung, ohne dass sie irgendeinen legitimen Grund dafür hätte, einzig und allein, um sich selbst zu quälen. Alle nehmen an, dass sie die Tragödie verwunden hat und wieder nach vorne schaut. Ihre Töchter haben die Highschool mit Bestnoten abgeschlossen und genießen jetzt ihr Gap Year in vollen Zügen. Ihre Kollegen haben aufgehört, ihren Blicken auszuweichen oder sie mitleidig anzusehen. Dieses Mitleid war das Allerschlimmste – von allen im Boston PD, bis hin zu den Streifenbeamten, nur noch bedauert zu werden. Nein, in ihrem Leben ist wieder Normalität eingekehrt – oder zumindest ein Anschein davon.
Und doch parkt sie jetzt wieder einmal vor dem Haus in Packard’s Corner.
Eine Frau tritt aus dem Gebäude, und Frankie ist schlagartig hellwach. Sie sieht zu, wie die Frau die Straße überquert und an Frankies Auto vorbeigeht, offensichtlich ohne zu ahnen, dass sie beobachtet wird. Frankie jedoch nimmt sie umso genauer wahr. Die Frau hat blondes Haar und hat sich gegen die Kälte in schwarze Leggings und eine weiße Daunenjacke gehüllt, die eng genug anliegt, um eine Wespentaille und schmale Hüften erkennen zu lassen. Frankie hatte früher auch so eine Figur, damals, vor der Geburt der Zwillinge. Bevor die Jahre, die Schreibtischarbeit und die vielen eilig hinuntergeschlungenen Mahlzeiten ihre Hüften in die Breite gehen und ihre Oberschenkel anschwellen ließen.
Im Rückspiegel beobachtet Frankie, wie die Frau zur Stadtbahn-Haltestelle geht. Sie überlegt, ob sie aussteigen und ihr folgen soll. Überlegt, sich der Frau vorzustellen und ihr vorzuschlagen, dass sie sich einmal in aller Ruhe unterhalten könnten, von Frau zu Frau, vielleicht in dem Café an der Straßenecke. Doch sie bringt es nicht fertig auszusteigen. In Frankies langer Laufbahn als Polizistin hat sie Türen eingetreten, Mörder zur Strecke gebracht und zweimal in die Mündung einer Pistole geblickt, und doch bringt sie es nicht fertig, Ms. Lorraine Conover gegenüberzutreten, einer sechsundvierzigjährigen, nicht vorbestraften Verkäuferin bei Macy’s.
Die Frau biegt um die Ecke und verschwindet aus Frankies Blickfeld.
Frankie sinkt in ihren Sitz zurück. Sie ist noch nicht bereit, den Motor wieder anzulassen, nicht bereit, sich den Schrecken zu stellen, die dieser Tag noch bringen mag.
Eine tote junge Frau ist schlimm genug.
DAVOR
DREI MONATE ZUVOR
2
Taryn
Niemand wusste, dass sie hier war. Niemand würde es je erfahren.
Um halb zehn Uhr morgens dürften alle Mieter im zweiten Stock das Gebäude verlassen haben. Die Abernathys in Wohnung 2A, die immer so aufreizend nett zu Taryn waren, müssten schon an ihren Arbeitsplätzen sein – er in der Revisionsabteilung der City of Boston, sie im Büro für Stadtteilentwicklung. Die beiden Ingenieurstudenten, die in 2B wohnten, hockten jetzt bestimmt irgendwo auf dem Campus vor ihren Laptops. Die Blondinen in 2C hatten wohl ihren üblichen Wochenendkater auskuriert und waren zu ihren Vorlesungen an der Commonwealth gestakst.
In 2D dürfte auch niemand sein. Liam war inzwischen auf dem Weg zu seinem WiWi-Seminar am anderen Ende des Campus, eine Viertelstunde zu Fuß von hier. Nach WiWi hatte er Deutsch III, danach würde er zu Mittag essen, wahrscheinlich sein übliches belegtes Baguette mit extra Jalapeños in der Student Union, und anschließend hatte er eine Politikvorlesung. Taryn kannte seinen Stundenplan auswendig, genau wie sie auch jeden Quadratzentimeter seiner Wohnung kannte.
Sie drehte den Schlüssel um, drückte leise die Tür auf und betrat Nummer 2D. Die Wohnung war größer und so viel schöner als ihre eigene Bruchbude, die nach Schimmel und alten Rohrleitungen stank. Wenn sie hier tief einatmete, war er es, den sie roch. Der samtige Dampf, der noch von seiner morgendlichen Dusche in der Luft hing. Die Zitrusnoten seines Rasierwassers. Der Hefeduft des Vollkorntoasts, den er immer zum Frühstück aß. All die Gerüche, die sie so vermisste.
Wohin sie auch blickte, alles brachte glückliche Erinnerungen zurück. Da war das Sofa, auf dem sie sich ganze Samstagnachmittage lang billige Horrorfilme reingezogen hatten, ihr Kopf an seine Schulter geschmiegt, sein Arm um sie gelegt. Da war das Bücherregal, wo ihr Foto einen Ehrenplatz eingenommen hatte. Auf diesem Foto, aufgenommen in dem Sommer, als sie beide ihren Highschool-Abschluss gemacht hatten, standen sie Arm in Arm auf dem Bald Rock Mountain, und sein vom Wind zerzaustes Haar leuchtete golden im Sonnenschein. Liam und Taryn, für immer und ewig. Wo war dieses Foto jetzt? Wo hatte er es versteckt?
Sie ging in die Küche und erinnerte sich an ihre Sonntagsfrühstücke mit Pancakes und Mimosas, Letztere gemixt mit billigem Sekt, weil echter Champagner zu teuer war. Auf der Arbeitsplatte lag die Post von gestern, die Umschläge bereits aufgeschlitzt. Sie las den Brief, den ihm seine Mutter geschickt hatte, zusammen mit einem Ausschnitt aus ihrem Lokalblatt. Dr. Howard Reilly, Liams Vater, war von der Stadt als »Bürger des Jahres« ausgezeichnet worden. Wow! Sie ging den Rest seiner Post durch – eine Mietrechnung, ein paar Pizza-Gutscheine und ein Kreditkartenantrag. Ganz unten lag eine dicke Broschüre von der Stanford Law School. Warum interessierte er sich für Stanford? Sie wusste, dass er sich an juristischen Hochschulen bewarb, aber nicht ein einziges Mal hatte er davon gesprochen, nach Kalifornien zu gehen. Sie waren sich einig gewesen, dass sie nach ihrem Abschluss in Boston bleiben würden. Das war ihr Pakt. So hatten sie es von Anfang an geplant.
Es war nur eine Broschüre. Es hatte nichts zu bedeuten.
Sie öffnete den Kühlschrank und ließ den Blick über die alten Bekannten schweifen: Sriracha-Soße, Hellmann’s Mayonnaise und Yoo-hoo-Schokodrink. Aber zwischen diesen vertrauten Produkten lauerte ein fremder Eindringling: ein Becher Magerjoghurt. Der sollte da nicht sein. In all den Jahren, die sie Liam schon kannte, hatte sie ihn nicht ein einziges Mal Joghurt essen sehen. Er verabscheute Joghurt. Der Anblick dieser Anomalie war so verstörend, dass sie sich fragte, ob sie sich vielleicht in der Wohnung geirrt und den falschen Kühlschrank geöffnet hatte. Ob sie sich in ein Paralleluniversum verirrt hatte, wo ein falscher Liam lebte, ein Liam, der Joghurt aß und einen Umzug nach Kalifornien plante.
Verunsichert ging sie ins Schlafzimmer, wo an den Wochenenden ihre abgelegten Kleider nachts wie eng umschlungene Liebende am Boden gelegen hatten, sein Hemd über ihre Bluse geworfen. Auch hier war irgendetwas nicht ganz richtig. Sein Bett war gemacht, die Ecken des Lakens sauber eingesteckt, wie im Hotel. Wann hatte er das gelernt? Wann hatte er je sein eigenes Bett gemacht? Sie hatte es immer für ihn gemacht.
Sie öffnete seinen Kleiderschrank und sah seine Hemden dort hängen, manche noch in den Plastikhüllen von der Reinigung. Sie hob einen Ärmel an und drückte ihr Gesicht an die kühle Baumwolle, und sie erinnerte sich an die vielen Male, die sie ihren Kopf an seine Schulter gelehnt hatte. Aber diese frisch gewaschenen Hemden rochen nur nach Seife und Stärke. Anonyme Gerüche.
Sie schloss die Schranktür und ging ins Bad.
Im Zahnputzbecher, wo ihre Zahnbürste immer gesteckt hatte, war jetzt nur noch seine, allein und einsam, ohne ihre Partnerin. Sie hob den Deckel seines Wäschekorbs an, wühlte in der Schmutzwäsche und zog ein T-Shirt heraus. Sie vergrub ihr Gesicht darin, und der Duft berauschte sie. Er hatte so viele T-Shirts, da würde er dieses eine bestimmt nicht vermissen. Sie stopfte es in ihren Rucksack – sie würde es als ihre geheime Liam-Droge behalten, und es würde ihr helfen, die Zeit zu überbrücken, bis diese Farce von wegen »ihrer Beziehung eine Pause gönnen« vorbei war. Sicherlich würde ihre Trennung nicht mehr lange dauern. Sie waren schon so lange zusammen, dass sie zu einem einzigen Organismus zusammengewachsen waren. Sie waren ein Fleisch, ihre Leben auf ewig miteinander verbunden. Er brauchte nur etwas Zeit, um zu erkennen, wie sehr sie ihm fehlte.
Sie trat hinaus auf den Flur und zog lautlos die Tür hinter sich zu. Bis auf das T-Shirt, das sie gestohlen hatte, hatte sie alles in seiner Wohnung so hinterlassen, wie sie es vorgefunden hatte. Er würde nicht merken, dass sie hier gewesen war; er merkte es ja nie.
Draußen pfiff ein eisiger Wind zwischen den Häusern hindurch, und sie zog die Kapuze ihrer Jacke hoch, wickelte sich den Schal fester um den Hals. Sie war schon viel zu lange hier; wenn sie sich nicht beeilte, würde sie zu spät zum Seminar kommen. Aber dennoch blieb sie noch einmal auf dem Gehweg stehen, um einen letzten Blick auf seine Wohnung zu werfen.
Und da sah sie das Gesicht am Fenster, das auf sie herabblickte. Es war eine der Blondinen aus 2C. Warum war sie nicht schon in der Uni, wo sie hingehörte? Während Taryn Liams Wohnung durchstöbert hatte, war diese Frau noch zu Hause gewesen. Sie starrten einander an, und Taryn fragte sich, ob die andere Frau gehört hatte, wie sie nebenan umhergegangen war. Würde sie Liam von dem Besuch erzählen?
Taryns Herz pochte, als sie davonging. Vielleicht hatte die Blondine sie ja nicht gehört. Und selbst wenn, hätte sie doch keinen Grund, es Liam gegenüber zu erwähnen. Taryn hatte immer die Wochenenden hier bei ihm verbracht, sie war schon Dutzende Male in diesem Haus gewesen.
Nein, es gab keinen Grund zur Panik. Keinen Grund zu der Befürchtung, dass er es je erfahren würde.
Sie beschleunigte ihre Schritte. Wenn sie sich beeilte, könnte sie es immer noch pünktlich zum Seminar schaffen.
3
Jack
Ihr Name war Taryn Moore, und sie schlich sich am ersten Tag des Semesters in Professor Jack Dorians Leben, als sie den Seminarraum betrat, bekleidet mit einem silberfarbenen Blouson und glänzend schwarzen Leggings. Die Veranstaltung hatte schon vor zehn Minuten begonnen, und sie murmelte eine Entschuldigung, als sie sich an den anderen Studenten vorbeischob, die sich in dem kleinen Raum drängten, und den letzten freien Platz am Tisch einnahm. Jack konnte nicht umhin zu bemerken, wie verführerisch sie aussah, als sie auf ihren Stuhl glitt, ihre Figur geschmeidig wie die einer Tänzerin, mit rötlichen Strähnchen in ihren vom Wind zerzausten braunen Haaren. Sie setzte sich neben einen pummeligen Typen mit einer Red-Sox-Mütze, stellte ihr Notebook auf den Tisch und fixierte Jack mit einem so offenen Blick, dass er für einen kurzen Moment beinahe vergaß, was er sagen wollte.
Sie waren fünfzehn in diesem Kurs, mehr passten auch kaum in den kleinen Seminarraum des English Departments. Bei einer so überschaubaren Gruppe hatte Jack sich schon nach kurzer Zeit alle ihre Namen merken können.
»Und Sie sind …?«, fragte er mit einem Blick auf die Teilnehmerliste seines Seminars »Liebende unterm bösen Stern«. Es war zugegebenermaßen ein etwas reißerischer Titel für den Kurs, den er konzipiert hatte, in dem das Thema zum Scheitern verurteilter Liebe von der Antike bis in die Gegenwart behandelt werden sollte. Gab es einen besseren Weg, abgestumpfte Collegestudenten im vierten Jahr dazu zu bringen, die Aeneis, Tristan und Isolde, Medea oder Romeo und Julia zu lesen, als das Ganze zu einem sexy Paket aus Liebe, Lust und tragischem Ende zu verschnüren? Welche unglücklichen Umstände haben zum Tod der Liebenden geführt? Welche religiösen, politischen und gesellschaftlichen Kräfte standen ihrem Glück im Weg?
»Taryn Moore«, antwortete sie.
»Willkommen, Taryn«, sagte er und hakte den Namen auf der Liste ab. Er fand die Stelle in seinem Konzept, wo er unterbrochen worden war, und fuhr in seinem Vortrag fort, doch er war immer noch abgelenkt von der Frau am anderen Ende des Tisches. Vielleicht vermied er es deshalb, sie anzusehen. Schon an diesem allerersten Tag musste irgendein Instinkt ihm gesagt haben, dass er auf der Hut sein musste.
Das Semester war vier Wochen alt, als sich sein Instinkt als zutreffend erwies.
Sie sprachen über den Briefwechsel von Abaelard und Héloïse aus dem zwölften Jahrhundert. Abaelard war der ältere der beiden, ein berühmter Philosoph und Theologe an der Domschule von Notre-Dame. Héloïse war seine kluge und begabte Schülerin. Trotz einer Vielzahl sozialer und religiöser Tabus, die ihrer Verbindung entgegenstanden, wurden Abaelard und Héloïse ein Liebespaar. Als sie von Abaelard schwanger wurde, zog sie sich entehrt in ein Kloster zurück. Ihr Onkel jedoch vollzog eine brutale Strafe an dem unglücklichen Abaelard: Er ließ ihn von seinen Helfershelfern kastrieren. Abaelard trat daraufhin als Mönch in eine Abtei ein. Obwohl für immer getrennt, hielten die Liebenden ihre Romanze durch die Briefe lebendig, die sie einander schrieben, ein Dokument des Herzeleids zweier unglücklich Liebender, denen es versagt war, einander je wieder zu berühren.
»Ihre Briefe offenbaren faszinierende Details des Klosterlebens im Mittelalter«, erklärte Jack den Studenten. »Doch es ist ihre tragische Liebesgeschichte, die diese Briefe so bewegend und zeitlos macht. Die Tragödie bestimmte ihr Leben, und ihr Leiden im Namen der Liebe machte sie zu Helden. Aber sehen Sie sein und ihr Opfer als gleichwertig? Wer von den beiden Liebenden erscheint Ihnen heldenhafter?«
Beth, ihre Miene ernst wie immer, hob die Hand. »Ich finde, was an Héloïse besonders beeindruckend ist, angesichts der Normen, die damals für Frauen galten, ist ihre fortgesetzte Auflehnung.« Sie sah auf ihren Text hinunter. »Sie schreibt aus dem Kloster, während die anderen ›mit Gott vermählt sind, bin ich mit einem Mann vermählt‹, und ›ich bin allein Abaelards Sklavin‹. Daraus spricht eine willensstarke Frau, die den Tabus ihrer Zeit trotzte. Ich würde sagen, dass sie die wahre Heldin ist.«
Er nickte. »Und sie hat ihre Liebe zu ihm nie aufgegeben.«
»Sie sagt, dass sie Abaelard sogar in die Flammen der Hölle folgen würde. Das ist wahre Hingabe.«
Jason meldete sich zu Wort: »Ich kann meine Freundin nicht mal dazu bringen, zu einem Spiel der Bruins mitzukommen.«
Der ganze Kurs brach in Gelächter aus. Jack war erfreut zu sehen, wie alle sich an der lebhaften Diskussion beteiligten, ganz anders als an den frustrierenden Tagen, wenn er allein das Reden übernehmen musste und seine Studenten ihn nur gelangweilt mit glasigen Augen anstarrten, wie Karpfen in einem Teich.
Jason fuhr fort: »Mir hat auch gefallen, wie Héloïse schreibt, dass sie während der Messe sexuelle Fantasien hatte. Also, damit kann ich mich voll identifizieren! In griechischen Kirchen dauert die heilige Liturgie volle zwei Stunden. In der Zeit könnte ich es mit einem Dutzend Mädels treiben. Im Kopf jedenfalls.«
Wieder Gelächter. In diesem Moment fing Taryn Jacks Blick auf. Sie hatte eifrig mitgeschrieben, und jetzt hob sie die Hand.
»Ja, Taryn?«, sagte er.
»Ich habe ein Problem mit dieser Geschichte. Und auch mit den anderen auf Ihrer Lektüreliste«, sagte sie.
»Oh?«
»Es scheint da ein durchgängiges Thema zu geben in den Geschichten, die Sie uns bisher vorgestellt haben. Und das ist, dass die Männer ausnahmslos die Frauen verraten, die sie zu lieben behaupten. Héloïse gibt alles auf für die Liebe. Und doch feiern die meisten Kommentatoren Abaelard als den wahren Helden.«
Er hörte die Leidenschaft aus ihren Worten heraus, und mit einem Nicken forderte er sie auf fortzufahren.
»Abaelard stellt sich sogar selbst als eine Art romantischer Held dar, weil er solche Leiden zu erdulden hat, aber ich sehe das völlig anders. Ja, es ist furchtbar, dass er kastriert wurde. Aber während Héloïse die Flamme ihrer Liebe am Leben gehalten hat, schwört Abaelard letztlich all seinen sexuellen Gefühlen für sie ab. Er entscheidet sich aus freien Stücken für die Frömmigkeit und gegen die Liebe, während sie ihre Leidenschaft für ihn niemals preisgibt.«
»Sehr gut argumentiert«, lobte er sie, und er meinte es ernst. Taryn hatte offensichtlich über das Gelesene nachgedacht, und sie war tiefer in die Materie eingedrungen als die anderen Studenten, von denen viele nur das Allernötigste taten, um ihren Schein zu bekommen. Bei so viel intellektueller Begeisterung und Verständnis für den Gegenstand machte das Unterrichten einfach Freude. Studentinnen und Studenten wie sie waren der Grund, warum er diese Arbeit machte. Er wünschte, es gäbe mehr von ihrer Sorte. »Sie haben recht – sie hält an ihrer Leidenschaft fest, während er sich dafür entscheidet, in die Fußstapfen der Heiligen zu treten und auf sinnliche Freuden zu verzichten.«
»Das klingt natürlich sehr edel«, fuhr sie fort, »aber man muss sich mal vor Augen führen, was Héloïse alles aufgegeben hat. Ihre Freiheit, ihre Jugend. Ihr eigenes Kind. Wie verzweifelt muss sie gewesen sein, als sie schrieb: ›Ich war nur deine Hure.‹ Es ist, als sei ihr klar geworden, dass er sie fallen gelassen hat und sie im Kloster verrotten lässt.«
»Ach, nun hör aber mal auf!« Jessica schnaubte verächtlich. »Sie landet im Kloster wegen der ganzen sozialen und religiösen Zwänge. Er hat sie nicht dorthin geschickt.«
Caitlin, ihre Mitbewohnerin, die neben ihr saß, nickte mechanisch. Jack wusste nicht, was der Grund war, aber die beiden gifteten ständig gegen Taryn, wechselten Blicke und verdrehten die Augen, wann immer sie eine kluge Bemerkung machte. Eifersucht vielleicht?
»Das stimmt nicht«, entgegnete Taryn. Sie schlug die entsprechende Seite in ihrem Buch auf. »Héloïse schreibt: ›Es war dein Befehl allein, der mich in dieses Kloster schickte.‹ Sie hat es für ihn getan. Sie hat alles für ihn getan. Das ist für jeden offensichtlich, der den Text tatsächlich gelesen hat.«
Jessica lief rot an. »Ich habe die Briefe gelesen!«
»Ich habe auch nie etwas anderes behauptet.«
»Aber du hast es mir unterstellt!«
»Nun ja, die Briefe sind ja auch eine ziemlich komplexe Lektüre. Vielleicht ist dir der Punkt entgangen.«
Jessica wandte sich Caitlin zu und flüsterte: »Was für ein Miststück.«
»Jessica?«, sagte Jack. »Habe ich Sie richtig verstanden?«
Sie sah ihm direkt in die Augen und erwiderte mit einem unschuldigen Lächeln: »Ich habe nichts gesagt.« Aber die anderen hatten sie offenbar auch gehört, so betreten, wie sie alle dreinblickten.
»In diesem Raum ist kein Platz für persönliche Attacken. Ist das klar?«, sagte er.
Statt einer Antwort starrte Jessica nur stumm vor sich hin.
»Jessica?«
»Jaja, schon recht.«
Es wurde Zeit, diesem Geplänkel ein Ende zu bereiten. Er wandte sich Taryn zu. »Sie sagten, Abaelard habe Héloïse verraten. Möchten Sie das etwas genauer ausführen?«
»Sie hat alles für ihn aufgegeben. Sie braucht seinen Trost, die Versicherung, dass er sie liebt. Und was tut er? Er sagt ihr, sie soll das Kreuz umarmen. Ich glaube, da kommt raus, was für ein herzloser Egoist er ist, wenn er behauptet, er hätte mehr gelitten als sie.«
»Na ja, immerhin haben sie ihm die Eier abgeschnitten«, meinte Jason.
Das Gelächter war eine willkommene Abwechslung nach der ganzen Anspannung, aber ihm fiel auf, dass Jessica nicht mitlachte. Sie und Caitlin hatten die Köpfe zusammengesteckt und tuschelten.
Er wollte noch andere Stimmen hören, weshalb er Cody Atwood ansah, der wie üblich neben Taryn saß. Er war ein schüchterner Junge, der sich immer unter seiner Baseballkappe zu verstecken schien, die er manchmal so tief ins Gesicht zog, dass man seine Augen nicht sehen konnte. »Was meinen Sie, Cody?«, fragte Jack.
»Ich, äh … Ich finde, Taryn hat recht.«
»Das findet er immer«, sagte Jessica. Sie wandte sich zu Caitlin um und zischelte: »Loser.«
Jack beschloss, es durchgehen zu lassen, da niemand sonst die Beleidigung gehört zu haben schien.
»Ich sehe das genau wie Taryn, dass Abaelard ein ziemlicher Egoist ist«, sagte Cody. »Er ist ihr Lehrer, und er ist doppelt so alt wie sie. Das macht ihn noch unsympathischer, dass er seine Schülerin ausnutzt.«
»Und das ist die gleiche Dynamik, die wir auch in späteren literarischen Werken sehen. Denken Sie an Philip Roths Das sterbende Tier und an Jonathan Franzens Die Korrekturen. Und ich bin sicher, dass viele von Ihnen Gone Girl gelesen haben. In all diesen Geschichten geht es darum, wie sich ein älterer Lehrer in eine Schülerin oder Studentin verlieben kann.«
»Genau wie in Scharf auf meinen Prof«, warf Jason ein.
»Was?«
»Ach, das ist bloß so eine billige Teenie-Klamotte.«
Jack lächelte. »Komisch, muss ich wohl verpasst haben.«
»Also ist das das eigentliche Thema dieses Seminars, Professor?«, fragte Jessica. »Lehrer, die es mit ihren sexy Schülerinnen treiben?«
Er starrte sie einen Moment lang an, als ihm bewusst wurde, dass sie sich auf gefährlichem Terrain bewegten. »Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ein Thema ist, das in der Literatur immer wieder aufgegriffen wird. Diese Geschichten illustrieren, wie und warum eine Situation, die eigentlich von der Gesellschaft tabuisiert ist, dennoch eintreten kann. Sie zeigen uns, dass jeder, und sei er moralisch noch so integer, in eine desaströse sexuelle Affäre hineingezogen werden kann.«
Jessica lächelte, ihre Augen blitzten. »Jeder, Professor?«
»Wir reden hier über Literatur, Jessica.«
»Also wirklich, was ist denn schon dabei, wenn ein Lehrer sich in eine Studentin verliebt, die es auch will?«, meinte Jason. »Ist ja nicht so, als ob das irgendwo in den Zehn Geboten steht. Du sollst es nicht mit heißen Studentinnen treiben.«
»Aber es gibt ein Gebot gegen Ehebruch«, wandte Beth ein.
»Abaelard war nicht verheiratet«, sagte Taryn. »Aber wieso halten wir uns eigentlich mit diesem Punkt auf? Wir kommen vom Thema ab.«
»Das finde ich auch«, sagte Jack und sah auf die Uhr. Erleichtert stellte er fest, dass die Stunde beinahe zu Ende war. »Okay, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, und ich glaube, das wird Ihnen gefallen. In zwei Wochen eröffnet im Museum of Fine Arts eine Sonderausstellung mit Illustrationen, die von Héloïse und Abaelard inspiriert wurden. Ich habe mit dem Museum vereinbart, dass unser Seminar eine private Führung bekommt. An dem Tag treffen wir uns also nicht hier, sondern machen eine Exkursion zum MFA. Notieren Sie sich den Termin, aber ich schicke auch noch mal eine Rundmail zur Erinnerung. Aber nächste Woche treffen wir uns wie gewohnt hier. Und bis dahin sollten Sie die Aeneis gelesen haben!«
Während die Studenten den Seminarraum verließen, sammelte er seine Unterlagen ein und legte sie in seinen Aktenkoffer. Er merkte nicht, dass Taryn neben ihm stand, bis sie ihn ansprach.
»Ich freue mich jetzt schon auf die Exkursion, Professor Dorian«, sagte sie. »Ich habe ein paar der Bilder auf der Website des Museums gesehen, und es scheint eine wunderbare Ausstellung zu sein. Danke, dass Sie das für uns organisiert haben.«
»Das ist doch selbstverständlich. Übrigens, Ihre Arbeit über Medea letzte Woche hat mir sehr gut gefallen. Es ist das Beste, was ich in diesem Semester gelesen habe. Ich muss sagen, das ist ein Niveau, das ich normalerweise nur von Doktoranden erwarten würde.«
Sie strahlte übers ganze Gesicht. »Wirklich? Ist das Ihr Ernst?«
»Ja. Es ist ausgesprochen durchdacht und auch sehr gut geschrieben.«
Spontan ergriff sie seinen Arm, als ob er ein guter Freund wäre. »Danke. Sie sind der Beste.«
Er nickte und zog seinen Arm leicht zurück, worauf sie ihn losließ.
Plötzlich bemerkte er, dass Jessica von der Tür aus zusah, und der Blick, den sie ihm zuwarf, gefiel ihm gar nicht. Genauso wenig wie die eindeutig sexuelle Geste, die sie Caitlin zeigte, als Taryn hinausging – sie schob einen Finger in ihre Faust und zog ihn wieder heraus. Caitlin kicherte, dann verschwanden sie beide.
Jessicas Hausarbeit war allenfalls von durchschnittlicher Qualität, und es hatte ihm großen Genuss bereitet, eine fette Drei minus darauf zu kritzeln.
Er klappte den Aktenkoffer mit einem lauten Knall zu. Jessicas obszöne Geste hatte ihn mehr verstört, als er zugeben mochte. Erst nachdem der Seminarraum sich ganz geleert hatte, zog er endlich seine Jacke an und trat allein hinaus in den kalten Januarwind.
4
Jack
Maggie kam wie üblich zu spät. Sie wirkte gehetzt, als sie kurz nach halb sieben mit windzerzausten Haaren das Restaurant betrat, doch sie strahlte übers ganze Gesicht, als sie auf ihren Tisch zueilte, ihren Vater mit einer herzlichen Umarmung begrüßte und Jack anschließend einen flüchtigen Kuss gab.
»Na, wie geht’s unserer begnadeten Ärztin?«, fragte Charlie, ihr Vater.
Maggie zog sich die Jacke aus, hängte sie über die Stuhllehne und ließ sich kraftlos auf das Polster sinken. »Erschöpft. Ich glaube, ich habe mich den ganzen Nachmittag nicht ein einziges Mal hingesetzt. Es ist dieses fiese Virus, das gerade umgeht. Alle wollen, dass ich ihnen Antibiotika verschreibe, und ich muss es ihnen mühsam ausreden.« Sie winkte die Kellnerin herbei, um einen Chardonnay zu bestellen, dann ergriff sie Charlies Hand. »Und wie geht’s meinem lieben Geburtstagskind?«
»Jetzt, wo du hier bist, komme ich allmählich in Feierstimmung.«
»Wir warten schon vierzig Minuten«, sagte Jack, wobei er sich bemühte, nicht verärgert zu klingen. Er hatte Charlie auf dem Weg zum Restaurant abgeholt und ständig auf die Uhr gesehen, während sie hier gesessen und Small Talk gemacht hatten. Er war schon beim zweiten Glas Wein.
»Jack, sie hat doch die beste Entschuldigung der Welt«, meinte Charlie. »All die kranken Leute, die sie brauchen.«
»Danke, Dad.« Maggie warf ihrem Mann einen »Da-hast-du’s«-Blick zu.
»Und du kannst froh sein, dass du sie hast, mein Junge«, fügte Charlie hinzu. »Wenn du je krank wirst, hast du deine eigene Leibärztin im Haus.«
»Ja, ich kann wirklich froh sein«, gestand Jack ein und nahm einen Schluck Pinot noir, um seine Verärgerung hinunterzuspülen. »Wenigstens schaffen wir es heute Abend mal, zusammen zu essen.«
»Das ist das Stichwort«, sagte Charlie und rieb sich die Hände. »Lasset das große Fressen beginnen! Da freu ich mich schon das ganze Jahr drauf. Wenn es einen Gott gibt, dann hat er kein Problem mit Cholesterin.«
Jedes Jahr feierten sie zu dritt Charlies Geburtstag mit einem – wie sie es scherzhaft nannten – »großen Fressen«, bei dem all die Köstlichkeiten auf den Tisch kamen, die ihm sein Arzt verboten hatte. Dino’s Steer House war ein altmodisches Steakrestaurant, das schon seit einem halben Jahrhundert existierte und sich dem Trend zur Haute Cuisine, dem andere Lokale in der Stadt gefolgt waren, standhaft verweigerte. Hier servierte man immer noch Steaks, Burger und im wahrsten Sinne des Wortes umwerfende Beilagen wie »Porky Sticks« – ein Berg Pommes frites, übergossen mit einer fetten Käsesoße und garniert mit Speckwürfeln und Sauerrahm.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Pops«, sagte Maggie und stieß mit ihrem Weinglas an sein Bier. »Und schau mal, was ich für dich habe.« Aus ihrer Aktentasche zog sie ein in rotes Glanzpapier eingeschlagenes und mit einer großen goldenen Schleife versehenes Päckchen.
»Ach, Schätzchen, du sollst mir doch nichts schenken«, sagte er, doch seine Augen glänzten, als er das Päckchen entgegennahm. Er bemühte sich, es auszupacken, ohne das Papier zu ruinieren, indem er das Klebeband sorgfältig mit seinem Steakmesser durchtrennte.
»Die machen hier um halb zehn zu«, sagte Jack zu Charlie.
Charlie kicherte vergnügt, während er das Papier mit einer schwungvollen Bewegung wegriss. Strahlend betrachtete er die Schachtel mit einem Sortiment gerösteter Nüsse aus handwerklicher Herstellung von Fastachi. Charlie liebte Nüsse. Er beugte sich vor und umarmte Maggie. »Du bist die Allerbeste, Kindchen. Und mein Arzt sagt, dass Nüsse ganz prima für mein Herz sind.« Er zwinkerte Jack zu. »Aber du kriegst keine. Die gehören alle mir!«
Maggies Handy signalisierte den Eingang einer Textnachricht. Jack seufzte. Maggie war Allgemeinärztin am Mount Auburn Hospital in Cambridge, und sie schafften es grundsätzlich nicht, in Ruhe zu Ende zu essen, ohne dass dieses verdammte Telefon klingelte oder summte. Falls sie überhaupt rechtzeitig zum Essen zu Hause war.
Die Kellnerin kam, um ihre Bestellungen aufzunehmen, und noch während Maggie ihren Jumbo-Rumpsteak-Cheeseburger bestellte, scrollte sie schon durch ihre Nachrichten.
»Und für Sie, Sir?«, fragte die Bedienung Jack.
»Wenn du Lachs bestellst«, sagte Charlie, »machst du deiner armenischen Herkunft Schande.«
Jack bestellte das Schaschlik.
Die Bedienung wandte sich Charlie zu. »Und was nehmen Sie?«
»Mein Arzt hat mich auf diese verfluchte Fünfmal-weniger-Diät gesetzt.« Und er zählte es an den Fingern ab. »Weniger Fett, weniger Salz, weniger Zucker, weniger Fleisch, weniger Geschmack. Also bringen Sie mir eine ganze Kuh, medium rare, mit Mozzarella-Sticks und ausgelassenem Schweinespeck zum Tunken.«
Die Frau kicherte. »Ich fürchte, ganze Kühe sind aus.«
»Wie wär’s dann mit gegrillten Spareribs und Porky Sticks? Ach ja, und gebratener Mozzarella als Vorspeise. Ich hab nämlich heute Geburtstag.«
»Tatsächlich? Na, dann herzlichen Glückwunsch!«
»Möchten Sie raten, wie alt ich bin?«
Die Frau zog die Stirn in Falten. Sie wollte ihn auf keinen Fall beleidigen. »Fünfundfünfzig, würde ich schätzen.«
»Ganz falsch. Ich bin siebenunddreißig.«
Die Augenbrauen der Kellnerin schnellten in die Höhe. »Siebenunddreißig?«
»Celsius. Wenn Sie mal so alt sind wie ich, schalten Sie aufs metrische System um.« Er zwinkerte verschmitzt, während die Frau, immer noch lachend, davonging.
Charlies Miene war meist schwer zu deuten – eine starre, ausdruckslose Maske, hinter der alle Emotionen, die in ihm brodeln mochten, verborgen blieben. Es war ein Gesicht, wie geschaffen für Vernehmungen. Bis zu seiner Pensionierung vor sieben Jahren war Charlie Detective beim Cambridge PD gewesen. Jack stellte sich oft vor, wie die Verbrecher sich unter dem stechenden Blick dieser glanzlosen blauen Augen wanden, Augen in einem Gesicht, das nichts verriet – ein undurchschaubares, emotionsloses Osterinsel-Antlitz, das selbst einen Heiligen dazu bringen konnte, einen Mord zu gestehen.
Aber heute Abend grinste Charlie die ganze Zeit wie ein Honigkuchenpferd, und seine Augen blitzten munter, während er und Maggie ihre üblichen Vater-Tochter-Neckereien austauschten. Wenn Jack sie so beobachtete, vermisste er die Abende, als er und Maggie noch so entspannt und liebevoll miteinander herumgealbert hatten. Die Abende, als sie sich noch nicht total erschöpft vom Krankenhaus nach Hause geschleppt hatte, zu ausgebrannt für Gespräche mit ihm. Es schien noch gar nicht so lange her zu sein, dass Maggie und Jack sich regelmäßig gegen halb sieben zum Abendessen hingesetzt hatten, das entweder von beiden gemeinsam zubereitet wurde oder von demjenigen, der zuerst nach Hause kam. Manchmal gingen sie auch einfach schön essen, und an warmen Abenden fuhren sie ab und zu zum Revere Beach hinaus, um im Kelly’s Hummerbrötchen zu essen. Und heute? Mit Ausnahme von besonderen Abenden wie diesem bestellten sie das Essen beim Lieferservice, oder sie aßen getrennt, sie im Krankenhaus und Jack im Subway in ihrer Straße.
Maggies Handy summte abermals. Sie warf einen Blick aufs Display, dann leitete sie den Anruf auf die Mailbox um.
»Vielleicht könntest du das Ding ausschalten, während wir essen«, meinte Jack, bemüht, sich seine Verärgerung nicht anmerken zu lassen. Mit einem Seufzer steckte sie das Handy in ihre Handtasche.
»Happy Birthday!«, sagte die Kellnerin, als sie ihnen das Essen servierte.
»Sie wissen ja gar nicht, wie happy Sie mich machen!«, sagte Charlie und betrachtete mit sichtlichem Wohlgefallen seine mit glitzernder Aprikosenmarinade überzogenen Spareribs und die große Schüssel Pommes mit geschmolzenem Käse und Speckwürfeln.
Maggie beäugte den einschüchternden, käsetriefenden Burger auf ihrem Teller. »So ein Monstrum habe ich seit deinem letzten Geburtstag nicht mehr gegessen, Dad.«
Charlie grinste und steckte sich die Serviette in den Hemdkragen. »Ich weiß, das ist angeblich gar nicht gut für mich. Also solltest du vielleicht lieber einen Krankenwagen rufen, der dann mit laufendem Motor vor dem Eingang wartet. Und wenn ich einen Herzstillstand kriege, will ich, dass diese süße kleine Kellnerin mich beatmet.« Er griff nach dem Steakmesser, dann hielt er plötzlich inne und verzog das Gesicht.
»Alles okay, Dad?«, fragte Maggie.
»Ja, bis auf diesen Dolch in meinem Rücken.«
»Wie meinst du das?«
»Es fühlt sich an, als ob mir jemand eine Klinge zwischen die Schulterblätter rammt. Ich hasse es, wenn das passiert.«