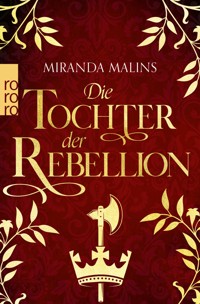
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cromwells Töchter
- Sprache: Deutsch
Ein zerrissenes Land. Der Kampf um die Krone. Eine junge Frau inmitten der Rebellion … Der zweite Teil der ergreifenden Trilogie um Cromwells Töchter. Ely, 1643. England wird vom Bürgerkrieg erschüttert. Der tyrannische König Charles kämpft gegen sein eigenes Parlament. Nachbar kämpft gegen Nachbar. Als die Unruhen ihr Elternhaus in Ely erreichen, gerät die 19-jährige Bridget Cromwell mitten in den Konflikt. Während der Stern ihres Vaters Oliver Cromwell, Kavalleriekommandeur des rebellischen Parlaments, in ungeahnte Höhen steigt, hegt Bridget eigene Ambitionen für ihr Leben – jenseits von Ehe und Mutterschaft. Und als in ihrer eigenen Familie Risse entstehen, steht Bridget vor der Wahl: Soll sie ihrem Herzen folgen? Oder soll sie für Macht und Einfluss heiraten und für eine Revolution kämpfen, die Englands Geschichte für immer verändern wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Miranda Malins
Die Tochter der Rebellion
Historischer Roman
Über dieses Buch
Ein König im Krieg gegen sein Parlament.
Das Parlament in tiefer Zerrissenheit.
Und eine junge Frau inmitten der Rebellion.
England, in den Fens im Jahr 1636
Die junge Bridget, Tochter des Oliver Cromwell, führt ein Leben in Armut. Ihre Familie ist aus dem Landadel in den Stand von Farmpächtern hinabgesunken. Da trifft völlig unerwartet die Nachricht von einer Erbschaft ein! Bridgets Vater sieht seine Chance gekommen. Endlich wird er wieder standesgemäß leben, Gott dienen und Großes in der Welt bewirken.
Sieben Jahre später wird England vom Bürgerkrieg erschüttert: Der tyrannische König Charles I. kämpft gegen sein eigenes Parlament. Während der Stern von Oliver Cromwell, Kavalleriekommandeur der Parlamentstruppen, in ungeahnte Höhen steigt, hat Bridget eigene Pläne für ihr Leben, jenseits von Ehe und Mutterschaft. Wie kann sie für eine Rebellion kämpfen, die Englands Geschichte für immer verändern wird?
Der zweite Teil der ergreifenden Trilogie um Cromwells Töchter.
«Ein historischer Roman, nicht nur für Frauen oder nur für Männer: eine gute, packende Geschichte, messerscharf und unmittelbar erzählt.»
(Aspects of History)
Vita
Miranda Malins ist Autorin, Historikerin und Wirtschaftsjuristin. Sie promovierte an der University of Cambridge und ist seitdem als Rednerin bei Konferenzen sowie als Journalistin und Rezensentin tätig. Ihr Spezialgebiet ist die Geschichte Oliver Cromwells und seiner Familie sowie die Politik des Interregnums nach der Hinrichtung Karls I. Die Autorin lebt mit ihrem Mann, ihren zwei Kindern und der Katze Keats in Hampshire. «Die Tochter des Königsmörders» war ihr Debüt.
Anja Schünemann studierte Literaturwissenschaft und Anglistik in Wuppertal. Seit 2000 arbeitet sie als freiberufliche Übersetzerin der verschiedensten Genres und hat seitdem große Romanprojekte und Serien von namhaften Autorinnen und Autoren wie Philippa Gregory, David Gilman sowie Robert Fabbri aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Historische Romane sind eines ihrer Spezialgebiete: Von der Antike bis zum Mittelalter, in die frühe Neuzeit sowie bis ins 20. Jahrhundert verfügt sie über einen reichen Wissensschatz, der ihre Übersetzungen zu einem gelungenen Leseerlebnis macht.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel «The Rebel Daughter» bei Orion Books/The Orion Publishing Group Ltd/Hachette UK Company, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«The Rebel Daughter» Copyright © 2022 by Miranda Malins
Redaktion Kathrin Jurgenowski
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich,
nach dem Original von The Orion Publishing Group Ltd
ISBN 978-3-644-00914-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Mommy
Personen
Oliver Cromwell, Parlamentsabgeordneter für Cambridge und Colonel in der Eastern Association Army
Elizabeth Cromwell (geborene Bourchier), seine Frau
Robert Cromwell (Robin), ihr ältester Sohn
Oliver Cromwell (Olly), der zweite Sohn der Cromwells
Bridget Cromwell (Biddy), die älteste Tochter der Cromwells
Richard Cromwell (Dick), der dritte Sohn der Cromwells
Henry Cromwell (Harry), der jüngste Sohn der Cromwells
Elizabeth Cromwell (Betty), die zweite Tochter der Cromwells
Mary Cromwell (Mall), die dritte Tochter der Cromwells
Frances Cromwell (Fanny), die jüngste Tochter der Cromwells
Elizabeth Cromwell (geborene Steward), Olivers verwitwete Mutter, lebt bei der Familie
Liz Cromwell, Olivers unverheiratete Schwester, lebt ebenfalls bei der Familie
Jane Desborough, Olivers Schwester
John Desborough, ihr Mann, Colonel in der Eastern Association Army
Valentine Walton, Olivers Schwager, Colonel in der Eastern Association Army
Valentine Walton (Val), sein Sohn
Catherine Whetstone, Olivers Schwester, lebt später bei der Familie
Lavinia Whetstone, ihre Tochter, lebt später bei der Familie
Edward Whalley, Olivers Cousin, Major in der Eastern Association Army
Reverend Hitch, Kantor und Vorsänger der Kathedrale von Ely
Sir John Claypole aus Northborough
Mary Claypole, seine Frau
John Claypole, ihr Sohn
Martha, Magd der Familie Cromwell
Matthew, Knecht der Familie Cromwell
Earl of Essex, Oberkommandeur der Parlamentstruppen
Earl of Manchester, Kommandeur der Eastern Association Army
Henry Ireton, Major in Colonel Thornhaughs Reiterregiment
Francis Thornhaugh, Colonel
Charles Fleetwood, Captain in der Leibgarde des Earl of Essex
Sir Thomas «Black Tom» Fairfax, stellvertretender Kommandeur der Northern Association Army, später Oberkommandeur der New Model Army
Lady Anne Fairfax, seine Frau
John Lambert, Colonel in der Northern Association Army
Frances Lambert, seine Frau
Thomas Harrison, Major in der Eastern Association Army
Catherine Harrison, seine Frau
Thomas Rainsborough, Colonel in der Eastern Association Army
Edward Sexby, Kavallerist in der Eastern Association Army und Agitator
Hugh Peter, Geistlicher in der New Model Army
Edmund Ludlow, Lieutenant-General, Mitglied des Parlaments und später des Staatsrats
John Pym, Parlamentsmitglied, führende Stimme gegen den König in der Vorphase des Krieges
William Lenthall, Speaker des House of Commons
Sir Henry Vane, Parlamentsmitglied, führender Vertreter der Fraktion der Independents
Denzil Holles, Parlamentsmitglied, führender Vertreter der Fraktion der Presbyterianer
John Lilburne, Verfasser von Flugschriften, ehemaliger Offizier bei den Parlamentstruppen und ein führender Leveller
Elizabeth Lilburne, seine Frau, ebenfalls bei den Levellers aktiv
Frances Fleetwood, Charles Fleetwoods Frau
Margery, Amme
Jean, Olivers Diener
König Charles I.
Charles, Prince of Wales
James, Duke of York
Prinz Ruprecht von der Pfalz, Neffe des Königs und dessen Reitergeneral
Sir John Ashburnham, Höfling
Sir Charles Lucas, Lieutenant-General in der Armee des Königs
Sir George Lisle, Colonel in der Armee des Königs
Lady Whorwood, Eigentümerin von Holton Park
Jane Whorwood, ihre Schwiegertochter
Prolog
Januar 1636, in den Fens
Ich bin stets die Erste im Haus, die erwacht. Vor Mutter und Vater, vor meinen Brüdern und Schwestern. Vor Großmutter, die nicht länger als drei Stunden am Stück schläft und niemals nach fünf Uhr früh.
Ich komme sogar dem Hahn in der Scheune zuvor.
Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause, und dem Gesinde, was ihm zukommt.
Ich mag diesen Vers aus den Sprüchen Salomos. Was mich anspricht, ist nicht allein die Wärme, nicht die Vorstellung, Licht in die Dunkelheit zu bringen oder für geliebte Menschen zu sorgen. Es ist das Wort Sie. Sie steht auf. Sie handelt. Sie begegnet dem neuen Tag als Erste und auf ihre Weise, gestärkt durch ein paar kostbare Minuten der Stille. Sie facht das Feuer an und deckt den Tisch, ja. Aber sie leistet mehr als das: Sie gibt dem Tag seine Form, für sich selbst und für alle um sie herum.
Und was kommt dann? Sie tut noch mehr. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Darin stecken viele Verben. Frauen bekommen sonst nicht viele Verben. Dieses eine Mal spricht der Herr zu uns nicht von Königen oder Propheten, von einem reichen Mann in einem Palast oder einem armen Mann an seinem Tor. Er spricht von einer gewöhnlichen Frau. Einer Frau, für die Kraft und Würde ihr Gewand sind. Einer Frau, die ihren Mund auftut mit Weisheit, und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Einer Frau, die viel edler als die köstlichsten Perlen ist.
Und so erwache ich jeden Morgen als Erste und nehme den Tag in Besitz.
Dennoch gibt es Dinge, die ich nicht vermag. Ich kann kein Geld auftreiben für eine Magd, die Mutter zur Hand geht. Ich kann keinen Speck herbeischaffen, wenn unser Vorrat an Salzfleisch zur Neige geht, noch kann ich dem Frost Einhalt gebieten, wenn er wie mit unzähligen Fingern durch die Fensterritzen kriecht. Ich lege getrockneten Lavendel auf den Küchentisch und mische Honig und Kräuter für den Haferbrei, der zum Anwärmen über dem Feuer steht. Doch das ist alles, was ich tun kann.
Es war ein harter Winter für uns. Mutter und Vater wollen ihre Bedrängnis ungern eingestehen, aber wir Kinder haben all die kleinen Sparmaßnahmen wohl bemerkt, die sich in unser Leben geschlichen haben. Wie erstmals die heruntergebrannten Bienenwachskerzen durch stinkende Talglichte ersetzt wurden. Wie Mutter anfing, für unsere Nachbarn Wäsche zu stopfen. Wie Vater sein Jagdpferd verkaufen musste; dabei war ihm dieses Pferd fast so lieb wie seine Kinder. Aber was nutzt einem Landmann – auch wenn er ein Edelmann ist – ein Vollblut, das nicht zur Feldarbeit taugt?
Und das schlechte Wetter hat ein Übriges getan. Die Kälte ist Vater auf die Brust geschlagen, sodass er Tag und Nacht ein rotes Flanelltuch um den Hals tragen muss. Und der Regen, so viel Regen. Die Überflutungen sind zurückgegangen, haben aber einige Verwüstung hinterlassen: Wälle aus schlammigem Torf säumen die Straßen, die Felder sind aufgeweicht und die Zaunpfähle morsch. Hierzulande werden Pächter schnell vom Hof gejagt, wenn sie nicht den nötigen Ertrag erwirtschaften; ein guter Name und berühmte Vorfahren schützen einen nicht davor.
Und so machen wir uns täglich an die Arbeit, sobald wir im rosigen Licht der Morgendämmerung unseren Haferbrei gegessen haben. Vater ist sehr darauf bedacht, keine Stunde der kurzen Wintertage zu vergeuden. Als an diesem Morgen die blasse Sonne über den weiten, flachen Horizont klettert, sitze ich mit meiner kleinen Schwester Betty in der Scheune am Rand des Feldes. Wir bereiten Setzkartoffeln vor, während die Männer in ihren braunen Jacken gebückt arbeiten. Stundenlang sind wir damit beschäftigt, alle bis auf die vielversprechendsten Keimansätze zu entfernen und die Knollen zum Vortreiben mit dem rosigen Ende nach oben in lange, schmale Kisten mit Stroh zu setzen.
Meine Hände kribbeln vor Kälte. Die Handschuhe sind vorne aufgetrennt, damit ich die Finger besser gebrauchen kann. Ich halte kurz inne und reibe meine Fingerspitzen aneinander. Sie riechen widerlich süß von der Stärke und sind schwarz von Erde. Die Schwärze sitzt in jeder Rille der Haut; ich könnte damit Abdrücke auf Papier machen, wie ich es früher gern tat. Ich schaue auf Betty hinunter, die ihren Kopf mit den weizenblonden Locken an meinen Arm lehnt. Sie ist erst sechs, fünf Jahre jünger als ich, und wird rasch müde. Ich denke, ich werde sie bald ins Haus schicken. Sie kann etwas Milch und einen Keks bekommen und dann Mutter beim Stopfen helfen.
Wenigstens ist Vater heute gut gelaunt. Die düstere Stimmung, die ihn vorige Woche fest im Griff hatte, scheint verflogen. Allerdings kann man nie wissen, wann sich das nächste Mal düstere Wolken über ihm zusammenballen. Er stimmt ein Lied an, und ich höre, wie meine Brüder mit ihren hellen Knabenstimmen einfallen. Mein ältester Bruder Robert hält den Ton weniger sicher als die anderen, da er gerade im Stimmbruch ist und zum Bariton wird. Betty und ich schließen uns dem Gesang an. Zusammen sind wir ein richtiger kleiner Chor.
Da zeichnet sich auf dem Damm die Silhouette eines Reiters ab. Ich bemerke ihn zuerst und verstumme. Betty folgt meinem Blick, dann meine Brüder, und ihr Gesang bricht ebenfalls ab. Vater hört als Letzter auf zu singen. Der Reiter hält vor dem nächsten Tor an; sein Brauner schnaubt Dampfwolken in die frostige Luft. Vater, der gerade einen Zaun repariert, richtet sich auf und hält sich mit einer Hand das Kreuz.
«Seid Ihr der Pächter? Mister Oliver Cromwell?», ruft der Reiter Vater zu und beugt sich über seine Satteltasche. «Ich habe einen Brief für Euch.»
Wir schauen zu, wie Vater den Pfahl in den durchweichten Boden rammt und auf den Mann zugeht. Der Schlamm schmatzt unter seinen hohen Stiefeln. Er nimmt das gefaltete Papier und bricht mit seinen behandschuhten Händen das Siegel. Dann liest er, tief über das Blatt gebeugt, die Stirn so gefurcht wie das Feld, in dem er steht.
Es ist ein langer Brief.
Betty vertreibt sich die Zeit, indem sie mit zwei Kartoffeln jongliert. Ich sehe, wie sie sich in der Luft drehen und Erdkrümel auf unsere Röcke fallen. Doch dann ertönt plötzlich ein lautes, herzhaftes Lachen. Unsere Blicke richten sich wieder auf Vater, und die Kartoffeln fallen zu Boden. Vater schlingt die Arme um sich, sein ganzer Körper schüttelt sich vor Lachen, und ihm laufen Tränen über die Wangen.
«Jungs!», ruft er, als er seine Sprache wiederfindet. «Robin, Olly, Dick, Harry!» Vater ruft sie in der Reihenfolge ihres Alters, und sie kommen angesprungen wie Jagdhunde. «Biddy, Betty!» Nun schaut er sich nach uns Mädchen um.
Wir laufen los, dass die Kartoffeln uns vom Schoß fallen und kreuz und quer über den Scheunenboden kullern. Ich raffe meine Röcke und eile aufs Feld, Betty rennt voraus und springt über Wälle aus aufgeworfener Erde, die ihr bis zu den Knien reichen. Als wir bei Vater ankommen, um den sich schon unsere Brüder drängen, schließt er Betty in die Arme und hebt sie hoch. Sie umklammert mit ihren schlammigen Beinen seine Taille und schmiegt das Gesicht an seine dicke, raue Arbeitsjacke. Ich bleibe ein wenig auf Abstand, dabei wünsche ich mir, ich wäre es, die ihre gerötete Wange an seine drückt. Gleich darauf schelte ich mich selbst für meine sündhafte Eifersucht.
«Es gibt Neuigkeiten, meine Lieben! Großartige Neuigkeiten!», verkündet Vater schließlich. «Gelobt sei Gott! Wie ihr ja wisst, ist mein Onkel vorigen Monat gestorben. Nun hat er mir eine Erbschaft hinterlassen: großen Grundbesitz in und um Ely, einen Posten als Zehnteinnehmer für den Dekan und das Domkapitel der dortigen Kathedrale, Einkünfte von gut dreihundert Pfund im Jahr. Das ist kein Vermögen, aber es ist genug, mehr als genug …»
Er spricht nicht weiter, doch ich weiß, was er meint: genug, um wieder in die Gentry aufzusteigen, den Stand, der ihm gebührt. Genug, um seinen Status als einer der einflussreichsten Grundbesitzer der Grafschaft wiederzuerlangen. Genug, um den Abstieg, den wir in letzter Zeit erlebt haben, umzukehren. Vier Jahre sind nun vergangen, seit das Glück uns verließ; damals musste Vater seinen Besitz verkaufen und seine Heimat Huntingdon verlassen. Ich habe mit angesehen, wie er sein ehrbares Leben dort hinter sich ließ und in den Stand eines Pächters hinabsank – er, der Enkel des sogenannten «goldenen Ritters» Sir Henry Cromwell. Dieser hatte einst das herrschaftliche Hinchingbrooke House erbaut, wo der alte König James mit Vorliebe einkehrte, wenn er auf der großen Straße nach Norden reiste. Selbst unser König Charles war als Knabe einmal dort und tollte sogar mit Vater durch die Gärten. Wenigstens behauptet Vater das.
Aber nun wird alles anders. Wir können unsere Geschichte neu schreiben.
Mein ältester Bruder Robin, mit seinen vierzehn Jahren selbst schon fast ein Mann, strahlt vor Freude und Erleichterung. Als Vaters Erbe wird er am meisten von diesem Aufstieg profitieren, doch auch für uns andere tun sich neue Möglichkeiten auf. Meine Brüder können die Universität besuchen, vielleicht einmal einen akademischen Beruf ergreifen – sogar einen Sitz im Parlament bekommen, sofern der König es je wieder zusammentreten lässt. Betty und ich haben bessere Heiratsaussichten, wenn es einmal so weit ist. Und Mutter muss nicht mehr im Licht von Talgkerzen die Wäsche anderer Leute flicken.
«Ach, meine Lieben …» Vater findet seine Stimme wieder. Sie klingt jetzt kräftiger als zuvor, und mir ist, als könne ich sehen, wie sein Körper unter der Arbeitskleidung erstarkt. «Kommt, wir wollen gehen und es eurer Mutter erzählen. Wir werden zur Feier des Tages ein Huhn schlachten! Und Ihr, werter Herr», ruft er dem verblüfften Boten zu, «Ihr werdet doch hoffentlich mit uns anstoßen? Ein Glas Wein auf unsere Zukunft trinken?»
Vater legt die Arme um uns, und so gehen wir über die Felder zum Wohnhaus. Der erfreute Reiter folgt uns entlang der Straße. Die Jungs laufen voraus, Vater jedoch hält nach wenigen langen Schritten inne. «Das ist Gottes Werk», sagt er so leise, dass nur Betty und ich es hören, «und ich will Ihm jeden Tag meines Lebens danken.» Vater berührt Bettys Nasenspitze mit seiner, und sie lächelt. «Gott ist in meinem größten Elend zu mir gekommen, Mädchen, wisst ihr das? Als ich am tiefsten gesunken war. Er forderte mich auf, Ihm durch mein Leiden zu dienen. Und das habe ich getan, weiß Gott, das habe ich getan. All meinen Zweifeln zum Trotz habe ich Seinen Plan für mich nie infrage gestellt. Aber jetzt, ha!»
Betty kichert, und auch ich lache unwillkürlich, ganz taumelig vor Freude. Vater legt den Arm um mich und drückt mich an seine Brust. Meine Brüder hören unser Lachen, kehren um und drängen sich erneut um Vater. Die zwei älteren, Robin und Olly, klopfen ihm grinsend auf den Rücken, die jüngeren, Dick und Harry, springen herum und klammern sich an seine Jacke.
Doch Vater ist schon nicht mehr bei uns. Er schaut zum Himmel auf, Tränen steigen ihm in die Augen. Ich folge seinem Blick, und bleiche Sonnenstrahlen lassen meine Sicht verschwimmen. Wieder höre ich Vaters tiefe Stimme durch den Herzschlag in meinem Ohr:
«Nun kann ich Gott durch meine Taten dienen, nicht mehr nur durch mein Leiden. Und was ich in der Welt bewirken werde!»
Vaters laute Stimme stört einen Schwarm Stare auf, die sich flatternd in die Luft erheben, und unsere Freudenrufe schallen über das ganze Feld.
Erster Teil
Sieben Jahre später, Ely
Kapitel eins
Frühjahr 1643
Die Schüssel gleitet Betty aus den Händen und zerschellt auf dem Fliesenboden. Mir gelingt es irgendwie, die meine nicht fallen zu lassen. Vor Schreck wie versteinert, stehen wir beide da und starren auf die Haustür. Das Eichenholz erzittert unter dröhnenden Schlägen, und die Straße draußen hallt wider von wütendem Geschrei und Schüssen. Instinktiv warte ich darauf, dass Vater sich an uns vorbeidrängt und an die Tür geht, doch dann fällt mir wieder ein, dass er nicht da ist. Er kämpft bei seinem Regiment, ebenso wie mein Bruder Olly. Mein ältester Bruder Robin liegt in der kalten Erde, Dick und Harry sind in der Schule, und unser Knecht, der alte Matthew, hat im Wirtshaus The Bell gewiss schon das zweite Bier getrunken. Es ist nach neun Uhr abends.
Kalte Angst überkommt mich, als mir bewusst wird: In diesem Haus sind acht Frauen und kein einziger Mann.
«Wer ist da?» Ich wage mich ein paar Schritte vor, die Schüssel mit Kartoffeln noch immer in den Händen. In der Tür zur Stube erscheint Mutter. Ich werfe ihr einen raschen Blick zu, hoffe auf eine beruhigende Geste.
«Reverend Hitch», flüstert eine vertraute Stimme durch das gemaserte Holz. «In der Stadt hat es einen Aufstand gegeben, Mistress. Ihr müsst Türen und Fenster verschließen und das Licht löschen.»
Mutter ist jetzt an meiner Seite und hat die Tür einen Fingerbreit geöffnet. Draußen steht der Geistliche mit angespannter Miene. Über Mutters Haube hinweg sehe ich undeutlich Stadtvolk mit gesenkten Köpfen durchs Halbdunkel huschen. Wie gütig der Reverend ist, uns zu warnen, denn wir gehören nicht zu den folgsamsten unter seinen Schäfchen – wir haben in Sachen Religion unsere eigenen Ansichten.
«Royalisten?»
«Ja, Mistress. Etwa fünfzig Männer sind für den König aufgestanden. Sie haben die Tore besetzt und arbeiten sich durch die Stadt vor. Sechs Soldaten unserer Parlamentstruppen wurden bereits getötet, ein weiterer verblutet in der Kathedrale. Ihr müsst Euch verschanzen – sie wissen sicher, dass dieses Haus Captain Cromwell gehört und dass er nicht zu Hause ist. Ich muss jetzt weiter.»
«Der Herr sei uns gnädig.» Mutter greift nach der einfachen Perlenkette an ihrem Hals. «Danke, Reverend, wir sind Euch sehr verbunden. Falls Ihr in der Stadt unserem Knecht begegnet, bitte schickt ihn her und sagt, er soll so viele Männer mitbringen, wie entbehrlich sind. Wir werden Türen und Fenster verbarrikadieren und auf Gott vertrauen.»
Reverend Hitch nickt und verschwindet mit wehendem schwarzem Mantel in der Düsternis. Mutter schließt die Tür wieder und verriegelt sie fest. Mit entschlossener Miene dreht sie sich zu uns um und erteilt gestikulierend einen Schwall von Anweisungen. Mein Herz hämmert unter dem Mieder.
«Betty, bring Großmutter hinauf in ihre Kammer und versorge sie mit Brot, Dünnbier und Decken. Dann geh zu den Kleinen – gewiss sind sie von dem Klopfen aufgewacht und ängstigen sich. Kleide sie an für den Fall, dass wir das Haus eilig verlassen müssen, dann setze dich zu ihnen. Lösche alle Kerzen bis auf eine!»
Betty zögert und wirft einen Blick auf die Scherben aus bemaltem Steingut auf dem Boden. Es war Mutters beste Schüssel.
«Lass das liegen, ich räume es weg, wenn die Gefahr vorüber ist.»
Wortlos verschwindet meine Schwester in der Stube. Als sie die Stufe hochsteigt, blitzt der weiße Saum ihres Unterrocks.
«Ich gehe nach hinten, Mutter», sage ich und stelle die Kartoffeln auf dem Tisch neben der Tür ab.
«Ja, übernimm du die Rückseite des Hauses, Bridget, und ich kümmere mich um die Vorderseite. Verriegele die Fenster, zieh die Vorhänge zu, schließe die Türen ab. Lass in jedem Raum nur ein Binsenlicht brennen, damit wir noch sehen, was wir tun.»
«Liz?», ruft Mutter nach hinten, und meine unverheiratete Tante antwortet aus der Küche. «Lösche das Feuer. Fülle ein paar Flaschen Bier ab und richte Proviantpakete her für den Fall, dass wir fliehen müssen.»
Rasch arbeite ich mich von einem Raum zum nächsten vor. Zuletzt ist die Scheune an der Reihe, die an das westliche Ende des Hauses angebaut ist – vor dem Krieg hatte Vater dort seine Zehntstube. Beinahe stolpere ich über eine dahinhuschende Maus, als ich eilig zu der großen Tür am Ende des Raumes gehe. Ich schließe sie ab und lege den Riegel vor, dann schleife ich ein paar Mehlsäcke herbei und lehne sie gegen die Tür. Schwitzend versuche ich, einen hochzuheben, um ihn auf die anderen zu stapeln, doch er ist zu schwer. Ich fluche darüber, dass ich nicht die Kraft eines Mannes habe. Stattdessen zerre ich Vaters Stuhl herbei und verkeile die Tür damit. Ich bete, das möge genügen.
Als ich wieder in den Hausflur komme, fegt Martha, unsere Küchenmagd, gerade die Scherben der zerbrochenen Schüssel zusammen. Als sie fertig ist, holen wir gemeinsam die Bank aus der Ecke mit unseren Stiefeln und Mänteln und verrammeln damit die Haustür. Ich drehe mich um, da sehe ich zu meiner Überraschung Betty die Treppe herunterkommen.
«Die Mädchen weinen», sagt sie mit gequälter Miene. «Sie haben sich an mich geklammert, und ich habe ihnen versprochen, dass uns nichts geschieht, aber sie glauben mir nicht. Sie hören nur auf dich, Biddy.»
Das Los der ältesten Schwester, denke ich und bin wider Willen gerührt vom Vertrauen der Kleinen. Mary und Frances sind so viel jünger als wir: sechs und fast fünf Jahre. Beinahe eine zweite Familie; sie kamen erst zur Welt, nachdem Vaters Schicksal sich gewendet hatte. Ich weiß, dass sie die dreizehnjährige Betty anhimmeln, schön und liebenswürdig, wie sie ist. Mich mit meinen nunmehr achtzehn Jahren finden sie mitunter etwas streng. Aber wir leben im Krieg. Schön und liebenswürdig zu sein, genügt nicht mehr. In Abwesenheit der Männer müssen wir stark und erfinderisch sein. Harte Arbeit, Geistesgegenwart und Kenntnisreichtum sind jetzt die Währung der Frauen, Mut und Mitgefühl gleichermaßen unser Kapital. Früher wünschte ich mir für meine Zukunft nichts als den sicheren Hafen der Ehe und Mutterschaft, geht es mir durch den Kopf, während ich die Treppe hinaufsteige. Nun frage ich mich, ob mir das genügen wird.
Wir verbringen die ganze Nacht zusammen im oberen Stockwerk, eine Masse zusammengedrängter weiblicher Körper, eingehüllt in eine warme Wolke aus Lavendelduft und Angstschweiß. Wir schweigen, lauschen aufmerksam. Die Mädchen schlafen unruhig auf Mutters und Bettys Schoß, während Großmutter in ihrem Bett wachliegt und leise Psalmen rezitiert. Tante Liz döst daneben in einem Lehnstuhl, während Martha und ich abwechselnd durch einen Schlitz zwischen den Vorhängen Ausschau halten. Einmal in der Stunde schleichen wir nach unten, um an den Türen und Fenstern nach dem Rechten zu sehen.
Außerhalb unserer vier Wände ist die Stadt Ely wie ein lebendes Wesen. Mal verstummt sie für eine Weile, dann brechen erneut Rufe und Geschrei aus, und Schritte poltern über das Kopfsteinpflaster. Anschließend schläft sie wieder ein, und nur die Glocken der Kathedrale lassen von Zeit zu Zeit ihren Herzschlag ertönen. Gegen drei Uhr früh dringt Fackelschein von der Straße durch die Vorhänge und lässt Schatten über die verängstigten Gesichter tanzen. In die gespenstische Stille hinein hören wir unter unserem Fenster Männerstimmen.
«Ist das hier sein Haus?», fragt ein Mann mit rauer Stimme.
«Ja», antwortet ein anderer.
Jemand hämmert an die Tür. Diesmal ist es nicht das rhythmische Klopfen des Reverend, das klang wie von einem Specht. Es sind die Schläge vieler Fäuste und sogar ein paar Stiefeltritte.
Mary erwacht und wimmert. Mutter hält ihr rasch mit einer Hand den Mund zu und flüstert ihr etwas ins Ohr. Ich lausche, und das Geräusch meines eigenen Atems klingt überlaut in meinen Ohren. Ich schließe die Augen und bete, die Bank an der Tür möge halten.
Eine Minute vergeht, dann hört das Poltern auf, und wir hören schwere Männerschritte zu beiden Seiten um das Haus herumgehen. Der Fackelschein entfernt sich. Ich öffne die Augen wieder und stelle mir vor, wie Nasen sich an die Scheiben pressen, wie Männer versuchen, in der Nachtluft die Witterung der Frauen aufzunehmen, die sich in ihr Nest ducken. Irgendwo klopft jemand an Glas, und einen entsetzlichen Moment lang fürchte ich, sie könnten eine Scheibe einschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen, oder in Lampenöl getränkte Lumpen um Steine wickeln, sie anzünden und durch die Fenster werfen.
Mutter greift nach meiner Hand und spricht flüsternd das Vaterunser. Vater unser, der du bist im Himmel … Ich drücke ihre Hand, und Betty und die Mädchen klammern sich an uns. Leise wie die Mäuschen in der Kirche fallen wir alle in das Gebet ein. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden … Ich schließe die Augen wieder und verliere mich in dem Gebet. Wir sprechen es vier, fünf Mal, ehe Mutter plötzlich verstummt. Der Bann ist gebrochen, wir verfallen wieder in Schweigen, lauschen.
Die Männer sind fort. Unsere Worte, Gottes Worte, haben sie abgewehrt – und auch die Bank im Hausflur. Wenigstens vorerst.
Das Gefühl des Sieges lässt mich freier atmen. Ich lasse Mutters Hand los und richte mich erneut aufs Warten ein. Mall und Fanny sinken allmählich wieder in Schlaf, und auch Betty schläft nun ein. Tante Liz döst, Mutters Kopf sinkt auf die Brust, und Martha in der Zimmerecke hüllt sich in ihr zerschlissenes Umschlagtuch.
Großmutter und ich sind die Einzigen, die sich nicht dem Schlaf ergeben. Selbst im Stockfinsteren spüren wir unsere Verbindung. «Du und ich, Bridget», dringt Großmutters vom Alter brüchige Stimme durch die Dunkelheit, «wir halten jetzt Wache.» Irgendwo in der Ferne höre ich einen Schrei.
Von da an bleibt es die meiste Zeit still, nur hin und wieder höre ich draußen noch Männer rufen und in der Nähe des Hauses herumrennen. Mutter wird für eine Weile wach, und wir unterhalten uns flüsternd, dann döst sie wieder ein. Noch ein paar Stunden vergehen, ehe das erste rosige Dämmerlicht schüchtern durch die Ritzen der Vorhänge kriecht. In dem Spalt in der Mitte, wo sie nicht ganz schließen, sehe ich das beschlagene Glas. Meine Blase macht sich bemerkbar, und ich schleiche auf Zehenspitzen aus dem Zimmer, um nach einem Nachttopf zu suchen.
Da ich schon einmal auf den Beinen bin, beschließe ich, nach dem Rechten zu sehen. Ich lege mir eine Decke um die Schultern und steige leise die Treppe hinunter. Als ich im Hausflur stehe, dort, wo Betty die Schüssel hat fallen lassen, höre ich plötzlich eine Gewehrsalve, gefolgt von Hufgeklapper auf der Straße. Das Geräusch kommt näher, dann halten die Reiter vor unserem Haus an. Ich weiche von der Tür zurück. Hastig schaue ich mich nach etwas um, das ich als Waffe gebrauchen kann. Ein großes Scheit im Brennholzkorb und der schwere Kerzenleuchter auf der Truhe nicht weit von mir erscheinen mir am besten geeignet. Ich nehme beides und ziehe mich damit unter die Treppe zurück. Mein Herzschlag dröhnt in meinen Ohren. Ich bete zu Gott, meine Schwestern zu verschonen und mir Kraft zu geben. Wenn Er mich als Werkzeug braucht, so will ich gern alles tun, was ich vermag – eher werde ich sterben, als zuzulassen, dass ein Mann meine Schwestern anrührt.
Wieder erzittert die Tür unter Faustschlägen. Laute Stimmen ertönen, als riefen die Männer etwas zu uns herein, doch in meinem Versteck unter der Treppe kann ich sie nur gedämpft hören. Jetzt klingt es wie Stiefeltritte gegen die Tür. Als das Holz splittert, zwinge ich mich, meinen Schlupfwinkel zu verlassen. Ich atme tief durch, noch einmal, dann fliegt die Tür auf.
Mit einem Aufschrei stürze ich den Eindringlingen entgegen und schwinge meine Waffen. Wild fuchtelnd, renne ich geradewegs in zwei Männer hinein; gleichzeitig stolpern die beiden über die Bank, mit der die Tür verrammelt war. Ich schlage nach ihnen. Dann prallen sie im Sturz gegen mich, und ich falle nach hinten. Da ich keine Hand frei habe, um mich abzufangen, schlage ich heftig mit dem Rücken auf dem Boden auf. Für einen Moment bleibt mir die Luft weg, außer mir vor Wut liege ich da. Doch dann schaue ich auf und erblicke den stämmigen Mann, dessen Silhouette sich nun im Türrahmen abzeichnet.
Vater. Es ist mein Vater.
«Biddy!» Er eilt besorgt zu mir. «Mein Liebling, mein tapferes Mädchen! Bist du verletzt? Sind alle in Sicherheit?»
Ich kann den Blick nicht von ihm wenden. «Wir alle sind wohlauf, Vater. Die anderen sind oben.»
«Und du bist der Wachhund?», fragt Vater. Ich höre den Stolz in seiner Stimme und sonne mich darin.
Einer der Männer, die die Tür eingetreten haben, beugt sich über mich, fasst mich unter den Achseln und hebt mich auf. Der Geruch nach verschwitzter Kleidung und Pferdehaar steigt mir in die Nase. Der Mann ist hochgewachsen und drahtig, ganz das Gegenteil der eher gedrungenen Cromwell-Männer, an die ich gewöhnt bin. Erst jetzt schaue ich ihn richtig an und bemerke, dass seine Lippe blutet.
«Nun, Henry, was sagt Ihr zu meiner ältesten Tochter Bridget?», redet Vater den Mann an, dann breitet er die Arme nach mir aus. «Ist sie nicht die tapferste, mutigste Frau, der Ihr je begegnet seid?»
Der Mann lässt mich los, richtet sich zu seiner vollen Größe auf und betastet mit einem Finger vorsichtig seine Lippe. In plötzlicher Verlegenheit weiche ich von ihm zurück und flüchte mich in Vaters Arme. Seine stämmige Gestalt und sein vertrauter Geruch nach Stroh und Leder beruhigen mich. Nun betrachte ich die zwei anderen Männer eingehender. Sie sind in den besten Jahren – ich schätze beide auf Anfang bis Mitte dreißig – und nach ihrer Kleidung zu urteilen Kavalleriesoldaten. Der Dunkelhaarige, dessen Lippe blutet, wirkt streng und ernst, der andere Mann ist blond und lächelt.
«Sie hat mir einen ordentlichen Schlag verpasst, Sir, das muss ich ihr lassen», erwidert der Dunkelhaarige schließlich. Er reibt sich das Kinn und mustert mich mit durchdringendem Blick.
«Und ob, mir auch», sagt der andere lachend; seine blonden Locken wippen über dem Spitzenkragen. «Gut gemacht, Mistress!»
Beide sprechen einen ähnlichen Akzent, vielleicht aus Nottinghamshire. Mir bleibt die Peinlichkeit erspart, etwas erwidern zu müssen, denn in diesem Moment kommt Mutter fliegenden Schrittes die Treppe herunter, gefolgt von Betty und den kleinen Mädchen. «Oliver, Gott sei Dank.»
Ich trete ein wenig zurück, damit Vater seine Frauen in die Arme schließen kann. Während ich die Szene lächelnd betrachte, gewinne ich allmählich meine Fassung und Geistesgegenwart wieder. «Ich kümmere mich um das Frühstück», sage ich und mache mich auf den Weg in die Küche.
Vater hat seine vertrautesten Offiziere mit nach Hause gebracht, darunter auch Verwandte, die wir herzlich willkommen heißen. Meine beiden Onkel, Colonel Valentine Walton und Colonel John Desborough – die Ehemänner von Vaters Schwestern Margaret und Jane –, scheinen das ganze Haus auszufüllen. Onkel Walton lacht und plaudert mit Mutter und Tante Liz. Er schüttelt das Armeeleben ab wie ein Zugpferd nach Feierabend seine Last. Sein Sohn, mein jugendlicher Vetter Val, gebärdet sich neben ihm wie ein junger Hengst, das glänzende Schwert am Gürtel. Onkel Desborough hingegen entspannt sich auf gänzlich andere Art: Mit seiner massigen Gestalt trottet er schwerfällig wie ein alter Bär durchs Haus, und wer sich ihm nähert, erntet finstere Blicke. Aber am glücklichsten bin ich über die Rückkehr meines älteren Bruders Olly. Freudig beobachte ich, wie er jeden Gegenstand, jede Fläche mit den Händen berührt, als wolle er sich vergewissern, dass er wirklich wieder daheim ist.
Beim Frühstück sind wir eine große Gesellschaft, so groß, dass nicht alle am Esstisch in der Stube Platz haben. Deshalb macht Olly es sich auf dem Boden bequem, wo die Mädchen seine Schärpe und sein Schwert genau untersuchen, und Großmutter bleibt in ihrem Lehnstuhl am Feuer. Betty sitzt anmutig auf einem Schemel neben ihr, während mir zu meiner stillen Freude ein Platz am Tisch zugestanden wurde. Durch die Tür höre ich Matthew hämmern und ächzen – er setzt die Haustür wieder instand.
«Ich war noch nie so froh, wieder zu Hause zu sein», sagt Vater. Er lehnt sich auf seinem Stuhl am Kopfende der Tafel zurück und strahlt uns an, dann runzelt er plötzlich finster die Stirn. «Aber die Vorstellung, dass meine kleinen Frauenzimmer bedroht wurden, in unserem eigenen Haus.»
«Bekümmere dich nicht weiter deswegen, Liebster», sagt Mutter und wirft ihm über den Tisch hinweg einen beruhigenden Blick zu. «Wir waren hier drin sicher.»
«Und nun, da mein Sohn wieder da ist, werden wir noch sicherer sein», wirft Großmutter ein. Sie schaut von ihrer Schale mit Haferbrei auf. «Als er fortging, war er bloß Captain, jetzt kehrt er als Colonel zurück!» Stolz und zufrieden strahlt sie Vater an. Ihr einziger Sohn hat der Welt bewiesen, dass er der Goldjunge ist, für den sie ihn schon immer gehalten hat.
Vater errötet über das Lob seiner Mutter, dann platzt er heraus: «Die Beförderung schmeichelt mir, Mutter, das will ich nicht bestreiten.»
«Hört, hört.» Die anderen Offiziere klopfen beifällig auf den Tisch.
«Der ‹Herr der Fens› reißt alle mit!» Onkel Walton hebt schmunzelnd sein Glas, sichtlich erfreut, dass er und Vater nun den gleichen Rang haben.
Vater zieht eine Augenbraue hoch, dann hebt auch er dankend sein Glas und leert es in einem Zug. Seine gute Laune ist zurückgekehrt.
Ich stehe beflissen auf und gehe mit dem Bierkrug hin, um ihm nachzuschenken, dann schaue ich in die Runde, ob einer der Gäste noch etwas braucht. Mir ist sehr daran gelegen, dass auch die beiden Fremden sich an unserem Tisch willkommen fühlen, nicht zuletzt, weil ich ihnen so einen unsanften Empfang bereitet habe. Daher freut es mich, dass der blonde junge Offizier, den ich mit dem Kerzenständer geschlagen habe – Vater hat ihn als Captain Charles Fleetwood vorgestellt –, mir freundlich zulächelt, als er mir sein leeres Glas hinhält. Von dem dunkelhaarigen Offizier neben ihm, den ich nunmehr als Major Henry Ireton kenne, kommt hingegen keine solche freundschaftliche Geste. Ich werfe ihm einen Blick zu und frage mich kurz, ob seine geschwollene Lippe – die Folge meines Angriffs mit dem Holzscheit – ihn daran gehindert hat zu frühstücken, denn er hat weder seinen Teller mit Brot und Speck noch das Glas Ale angerührt. In diesem Moment richtet er seinen eindringlichen Blick auf Vater und ergreift das Wort:
«Dennoch dürfen wir nun nicht müßiggehen, Colonel», beginnt er. Seine Stimme ist tief und klangvoll, und er spricht mit einer ruhigen Autorität, die nicht recht zu seinem untergeordneten Rang passt. «Wir haben die Armee des Königs aus den östlichen Grafschaften hinweggefegt, was hauptsächlich Euren Anstrengungen zu verdanken ist, doch die Isle of Ely ist nach wie vor bedroht. Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten ist die Gegend besonders gut zu verteidigen, daher wird der König sie erobern müssen, wenn er diesen Teil des Landes wieder unter seine Herrschaft bringen will. Und nun wurde Major-General Grey mit fünftausend Mann unserer Eastern Association Army nach Westen beordert, wo er sich den Truppen des Earl of Essex im Themsetal anschließen soll, um die kleineren Städte zu besetzen, die Oxford verteidigen. Damit ist Ely der nördlichen Armee des Königs schutzlos ausgeliefert.»
Henry Ireton verstummt – er hat die Lage nüchtern und rational zusammengefasst. Es würde mich wundern, wenn er nicht an der Universität studiert und ein Juraexamen abgelegt hätte, denke ich, während ich ihn über den Rand meines Bechers hinweg betrachte.
«Ihr sprecht wahre Worte, Henry.» Vater nickt ernst. Wieder redet er den jüngeren Mann vertraulich mit dem Vornamen an. «Die Heeresleitung hat mir geschrieben, meine Liebe, die Herren beurteilen die Lage ganz so wie Henry», fährt er an Mutter gerichtet fort. «Deshalb haben sie mich zum Gouverneur von Ely ernannt, damit ich hier ein Hauptquartier einrichte und die Verteidigung der Region leite. Nachdem Grey nach Westen marschiert ist, kann ich nach meinem Gutdünken schalten und walten – bis auf Weiteres.»
Vater wird in der Heimat stationiert? Ich bin begeistert über diese Nachricht, doch ehe ich mein Entzücken zum Ausdruck bringen kann, kommt Betty mir zuvor.
«Dann wirst du diesmal länger bei uns bleiben, Vater?», fragt sie, kommt mit glühenden Wangen angesprungen und nimmt seine Hand.
«Ja, Betty, mein Liebling», erwidert er und küsst ihre Hand. «Ich werde wahrscheinlich bis nach der Ernte hauptsächlich hier in der Gegend zu tun haben. Allerdings muss ich mit meinen Männern etwaige Einfälle abwehren, und von Zeit zu Zeit werde ich nach London gehen, um dem Parlament und unserem Oberbefehlshaber, dem Earl of Essex, Bericht zu erstatten.»
«Ab September stehen wir dann wieder im Feld, und wer weiß, was uns noch erwartet», wirft mein Bruder Olly von seinem Platz am Boden ein. Zwar kann ich sein Gesicht nicht sehen, und seine Stimme klingt beherzt, doch ich meine, in der aufgesetzten Tapferkeit einen unsicheren Unterton zu hören. Er und unser Vetter Val haben mit solchem Eifer zu den Waffen gegriffen, als der Krieg voriges Jahr begann, begeistert wie Schuljungen, die zum ersten Mal von zu Hause fortgehen. Doch nun, da sie jeder einen Reitertrupp in Vaters Regiment befehligen, ist die Sache kein Spiel mehr. Ich frage mich, ob die Erfahrung, gegen seine Landsleute zu kämpfen, Olly verändert hat. Wenn wir beide allein sind, werde ich ihn ausfragen, damit er mir erzählt, wie es wirklich ist.
«Da haben sie Euch vor eine große Aufgabe gestellt», sagt Henry Ireton bedächtig zu Vater. «Es wird viel zu tun geben: die Verbindung zur Garnison in Cambridge halten, Befestigungen in Wisbech und Earith errichten, neue Rekruten anwerben und ausbilden, die Finanzierung sichern, Waffen und Verpflegung für zweitausend Mann beschaffen, das heißt …» Er verstummt, die kohlschwarzen Augen ins Leere gerichtet. Wahrscheinlich überschlägt er die Zahlen im Kopf.
Vater schiebt scharrend seinen Stuhl zurück, steht auf und geht um den Tisch herum, bis er hinter Iretons Stuhl stehen bleibt. «Es ist wahrhaftig eine große Aufgabe, Henry, so groß, dass ich einen guten Stellvertreter brauche. Jemanden, der weit klüger ist als ich, der einen Blick fürs Detail hat und einen Kopf für Zahlen. Was meint Ihr?»
Zum ersten Mal, seit er zur Haustür hereingestürmt ist, verzieht Major Ireton sein strenges Gesicht zu einem Lächeln. «Ich meine, es hatte seinen Sinn, dass der Herr mich hergeführt hat», erwidert er und steht auf. Vater schließt ihn herzlich in die Arme und küsst ihn auf beide Wangen.
Ich beobachte diese Freundschaftsbezeigung und bin wieder einmal fasziniert, wie leicht mein Vater neuerdings auf dem Schlachtfeld Freundschaften schließt. Wie mag es wohl sein, in einem Kavallerieangriff neben einem anderen Mann zu reiten? In einen Hagel aus Musketenkugeln zu stürmen und Männer niederzumachen, als würde man Getreide dreschen? Wie mag es sich für Vater anfühlen, der bis vor einem Jahr nie eine Waffe in die Hand genommen hat, außer um auf die Jagd zu gehen? Ich schaue mich im Zimmer um und beobachte, wie die anderen Männer auf Henrys Ernennung reagieren: Onkel Walton schlägt freudig auf den Tisch, Val und Olly folgen rasch seinem Beispiel; von Onkel Desborough kommt ein zustimmendes Nicken, doch seine Miene bleibt griesgrämig. Charles Fleetwood applaudiert leise, allerdings wirkt sein Beifall auf mich etwas zurückhaltend. Vielleicht hatte Charles selbst auf die Beförderung gehofft?
«Und du kannst für mich ein Auge auf meine Familie haben, wenn ich unterwegs bin, Henry», fährt Vater fort. «Vorausgesetzt, du verdirbst es dir nicht mit Biddy und ihren Holzscheiten und Kerzenständern! Bidding Biddy – Biddy die Gebieterische, so nenne ich sie, und warum, brauche ich dir wohl nicht zu erklären», fügt er lachend hinzu.
Ich schrecke peinlich berührt aus meinen Gedanken auf. Alle Blicke sind auf mich gerichtet. Vaters scherzhafte Bemerkung kränkt mich, doch ich weiß, er hat es nicht spöttisch gemeint – er wollte ausdrücken, wie stolz er auf seine tüchtige älteste Tochter ist. Daher richte ich mich gerade auf und antworte lächelnd: «Deputy Ireton hat von mir nichts zu befürchten.»
Henry neigt leicht den Kopf, und ich erwidere dies mit einem knappen Nicken, ehe ich aufstehe, um den Tisch abzuräumen.
Kapitel zwei
«Ich finde, er sieht nicht besonders gut aus», flüstert Betty mir später am Vormittag zu. «Zu streng. Zu spitz. Woran erinnert er mich nur? Ah, ich weiß! An einen Fuchs. Er ist zu füchsisch.»
«Unfug», entgegne ich, verärgert über ihre Oberflächlichkeit. «Das kannst du Major Ireton wohl kaum vorwerfen. Was zählt, ist der Charakter eines Menschen, nicht seine Gesichtszüge.» Insgeheim muss ich einräumen, dass er wirklich etwas von einem Fuchs hat, doch ich werde mich nicht dazu herablassen, Betty zuzustimmen.
Wir stehen am Waschbecken in der Küche und weichen die Wäsche ein, die unser Bruder Oliver wie immer in einer verdreckten Satteltasche auf dem Küchentisch abgelegt hat. Es ist unsere Aufgabe, die hartnäckigsten Flecken mit Lauge zu behandeln, bevor Martha die Kleidung im Nebengebäude wäscht. Während ich an einem dunkelbraunen Fleck an seinem Ärmelaufschlag herumschrubbe, frage ich mich plötzlich, ob das wohl Blut ist.
«Aber er ist so ernst», fährt Betty fort und streicht sich mit dem Handgelenk eine Locke aus dem Gesicht.
Ich reibe den Blutfleck zwischen Daumen und Zeigefinger. Dabei bin ich erstaunt, wie wir beide denselben Wesenszug bemerken und ihn doch ganz gegensätzlich beurteilen können. Für Betty ist Major Iretons Ernsthaftigkeit ein Makel, ich hingegen sehe darin eine Tugend: Die Unverständigen erben Torheit; aber Erkenntnis ist der Klugen Krone. «Er ist ein Soldat, der das Werk Gottes tut, Betty», versuche ich zu erklären. «Wenn das einen Menschen nicht ernsthaft macht, dann weiß ich es auch nicht.»
Betty lässt ein winziges, helles Lachen ertönen und stößt mich leicht mit dem Ellenbogen in die Seite. «Er würde zu dir passen, Biddy. Ich kann mir gut vorstellen, wie ihr beide in eurer Ernsthaftigkeit miteinander glücklich wäret, und vor dem Schlafengehen würdet ihr Seite an Seite knien und beten.»
Ich versteife mich. Sie hätte nichts Besseres sagen können, um mir Henry Ireton zu verleiden. Nachdem sie ihn für mich auserkoren hat, könnte ich ihn niemals mehr selbst erwählen, selbst wenn ich mich entschließen sollte zu heiraten. Sie weiß das, und ich weiß, sie wartet nur darauf, dass ich es ausspreche. Stattdessen schweige ich trotzig und widme mich mit neuer Energie dem Blutfleck.
Nach einer Weile sieht Betty ein, dass ich ihr nicht den Gefallen tun werde, mich zu empören. Also verfolgt sie ihre Gedanken weiter. «Aber wenigstens haben wir noch die anderen jungen Männer, die uns aufheitern. Captain Fleetwood wirkt recht lebhaft, und Val ist durch den Krieg offenbar auch nicht furchtbar ernst geworden.» Betty hält in ihrer Arbeit inne und schaut durch das breite Sprossenfenster. Draußen im Garten liegen unser Vetter Val und unser Bruder Oliver ausgestreckt im Gras, die Köpfe zusammengesteckt, und lassen sich von der Sonne bescheinen. «Ich werde sie mal fragen, ob sie hereinkommen und etwas Kuchen essen möchten», sagt Betty plötzlich. «Meine Finger sind schon ganz schrumpelig.» Sie trocknet sich die Hände ab und entledigt sich ihrer Schürze, dann läuft sie durch die Hintertür hinaus in den Garten. Ich schaue zu, wie sie anmutigen Schrittes zu den jungen Männern hinübergeht, sich majestätisch neben ihnen im Gras niederlässt und ihre Röcke ordnet. Olly reagiert nicht, als sie sich nähert, Val hingegen setzt sich auf und wirft sich ein wenig in Pose.
Ich beobachte, wie die drei miteinander plaudern. Dabei versinke ich in meine Gedanken, während meine Finger die zarte Spitze an Olivers Leinenkragen bearbeiten, nur ein schmaler Stoffstreifen zwischen meinen Fingern. Ich fühle mich an die Zeit vor ein paar Jahren erinnert, als meine jüngsten Schwestern noch klein waren und ich ihre schmutzigen Windeln und spitzenbesetzten Nachthäubchen wusch. Das war eine turbulente Zeit. Mit dreizehn und dann vierzehn war ich alt genug mitzuerleben, wie Mutter in den Wehen lag, und ich sah, wie die Last weiterer Kinder sie wieder in den Morast der Mutterschaft hinabzog – das endlose Füttern, Wickeln, Waschen, Trösten; von früh bis spät hatte sie nie eine Hand frei, um etwas für sich zu tun. Davor hatte ich romantische Vorstellungen von Geburt und Säuglingspflege gehabt, doch diese blieben zwischen Putzen und Wiegen in jenen Jahren der Knechtschaft auf der Strecke. Für Mutter und Vater war es natürlich das größte Glück. Sie sahen in den Kleinen eine neue Hoffnung, einen Neubeginn, nachdem das Erbe meines Großonkels unser Geschick gewendet und uns nach Ely geführt hatte. Ich glaube, sie waren auch erleichtert, dass der kleine James nicht ihr letztes Kind blieb – er hatte nur zwei Tage gelebt. Ich war damals acht. Sein Tod in Verbindung mit Vaters Ängsten und seinem Statusverlust hatte für einige Jahre eine kalte Decke über das Ehebett meiner Eltern gelegt.
Ich wringe den letzten Kragen aus und lege ihn in den Korb neben mir. Diese Arbeit ist getan, und mich durchströmt eine plötzliche Befriedigung. Meine Arme fühlen sich angenehm erschöpft an. Mein Blick wandert wieder durch das Fenster zu der Gruppe auf dem Rasen. Betty macht gerade einen Scherz, die Jungen lachen. Val beugt sich zu ihr hinüber und dreht eine Locke ihres Haares um seinen Finger. Die kastanienbraune Strähne glänzt im Sonnenschein.
Da steht Olly auf, durchquert gemächlichen Schrittes den Garten und kommt in die Küche. Er wirft einen Blick auf den vollen Wäschekorb neben mir, dann gibt er mir einen Kuss.
«Du bist eine gute Schwester, Biddy. Ich bin froh, saubere, läusefreie Kleidung zu haben, wenn ich wieder bei der Truppe bin.»
Ich schenke ihm ein warmes Lächeln. Er ist mein Lieblingsbruder, sofern Gott so etwas zulässt. Im Alter am nächsten, nur ein Jahr älter als ich. Der ruhigste, vernünftigste unter den Jungen; Mutters gesunder Menschenverstand gepaart mit Vaters einnehmender Art. «Versprich mir nur, an mich zu denken, wenn das nächste Mal der Mann neben dir sich kratzt», sage ich.
Olly lacht, dann wird er still und blickt ins Leere. Ich spüre, wie er sich in meiner Gegenwart entspannt, und ich glaube fast, die heimliche Angst in seinem jugendlichen Gesicht zu sehen, gefolgt von Erleichterung. Plötzlich überkommt mich der Drang, ihn in Daunen zu packen und sicher in der Truhe am Fußende von Bettys und meinem Bett zu verwahren. Doch ich weiß, er braucht Stärkung, keine übertriebene Fürsorge.
«Du tust Gottes Werk, Olly, das weißt du», rede ich ihm sanft zu. «Du leistest deinen Beitrag in einem gerechten Krieg gegen einen Tyrannenkönig. Gott, ich wünschte, ich könnte kämpfen – ich würde so gern etwas anderes tun, als nur zu waschen und zu nähen.» Ich knete und wringe das Handtuch in meinen Händen.
«Du würdest nicht so reden, wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe», entgegnet Olly rasch, aber nicht unfreundlich. Er weiß, wie ich unter meinen Beschränkungen leide. «Auf dem Tisch des Wundarztes oder in einem von Seuchen heimgesuchten Lager ist von der Ehre Gottes nicht viel zu sehen.» Sein Ton wird düster, als grässliche Erinnerungen in ihm aufsteigen. «Da sind Blut und Schweiß. Kot und Schlamm. Es fällt schwer, an ‹die größere Sache› zu denken, wenn man vom Regen durchweicht erwacht, mit nassen, geschwollenen Füßen, mit leerem Magen, zwanzig Meilen Ritt vor sich, und am Ende erwartet einen eine Musketenkugel. Ich verbringe jetzt jeden Tag meines Lebens entweder gelangweilt oder verängstigt. Und immer, immer hungrig.»
Seine erschreckenden Worte beschwören eine fremde Szenerie herauf, und es fällt mir schwer, das Gesagte wirklich zu begreifen. Die Erfahrungen, mit denen ich es am ehesten vergleichen kann, sind wohl die Geburten, die ich miterlebt habe – die blutigen Laken, die Schüsseln mit gestaltlosem, ekelerregend riechendem Fleisch, endloses, eintöniges Stöhnen, durchsetzt von Momenten schreienden Grauens. Olly lässt sich auf einen Stuhl sinken und greift über den Tisch nach einem Stück Korinthenkuchen. Ich setze mich neben ihn und schaue zu, wie er lustlos isst, sehe Krümel von seinem Kinn fallen.
«Ach, mein Lieber.» Ich weiß nichts Tröstendes zu sagen – der Krieg ist so weit jenseits meines Horizonts. «Bestimmt empfinden all die anderen Männer mitunter so wie du.»
Oliver schnaubt mit vollem Mund. «Manche, ja, die von der gewöhnlichen Sorte. Aber nicht die aus unserer Familie, niemals. Unsere Onkel sind tapfer wie Bären; Val hält das Ganze für ein großartiges Spiel und stürzt sich mit Begeisterung hinein; und Vater …»
«Und Vater?»
Er schweigt einen Moment, sucht nach den richtigen Worten. «Vater wird ein ganz anderer Mensch. Bei der Truppe und auf dem Schlachtfeld lebt er richtig auf, als sei er dazu geboren. Es ist seltsam, das mit anzusehen. Beinahe unirdisch – und dann auch wieder ganz irdisch. Nein, ich bin der Einzige, der solche Angst und solchen Groll hegt, aber ich lasse es mir vor den anderen nicht anmerken. Außerdem habe ich gar keine Wahl: Ich bin jetzt Vaters Erbe, und wenn er für das Parlament kämpft, muss ich es auch tun.»
Es ist die vertraute Bürde, die wir beide auf unterschiedliche Weise empfinden: der Verlust unseres ältesten Bruders Robert. Eine Erinnerung, scharf wie ein Nadelstich, versetzt mich in die Vergangenheit. Es war mitten in einer Novembernacht vor vier Jahren, als ein rotwangiger Bote unter Hufgeklapper in die Straße ritt und unser ganzes Haus weckte, indem er mit der Faust an die Tür hämmerte. Eine Laterne, ein Brief, ein Aufschrei von Vater, wie ich ihn weder zuvor noch danach je vernommen habe, von keinem Menschen und auch von keinem Hund. Der Direktor der Knabenschule in Essex hatte geschrieben, der achtzehnjährige Robin, mein ältester Bruder, sei plötzlich an einem Fieber gestorben. Er war der Erbe, der Goldjunge, nach meinem Großvater benannt. Unser einziges Fünkchen Trost war, dass unser anderer Großvater, der in der Nähe wohnte, gerade noch rechtzeitig eingetroffen war, um am Ende bei Robin zu sein.
In den folgenden Wochen und Monaten gab es nichts als Schmerz, eine Welt der Trauer, tief und unerschöpflich wie ein Brunnen. Als wir endlich ausgehöhlt und blinzelnd ins schwache Licht traten, fanden wir uns alle verwandelt. Ich war Mutter und Vater zugleich geworden in jenen düstersten Tagen, als meine Eltern in ihrem Schmerz zu Kindern wurden: Vater haderte mit Gott und verlor beinahe den Verstand, Mutter entwickelte eine sanfte Stärke. Die jüngeren Kinder Dick, Harry und Betty schienen kostbarer geworden, die kleinen Mädchen ein Quell der Freude. Und Olly, stets so sorglos und unbefangen auf seinem Platz als Zweitgeborener, war mit Bitterkeit an die Stelle unseres toten Bruders gerückt und blinzelte ins grelle Licht.
«Was, wenn ich als Nächster sterbe?» Olly schaut mich an, Tränen in den Augen. Er ist neunzehn, doch in diesem Moment wirkt er so viel jünger. «Robin ist als ältester Sohn gestorben. Jetzt bin ich der älteste. Was, wenn Gott mich schlägt wie die Knaben in Ägypten? Und nach mir Dick, dann Harry …»
«Psst.» Ich schließe ihn fest in die Arme und wiege ihn sanft wie ein kleines Kind. «Das wird nicht geschehen. Der Herr nahm jeder Familie ihren erstgeborenen Sohn, und das auch nur, um den Pharao zu strafen.»
«Aber der König ist unser Pharao, und er ist ein ebensolcher Tyrann.»
«Sprich nicht so.» Ich nehme seine Hände, auf die der Krieg seine Landkarte gezeichnet hat: Die Hände des Schuljungen waren weich bis auf die kleine Schwiele, die der Griffel hinterlassen hatte. Nun ist die Haut rau und rissig, die Finger schwielig, weil sie stundenlang Zügel oder Musketen halten müssen. «Wir sind nicht mehr in Ägypten, sondern auf dem Weg ins Gelobte Land. Du wirst sehen, wir werden ein neues Jerusalem erleben. Dafür kämpfst du, mein Lieber. Vertraue auf Gott, und Er wird gütiger zu uns sein, das verspreche ich dir.»
«Vielleicht werden deine Versprechen mich schützen.» Olly macht sich von mir los, stößt die Worte unter Tränen hervor und greift dabei nach seiner Tasche, die noch auf dem Tisch liegt. «Ich habe hier ein Töpfchen Salbe von einem Apotheker, den ich bei Peterborough traf. Wenn ich verwundet werde, aber die Waffe zu fassen bekomme, die mich verletzt hat, dann werde ich sie dir so schnell wie möglich schicken, und du musst sie mit dieser Salbe bestreichen. Die Veteranen in meiner Truppe schwören, man könne Wunden heilen, indem man die Waffe behandelt, die sie verursacht hat.»
Ich nehme zögernd den Tiegel, öffne ihn und betrachte die dunkel glänzende Masse darin. Sie sieht aus wie mit Blut vermischtes Gänseschmalz. Ich weiß, dass auch unbelebten Objekten Gefühle innewohnen können, aber könnte diese Schmiere wirklich meinen Bruder über Hunderte Meilen Entfernung heilen?
«Versprich es mir!», verlangt Olly weinend und drückt mir den Salbentiegel an die Brust. Ich nicke rasch, verberge meinen Zweifel und schließe meinen Bruder noch einmal in die Arme.
«Ich verspreche es», flüstere ich. Es ist ein tröstlicher Gedanke, etwas tun zu können, um ihm zu helfen.
Als wir ein paar Stunden später zum Abendessen zusammenkommen, scheint Olly sich gänzlich erholt zu haben. Die Maske ist wieder da; die einstudierte tapfere Gelassenheit des Soldaten überdeckt seine wahren Gefühle wie Morgentau das Gras. Die Familie ist jetzt unter sich, denn Henry Ireton und Charles Fleetwood sind unterwegs und kümmern sich um die Quartiere für ihre Männer. Dadurch sind wir entspannter, können gleichsam freier atmen, wie wenn wir am Ende des Tages unsere steife Kleidung ablegen und in der Unterwäsche dastehen.
Wir haben ein Festmahl für die Männer vorbereitet. Mutter hat den ganzen Nachmittag in der Küche das Regiment geführt und eigenhändig Vaters und Ollys Lieblingsspeisen zubereitet. Es gibt Aalpastete mit Muskatkruste. Tante Liz hat sie zum Bäcker gebracht, um sie im Ofen zu garen. Außerdem gibt es Huhn, am Drehspieß gebraten und dabei mit Salbeibutter übergossen; es gibt gestampfte Kartoffeln und gekochte Möhren. Die Nachspeise, eine Creme aus Milch und Weißwein mit den ersten Kirschen des Jahres, ist meine stolze Kreation, unter Einsatz von Kasserolle und Schaumschläger mit größter Sorgfalt hergestellt. Nach dem Essen rücken wir unsere Stühle ans Feuer. Die Wärme ist an einem kühlen Frühlingsabend noch immer willkommen. Mutter bringt Mary und Frances allen Protesten zum Trotz hinauf ins Bett, und Tante Liz kümmert sich um Großmutter. Die älteren Männer machen es sich bequem und reden über den Krieg – wobei ich den Eindruck habe, dass Onkel Walton schon das eine und andere Gläschen zu Kopfe gestiegen ist –, während Olly und Val aufmerksam zuhören. Betty sitzt neben Vater, eine Hand in die seine gelegt, und ich mache mich daran, ein Paar seiner Strümpfe zu stopfen.
«Wenn wir nur hier in den östlichen Grafschaften erfolgreich die Stellung halten», sagt Onkel Walton und stopft seine Pfeife aus Vaters Tabakbeutel auf dem Kaminsims, «wenn wir nur das bereits gewonnene Territorium verteidigen können, dann wird alles gut.»
«Nein.» Onkel Desborough schüttelt unwirsch den Kopf. Vor seinem Gesicht kringelt sich Pfeifenrauch. «Das wird nicht genügen. Wir müssen den Osten halten und Essex dabei unterstützen, Oxford und das Themsetal einzunehmen. Sonst geraten wir in den Zangengriff – Hoptons Truppen rücken aus dem Westen an, und Newcastles Armee bedrängt uns von Norden. Solange der König Oxford und die Städte an der Themse hält, kann er London angreifen, und dann ist alles verloren.»
Instinktiv schauen alle zu Vater, um zu sehen, wie er darüber denkt. Er nimmt einen tiefen Zug von seiner Pfeife und richtet den Blick in die Flammen im Kamin.
«Weißt du, was mir nachts den Schlaf raubt, Betty?», fragt er schließlich, wendet sich meiner Schwester zu und drückt ihre zarte Hand. «Material. Männer. Und Motive. Das Parlament muss uns mehr Mittel bewilligen – ich zahle die Schuhe und Strümpfe für meine Männer größtenteils aus eigener Tasche. Und wir müssen mehr Soldaten rekrutieren, gute, ehrbare Männer, die wissen, wofür sie kämpfen, und die Gott lieben.»
«Und die Motive?», fragt Olly nach.
Vater schaut ihn mit traurigem Lächeln an. «Das Problem bereitet mir die größten Sorgen, mein Junge. Dein Onkel Desborough hat recht. Es genügt nicht, diesen Krieg nicht zu verlieren, sondern wir müssen ihn gewinnen, klar und eindeutig. Sonst wird keiner von uns sicher sein. Doch ich fürchte, manche unserer edlen Kommandeure sehen es nicht so. Sie wollen lediglich auf dem Schlachtfeld Stärke demonstrieren und unsere Position dann dazu nutzen, einen ehrenhaften Friedensschluss mit dem König auszuhandeln. Ihnen behagt die Vorstellung nicht, um jeden Preis bis zum Sieg zu kämpfen. Das ist überaus frustrierend für diejenigen unter uns, die sich am Rande dieses Krieges abmühen und wenig Einfluss auf das Herz des Geschehens haben.»
Ich verstehe, was er meint. Aus der Sicht des Königs sind wir, die für das Parlament kämpfen, in diesem Krieg die Rebellen und werden es immer bleiben, ganz gleich, wie oft wir seine Truppen schlagen. Aber wenn er nur ein einziges Mal wirklich die Oberhand gewinnt, werden möglicherweise all unsere tapferen Männer hängen, ihr Besitz fällt an die Krone, und wir Frauen stehen auf der Straße. Es ist eine schreckliche Vorstellung, doch ich ducke mich nicht davor weg, sondern blicke ihr mit umso größerer Entschlossenheit ins Auge. Ich werfe einen Blick zu Olly und wünsche, ich könnte etwas von dem Zorn, aus dem ich meine Kraft ziehe, auf ihn übertragen.
«Aber auch wir wollen doch gewiss irgendwann Frieden mit dem König schließen, Vater?», fragt Betty, schmiegt sich an Vater und schenkt zugleich Val ein strahlendes Lächeln. «Du bist doch nicht in den Krieg gezogen, um ihn vom Thron zu stoßen.»
Eigentlich sollte ich seine Antwort abwarten, doch diese Angelegenheit liegt mir so am Herzen, dass ich meine Zunge nicht im Zaum halten kann: «Ja, aber wenn wir nicht die Absicht hätten, den Krieg zu gewinnen, Betty», halte ich dagegen, «warum haben wir dann überhaupt zu den Waffen gegriffen?»
«Du hast recht, Biddy.» Vater belohnt mich mit einem breiten Lächeln, und ich sonne mich in seiner Wärme. «Wir müssen tapfer und standhaft sein. Wir müssen mutig für unsere Überzeugungen kämpfen.»
Betty runzelt leicht die Stirn, doch Vater nimmt augenblicklich ihre Einwände vorweg.
«Auch du sprichst wahre Worte, mein Liebes: Natürlich wollen wir, dass der König seinen Thron behält. Aber das Parlament muss aus einer unanfechtbar starken Position heraus mit ihm verhandeln können. Wir müssen die Möglichkeit offenhalten, ihn gänzlich zu schlagen und uns auf keinen Kompromiss mit ihm einzulassen. Nur so können wir seine Macht beschneiden und unsere Köpfe sicher behalten.»
«Da wir gerade von Köpfen sprechen, meiner gehört ins Bett», wirft Onkel Walton mit etwas schleppender Stimme ein. «Wir reiten morgen heim, Val», teilt er seinem Sohn mit, der aufspringt, um seinem Vater auf die Beine zu helfen. Dann wendet Onkel Walton sich an seinen Schwager, meinen Onkel Desborough. «John, reitet Ihr mit uns? Wir können Euch nach Hause begleiten und bei der Gelegenheit Jane und den Kindern Guten Tag sagen, ehe wir nach Great Staughton weiterreiten.»
Onkel Desborough nickt. Er tritt an den Kamin, um seine Pfeife auszuklopfen.
«Ich kümmere mich um die Betten», sage ich und mache mich auf die Suche nach Martha. Sie soll mir helfen, die Rollbetten für die Gäste bereit zu machen. Val kann bei Olly unterkommen, und meine Onkel schlafen in der hinteren Stube. Es dauert einige Zeit, die Rahmen abzustauben, die Matratzen auszurollen und genug frische Laken und Decken aufzutreiben. Bis wir fertig sind und Martha noch Nachttopf, Krug und Waschschüssel, Binsenlicht und Kerzen herbeigeschafft hat, liegen die meisten Familienmitglieder schon im Bett, und im Haus herrscht schläfrige Stille. Auch ich bin nun erschöpft. Ich sage meinen Onkeln Gute Nacht, dann gehe ich nach oben. Als ich die Tür öffne, finde ich zu meiner Überraschung Betty nicht in unserem Bett vor. Leise, um Mary und Frances nicht zu wecken, schließe ich die Tür, dann bleibe ich stehen und lausche.





























