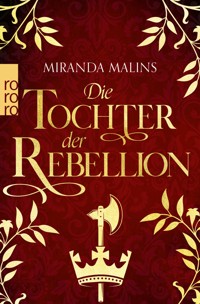9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cromwells Töchter
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ein zerrissenes Land. Der Kampf um die Krone. Eine Familie im Zentrum der Macht … Der bewegende Trilogie-Auftakt um Cromwells Töchter. Perfekt für die Leserinnen von Philippa Gregory, Hilary Mantel und Rebecca Gablé. England im Jahr 1657: König Charles I. ist tot. Für seine Tyrannenherrschaft endete er als Verräter auf dem Schafott. England erlebt den beispiellosen Aufstieg des Oliver Cromwell, Feldherr des Parlamentsheeres, am Tiefpunkt seines Lebens nicht mehr als ein Pächter auf einem Landgut. Nun bietet das Parlament ihm die Krone. Mit der Welt ihres Vaters wächst auch Frances' Horizont: Plötzlich ist die Vermählung von Cromwells jüngster Tochter eine Staatsangelegenheit. Aber ihr Herz gehört bereits Robert Rich, Enkel des Earl of Warwick, dem ein zweifelhafter Ruf vorauseilt. Darf sie ihrer Liebe folgen, oder muss sie sie für höhere Ziele opfern? Kann ihr Vater Parlament, Armee und Royalisten dauerhaft einen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Ähnliche
Miranda Malins
Die Tochter des Königsmörders
Historischer Roman
Über dieses Buch
DER TRIUMPH DES VATERS
IST DAS SCHICKSAL SEINER TOCHTER
England im Jahr 1657
König Charles I. ist tot. Für seine Tyrannenherrschaft endete er als Verräter auf dem Schafott. England erlebt den beispiellosen Aufstieg des Oliver Cromwell, Feldherr des Parlamentsheeres, am Tiefpunkt seines Lebens nicht mehr als ein Pächter auf einem Landgut. Nun bietet das Parlament ihm die Krone.
Mit der Welt ihres Vaters wächst auch Frances’ Horizont: Plötzlich ist die Vermählung von Cromwells jüngster Tochter eine Staatsangelegenheit. Aber ihr Herz gehört bereits Robert Rich, Enkel des Earl of Warwick, dem ein zweifelhafter Ruf vorauseilt. Darf sie ihrer Liebe folgen, oder muss sie sie für höhere Ziele opfern? Kann ihr Vater Parlament, Armee und Royalisten dauerhaft einen?
Ein zerrissenes Land. Der Kampf um die Krone. Eine Familie im Zentrum der Macht … Der Trilogie-Auftakt um Cromwells Töchter.
«Wunderschön geschrieben, mit einem erstaunlichen Gespür für die Szenerie.»
Nominiert für den HWA Debut Crown Award der Historical Writers Association
Vita
Miranda Malins ist Autorin, Historikerin und Wirtschaftsjuristin. Sie promovierte an der University of Cambridge und ist seitdem als Rednerin bei Konferenzen sowie als Journalistin und Rezensentin tätig. Ihr Spezialgebiet ist die Geschichte Oliver Cromwells und seiner Familie sowie die Politik des Interregnums nach der Hinrichtung Karls I. Die Autorin lebt mit ihrem Mann, ihren zwei Kindern und der Katze Keats in Hampshire. «Die Tochter des Königsmörders» ist ihr Debüt.
Anja Schünemann studierte Literaturwissenschaft und Anglistik in Wuppertal. Seit 2000 arbeitet sie als freiberufliche Übersetzerin der verschiedensten Genres und hat seitdem große Romanprojekte und Serien von namhaften Autorinnen und Autoren wie Philippa Gregory, David Gilman sowie Robert Fabbri aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Historische Romane sind eines ihrer Spezialgebiete: Von der Antike bis zum Mittelalter, in die frühe Neuzeit sowie bis ins 20. Jahrhundert verfügt sie über einen reichen Wissensschatz, der ihre Übersetzungen zu einem gelungenen Leseerlebnis macht.
Für meine Jungs
Personen
Oliver Cromwell, Lord Protector
Elizabeth Cromwell, seine Frau, Lady Protectoress
Bridget (Biddy) Fleetwood, ihr ältestes lebendes Kind
Charles Fleetwood, Bridgets zweiter Mann, Major General der Armee und Mitglied des Staatsrats
Richard (Dick) Cromwell, der älteste lebende Sohn der Cromwells
Dorothy (Doll) Cromwell (geborene Maijor), Richards Frau
Elizabeth (Betty) Claypole, die zweite Tochter der Cromwells
John Claypole, Elizabeths Mann, Parlamentsmitglied und Master of Horse
Mary (Mall) Cromwell, die dritte Tochter der Cromwells
Frances (Fanny) Cromwell, das jüngste Kind der Cromwells
Henry (Harry) Cromwell, der zweitälteste lebende Sohn der Cromwells, amtierender Lord Deputy of Ireland
Elizabeth Cromwell (geborene Russell), seine Frau
John Desborough, Cromwells Schwager, Major General der Armee und Mitglied des Staatsrats
Elizabeth (Liz) Cromwell, Cromwells unverheiratete Schwester
Lavinia Whetstone, Cromwells Nichte
Richard Beke, ihr Mann, Major und Captain der Leibgarde des Lord Protector
Sir Oliver Flemyng, Cromwells Cousin und Master of Ceremonies
John Lambert, Major General der Armee
Nathaniel Fiennes, Commissioner of the Great Seal
Sir Charles Wolseley, sein Schwager
Henry Lawrence, Präsident des Staatsrats
Sir Gilbert Pickering, Lord Chamberlain
John Thurloe, Sekretär des Staatsrats und Leiter des Geheimdienstes
Henry Scobell, Schreiber des Staatsrats und Justice of the Peace
Robert Rich, Enkel und Erbe des Earl of Warwick
Earl of Warwick, sein Großvater
Countess of Devonshire, Roberts Großmutter
Bulstrode Whitelocke, Parlamentsmitglied und Commissioner of the Great Seal
Roger Boyle Lord Broghill, Parlamentsmitglied und Höfling
Marchamont Nedham, Autor und Herausgeber der Zeitung Mercurius Politicus
John Milton, Dichter, Polemiker und Leiter des Sekretariats für Latein und Französisch
Andrew Marvell, Dichter und stellvertretender Leiter des Sekretariats für Latein und Französisch
John Dryden, Autor und Beamter im Sekretariat für Latein und Französisch
Edmund Waller, Dichter und Komponist
John Hingston, Master of Music
Master Farmulo, Cromwells Musiklehrer
Samuel Cooper, Maler
John Michael Wright, Maler
Thomas Simon, leitender Medailleur der Münzstätte
Dr. John Hewitt, Geistlicher
Hugh Peters, Kaplan
Jeremiah White, Kaplan
Katherine, Frances’ Zofe
Anne Grinaways, Marys Zofe
Anthony Underwood, Gentleman of the Bedchamber
Nicholas Baxter, Gentleman of the Horse
John Embree, Surveyor General of Works
Philip Jones, Colonel und Controller of the Household
George Bate, Arzt
Master Hornlock, Schneider
Master Riddell, Juwelier
Diverse Sänger und Musiker, darunter zwei Knabensoprane
Thomas Belasyse Viscount Fauconberg, Höfling
Francisco Giavarina, Botschafter von Venedig
Antoine de Bordeaux, Botschafter von Frankreich
George Fox, Begründer der Quäker
Margaret Fell, Quäkerin
Sir William Davenant, Opernkomponist
Mountjoy Blount Earl of Newport, ehemals Höfling von König Charles
Sir Thomas Billingsley, ehemals Höfling von König Charles
Edward Montagu, General at Sea und später Mitglied des Staatsrats
Robert Blake, General at Sea (zusammen mit Edward Montagu)
William Lockhart, Cromwells Botschafter in Frankreich und später Kommandant in Dünkirchen
Robina Sewster, seine Frau, Cromwells Nichte
Philip Meadowes, Cromwells Botschafter in Dänemark
George Monck, General, Oberbefehlshaber der Truppen in Schottland
Sir Thomas Widdrington, Speaker des House of Commons und Commissioner of the Great Seal
Sir Arthur Haselrig, führender Republikaner
John Lisle, Königsmörder, Republikaner und Commissioner of the Great Seal
Sir Christopher Pack, Miturheber des neuen Verfassungsentwurfs
Sir Francis Russell, 2. Baronet
Catherine Russell, seine Frau
John Russell, ihr Sohn und Erbe
Lord Rich, Roberts Vater
Seine zweite Frau und ihre kleinen Töchter
Thomas «Black Tom» Fairfax, einstiger Oberbefehlshaber des Parlamentsheers
Edward Sexby, ehemaliger Leveller und Verschwörer
Miles Sindercome, ehemaliger Leveller und Verschwörer
Thomas Harrison, Königsmörder und Quintomonarchist
Charles Stuart, Sohn des Königs Charles I., lebt mit einem Hof im Exil auf dem Kontinent
König Ludwig XIV. von Frankreich
Kardinal Mazarin, sein regierender Minister
Königin Christina, ehemalige Herrscherin von Schweden
Sämtliche Figuren in diesem Roman sind historische Persönlichkeiten.
Prolog
30. Januar 1661
Wir stehen zusammen, Schulter an Schulter, Rock an Rock, wie eine Kette aus Papierpüppchen, um die Hinrichtung unseres Vaters zu sehen.
Wir haben unsere Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, auch wenn wohl nur die wenigsten in der Menge uns in diesem schlichten Aufzug erkennen würden: Wir zieren weder Münzen noch Medaillen, unser Konterfei wurde nie gedruckt, und kaum jemand von diesen Leuten dürfte unsere gemalten Porträts gesehen haben, als sie in den Palästen Whitehall und Hampton Court hingen.
Eine frostige Windbö greift in meinen Mantel und lässt die drei Schlingen an dem Galgen baumeln, als tanzten die Verurteilten bereits ihren letzten Tanz. Ich starre in schierem Grauen den Galgen an. Es ist ein entsetzliches Ding, riesig und von dreieckiger Form. Vater hat mir einmal erzählt, er sei groß genug für vierundzwanzig Seelen auf einmal.
«Warum muss es hier sein?», frage ich meine Schwestern, ohne sie anzuschauen. Irgendwie macht es das schlimmer, viel schlimmer, dass es in Tyburn geschieht, an der schmutzigen, unheimlichen Straßenkreuzung außerhalb Londons, wo sie gewöhnliche Verbrecher hängen: Wegelagerer, Diebe, Mörder. «Das Parlament hat entschieden, das Verbrechen sei Verrat, also müsste es im Tower geschehen.»
«Ich nehme an, zur Abschreckung», erwidert Mary. «Sie wollen zeigen, wie es Männern ergeht, die sich so hoch über ihren Stand erheben.»
Angst kriecht mir den Rücken hinauf wie eine Spinne, ich fühle, wie sie über meinen Arm auf den von Mary krabbelt. Sie zittert an meiner Seite.
«Wir hätten nicht herkommen sollen», sage ich.
Mary strafft sich. «Es war richtig, dass wir gekommen sind, Frances. Vater würde es wollen. Auch wir waren seine Soldaten.»
Ihre Worte beschwören Bilder aus alten Zeiten herauf, Bilder von den Ironsides in ihren rotbraunen Mänteln. Ich sehe sie durch die Luft marschieren, und wieder einmal überrascht es mich, welche Entschiedenheit Mary neuerdings an den Tag legt. Früher war immer ich die Tapfere.
«Wir sind auch um Henrys willen hier», sagt Bridget an meiner anderen Seite leise. Ihre Stimme bricht, als sie seinen Namen ausspricht.
In diesem Moment hören wir sie kommen. Langsamer Trommelschlag teilt die Menge, und ein scharrendes Geräusch hinter mir versetzt mich augenblicklich in meine frühe Kindheit zurück, da die Jungen den Pflug über die Felder im Moorland um Ely führten. Doch dies ist kein Pflug. Ohne mich umzuschauen, weiß ich, dass es eine Schleife ist, ein großes hölzernes Gestell, auf dem die Pferde die Gefangenen den ganzen Weg durch Holborn gezogen haben. Ein seltsamer Umweg von der Westminster Abbey, doch auch das ist symbolisch: als kämen die Männer nicht aus der geweihten Kapelle der Könige, sondern wie die meisten aus dem Gefängnis Newgate.
Die Menge drängt nach vorn und schiebt uns näher an das Schaugerüst heran. Ich lächle, als mir plötzlich ein Ausspruch von Vater in den Sinn kommt, von dem mein Schwager Charles mir erzählt hat. Es war an dem Tag, als Vater und General Lambert ihre große Armee nach Norden in Marsch setzten, um gegen die Schotten zu kämpfen. Lambert machte eine Bemerkung über die jubelnden Menschenmassen, die sich drängten, um ihnen zuzuwinken und viel Erfolg zu wünschen. Darauf versetzte Vater trocken, die Menge würde ebensolchen Lärm machen, wenn es gälte, ihn am Galgen zu sehen.
Wie recht er hatte.
Doch als ich unter meiner Kapuze hervor die Gesichter der Umstehenden betrachte, erkenne ich, dass Vater nur zum Teil recht hatte. Es stimmt, dass viele herbeigeströmt sind, um ihn am Galgen zu sehen, aber sie jubeln nicht und drängen sich nicht so eifrig wie damals, da sie ihn als Führer seiner Armee sahen. Sie lachen auch nicht, noch trinken sie und gebärden sich auch nicht so ausgelassen wie wohl sonst bei öffentlichen Hinrichtungen. Sie sind ernst, wachsam, beklommen.
Denn dies ist keine gewöhnliche Hinrichtung. Diese Menge ist hier versammelt, um etwas Groteskes mit anzusehen, einen Verstoß gegen die gesellschaftlichen Konventionen, einen Bruch des göttlichen Gesetzes, einen Akt schierer brutaler Rache durch ihren sogenannten «fröhlichen Monarchen». Hier sollen Männer den Verrätertod sterben, die der Arm des Gesetzes nicht mehr erreichen kann, die sogar dem Zugriff des Königs entzogen sind: ein zweiter Tod für Männer, die schon bei Gott sind.
Diese Gefangenen sind bereits tot.
Es sind keine Lebenden, die der Henker und seine Gehilfen nun von der Schleife losbinden und hochziehen, sodass sie unbeholfen aufrecht gehalten unter den Schlingen stehen, in ihre Leichentücher gehüllt. Es sind Tote, aus ihrem gesegneten Schlaf aufgestört, aus ihrer Ruhestätte unter der Erde gezerrt. Aus ihren christlichen Gräbern geraubt.
John Bradshaw, der Präsident des Gerichts, das dem Tyrannenkönig Charles, Vater des jungen Charles Stuart, den Prozess machte.
Henry Ireton, Bridgets Ehemann und der kämpferischste, klügste Mann in Vaters Armee.
Und Vater, Lord Protector des Commonwealth, Oliver Cromwell.
Bei Henrys Anblick stiehlt sich Bridgets Hand in meine, und ich denke, auch wenn sie damals lange zögerte, auf Henrys Werbung einzugehen, hat sie ihn später doch innig geliebt. Etwas an der Geste raubt mir die Fassung – wie klein sich ihre Hand in meiner anfühlt, wie die eines Kindes. Dabei war sie, meine tapfere, viel ältere Schwester doch immer so stark, so selbstsicher und Gott so nah.
«Vater!», platze ich heraus, dabei weiß ich es doch besser. «Vater …» Lauter jetzt. Köpfe drehen sich nach uns um.
Mary fasst meine Hände und senkt den Kopf. «Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme …»
Ich besinne mich und falle leise ein. Die Köpfe wenden sich wieder dem Galgen zu.
Kalte Tränen kullern mir über die Wangen, während ich zusehe, wie den mit Kapuzen verhüllten Leichen die Henkersschlingen umgelegt werden. Trompeten erschallen, und das Urteil über die Verräter wird der Menge verlesen. Doch der Wind verweht die Worte, sodass nur die Leute dicht vor den Stufen sie hören.
Natürlich können die Beschuldigten nicht auf Schemeln stehen, um ihr Schicksal zu erwarten, noch kann man sie ohne ihre Leichentücher hängen, sonst würden die Körper womöglich dort auf dem Schaugerüst auseinanderfallen. Also werden die verwesenden Körper eingewickelt an ihren Stricken hochgezogen. Ziellos baumeln sie in der Luft, nicht zuckend und strampelnd, sondern reglos, beinahe gelassen.
Sie sind nicht da, sage ich mir. Sie sind bei Gott. Niemand kann Vater mehr etwas anhaben.
Stundenlang stehen wir da, taub vor Kälte. Als die Wintersonne sich dem Horizont nähert, werden die Leichen abgeschnitten. Mit dumpfem Poltern fallen sie auf den Boden, zu Füßen des Henkers. Der zieht jetzt unter dem Stroh ein gewaltiges Beil hervor, und instinktiv drängt die Menge näher heran, um besser sehen zu können. Die Männer, noch immer in ihren grünlich schimmligen Leichentüchern, werden zurechtgelegt wie Tiere auf der Metzgerbank, und der Henker schreitet mit schiefgelegtem Kopf vor den Körpern auf und ab, als wollte er sehen, wie er den besten Braten herausschneiden könne. Zufrieden dehnt er noch einmal knackend den Hals, strafft die Schultern und macht sich ans Werk.
Die Köpfe werden zuerst abgeschlagen. Die Leichentücher dämpfen die Wucht des Beils, sodass es acht gewaltige Hiebe braucht, Vaters Kopf abzuhacken, und fast ebenso viele für Henrys; nach jedem Schlag schnappt die Menge hörbar nach Luft. Der Henker hält die Köpfe nacheinander hoch, wobei er sich nicht die Mühe macht, sie auf Armeslänge von sich zu halten, denn hier besteht keine Gefahr, sich die Kleidung mit frischem Blut zu besudeln. Seine Gehilfen kommen dazu, und als Nächstes geht es an Finger und Zehen. Die dem Schaugerüst am nächsten stehen, strecken begierig die Hände nach einem schaurigen Andenken aus. Wieder ergreift Bridget meine Hand, und wir verschränken die Finger fest ineinander, als könnten wir damit gegen das Zerstückeln vor unseren Augen an.
Als endlich die Metzger ihre Arbeit leid sind, wirft man die drei kopflosen Rümpfe kurzerhand in eine tiefe Grube neben dem Galgen. Sie fallen durch die Luft und landen mit einem hässlichen, dumpfen Laut einer auf dem anderen, wie Mehlsäcke, die von einem Heuboden geworfen werden. Die Köpfe verschwinden in einem Sack und werden später zweifellos auf Spieße gesteckt, wie es von alters her üblich ist. Ich beobachte voller Grauen, wie der Abstand zwischen Köpfen und Körpern immer größer wird. Mir wurde erzählt, der alte König sei wieder ganz gemacht worden, nachdem man ihm den Kopf abgeschlagen hatte: Man habe ihn sorgfältig wieder an den Körper angenäht, ehe er in die heilige Krypta der Kapelle von Windsor Castle gesenkt wurde. Für unsere Lieben wird es kein solch glückliches Ende geben, sie müssen auf ewig kopflos in einer unmarkierten Grube zwischen Dieben und Mördern liegen.
Ich kann nicht länger hinschauen. Stattdessen richte ich den Blick auf die Männer, Frauen und Kinder, die sich um mich drängen. Jedes Gesicht ist erstarrt, in einen Augenblick des Grauens gebannt wie eine zerschlagene Uhr. Ob auch nur einer unter ihnen nicht daran denkt, dass auf den Tag genau vor zwölf Jahren der Kopf des Verräterkönigs auf dem Schafott zu Whitehall in die Höhe gehalten wurde? Mary und ich erfuhren erst Monate später davon. Wir waren noch Kinder, und man versuchte, unser Unwissen durch eine Verschwörung des Schweigens zu bewahren. Flugschriften wurden versteckt, Briefe hastig in Taschen geschoben und Bedienstete zum Schweigen gebracht.
Ich schaue zu Bridget hinüber. Sie wusste natürlich Bescheid – sie war damals jungverheiratet, gründete mit Henry eine Familie. Sie hatte von der gedrängt vollen Galerie aus den Prozess gegen den König verfolgt, und Henry hatte den Hinrichtungsbefehl unterzeichnet, als Neunter auf dem Pergament. Bradshaw als Erster. Vater als Dritter.
Ich schließe die Augen und genieße die Stille. Wenn Leute später über das hier schreiben – Chronisten, Verfasser von Klatschgeschichten, Zeitungsschreiber und Berichterstatter der Regierung, die sich jetzt dicht an das Schaugerüst drängen, Bleistifte und Notizpapier in den Händen –, dann werden sie sagen, die Leute hätten gejubelt, als «Old Noll», der große Usurpator, aufgeknüpft und zurechtgestutzt wurde; Gerechtigkeit sei geschehen, und Gott habe lächelnd auf diesen Tag geblickt.
Aber wir werden die Wahrheit kennen. Wir sind auch hier.
Erster Teil
Vier Jahre zuvor, Januar 1657
Kapitel eins
Sie wollen meinen Vater zum König machen. Zum König von England, Schottland und Irland. König Oliver – der Erste seines Namens.
Ich habe das schon früher gehört, damals vor drei Jahren, als Vater zum Lord Protector ernannt wurde, und wieder im Jahr ’55 und dann bei der Hochzeit meiner Cousine Lavinia vor einem Jahr. Was für ein Tag das war. Ich hatte nie etwas Schöneres gesehen als die Braut. Sie leuchtete vor Glück in ihrem goldgesäumten Kleid, als sie mir einen Kuss auf die Wange drückte. Die Jungvermählten lachten und tuschelten, und die Kerzen in den riesigen Leuchtern an den Wänden der großen Halle hier im Palast zu Whitehall brannten herunter, während wir bis in die Nacht hinein schmausten und tanzten. Ich war siebzehn, es war das erste Mal, dass ich so lange aufbleiben durfte, und auch das erste Mal, dass ein Mann meine Hand hielt und mich im Tanz führte.
Ich tanzte zuerst mit meinem Bruder Richard und danach mit meinem Schwager Charles Fleetwood, Bridgets zweitem Mann. Doch dann forderte Robert Rich, der Enkel des Earl of Warwick, mich zum Tanz auf, und etwas an dem Druck seiner Hand auf meiner brachte mich dazu, ihn für den Rest des Tages nicht mehr aus den Augen zu lassen, während er trank und aß und sich unter die anderen Gäste mischte. Später, als die Ecken des Saales sich in Dunkelheit verloren, folgten meine Füße unwillkürlich meinen Augen, und im Schatten einer Plantagenet-Rüstung lauschte ich Robert, wie er mit seinen edlen Freunden scherzte.
«Cromwell gibt eine prächtige Hochzeitsfeier, das muss man ihm lassen», bemerkte ein junger Höfling. Dann hob er seinen Trinkkelch an den Mund und vergoss dabei dicke Tropfen Rotwein.
«Ha», machte Robert spöttisch, und seine Augen funkelten über der langen, edlen Nase. «Eine bemerkenswert königliche Veranstaltung für eine Bauernfamilie aus East Anglia.»
Ein anderer kicherte. «Wohl wahr. Der Hof ist mit jedem Tag weniger steif und verstaubt, und man trifft auch auf weniger Soldaten. Vielleicht wäre ein König Oliver doch keine so schlechte Idee.»
Darauf stießen alle mit ihren schweren Weinkelchen an. Das Zinn glänzte im Kerzenschein.
Ich zog mich auf leisen Sohlen weiter in die Nische zurück. Mir drohten die Tränen zu kommen, doch ich schluckte sie hinunter. Ich war die Tochter meines Vaters, kein Mann würde mich zum Weinen bringen. Später kam Robert zu mir und bat um einen weiteren Tanz, doch ich kehrte ihm meine marmorweiße Schulter zu und redete stattdessen mit meiner Schwester Mary.
Natürlich kränkte mich diese Beleidigung meiner Familie, aber überrascht war ich kaum. Wenn ein vormals bedeutungsloser Mann zum Staatsoberhaupt aufstieg wie mein Vater – und seine Frau und Kinder ihm den Berg hinauf folgten –, dann weckte das bei anderen unweigerlich Hass und Neid. Schließlich gibt es kein größeres Laster als den Ehrgeiz, und gegen diesen Vorwurf ist Vater besonders empfindlich; die Sünde des Hochmuts ist seinem Wesen so fremd. Doch diese Beleidigungen hängen ihm nie lange an, denn Vater verleugnet seine bescheidene Herkunft nicht, sondern ist im Gegenteil stolz darauf. Er selbst spricht davon, nichts als ein «guter Schutzmann» zu sein, der über das Volk wacht. Er erklärt auch den Höflingen, Botschaftern und Gesandten, die tagtäglich zu ihm hereindrängen, unser Familienname müsste eigentlich schlicht «Williams» lauten, den vornehmeren Namen «Cromwell» habe mein Ururgroßvater angenommen, um ein wenig am Glanz seines Onkels teilzuhaben. Thomas Cromwell war König Henrys Erster Minister. Und Vater weist Master Cooper ausdrücklich an, ihn «mitsamt Warzen und allem» zu malen.
Nein. Diese Worte trafen mich wie immer. Aber was mich beunruhigte, war, dass der lachende junge Mann von «König Oliver» gesprochen hatte. Diese Vorstellung war mir schon früher begegnet, von einem Botschafter geflüstert oder in einer Flugschrift gedruckt. Und ich spürte die Folgen, wurde selbst sogar ein- oder zweimal als «Prinzessin» angeredet, wenn auch nur von Dienern, die es wohl nicht besser verstanden. Ich aber wusste, dass Vater ganz zufrieden damit war, Lord Protector zu sein. Ich wusste auch, dass das Wort «König» in Menschen glühende Leidenschaften entfachen konnte: Es brachte sie dazu, auf die Knie zu fallen und Tränenströme um ihren «Märtyrerkönig» Charles zu vergießen, der auf dem Schafott gestorben war, oder aufzustehen und wütend ein reines Commonwealth frei geborener Menschen zu fordern. Weshalb sollte das Parlament diese gefährlichen Feuer neu entfachen, indem es Vater zum König machte? Zum Erben der Krone des toten Tyrannen, zu dessen Nachfolger in jenem Amt, das so anfällig für Korruption ist. Deshalb war mein Gesicht zu Alabaster erblasst, als ich das müßige Gerede der jungen Höflinge hörte.
Und heute nun also wieder. Diesmal flüstert meine Schwester Elizabeth es mir zu, während wir mit der Familie vor dem versammelten Hof sitzen, Bettys Kinder auf dem Schoß und um uns herum. Sie ist stets die Erste, der neues Gerede zu Ohren kommt. Meist hört sie es von ihrem Mann John Claypole, der als Vaters Master of Horse einer der höchsten Amtsträger im Haushalt ist. In diesem Fall hat John die Neuigkeit allerdings in seiner Eigenschaft als Parlamentsabgeordneter für Northampton erfahren.
«John sagt, manche Parlamentarier sprechen offen davon, Vater die Krone anzubieten.» Elizabeth beugt sich so dicht zu mir herüber, dass ich ihren vertrauten Rosenwasserduft rieche. «Es sind Johns Freunde, seine Verbündeten, die wollen, dass Vater König wird – John ist auch entschieden dafür.»
«Aber weshalb jetzt?», frage ich und schiebe die klebrige Hand meiner kleinen Nichte vom Seidenatlas meines Rockes.
Betty schaut mich mit schiefgelegtem Kopf und funkelnden Augen an. «Weil John Lambert und die anderen Armeeführer endlich auf dem absteigenden Ast sind. Ihre Versuche, die Regionen direkt zu regieren, sind allesamt gescheitert – nun ist ihnen das Geld ausgegangen, und sie sind beim Volk zutiefst unbeliebt. Vater hat diese Regierung durch Major Generals als Experiment eingerichtet; eine Notfallmaßnahme, da es schien, als würden die Royalisten sich wieder erheben. Doch nun ist die Bedrohung vorüber, und das Volk will nicht, dass Scharen bewaffneter Generäle wie Onkel Desborough umhermarschieren und das Alte Testament predigen, Schankstuben schließen und Maibäume umreißen, all das in Vaters Namen. Und unter uns gesagt …» Sie hält ihrer kleinen Tochter die Ohren zu. «Vater will es auch nicht.»
Das überrascht mich, denn Vater betrachtet viele Major Generals nicht nur als Gleichgesinnte im Streben nach einer reformierten Gesellschaft, sondern zählt sie auch zu seinen engsten Freunden. Sie sind die Helden, die den jüngsten Krieg für das Parlament gewonnen und die Welt verändert haben, die Waffenbrüder, denen Vater sein Leben anvertrauen würde – auch mein Onkel und mein Schwager Charles Fleetwood sind darunter. Sie hüten ihre Revolution und die dadurch errungene Macht eifersüchtig. «Das hat er wirklich gesagt?», frage ich.
«Nun, nicht öffentlich und gewiss nicht in Charles’ Beisein. Er hat es mir im Vertrauen gesagt.»
Ich weiß nur zu gut, wie sehr Vater die vertraulichen Gespräche zu später Stunde mit Elizabeth schätzt, und wieder einmal spüre ich den Stachel der Eifersucht auf die innige Beziehung der beiden. Ich schiebe das Gefühl beiseite und konzentriere mich stattdessen darauf, die richtigen Schlüsse zu ziehen und der neun Jahre älteren Betty zu beweisen, dass ich genau so viel Verstand habe wie sie.
«Und wenn die Herrschaft der Major Generals bröckelt», sage ich langsam, «kann an ihrer statt etwas anderes entstehen – eine traditionellere Regierung, in der das Parlament wieder mehr Macht bekommt.»
«Ganz genau.» Meine große Schwester strahlt mich an, und ich sonne mich in ihrer Anerkennung. «Eine neue, vom Parlament entworfene Verfassung mit Vater als König, und das Land wäre wieder auf vertrautem Boden. Aber so weit ist es noch nicht; die Armeeführer werden dagegen kämpfen, du wirst sehen.»
Ich schaue zum anderen Ende des Audienzsaals hinüber, wo Vater auf der Estrade sitzt, und forsche in seinem Gesicht nach Anzeichen dafür, dass die Dinge ins Wanken geraten sind. Doch ich kann seine Miene nicht deuten. Seine stämmige Gestalt beugt sich auf dem vergoldeten Stuhl vor, er betrachtet interessiert ein Objekt auf einem Samtkissen, das der kniende Master Simon vor ihm hochhält. Der Medailleur scheint auf Vaters Nachfragen verschiedene Eigenschaften des vorgezeigten Objekts zu erörtern. Nach ein paar Minuten fasst Vater Master Simon herzlich an der Schulter und neigt anerkennend den Kopf, um seine Leistung zu würdigen. Dann lehnt er sich auf seinem Stuhl zurück und klatscht, und der übrige Hof folgt seinem Beispiel. Ich vergesse das Unbehagen, das ich eben noch empfunden habe, und lächle vor mich hin: Ich würde den runden, satten Klang, den präzisen Rhythmus seiner klatschenden Hände jederzeit erkennen, ich höre ihn noch heraus, wenn hundert andere einfallen und ein einziger Lärm entsteht.
Und so höre ich eher, als ich es sehe, dass Vater aufhört zu klatschen und Master Simon mit einem Wink zu uns hinüberschickt. Höflich lächelnd verbeugt der Medailleur sich tief und tritt dann an Mutter heran, die zu meiner anderen Seite sitzt. Wir alle versuchen zu erkennen, was er Mutter überreicht, und ich rieche den Weinatem meines Bruders Richard, der hinter uns steht und sich nun ebenfalls vorbeugt.
Da liegt sie in purpurroten Samt gebettet wie das goldene Ei einer Gans: die frisch geprägte Zwanzig-Schilling-Münze, auf der stolz das Wappen des Commonwealth prangt, und als Mutter sie umdreht, sehe ich auf der anderen Seite Vaters Kopf glänzen. Andächtig betrachte ich Vaters vertrautes Profil – getreulich abgebildet, sogar mit der auffälligen Warze auf dem Kinn. Er ist mit einem Lorbeerkranz gekrönt wie ein römischer Kaiser, und der lange, bloße Hals, der eigentlich im Kragen verschwinden müsste, wirkt seltsam unmännlich. Er ist bereits ein König, denke ich, während ich die Münze in Augenschein nehme. Engländer von Bude bis Berwick werden von nun an das Bildnis meines Vaters in der Tasche tragen.
«Ich kann noch immer nicht begreifen, wie es dazu gekommen ist.»
«Halt still», schilt mich meine Schwester Mary. «Wie soll ich diese Knoten herausbürsten, wenn du immerfort den Kopf schüttelst?»
Ich lächle ihr im Spiegel zu. Ihr Bild ist mir so lieb und vertraut wie mein eigenes. Mary ist nur ein Jahr älter als ich, und wir beide, die so viele Jahre nach unseren anderen Geschwistern geboren wurden, waren immer schon wie Zwillinge – unsere Leben sind eine einzige gemeinsame Erfahrung.
«So, fertig.» Mary drückt mir einen Kuss auf den Kopf. «Ich bin an der Reihe.»
Wir tauschen die Plätze, und während ich Marys Locken bürste, erzähle ich ihr alles, was Elizabeth vorhin gesagt hat.
«Vater? König?» Mary schaut überrascht zu mir auf.
«Ja. Das heißt, vielleicht.»
«Aber das ist außergewöhnlich. Vater ist einfach Vater – kein König, kein Prinz von edlem Blut.»
«Ich weiß.» Ich streiche Marys Haar noch ein letztes Mal glatt, ehe ich die Bürste auf die Kommode zurücklege. «Aber Vater ist außergewöhnlich. Allmählich frage ich mich, ob er überhaupt jemals gewöhnlich war.»
Mit diesem Gedanken habe ich lange gerungen, allerdings bezweifle ich, dass er meine viel älteren Brüder und Schwestern ebenso beschäftigt. Denn sie kannten Vater noch als gewöhnlichen Mann, der an seinem Tiefpunkt nichts als ein Pächter auf einem Landgut war. Als Vater mit über vierzig die Weltbühne betrat, da das Parlament zu den Waffen rief, waren sie bereits fast erwachsen; und dann vollends, als sein Stern aufstieg, in den späteren Jahren des Bürgerkriegs und während des darauffolgenden Ringens um einen Friedensschluss.
Für Mary und mich war es anders. Als wir Kinder waren, war Vater der Herrscher unserer kleinen Welt, und als wir heranwuchsen, war er bereits zum Herrscher der Welt aller anderen aufgestiegen. Es fühlte sich fast an, als wäre Vater im gleichen Maß gewachsen wie wir. Unsere Welt erweiterte sich, und er füllte sie weiterhin aus. Er war mein Horizont gewesen, als er noch nichts war als der Zehnteinnehmer der Kathedrale von Ely, und er ist heute noch mein Horizont, nunmehr als Lord Protector des ganzen Landes. Ich kann niemals über ihn hinauswachsen oder ihn hinter mir lassen, wie die Tochter eines gewöhnlichen Mannes es wohl täte.
«Dir ist klar, was das auch bedeutet», sagt Mary jetzt, nachdenklich auf der Unterlippe kauend. «Wenn eine Ehe für uns arrangiert werden soll, wird das eine Staatsangelegenheit sein. Wenn wir Prinzessinnen werden, entscheiden nicht allein Vater und Mutter darüber, wen wir heiraten, sondern auch Sekretär Thurloe hat mitzureden, der Staatsrat und sogar das Parlament – sie werden darüber debattieren, welche Verbindung den größten Nutzen für die Nation hätte.»
Bei dem Gedanken wird mir ganz mulmig, doch dann gewinnt ein vertrauter Groll die Oberhand. «Was du da sagst, bedeutet letztendlich: Je höher Vater aufsteigt, desto weniger haben wir unser Schicksal in der Hand. Die ohnehin geringe Mitbestimmung, die wir bei der Wahl eines Ehemannes haben, wäre gänzlich dahin, wenn er die Krone annimmt. Mary, wie kannst du so ruhig davon sprechen?»
«Ich nehme die Dinge eben an, wie sie sind, Liebes», erwidert Mary in besänftigendem Ton, der so sehr an unsere Mutter erinnert.
«Nun, ich nicht», entgegne ich und höre in meinen Worten Vaters Stimme.
Wir blicken einander fest an, im flackernden Feuerschein am Fußende von Marys Bett stehend. Dann tun wir ohne ein weiteres Wort, was wir jeden Abend tun: Wir raffen unsere Nachthemden und knien nieder, die Ellenbogen auf das Bett gestützt, die Hände gefaltet, die Köpfe gesenkt.
«Für wen sollen wir heute Abend beten?», flüstert Mary nach ein paar Augenblicken.
«Für uns selbst», murmele ich und schließe fest die Augen.
Mit solchen Gedanken im Kopf kann ich nicht einschlafen. Zurück in meinem Zimmer, liege ich stundenlang im Bett, zu müde, um den Zeilen von Aristoteles’ Politik zu folgen. Das Buch liegt offen auf meinem Bauch, mein Daumen noch an der zuletzt gelesenen Stelle, obwohl ich weiß, dass ich die Lektüre heute Nacht nicht mehr fortsetzen werde. Doch es liegt etwas Beruhigendes im Gewicht der Seiten, der Schwere des teuren Einbands auf meinem Körper. Bücher sind meine Begleiter und haben schon immer mein Bett geteilt, schon in meiner Kindheit, als Mary mit ihrer Puppe neben mir lag und die Bücher in unserem Haus rarere, kostbarere Besitztümer waren.
Mein ältester Bruder Richard zog einen Ausritt mit seinen Hunden jederzeit einer nachmittäglichen Lektüre vor und pflegte mich damit aufzuziehen, dass ich ein Bücherwurm sei, doch Vaters Stolz auf meinen scharfen Verstand entschädigte mich überreichlich dafür. Vater nannte mich seine «kleine Gelehrte». Sein Lob trieb mich an, immer noch mehr Bücher zu suchen, denn ich war überzeugt, damit meine Rolle in seiner großen Kinderschar gefunden zu haben. Vater schätzt an anderen die Talente, die er selbst nicht besitzt, und wenn ich nach dem Abendessen lesend zu seinen Füßen saß, erzählte er mir von seiner vergeudeten Schulzeit.
«Ich hatte nie einen Hang zur Gelehrsamkeit, Fanny, nicht so wie du. Master Beard bemühte sich redlich, doch ich war von jeher zu stark in der Erde verwurzelt, lebte zu sehr im Hier und Jetzt. Ich wollte nicht über andere Länder und andere Zeiten nachdenken. Dies ist Gottes Land, hier, jetzt: das gelobte Land für Sein Volk. Und es ist unsere Pflicht, das Beste daraus zu machen. Ich war zu sehr damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie mein Vater die Pachterträge des Jahres anlegen oder wer für den Stadtrat kandidieren sollte. Ich lebte in einer Welt, in der sich alles um Grundbesitz, Rechnungen und Rechtsstreitigkeiten drehte, nicht in der Welt hehrer Philosophie oder großer Theorien. Und dann war ich nur ein Jahr auf der Universität oben in Cambridge, ehe mein Vater starb und ich mit achtzehn heimkehren musste, um die Rolle des Familienvorstands zu übernehmen: Neben geschäftlichen Angelegenheiten, einer Mutter und sieben Schwestern, die es unter die Haube zu bringen galt, blieb nicht viel Zeit zum Lesen, natürlich abgesehen von meiner Bibel. Ha, das will ich meinen!»
Ich pflegte dann zu lachen, wie er es erwartete. Machte einen Witz über all die vielen Frauen in Vaters Leben, unter denen ich als jüngste der vier Töchter nur der neueste Zuwachs war. Doch ich wusste, hinter Vaters scheinbarer Unbeschwertheit verbarg sich die Erinnerung an schwere Zeiten, und Mutters müdes Lächeln vom Kamin herüber, während sie das Hemd eines meiner Brüder flickte, sprach Bände. Wie sehr Vater sich auf sie gestützt haben muss, als er sie drei Jahre später als seine Braut heimführte.
Und härtere Jahre standen den beiden noch bevor: Vater geriet in finanzielle Bedrängnis, sodass sie seinen Besitz in Huntingdon verkaufen und als Pächter auf einen Bauernhof in St. Ives ziehen mussten; sieben Kinder kamen zur Welt, die es großzuziehen galt; er durchlebte eine Glaubenskrise. Doch dann, nach sechzehn Jahren, wandte Gott sich Vater wieder zu. Es gab eine Erbschaft von einem Onkel – einen ansehnlichen Grundbesitz und eine Position als Zehnteinnehmer in Ely. Mutter und Vater begannen wieder zu leben und einander zu lieben. Mary und dann ich waren die unverhofften Folgen: «eine zweite Familie», wie Vaters Freunde scherzhaft bemerkten. Die achtjährige Betty war nun nicht mehr das Küken unter den Geschwistern.
Auf der Galerie vor meinem Zimmer höre ich das vertraute Scharren, als die abgelösten Soldaten, müde von ihrer Schicht, davonschlurfen, dann das Kratzen und Stampfen der neuen Männer, frisch und wachsam, die sich eine bequeme Position suchen. Noch immer schlaflos, rolle ich mich unter der dicken Felldecke zusammen und denke an den toten König Charles. Mein Zimmer hier im Whitehall Palace war früher sein Kabinett. Oft höre ich das leise Tappen seiner Pantoffeln um mein Bett herum, den schottischen Singsang, wenn er seinem Sekretär einen Brief diktiert. Manchmal kann ich sogar das süßliche Parfüm riechen, das seine Pagen ihm ins Haar und in den Spitzbart gerieben haben. Wie sehr sich dieses königliche Gemach von unserem Kinderzimmer in meinem ersten Zuhause unterscheidet, dem Fachwerkhaus des Zehnteinnehmers in Ely. Dort rieben Mary und ich uns in frostigen Nächten wie dieser in unserem wackeligen Bett unter den Flickendecken gegenseitig die Finger und lauschten dem Klang der Kirchenglocken, die durcheinander läuteten, von der Kathedrale und von St. Mary’s nebenan.
Als ich drei war, entbrannte der Krieg zwischen König und Parlament, der mir Vater eines Morgens wegnahm. Meine früheste Erinnerung ist die an seine hellbraunen Stiefel hoch über meinem Gesicht, als er sich aus dem Sattel beugt, um Mutter einen Kuss zu geben. Er war damals noch ein unbedeutendes Parlamentsmitglied, das vor Ort eine berittene Truppe ausgehoben hatte und sie in den Krieg führte. Doch er zeigte ein natürliches Talent zur Kriegsführung und stieg in der Rangordnung der Befehlshaber auf. Als ich sieben war und der Krieg der Politik Platz machte, übersiedelte Vater uns alle nach London. Unsere erste Unterkunft in einem Stadthaus an der Drury Lane erschien mir über alle Maßen vornehm. Zwar teilten Mary und ich uns weiterhin ein Zimmer, aber es gab keine rauen Wände mit feuchten Flecken mehr. Kein Moordunst überzog die Fensterscheiben von innen mit Reif. Wir mussten nicht mehr barfuß eine Steintreppe hinunterschleichen, um unsere gestopften Strümpfe zu holen, die zum Trocknen über dem Herdfeuer in der Küche hingen.
Dann kamen die langwierigen Friedensverhandlungen mit dem König, die Kämpfe brachen erneut aus, es folgte ein Prozess und schließlich ein kalter Januarmorgen, an dem König Charles aus dem Banqueting House trat und zum Richtklotz ging. Ich war zehn, als England zum Commonwealth erklärt wurde; eine Republik, die keine Könige oder Lords mehr brauchte. Das Parlament war die höchste Instanz, und ich war von Ehrfurcht erfüllt. Doch wir hatten keinen Frieden: Die Royalisten griffen das junge Commonwealth beständig an seinen Rändern an, und die Regierung entsandte Vater mit der Armee nach Irland und anschließend nach Schottland, um die Kämpfe ein für alle Mal zu beenden.
Er war zwei Jahre fort. Mutter bemühte sich nach Kräften, uns mit dem täglichen Brot der höheren Töchter bei Laune zu halten – Nadelarbeiten, Singen, Lesen und höflicher Konversation. Dennoch sehnten wir uns nach Vater und dem lebendigen Chaos, das er um sich zu verbreiten pflegt, wie Keimlinge im Winter sich nach der Sonne sehnen. Als er schließlich im Triumph heimkehrte, fand er ein zerstrittenes, unentschlossenes Parlament auf der Suche nach einer dauerhaften Einigung vor, und ich, altklug und rastlos wie eh und je, verlangte nach Gesprächen mit seinen Freunden und Kollegen, die mir die Lage erklären sollten. Es folgte eine geschäftige Zeit, in der Vater und seine Verbündeten bis spät in die Nacht arbeiteten. Deshalb zogen wir in Räumlichkeiten im alten Cockpit auf dem weitläufigen Gelände des Whitehall Palace um. So konnte Vater in wenigen Minuten zu Fuß zu den Sitzungen des Staatsrats oder des Parlaments gehen. Für mich brachte der Umzug ungeahnten neuen Luxus mit sich: Ich bekam ein eigenes Zimmer, und ein Kammermädchen – Katherine, eine Kriegerwitwe, derer Vater sich angenommen hatte – wartete Mary und mir auf. Sie half uns dabei, uns an die einengenden Kleider junger Damen zu gewöhnen.
Doch ich ahnte nicht, dass mein Leben, das bereits so verändert war, sich in Kürze grundlegend und für immer wandeln sollte. Vater und die anderen ranghohen Offiziere der Armee verloren die Geduld mit ihren politischen Herren und lösten anno ’53 mit vorgehaltenen Musketen das Parlament auf. Die gottgefälligsten Männer des Reiches wurden in eine Versammlung berufen, um die Regierung zu übernehmen, doch sie schauten nur hinauf zum Himmel oder hinunter auf ihren eigenen Bauchnabel – niemals geradeaus nach vorn. Die Versammlung zerbrach in Fraktionen, und der Armeerat trat an Vater heran und forderte ihn auf zu herrschen. Und so bekamen wir eine neue Regierung mit einem Lord Protector als Herrscher und einem Rat, dem Council of State, die mit dem Parlament zusammenarbeitete. Das war vor drei Jahren. Ich war erst fünfzehn, als wir die ranghöchste Familie im Land wurden. Wir zogen in die königlichen Gemächer von Whitehall und Hampton Court, ich bekam Dienstmädchen und Zofen, Lehrer für Musik und Sprachen und ein Kleidergeld, über das ich nach Belieben verfügen konnte. Und was das Beste war, ich konnte die königliche Bibliothek plündern und mit den klügsten Köpfen des Hofes über meine Ausbeute diskutieren. Leute knicksten vor mir oder verbeugten sich; Mädchen unterbrachen ihre Unterhaltungen, wenn sie mich kommen sahen; junge Männer suchten unauffällig meine Nähe. Ich erinnere mich noch, wie mich zum ersten Mal eine Dienerin mit «Hoheit» anredete und ich gar nicht verstand, wen sie meinte.
Meine älteren Schwestern Bridget und Elizabeth machten viel Aufhebens darum, wie krass sich dieses Leben von jenem unterschied, in das sie einst hineingewachsen waren: Damals war ein Abendessen mit unseren Nachbarn der höchste gesellschaftliche Anlass, und Mutter gab ihnen monatlich ein paar Pennys, die sie für Bänder oder anderen kleinen Luxus ausgeben durften. Doch ihre Haltung zu den größeren Möglichkeiten, die Mary und mir nun offenstanden, unterschied sich so sehr wie ihr Wesen: Betty half mir, mein Kleidergeld auszugeben, schwärmte von Seide und Atlas und neckte mich damit, dass ich mir leisten konnte, was ihr in meinem Alter versagt geblieben war. Bridget hingegen ermahnte mich streng, nicht in sündhafte Eitelkeit abzugleiten und mich dem Unterricht zu widmen, den ich zu meinem Glück nun genießen durfte.
Beide hatten auf ihre Weise recht, wie immer, doch während ich zuhörte, wie sie um meine Seele rangen, fragte ich mich, zu welchem Zweck ich eigentlich so aufwendig erzogen und ausgestattet wurde. Wenn mein Schicksal letztendlich nur war, einen Mann zu heiraten, den meine Eltern billigten (wenn sie ihn nicht gleich selbst für mich aussuchten), dienten meine teuren Kleider und meine humanistische Bildung dann lediglich dazu, meinen Wert auf dem Heiratsmarkt zu steigern? Vielleicht würde ich darunter zu leiden haben, höher geschätzt zu werden. Vielleicht würde ich als Prinzessin in einem diplomatischen Bündnis an den höchsten Bieter vergeben, wo noch vor einem Jahrzehnt sich unsere Schwestern einfach in Freunde der Familie verlieben konnten.
Es dauerte vier Monate, die Paläste für uns bereit zu machen, da sie in den Jahren ohne König so heruntergekommen waren. So wurde es April ’54, ehe wir endlich einzogen – die Frühlingsblumen entfalteten gerade ihre Pracht in den Beeten unter den Sprossenfenstern in meinem herrschaftlichen neuen Schlafzimmer. Auch wenn es mich zugleich ängstigte und verwirrte – ich schwelgte in all dem Aufregenden und Neuen. Andere waren nicht so leicht zu begeistern. Meine Großmutter, Vaters Mutter, die mit uns einzog, kommentierte unsere neue Vornehmheit mit skeptischem Zungenschnalzen: «So mancher wird uns dafür hassen», sagte sie wieder und wieder, «Olivers Freunde ebenso wie seine Feinde.» Doch da sie bereits auf die neunzig zuging, nahm ich an, der Irrsinn dieser gewaltigen Veränderungen sei einfach zu viel für sie. Sie starb wenige Monate später und wurde – gänzlich unpassend für sie – in der Westminster Abbey beigesetzt. Nicht einmal im Tod entkam sie dem schwindelerregenden Aufstieg ihres Sohnes.
Und Irrsinn ist in der Tat die einzig treffende Beschreibung dafür, wie unser Leben sich verändert hat. Mutter sagt zu mir, ich hätte nie normale Zeiten gekannt – früher einmal sei der trügerische Boden, auf dem ich laufen lernte, fest und sicher gewesen. Meine Normalität war für alle anderen eine auf den Kopf gestellte Welt. Und so wandte ich mich meinen Büchern zu, um in den Seiten der Vergangenheit nach Parallelen zu unseren außerordentlichen Zeiten zu suchen. Denn wenn es keine Präzedenzfälle gibt, wo sonst kann ich Orientierung finden? Es gibt keine Lehre in einer Zeit ohne Regeln, kein Lehrwerk für die Revolution.
Jeder Augenblick ist jetzt Geschichte.
Ein Scheit zischt im Kamin, als plötzlich Rufe und Schreie die nächtliche Stille zerreißen. Heftiges Klopfen an meiner Tür schreckt mich aus meinem Halbdämmer auf. Im nächsten Moment stürzen die Wachen in mein Zimmer und fallen fast übereinander in ihrer Hast, mein Bett zu erreichen. Durch die offene Tür sehe ich Fackeln durch die Luft schnellen, höre draußen auf dem Gang Leute rennen.
Instinktiv ziehe ich die Decke bis zum Kinn hoch, fühle den Pelz heiß und seidig an meiner Haut.
«Ihr müsst mit uns kommen, Euer Hoheit. Bitte kommt jetzt sofort.»
Angst beschleicht mich, wie Frost eine Landschaft überzieht. Ich klettere aus dem Bett, schlüpfe mit nackten Füßen in die Pantoffeln und werfe ein dickes Umschlagtuch über mein Nachthemd. Sie geleiten mich hastig aus dem Zimmer. Sofort werde ich von einem Strom anderer Gestalten in Nachthemden erfasst, die aus dem Schlaf gerissen wurden und durch die Gänge des Palastes eilen. Ich schaue mich um, suche nach Mary. Oder Elizabeth, Mutter, Vater. Doch ich kann niemanden aus meiner Familie entdecken, nur die vertrauten Gesichter von Höflingen, Dienerinnen und Amtsträgern, allesamt von der schnellen Strömung mitgerissen. Plötzlich findet meine Zofe Katherine meine Hand, und ich umklammere dankbar die ihre, die klein und immer warm ist. Die Wachen rufen, Kinder weinen, doch die meisten Leute drängen schweigend vorwärts, mit entschlossener Miene, als hätten sie nur einen einzigen Gedanken: hinaus aus dem Palast.
Plötzlich quellen wir aus dem Gebäude hervor, strömen in den Hof wie die Wasserstrahlen aus den Mäulern der bronzenen Fische im großen Springbrunnen von Hampton Court. Ich erwarte völlige Dunkelheit, doch stattdessen erhellt sich die Szene, als dämmerte bereits der Morgen. Die Palastdiener eilen umher und entzünden sämtliche Lampen und Fackeln an den umgebenden Mauern. Überall erwachen Kerzen und Laternen zum Leben, von Händen umklammert, und beleuchten angespannte Gesichter von unten. Eine einsame Amsel fängt auf dem Dach der großen Halle an zu singen, ihr lieblicher Gesang unheimlich im Mondschein.
Da entdecke ich Mutter und den Rest meiner Familie auf der anderen Seite des Hofes, umgeben von Vaters Leibgarde in ihrer grau-schwarzen Livree, unverkennbar, auch wenn ich nur ihre Rücken sehe. Beim Anblick von Vaters persönlichen Beschützern empfinde ich Erleichterung und dränge mich durch die Menge zu ihnen, gefolgt von Katherine.
«Mutter, was ist geschehen?»
«Frances, Gott sei Dank.» Sie erdrückt mich fast, ihre Brust ist weich in dem weiten weißen Nachthemd. «Wir wissen es nicht genau. Als sie zu uns hereinkamen, sagten sie, in der Kapelle sei eine Bombe entdeckt worden.»
Ich schaue mich nach der Kapelle um, doch natürlich verdeckt das hohe Dach der großen Halle die Sicht. Mir wird bewusst, dass sie uns in die der Kapelle entgegengesetzte Richtung aus dem Palast geführt haben, zu dem Tor beim Banqueting House.
«Ist Vater etwas zugestoßen?», fragt Mary mit zitternder Stimme. «Ist er in Sicherheit?»
«Euer Vater ist mit Sekretär Thurloe und Mitgliedern des Rates gegangen …» Mutter bricht ab und schaut geistesabwesend in die Runde.
Ich sammle meine wirren Gedanken. Dies war also nicht bloß ein Anschlag auf Vater – er wurde schon früher von Meuchelmördern bedroht. Nein, wenn eine Bombe in den Palast gelegt wurde, dann hätte sie jeden von uns töten können: meine Mutter, meine Schwestern, die Kinder. Ich weiß, dort draußen gibt es Männer, die meinen Vater hassen, auch wenn ich diese Vorstellung nicht in Einklang bringen kann mit dem liebenden Vater, den ich kenne. Doch ich habe nie daran gedacht, dass der Hass mancher sich auf seine ganze Familie erstreckt. Männer, die uns allen den Tod wünschen. Dieser Anschlag ist viel furchteinflößender als jede frühere Bedrohung, und ich fühle mein Herz hämmern, das Blut durch meine Adern strömen. Ich sehe die ängstlichen Gesichter meiner Familie und wünsche mir nicht zum ersten Mal, mein Bruder Henry wäre nicht in Irland. Er bewahrt in Krisen immer den kühlsten Kopf. So muss Vater als junger Mann gewesen sein. Da Henry nicht hier ist, wende ich mich stattdessen an Richard. «Wer hat das getan, Dick?»
Richard fährt sich mit einer Hand durch die sandfarbenen Locken. «Wahrscheinlich Royalisten. Sie verschwören sich immerfort gegen uns, schmieden Komplotte, um den Sohn des toten Königs zurückzuholen. Doch wir alle dachten, die Bedrohung werde vorübergehen. Wenn sie es waren, wird dieser Vorfall der Armee in die Hände spielen. Vater kann schwerlich die Herrschaft der Major Generals abschaffen, wenn die Royalisten sich wieder regen.»
«Ich habe gehört, es waren die Levellers», mischt Elizabeth sich ein. Ihre prächtigen kastanienbraunen Locken fallen offen über ihre Schultern. «Thurloe hat es zu Vater gesagt.»
«Nun, sie hassen Vater ebenso wie die Royalisten, jetzt, da er an der Macht ist.» Dick lächelt bitter. «Vielleicht noch mehr, so, wie es nur Leute vermögen, die einst für dieselbe Sache gekämpft haben. Nichts ist so bitter wie eine zerbrochene Freundschaft.»
Ihre Worte verunsichern mich zutiefst, sie zeichnen ein Bild von Feinden, die uns von allen Seiten umzingeln. Hatte Vater wirklich etwas so Schreckliches getan, dass es einen einstigen Freund zu einer solchen Tat bewegen würde? Dass einer, der Seite an Seite mit ihm in der Schlacht gekämpft hat, ihn jetzt im Schlaf ermorden will? Vater ist derselbe wie immer – wie kann man ihn jetzt als schlechten Menschen verurteilen, wenn man ihn zuvor für gut hielt? Und was ist mit mir? Bin ich auf Gedeih und Verderb von seinem Ruf abhängig, der doch auf schlammigen Schlachtfeldern Hunderte Meilen entfernt erworben wurde, als ich noch ein Kind war?
Ich schaue mich verwirrt um und sehe Leute mit ihren kostbarsten Besitztümern, die sie beim Aufbruch hastig an sich gerafft haben: Ein Höfling, dessen Strümpfe ihm bis auf die Fußknöchel hinunterrutschen, trägt eine silberne Uhr bei sich, eine Dame umklammert ihre Parfümschatulle. Ein Koch schwankt unter dem Gewicht eines großen Käses. Irgendwo weiter entfernt höre ich ein Kind weinen.
«Bestimmt sind es diese Quintomonarchisten, Sir», sagt Katherine, die vor lauter Angst ihre Stellung vergisst. Sie zieht ihr verblichenes braunes Tuch fester um sich, klemmt die Finger unter die Achseln. «Die, die sagen, Seine Hoheit müsse fort, damit das Reich Christi wiederkehren kann. Ein paar der Männer im Regiment meines armen William haben sich denen zugewandt. Habe ich gehört», fügt sie hastig hinzu, damit wir sie nicht etwa bezichtigen, mit solchen Irren Umgang zu pflegen. Ich weiß, sie denkt an ihren Mann, der auf dem Schlachtfeld von Marston Moor gefallen ist, nur ein paar Schritte von Vaters Pferd entfernt. Sie tastet nach meiner Hand, und ich ergreife die ihre wie immer.
«Sind es viele? Sind sie noch hier im Palast?» Ich schaue mich ängstlich um, rechne halb damit, Rufe und Schmerzensschreie zu hören. Kampflärm.
«Es sind Dutzende!» Mein jüngerer Neffe Henry, Elizabeths Sohn, zwängt sich mit dem Kopf zwischen uns, an das Nachthemd seiner Mutter geklammert. «Und einem wurde bei dem Kampf die Hand abgeschlagen!»
«Nicht die Hand, Dummkopf, das Bein.» Sein Bruder schubst ihn und schaut grinsend zu uns auf.
«Ich habe gehört, es war sein Kopf.» Elizabeth beugt sich zu ihnen hinunter, und sie kreischen begeistert und hüpfen von einem Bein aufs andere.
«Betty, bitte.» Mutters Stimme ist fest, und sie lächelt dankbar, als eine elegante, schwarz gewandete Gestalt sich nähert. John Thurloe, Sekretär des Staatsrats und – wie jeder weiß – Leiter von Vaters Geheimdienst.
Ich frage mich, wie es kommt, dass er im Gegensatz zu allen anderen vollständig bekleidet ist.
«Hoheit.» Er verbeugt sich vor Mutter. «Wollen wir Euch alle ins Warme bringen? In der Wachstube unter dem Chairhouse wäre es vielleicht am sichersten.»
Er nimmt Mutters Arm und geleitet uns über den Hof, so ruhig, als ginge es zu Tisch. Die Menge teilt sich, manche verbeugen sich oder knicksen, ehrerbietig selbst inmitten dieser nächtlichen Panik. Ich halte inne, um sie anzuschauen, doch Richard drängt mich weiter unter das große Holbeintor, und wir steigen die Steinstufen zur Wachstube hinauf.
Thurloe macht es uns so bequem, wie es in dem spartanischen Quartier möglich ist, postiert mehrere Soldaten der Hausgarde vor der Tür und schickt Katherine und unsere anderen Bediensteten zurück in unsere Gemächer, um uns Kleidung zu holen und unsere Sachen zu packen.
Thurloe schließt die Tür hinter ihnen, dann wirft er prüfende Blicke in die hintersten Winkel der Wachstube. Nachdem er sich vergewissert hat, dass wir allein sind, richtet er seine klaren, haselnussbraunen Augen auf meinen Bruder Richard als das älteste männliche Familienmitglied im Raum. «Hoheit», sagt er mit seiner gewohnt sanften, leisen Stimme, als könnte dieser ganze Tumult ihm nichts anhaben. «Ich schlage vor, Ihr bringt die Familie nach Hampton Court, sobald es hell genug ist. Heute ist schließlich Freitag, Ihr würdet die Reise also ohnehin unternehmen, und es kann nicht schaden, etwas früher als sonst aufzubrechen. Ich lasse die königliche Barkasse für Euch bereit machen und eine zusätzliche Abteilung der Leibgarde abstellen. Seine Hoheit wird später am Tag nachkommen, ich habe die Angelegenheit bereits mit ihm besprochen.»
Niemand stellt das in Frage. Wir alle wissen, im Notfall übernimmt Thurloe die Führung. Vater vertraut ihm mehr als jedem anderen.
Dann bleibt nichts weiter zu tun, als zu warten.
Ein paar Stunden später, als die Morgendämmerung die Wolken rosig färbt, steige ich in die Barkasse und lasse mich auf einer mit Kissen gepolsterten Bank nieder, eng an Mary geschmiegt, in drei Mäntel und eine weiche Wolldecke gehüllt. Die Schiffer stoßen uns von den Stufen der Anlegestelle ab und beginnen ihre rhythmischen Ruderschläge, senken mit dumpfem Klatschen die Ruderblätter in die Themse, die in tintendunklen Wellen um uns strömt. Wir sitzen schweigend. Den Kopf an Marys Schulter gelehnt, sehe ich den riesigen Palastkomplex aus meiner Sicht verschwinden. Die winzigen Gestalten der Wachen wimmeln wie Ameisen, die über verwitterte Grabsteine krabbeln.
Ich bedaure nicht, verfrüht nach Hampton Court zu kommen. Es ist mein liebster Ort auf der Welt, ein ländliches Paradies fernab der lärmigen Straßen Londons. Ich habe meine Kindheit unter dem weiten Himmel der Fens zugebracht. Das erklärt wohl, weshalb ich mich in Whitehall, inmitten des Lärms und der Gerüche der großen Stadt Westminster, stets nach dem ruhigen Fluss sehne, nach dem Kammergarten und dem endlos weiten Wildpark von Hampton Court. Unser Leben dort ist ein gänzlich anderes. Whitehall ist der Ort, wo Vater arbeitet – wo Staatsakte stattfinden und Zusammenkünfte mit dem Parlament, wo Gesandte ausländischer Fürsten empfangen werden und die vielen Ausschüsse tagen, welche das Tagesgeschäft der Nationen verwalten; Hampton Court hingegen ist unser Zuhause.
Nur hier, den Blicken der Öffentlichkeit entzogen, kann Vater seinen vornehmen Leidenschaften für Sport, Musik und klassische Bildhauerei frönen, Vorlieben, die seinen streng puritanischen, bibelversessenen Untertanen missfallen würden. Keiner von uns wird je vergessen, wie einmal ein bilderstürmerischer Quäker mit einem Hammer über Vaters Statue von Venus und Adonis herfiel, die er ein abscheuliches heidnisches Bildnis nannte. Vater selbst sah nachher stundenlang voller Besorgnis zu, wie die Hofsteinmetze ihr Bestes taten, um seine geliebte Statue wiederherzustellen, doch er bestand darauf, dass der Quäker mit einem Tadel davonkam: «Ich bestrafe niemanden dafür, dass er seinem Glauben folgt», erklärte er. «Sein Weg ist dem meinen gleichwertig.»
Und so übersiedeln wir am Ende einer jeden Woche nach Hampton Court, damit Vater sich hier entspannen kann, wo er nicht wie in Whitehall auf dem Präsentierteller sitzt. Selbstverständlich kommt der Hof mit uns – die täglichen Besprechungen und Regierungsgeschäfte müssen weitergehen. Aber unser Leben hier ist einfacher, weniger förmlich, Vater widmet sich der Jagd und Falknerei, und beim Abendessen erzählt er uns in fröhlicher Runde aus seinem reichen Geschichtenschatz. Elizabeth sagt, wir hätten etwas Neues erfunden, indem wir die Woche so aufteilen – in fünf Arbeitstage und zwei anschließende Ruhetage –, und andere hätten schon begonnen, es uns gleichzutun. Sie ist immer ganz entzückt, wenn wir eine neue Mode begründen.
Vater kommt später am Tag den Fluss herauf zu uns, wie Thurloe versprochen hat, allerdings bekomme ich ihn wider Erwarten nicht zu sehen. Er reitet nicht aus und kommt auch nicht in unsere gemeinsamen Räume, um mit uns zu essen und Mutter in die Arme zu schließen. Stattdessen zieht er sich ganz in sein Privatkabinett zurück, redet bis spät in die Nacht mit Thurloe und den etwa fünfzehn Mitgliedern des Staatsrats, lässt das Abendessen aus und schickt die Diener, mehr Kerzen zu holen. Selbst hier herrscht eine angespannte Atmosphäre, Gerüchte über die Verschwörer fliegen durch die Korridore und über die langen Esstische. Es hat Verhaftungen gegeben, und Thurloes Boten reisen flussauf und flussab zwischen Hampton Court und dem Tower of London hin und her, die Gesichter unter den breitkrempigen Hüten ernst, übergeben Briefe durch halb geöffnete Türen und nehmen andere entgegen.
Mutter zieht sich früh zurück, da sie Kopfschmerzen hat, und ich folge ihr, klettere zu ihr ins Bett, in meiner Angst wieder ein Kind. Sie flüstert tröstliche Worte in mein Haar, bis mein Herzschlag sich beruhigt und ich einschlafe. Als ich bei Tagesanbruch dort wieder erwache, frage ich mich, ob Vater in dem großen Prunkbett im Staatsgemach geschlafen hat, als er sein eigenes Bett besetzt fand, oder ob er überhaupt schlafen gegangen ist. Ein paar Minuten liege ich da, gleite aus meinen verworrenen Träumen in die Ungewissheit eines neuen Tages hinüber. Als blasses Sonnenlicht sich durch die Ritzen der gelben Vorhänge stiehlt, verfestigt sich meine Entschlossenheit. Ich muss mich sofort mit Mary beraten.
Ich gehe aus dem Schlafzimmer meiner Eltern geradewegs in Marys Zimmer, husche eilig über die lange Galerie, frage mich beiläufig, ob Katherine sich Sorgen machen wird, wenn sie mich wecken kommt und mein Bett unberührt vorfindet. Mary schläft noch, und in ihrem Zimmer ist es stockduster – ihre Zofe Anne ist keine solche Frühaufsteherin wie Katherine. Ich ziehe die Vorhänge ein wenig auseinander, genug, dass der Raum sanft erhellt wird, und gehe um das Bett herum, bis ich neben Marys Kopf stehe. Ihre dunklen Locken, wirr vom Schlaf, regen sich auf dem Kissen.
«Mary, wir müssen unser Leben selbst in die Hand nehmen», sage ich schlicht und sachlich.
«Hmmm?» Sie hält die Augen geschlossen.
«Wir müssen anfangen, unser eigenes Leben zu leben. Heute.»
«Wie spät ist es?» Mary dreht sich von mir weg und vergräbt das Gesicht im Kissen.
«An der Zeit, dass wir uns über einiges klarwerden.» Ich gehe jetzt auf und ab, erwärme mich für mein Thema, während meine bloßen Füße die Morgenkälte fühlen. «Wir wissen nun, dass wir jederzeit im Schlaf ermordet werden könnten. Und sollte Vater König werden, wird die Gefahr nur noch größer. Wenn von uns erwartet wird, mit solchen Risiken zu leben, dann finde ich es nur gerecht, dass wir im Gegenzug auch etwas bekommen – mehr Mitbestimmung über unsere Zukunft.»
Nun gibt Mary es auf, weiterschlafen zu wollen. Sie dreht sich zu mir herum, schaut mich aus müden grauen Augen an und stützt sich auf die Ellenbogen. «Bitte sprich nicht davon, dass man uns im Schlaf ermorden könnte, ich habe schon genug Angst.»
«Es tut mir leid.» Ich nehme ihre Hand und küsse sie, dann verbeuge ich mich tief vor ihr, mime einen verliebten Höfling. Obwohl ich die Jüngere bin, übernehme ich immer den Part des Mannes, wenn wir unsere romantischen Phantasien inszenieren. Sie rückt im Bett zur Seite, und ich setze mich neben sie, lege einen Arm um ihre Schultern und lehne mich an das geschnitzte Kopfteil aus Eichenholz.
«Denke an die klügsten, vortrefflichsten Damen am Hof», fahre ich fort, Marys Kopf schwer auf meiner Schulter. «Diejenigen, die sich im Krieg bewiesen haben – ihr Zuhause gegen Belagerer verteidigt, während ihre Männer fort waren, Dinge in die Hand genommen, ihre Familien beschützt. Denke an Bridget, die gemeinsam mit Henry Ireton und Vater an den Bedingungen für einen Friedensschluss gearbeitet hat, den die Armee dem König stellte. Ich weiß, dass sie daran beteiligt war, sie hat es mir oft genug erzählt, wenn sie mir Müßiggang vorwarf. Sie war dabei, als sie hier in Hampton Court dem König die Bedingungen vorlegten – sie ist ihm begegnet, hat zweimal mit ihm gespeist, kannst du dir das vorstellen? Und nicht nur Frauen von unserem Stand wurden durch den Krieg selbständiger und nahmen mehr Dinge in die Hand. Denke an die einfachen Frauen dort draußen in der Stadt – die Predigerinnen und Druckerinnen, die Frauen der Levellers mit ihren Petitionen. Sie sitzen nicht den ganzen Tag herum, nähen und warten darauf, dass ein Mann für sie das Wort ergreift. Weshalb sollte das unser Schicksal sein?»
«Ich sehe dich schon vor mir, Fanny, wie du am St. Paul’s Cross mit den anderen Quäkern flammende Predigten hältst.»
Mary kichert, und ich versetze ihr einen Stoß in die Rippen.
«Ich sage nicht, dass ich irgendwem predigen will, Mall», entgegne ich und nenne sie damit nun ebenfalls bei ihrem Spitznamen. Mir ist sehr wohl bewusst, wie pathetisch ich klingen muss, ich rede schon wie die Ranters. «Ich weiß nicht, was ich will … Aber ich weiß, dass wir überhaupt nichts mehr selbst zu entscheiden haben, wenn wir mit irgendeinem reichen Witwer oder einem ausländischen Herzog verheiratet werden, der uns zu seinen übrigen Schätzen in die Vitrine stellen will. Wenn wir Vaters Eheanbahnung zuvorkommen und unsere Partner selbst wählen, können wir auf unsere Weise nach Erfüllung streben.»
Als Mary schweigt, wandern meine Gedanken zu unseren älteren Schwestern, die stets den Maßstab setzen. «Betty war siebzehn, als sie John heiratete – ein volles Jahr jünger als ich.»
Mary schürzt die Lippen, und ich sehe ihr an, dass sie im Kopf rechnet. «Ja – aber Biddy war zwei Jahre älter, als ich jetzt bin, weißt du noch? Sie war einundzwanzig, als sie Henry heiratete, und siebenundzwanzig, als sie die Ehe mit Charles einging.»
«Das zählt nicht.» Ich schüttle den Kopf. «Bridget ist ein Fall für sich – wahrscheinlich konnte Vater sie nicht eher unter die Haube bringen.»
Mary gibt mir in gespielter Missbilligung einen Klaps aufs Handgelenk.
«Ohnehin war das vor zehn Jahren, vor all dem hier.» Ich deute auf das herrschaftliche Gemach, die seidenen Wandteppiche, nunmehr glänzend in der Morgensonne, die über dem großen Wildpark aufgeht. «Jetzt ist unsere Zeit.»
Nachdem ich mir das einmal in den Kopf gesetzt habe, werde ich den Gedanken nicht mehr los. Es erscheint mir so klar, dass die Antwort auf Angst Liebe sein muss, dass man sich gegen den Tod am besten wehrt, indem man das Leben jeden Tag bis zur Neige auskostet. Mary mag das bezweifeln, aber ich weiß, Vater würde mir zustimmen. Niemand schätzt die Liebe in jeglicher Form höher als er – die Liebe zu Frau und Kindern, zu Verwandten, zu Freunden und Waffenbrüdern –, auch wenn er mir natürlich zureden würde, in alledem die Liebe zu Gott zu suchen.
Mit diesem Gedanken im Kopf mache ich mich später am Vormittag mit Katherine auf die Suche nach unserem Kaplan Jeremiah White. Er ist ein junger, eifriger Mann und weit anziehender als die meisten Gottesmänner. Wo andere schlurfend wie Büßer mit Gott gehen, springt Jeremiah behände neben Ihm her wie ein Tanzmeister. Gerade diese Freude an seinem Glauben, dieses heitere Gemüt schätzt Vater an ihm. Für Vater zählt die Leidenschaft eines Menschen für Jesus weit mehr als die Art und Weise, wie er Ihn verehrt – wie sonst könnte er sowohl ehemalige Erzbischöfe als auch abtrünnige Quäker zu seinen Freunden zählen, mit dem einen wie dem anderen bei einem Glas Wein angeregte Diskussionen führen, manchmal am selben Abend?
Ich finde Jeremiah in der großen Halle vor, wo er die Probe der Sängerknaben anhört. Um ihn herum räumen Diener die Überreste des Frühstücks von den Tischen. Die hellen Soprane der Knaben lassen mich an der Tür innehalten, und auch ich lausche mit großem Vergnügen ihrem Klang. Dabei schaue ich an den mit Hirschköpfen verzierten Wänden hinauf zu den Balken des Deckengewölbes, als könnte ich die Stimmen sehen, wie sie in dem riesigen Raum über unseren Köpfen auf- und absteigen. Sie beenden eben eine Motette, und John Hingston, Vaters Master of Music, spielt einen Akkord auf der Orgel, um ihre Tonlage zu überprüfen. Während er sich umdreht, um die Knaben anzureden, wirft er mir einen Blick zu und winkt; Mary und ich nehmen wöchentlich Gesangsstunden bei ihm, und wir haben uns mittlerweile gut angefreundet.