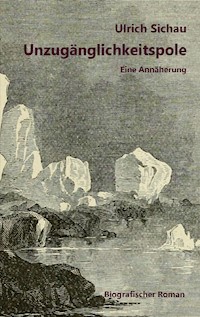Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Nationalsozialismus in Deutschland: Ein junges Mädchen, das in diese Zeit hineingeboren wird und - ob es will oder nicht - während dieser furchtbaren Kriegsdiktatur seine Kindheit und Jugend erlebt. Das Mädchen wird zur jungen Frau, die gezwungen ist, ihre Träume auszublenden, hinten anzustellen und die Widrigkeiten dieser Zeit zu überstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Mutter und ihre Träume, die sie nur träumen konnte, und für meinen Großvater, der viel zu früh gestorben ist und den ich gerne kennengelernt hätte.
Cover-Gestaltung:
Ulrich Sichau
Cover-Foto: Margarete Sichau, geb. Hellmann (*1925 2018), Familienarchiv
Hintergrundfoto: © Stadtarchiv Worms Abt. Füller Nr. M01026_2, Fotograf: Curt Füller
Vorwort
Die 12 Jahre des Nationalsozialismus, die Zeit der deutschen faschistischen Diktatur: Wer von uns heute hätte gern in dieser Zeit leben wollen?
Und doch gab es Menschen, die wurden ungefragt in diese Zeit hineingeboren. Sie lebten und gestalteten ihren Alltag. Sie mussten diese Zeit aushalten und ertragen und bestenfalls überleben.
Dieser Roman ist der Versuch, die Schicksale einiger Menschen in dieser Zeit zu beschreiben. Es geht um meine Mutter und ihre Eltern, meinen Großvater Jakob und meine Großmutter Helene, und die Brüder meiner Mutter Heiner und Hans.
Ich erzähle diese fiktive Geschichte auf der Grundlage von Dokumenten, Fotos und erzählten Überlieferungen, wie beispielsweise den Lebenserinnerungen meiner Mutter, die sie anlässlich ihres 90. Geburtstags aufgeschrieben hatte. Diese Erinnerungen hielten nicht immer den historischen Tatsachen stand. So brachte meine Mutter den Film „Jud Süß“ (1940) und die Reichspogromnacht (1938) miteinander in Verbindung, was offensichtlich nicht plausibel ist. Auch ihre Erzählung, man hätte sich vor der Mitgliedschaft in der Hitlerjugend oder im Bund Deutscher Mädchen „drücken“ können, musste ich zumindest in Frage stellen, da spätestens seit 1936 eine Zwangsmitgliedschaft für diese Jugendverbände bestand.
Unabhängig von diesen historischen Fakten ging es mir vor allem darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie das Leben meiner nahen Verwandten in dieser Zeit der Unfreiheit, Repression und Angst wohl ausgesehen haben könnte. Mit meiner eigenen Fantasie habe ich mich gefragt, welche Träume diese Menschen vielleicht hatten und wie viele dieser Träume für immer zerstört wurden, weil die Diktatur und der barbarische Krieg der Nationalsozialisten diese Menschen daran hinderten, ihre Lebenswünsche zu realisieren. Ich hoffe, dass solche Zeiten nie wieder anbrechen werden.
Februar, 2024
Inhalt
Margarete auf der Straße
Im kleinen Haus
Jakob im Dorf
Oktober-Sonntag
Die Lederfabrik
Kerzen und Fackeln
Große Bühne
Theatermann
Allein in der Stube
Lärm
Im Schatten
Entbehrungen
Kleiner Mensch
Abgrund
Kinderfrau
Der Mob
Sackgasse
Der Krieg
Auf dem Präsentierteller
Helene
Margarete in der Stadt
Erste Liebe
Getrennt
Glück im Unglück
Das Ende des Krieges
Heimkehrer
Margarete auf der Straße
Es ärgerte sie. Sie verstand es nicht. Es machte ihr Angst. Was hatte sie ihnen getan? Nicht nur einmal, immer wieder liefen sie hinter ihr her. Ob sie zum Bäcker ging oder gerade vom Metzger kam, selbst wenn sie auf dem Nachhauseweg von der Schule war, sie verfolgten sie, in gebührendem Abstand, aber sie riefen es laut und deutlich über die Straße. Jeder konnte es hören: “Dichtergöre! Dichtergöre!“ Sie lachten dabei, zeigten ihr die langen Nasen, machten mit ihren Händen wackelnde Eselsohren an ihren Köpfen. Sie ließen sie nicht in Ruhe.
Sie wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. War das ein Schimpfwort, das sie noch nicht kannte? Sie ahnte nur, dass die anderen sie ärgern wollten. Sie war erst sieben Jahre alt. Sie sollte erst viel später dahinterkommen, was mit diesen Rufen gemeint war. Hätte sie verstanden, warum die Buben ihr das zuriefen, hätte sie sogar fast ein wenig stolz darauf sein können.
So aber beschleunigte sie ihren Schritt, klammerte die Einkaufstasche fester in ihren Arm oder zog den Schulranzen noch enger an ihren Rücken. Die Mutter wartete zu Hause mit dem Essen.
Sie hatte ihr schon ein paar Mal davon erzählt, wie sie gehänselt wurde, was die Buben hinausposaunten auf der Straße und dass sie immer öfter hinter ihr her waren. Die Mutter hatte streng geschaut, die Stirn in Falten gelegt, jedoch nicht viel dazu gesagt. Geh mit deinem Bruder von der Schule nach Hause, dann passiert dir das nicht, meinte sie knapp. Ihrem Bruder war sie peinlich, das wusste sie, sie als Mädchen kam für ihn nicht in Frage. Der schloss sich lieber seinen Freunden an. Seiner großen Schwester Begleitschutz zu geben, das wäre ihm nie in den Sinn gekommen.
Jetzt waren sie verschwunden, die Schreihälse, waren rechts und links abgebogen in ihre Straßen und Gassen, zu ihren Häusern. Margarete konnte ausatmen und den Schritt verlangsamen. Sie hatte es nämlich in Wirklichkeit nicht eilig, nach Hause zu kommen. Wenn es Vater schlecht ging, lag er in seinem Bett im Schlafzimmer. Und dann mussten sie leise sein, sie und ihr Bruder. Das gefiel ihr nicht. Sie konnte nicht rennen, sich verstecken oder Lieder singen, die sie gerade in der Schule gelernt hatte. Heiner, ihr Bruder, verzog sich meist auf den Bolzplatz, traf sich mit seinen Kumpels. Sie musste zu Hause bleiben, am Küchentisch die Hausaufgaben erledigen und danach der Mutter im Haushalt helfen, sie war die Große und Vernünftige. Und sie musste still sein, wenn der Vater schlief.
Es war Sommer 1932 und es war ganz bestimmt kein Fasching mehr. Doch überall an der langen Hauptstraße im Ort hingen die Fähnchen aus den Fenstern, steckten in den Fensterläden. An manchen Häusern waren sogar richtig große Fahnen angebracht. Das merkwürdige schwarze Kreuz im weißen Kreis und mit kräftig roter Farbe eingerahmt, das flatterte jetzt im ganzen Dorf. Und schon oft war Margarete auf die Straße gesprungen, wenn die Lautsprecherwagen durch den Ort fuhren, begleitet von streng und entschlossen dreinblickenden Uniformierten, die vor und hinter dem Auto marschierten. Aus den Lautsprechern tönte Marschmusik, Getöse und gebrüllte Parolen, die Margarete nicht verstand, weil sie sich die Ohren zuhielt. Es wird Wahlen geben, hatte die Mutter ihr erklärt. Aber warum waren alle so laut und warum schrien die Uniformierten und streckten ihre Arme in die Luft? Sie verstand es nicht, sie war noch zu klein dafür.
Dem Vater gefiel das alles nicht. Man könne nicht mehr sagen, was man denkt, behauptete er. Er war nicht mehr so fröhlich wie früher. Aber vielleicht war das nur die Krankheit, die ihn plagte.
Margarete war jetzt in ihrer Gasse, die Hausnummer vier glänzte an der Wand des kleinen Häuschens, das die Eltern gekauft hatten. Das schwere Tor in den Hof musste sie mit aller Kraft öffnen. Sie fühlte sich wohl in diesem Haus. Alles roch noch neu nach Farbe. Es war gemütlich. Im kleinen Hof, eingerahmt von schützenden Mauern, konnte sie spielen. Hinten hatte die Mutter einen kleinen Garten angelegt. Im eingezäunten Stall sprangen ein halbes Dutzend Hühner und in den Käfigen mümmelten zwei, manchmal sogar drei Hasen. Meist war es ihre Aufgabe, sie zu füttern, denn Heiner war viel unterwegs auf dem Sportplatz und bei den Freunden.
Die erste Frage an die Mutter war immer: Ist Papa zu Hause? Seit sie etwas größer war und jetzt schon im zweiten Jahr zur Schule ging, wusste sie, dass davon der ganze Nachmittag abhing. Denn wenn Vater zu Hause war und schlief, dann ging es ihm nicht gut, dann musste sie still sein. Sie mochte ihren Vater, die Mutter hatte ihr erklärt, dass er krank war, dass er einen Unfall und seitdem immer wieder Schmerzen hatte. Aber manchmal vergaß Margarete das und hüpfte im Hof oder sang ein gerade gelerntes Lied. Dann war sofort die Mutter hinter ihr und schimpfte, streng und böse. Sie versprach, nie wieder laut zu sein und den Vater in Ruhe zu lassen.
Heute war Vater bei der Arbeit. Margarete war froh, auch weil das hieß, dass es ihm gerade gut ging. Sie erzählte nichts von den Rufen der Buben auf der Straße. Außer strengen Sorgenfalten auf der Stirn der Mutter wäre ohnehin nichts passiert. Für heute hatte sie die Angelegenheit für sich abgehakt.
Im kleinen Haus I mmkklleeiinneenn HHaauuss
Margarete liebte das kleine Häuschen, in das die Familie erst vor kurzem eingezogen war. Als die Eltern das Haus gekauft hatten, nahm der Vater sie mit in die leeren Räume. Er gab dem Malermeister Anordnungen, was zu reparieren und zu renovieren war. Sie sprang, während die Männer sich unterhielten, in den Hof und wühlte in der Erde im Garten.
Jetzt wohnten sie schon eine ganze Weile im neuen Zuhause. Die Schlafzimmer waren oben, das Elternschlafzimmer und das Zimmer, in dem sie mit ihrem Bruder Heiner schlief, unten die kleine Küche und das Wohnzimmer. Der Vater hatte dort seine Bücher im Schrank. Seit Margarete zur Schule ging und angefangen hatte, sich für diese rätselhaften Buchstaben zu interessieren, stöberte sie in den dicken und schweren Bänden hinter den Glastüren. Sie schlug die Seiten auf, suchte Bilder und begann die Texte, die dazugehörten, zu lesen. Über die Abenteuer von Max und Moritz las sie und später, als es nicht mehr nur Bilder sein mussten und die reinen Buchstaben ihr reichten, wagte sie sich an noch aufregendere Geschichten von Cowboys und Indianern heran, die Karl May aufgeschrieben hatte, als wäre er selbst in dieser wilden Welt dabei gewesen.
Sie saß dann im Wohnzimmer mit dem Buch auf dem großen Tisch. Wenn die Mutter gerade nichts für sie zu tun hatte, ließ sie Margret in Ruhe. Der Vater, der am Abend nach Hause kam, strich ihr übers Haar und lächelte, weil sie las. Ganz zu Beginn hatte er aber auch auf die Schublade im Schrank gezeigt und sie geöffnet. Sie war voller Papiere, beschriebenen Seiten und großen Schulheften. Sie erkannte die Handschrift ihres Vaters. Diese Geschichten lässt du in Ruhe, meinte er sehr ernst. Das sind meine Geschichten, ganz neu und vieles noch nicht zu Ende erzählt. Wenn ich so weit bin, lese ich dir daraus vor.
Margarete versprach, die Schublade nicht anzurühren. Sie hielt sich daran, lange Zeit, erst als sie viel älter war und sich sonst niemand mehr um die vielen beschriebenen Seiten kümmerte, schaute sie nach und verschlang alles, was ihr Vater aufgeschrieben hatte.
In ihrem zweiten Schuljahr hatte Margarete große Fortschritte in der Schule gemacht. Die Lehrer waren zufrieden mit ihr. Sie lernte schnell, konnte flüssig vor der Klasse vorlesen. Alle Lieder und Gedichte konnte sie nach einem Tag auswendig. Sie sagte sie ihrer Mutter auf und abends dem Vater, der lachend applaudierte. Heiner, ihr Bruder, verzog sich dann immer in den Hof. Er war gerade mal ein Jahr jünger als sie. Er konnte mit dem Ehrgeiz seiner Schwester nichts anfangen.
Am Abend saß der Vater am großen Tisch im Wohnzimmer, seine Schublade stand offen und einzelne Blätter lagen auf dem dunklen Holz, die Tischdecke hatte der Vater entfernt. Er schrieb mit dem Bleistift, radierte, strich bereits Geschriebenes durch und schrieb wieder neu. Er dachte nach, schaute an die Decke und aus dem Fenster auf die Straße, als könne er da neue Gedanken einfangen und sie auf dem Papier festhalten.
Für Margarete war das alles sehr geheimnisvoll. Sie saß in der Ecke am Boden und traute sich nicht, ein Geräusch zu machen. Der Vater könnte sie bemerken und ihm würde einfallen, dass seine Tochter längst im Bett sein müsste. Auch wenn sie nicht genau wusste, was der Vater tat, so war sie doch ziemlich sicher, dass es etwas sehr Wichtiges und Bedeutendes sein musste, wenn er sich am Abend nach der harten Arbeit in der Fabrik hinsetzte und Papiere von vorn und hinten beschrieb.
Diese geheimnisvollen Momente beendete die Mutter immer zu früh. Sie hatte ihre Tochter in der Ecke entdeckt, nahm sie still bei der Hand und schickte sie nach oben ins Bett zum Schlafen. Auch ihre Mutter wollte nicht stören, sie wusste Bescheid über das, was der Vater da schrieb.
Am Morgen traf sich Margarete mit ihren Freundinnen an der Ecke. Zusammen gingen sie über die leeren Straßen zur Schule. Manchmal ratterte ein alter Lieferwagen durchs Dorf und zwang sie, auf die Seite auszuweichen. Die Mädchen erzählten sich ihre Geschichten, so viel war schon wieder passiert seit gestern. Liese hatte zuhause Radio gehört, nein, nicht Musik, sie erzählte von einem Boxkampf, den ein Deutscher gewonnen hätte, in Amerika sei das gewesen. Ihr Vater sei stolz gewesen. Katharine hatte ihren Vater bewundert, der am Abend seine neue Uniform angezogen und vorgeführt hatte, braun wie die Haselnuss und mit roter Armbinde und dem komischen Kreuz. Zu einer Versammlung ins Wirtshaus sei er gegangen, und er hatte gesagt, dass sich bald alles ändern würde.
Margarete konnte bei den Sensationen der Freundinnen kaum mithalten. Was wäre an ihrem schreibenden Vater auch besonders gewesen? Von ihren Hasen konnte sie berichten und dass sie traurig sei, weil ihr Vater angedeutet hatte, dass der dicke Moppel wohl bald geschlachtet werden sollte. Darfst du dabei zugucken, fragten die Mädchen.
Dann saßen sie in ihren Bänken, riefen im Chor ihren Morgengruß dem Lehrer entgegen. Sie rechneten und schrieben und hörten Geschichten von Rittern und versunkenen Schätzen und Heldentaten. In der großen Stadt Worms, gleich neben ihrem Dorf, dort, wo auch der Vater arbeitete, hätten die Nibelungen gewohnt mit ihrem ganzen Hofstaat. Dort hätten sich Kaiser und Könige zusammengefunden und die wichtigsten Entscheidungen für Deutschland getroffen und darauf könnten sie alle sehr, sehr stolz sein.
Und alles sogen sie auf, die Mädchen und die Jungen, mit offenen Mündern und spitzen Ohren. Margarete konnte gar nicht genug kriegen von diesen Geschichten, weil alles neu und mehr war als das kleine Dorf, in dem sie lebte, weil die Welt so groß war. Und sie wollte alles von ihr wissen.
Jakob im Dorf
Nach Jakob schauten sich die Leute um, er war ein attraktiver Mann, jung, schlank, volles Haar und ein markantes, freundliches Gesicht. Er war im Sommer dreißig Jahre alt geworden und hatte längst eine Familie gegründet, mit der er sich im Dorf eingerichtet hatte. Zwei Häuser neben seinem Elternhaus hatte er ein eigenes kleines Häuschen gekauft. Er konnte sich nun auch um seine Mutter kümmern, denn sie war allein. Ihr Mann, Jakobs Vater, war früh gestorben, der Sohn kannte ihn nur aus Erzählungen.
Er konnte glücklich sein mit seiner Familie. Seine Tochter Margarete ging schon in die zweite Klasse und war zuhause eine große Hilfe. Sein Sohn Heiner war gerade eingeschult worden. Sie waren aus dem Gröbsten raus in diesen schwierigen Zeiten. Gott sei Dank, er hatte Arbeit, einen sicheren Arbeitsplatz in der großen Lederfabrik in Worms. Dorthin fuhr er jeden Morgen mit dem Fahrrad. Im Rest der Republik stöhnte man über Arbeitslosigkeit, doch hier in Worms hatten sie es gut.
Wenn Jakob durchs Dorf ging, zum Sportplatz, zur Kirche am Sonntag, zum Wirtshaus, kam er meist nicht weit. Sie kannten ihn, den jungen Hellmann. Er grüßte in alle Richtungen und er wurde gegrüßt.
Wenn er Zeit hatte – und meistens nahm er sich die Zeit – dann blieb er stehen. An einem Tor zu einem Haus, an der Straßenecke oder neben der Fußballwiese. Er hörte sich an, was es Neues gab, wo Nachwuchs eingetroffen war, ob jemand wieder Arbeit gefunden hatte. Der Bäcker, der Metzger und die Handwerker im Ort, sie jammerten über ihre Geschäfte, die Leute hätten kein Geld und sie würden nicht kaufen. Und doch wusste Jakob, dass das nur die halbe Wahrheit war. Sie hatten alle ihre Preise in den letzten Jahren erhöht und eigentlich ging es ihnen ganz gut.
Sie mochten Jakob. Er tat etwas im Dorf, er sorgte sich um die Gemeinschaft. Er redete nicht nur, sondern er packte zu. Aber alle waren auch auf der Hut, denn Jakob war anders als sie. Er schrieb Dinge auf, die er gehört hatte, machte sich Gedanken, er produzierte Gereimtes daraus. Und spätestens an Fasching, wenn die große Prunksitzung im Saal stattfand, stand der Jakob vorne am Rednerpult, als rot-weißer Clown verkleidet, und ließ seine Spottgedichte über einen niederprasseln. Es konnte jeden treffen, die Honoratioren, die Ladenbesitzer oder die kleinen und großen Handwerker im Dorf. Jakob war in dieser Beziehung ungnädig. Alles, was er im Laufe des Jahres in leutseligen Runden aufgeschnappt hatte, formte er in spitze Reime und präsentierte sie an Fasching in aller Öffentlichkeit. Manchmal kamen die Dorfbewohner schon vor der Faschingssitzung auf ihn zu und fragten ihn: Hast du was über mich in diesem Jahr? Auch nach der Sitzung kamen sie, wenn Jakob über sie gespottet hatte, und riefen ihm verärgert zu, sie würden nie mehr mit ihm reden. Diesen Vorsatz vergaßen sie aber meist wieder im Lauf des nächsten Jahres.
Sie respektierten Jakob, weil er keine Grenzen überschritt, nie Menschen verletzte. Unbestreitbar war das witzig, was er da vortrug in der Prunksitzung. Viele, die ihn kannten, wussten, was er abends in seinem Wohnzimmer am großen, dunklen Holztisch aufschrieb. Manche nannten ihn den Dichter, wenn sie mit anderen über Jakob sprachen und zwinkerten dabei und lachten verschmitzt. Es Jakob selbst ins Gesicht zu sagen, traute sich keiner.
Als Dorfdichter und Familienvater hatte sich Jakob seit Jahren Respekt verschafft. Und doch wurden die Gespräche mit den Nachbarn schwieriger. Die große Politik machte auch vor dem Dorf nicht Halt. Eine Regierungskrise in Berlin jagte die nächste, fast jedes halbe Jahr fand eine neue Wahl zum Reichstag statt und die Reichskanzler wurden ausgetauscht wie verdorbene Ware. Rote Fahnen mit Hammer und Sichel und vermehrt die Hakenkreuzfahnen der NSDAP flatterten an den Häusern ihres kleinen, unscheinbaren Dorfes.
Wenn Jakob jetzt durch die Straßen ging, sah er Nachbarn in der braunen Uniform, die sich abwendeten, wenn sie ihn sahen, immer weniger wollten mit ihm reden. Er verstand das Getöse nicht, das mit Lautsprecherwagen und marschierenden Trupps auf den Plätzen und Straßen veranstaltet wurde. Jakob gehörte zu keiner Partei. Er war Arbeiter und er sympathisierte mit denen, die sich um die Arbeiter kümmerten. Was sollte er sonst tun? Die NSDAP und ihre Aufmärsche machten ihm Sorgen. Sie hatten im Sommer gute Ergebnisse bei den Wahlen erzielt, aber es gab auch andere starke Parteien. Im Frühjahr hatten alle den Hindenburg wiedergewählt, Hitler war glatt durchgefallen, so hatte Jakob seine Sorgen beruhigt.
Er bedauerte die Veränderungen im Dorfleben. Wohin sollte das alles noch führen? Er hätte es gern gehabt wie früher, als jeder mit jedem reden und sich dabei ehrlich in die Augen sehen konnte.
So war es nicht mehr und auch weil es Herbst war und bald Winter wurde, verbrachte Jakob immer mehr seiner Abende im Wohnzimmer, schrieb sich die Finger wund und dachte nicht so sehr an die Zukunft. Vielleicht würde das neue Jahr die Normalität zurückbringen.
Oktober-Sonntag
Vater ging es gut. Wenn es so war, war Margarete erleichtert. Dann nahm er sich Zeit, spielte mit Heiner im Hof Fußball und schaute in Margaretes Schulhefte, um zu sehen, was sie im Unterricht lernte.
Mutter hatte schon die Brote und die Trinkflaschen im kleinen Rucksack verstaut. Es war Sonntag und heute wollten sie zusammen zum Rhein, an das Ufer des breiten Stroms und die Schiffe beobachten. Das Wetter war gut. Man spürte den nahenden Herbst, doch es versprach ein sonniger Tag zu werden.
Es sollte eine Wanderung werden heute. Im Sommer waren sie oft mit dem Fahrrad gefahren, in die Pfalz und an den Isenachweiher. Der Weiher war erfrischend gewesen, doch mit ihrem Kinderfahrrad kam Margarete nicht gut zurecht. Es hatte keinen Rücktritt und keine Bremse und sie musste sich sehr anstrengen, es zum Halten zu bringen. Einmal war sie böse gestürzt und hatte sich den Arm aufgeschürft.
Der Vater hatte den Rucksack geschultert. Margarete trug ihre kleine Umhängetasche, in der sie zwei Äpfel verstaut hatte. Sie freute sich schon auf die Rast am Rhein und ihr gemütliches Familienpicknick.
Raus aus dem Ort, sie überquerten die Hauptstraße und liefen zwischen den niedrigen Häusern und ihren schweren Hoftoren, bogen mal rechts und wieder links ab, um endlich die Ortsgrenze zu erreichen. Die Nachbarn, die aus den Fenstern schauten oder am Tor vor ihrem Haus standen grüßten die Familie, wo geht es hin, fragten sie, sie verwickelten den Vater in ein kurzes Gespräch oder riefen ihm lachend eine knappe Bemerkung zu. Margarete konnte sich keinen Reim machen, aus dem, was sie da riefen.
Nach den Häusern des Dorfs, auf den ersten Wiesen mit freiem Blick konnten sie den großen Dom sehen, der die Stadt Worms überragte. Sie würden nicht durch die Stadt gehen, das hatte der Vater beschlossen. Einfach unserem Eisbach folgen, hatte er Heiner und Margarete erklärt, der mündet direkt in den Rhein und da wollen wir doch hin. Margarete kannte den schmalen Bach, der durch ihren Ort floss, doch sie war ihm noch nie bis zur Mündung gefolgt.
Sie und Heiner liefen voraus, rannten, hielten nach Vögeln und Käfern Ausschau und warteten dann wieder auf ihre Eltern. Sie bekamen nicht mit, was die beiden redeten. Bestimmt ging es wieder um das liebe Geld, das am Ende des Monats immer zu knapp war. Der Vater verdiente, doch sie mussten das neue Haus noch abbezahlen, so hatte es die Mutter ihren Kindern gesagt. Margarete fühlte sich nicht arm, sie hatte saubere und hübsche Kleider, manches nähte die Mutter selbst und auch Heiner war angezogen wie die anderen Jungs. Es gab genug zu essen und jeder von den Kindern hatte sein eigenes Bett. Doch am Ende des Monats, wenn die Mutter Margarete zum Bäcker oder Metzger schickte, dann zählte sie ganz genau die Groschen ab, die die Tochter ausgeben durfte.
Von den Geldsorgen wollte Margarete heute nichts wissen, auch nicht vom Nachbarn in der braunen Uniform, der alle Kinder so streng zurechtwies und sie von der Straße vertrieb, wenn sie dort spielten. Margarete hatte gerade den Namen gehört, als die Mutter ernst mit dem Vater sprach.
Nach den Häusern ging es durch die Felder, die alle längst abgeerntet waren, vorbei an der Rohrlache, wo man von weitem sehen konnte, wie immer mehr kleine Häuschen aus dem Boden wuchsen. Der Vater hatte erzählt, dass dort bald viele Menschen wohnen würden, die sich sonst keine Wohnung leisten konnten.