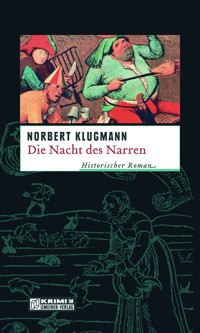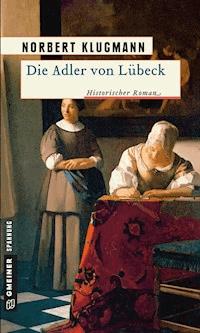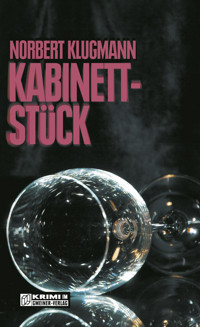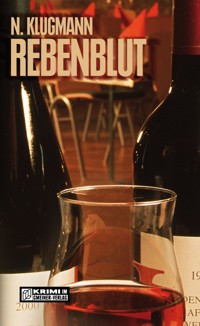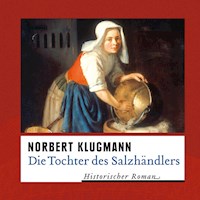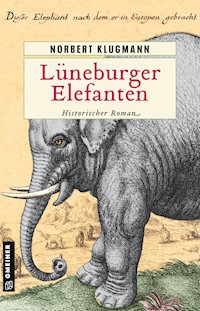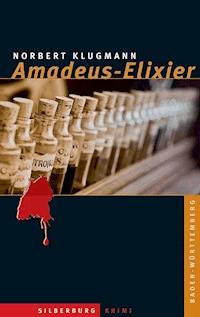Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Trine Deichmann
- Sprache: Deutsch
In der letzten Nacht des Jahres steht die Hebamme Trine Deichmann der Frau des stadtbekannten Salzkaufmanns Heinrich Schelling bei der Entbindung bei. Doch der Säugling kommt mit einem schweren Geburtsfehler zur Welt: Seine Beine sind zusammengewachsen und sehen aus wie der Schwanz einer Nixe. Die Mutter stirbt bei der Geburt, am nächsten Tag ist ihre Leiche spurlos verschwunden. Und kurz darauf ist auch der Kaufmann unauffindbar. Hebamme Trine beginnt zu ermitteln und stößt auf ein geheimnisvolles Experiment …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Klugmann
Die Tochter des Salzhändlers
Historischer Roman
Zum Buch
Lübeck, Silvester 1599 Die Frau des Lübecker Salzkaufmanns Heinrich Schelling bringt mit Unterstützung der Hebamme Trine Deichmann ein Kind zur Welt: der erste Säugling des neuen Jahrhunderts. Doch das Neugeborene weist eine seltsame Missbildung auf. Seine zusammengewachsenen Beine sehen aus wie der Schwanz einer Nixe. Bei der schweren Geburt stirbt die Mutter, ihre Leiche verschwindet spurlos. Und kurz darauf ist auch ihr Mann unauffindbar. Hebamme Trine geht dem Gerücht nach, dass der Kaufmann ermordet wurde. Gemeinsam mit dessen Kindern stößt sie auf die Spur eines pädagogischen Experiments, das heimlich in einem Salzhaus am Hafen stattfindet. Parallel dazu wollen schwedische Händler die Gelegenheit nutzen, den einträglichen Salzhandel unter ihre Kontrolle zu bringen. Nun kommt vieles zusammen: Wirtschaftskriminalität, religiöses Eiferertum, die Solidarität selbstbewusster starker Frauen rund um Hebamme Trine – und ein Fall von Liebe, die den Tod überdauert.
Norbert Klugmann, Jahrgang 1951, hat bislang 70 Bücher in den Genres Krimi, Thriller, Beziehungsroman, Satire und Jugendbuch geschrieben, von denen einige auch verfilmt wurden. Gepriesen wird er seit dem ersten Buch für seine Dialoge und Situationskomik. Nach seiner erfolgreichen Krimiserie um den weltgewandten Weinliebhaber Marchese beginnt mit »Die Tochter des Salzhändlers« die Geschichte der Lübecker Hebamme Trine Deichmann.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Neuausgabe 2022
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vermeer_van_Delft_021.jpg
ISBN 978-3-8392-3326-9
Das alte Jahr
1
Die Frau schrie, und Paul flog in Lilis Arme. »Du musst keine Angst haben«, tröstete Lili und streichelte über seine Haare.
»Aber … aber wenn das so weh tut …«
Lili blickte den kleinen Bruder an. Sein blasses Gesicht zeigte Verwirrung und Angst.
»Das ist nicht die Mutter«, log sie.
»Aber wer denn?«
Lili mochte sich nicht, wenn sie log, weil sie wusste, dass nach der ersten Unwahrheit die zweite kommen musste. Und bald würde man sich nicht mehr auskennen.
»Das ist die Hebamme, die so schreit«, sagte sie. Wie zur Bestätigung kam der nächste Schrei. Er war laut und durchdringend, es war ein Gurgeln und Heulen, voller Schmerz und Verzweiflung.
»Sie hilft unserer Mutter«, erklärte Lili und führte den Bruder zu seinem Bett. Plötzlich stöhnte er und knickte ein. Er war auf eins seiner Turnierpferde getreten, Figürchen aus Ton, die er über alles liebte und eifersüchtig vor Lili verbarg. Paul besaß ein Dutzend Ritter auf Pferden und noch viel mehr Burgfräulein, Hunde, natürlich auch das königliche Paar.
»Ich will zur Mutter«, forderte er, als er im Bett saß.
Lili faltete seine Finger. »Morgen«, sagte sie.
»Im neuen Jahr?«
»Was? Ja, ja, im neuen Jahr.«
»Vielleicht kennen wir uns nicht mehr«, sagte Paul und lachte glucksend.
Vor zwei Jahren hatte er damit angefangen. Immer wenn ein neues Jahr vor der Tür stand, fürchtete sich Paul nicht nur vor der neuen Zahl für das kommende Jahr. Er sagte voraus, dass dann alles anders werde und das, was bisher rot war, jetzt blau sei und was süß geschmeckt hatte, nun den Mund mit einem bitteren Geschmack erfüllen werde.
»Rede keinen Unsinn«, sagte Lili. »Natürlich kenne ich dich morgen wieder. Du bist mein kleiner Bruder. Du bist frech und dumm. Und wenn du mich ärgerst, sperre ich dich in den Schrank, genauso wie im letzten Jahr.«
Pauls schmächtiger Körper erbebte. In den Tiefen des Hauses waren Geräusche zu hören: schnelle Schritte, Türen fielen ins Schloss. Aber es war kein Fest zum Ausklang des Jahrhunderts, das gefeiert wurde.
»Schlaf jetzt«, sagte Lili. »Morgen besuchen wir die Mutter. Vielleicht hat sie eine Überraschung für dich. Vielleicht bist du morgen nicht mehr der Kleinste. Gute Nacht, ich habe dich lieb.«
Heinrich Schelling stand am Fenster. Die grimmige Kälte des letzten Dezembertages erreichte ihn auch noch, nachdem er einen Schritt in den Raum zurückgetreten war. Die meisten Fenster des Hauses auf der anderen Seite der Gasse waren hell erleuchtet. Wittmers Geschäfte gingen gut. Obwohl erst in der zweiten Generation im Gewerbe tätig, galt das Brauhaus als eines der größten in der Stadt. Die Fässer mit dem Gerstensaft rollten auf Schiffe, die nach Dänemark und bis Schweden hinauffuhren. Es gab viele Empfänge und dann ging es hoch her. Der Hausherr legte Wert darauf, jedes neue Fass selbst anzustechen, und wenn ihn nach Mitternacht die Trunkenheit auf weichen Armen schaukelte, ging er in den Keller, wo sich einer der Gäste mit dem Hausherrn im Anstechen messen musste. Der Sieger zog mit einer Kostbarkeit ab, einem Schachspiel aus Bernstein oder einem Dreimaster unter vollen Segeln in Öl. Bisher war Wittmer aus jedem Duell als Sieger hervorgegangen, der Verlierer nichtsdestotrotz mit der erhofften Trophäe beschenkt worden. Wittmer war ein großzügiger Mann und legte Wert darauf, dies zu zeigen. Die festliche Tafel, auf die Schelling von seiner erhöhten Warte einen erstklassigen Blick hatte, suchte in der Stadt ihresgleichen. Der Wein war vom Feinsten, über die Häfen von Bordeaux und La Rochelle schwamm der rote Wein der Franzosen heran. Schelling hielt den Nachbarn für einen Emporkömmling und ungehobelten Gesellen, aber er hatte schon oft seine Gastfreundschaft in Anspruch genommen. Schelling dachte: Seine Kinder werden den Stil besitzen, nach dem er sich so sehnt. Cornelius Wittmer war der Sohn eines Vaters, dessen dröhnender Bass in den Gaststätten und im Magistrat zu seinem Markenzeichen geworden war. Vom Vater zum Sohn hatten wenig Vergeistigung und Dämpfung der Triebe stattgefunden. Nicht einmal fromm war Wittmer. Schelling blickte auf die Tafel, an der Uta und Friedrich, die ältesten der Wittmer-Kinder, im Glanz ihrer Jugend das Fest zum Ausklang des Jahres und des Jahrhunderts genossen.
Halte durch, Martha, dachte Schelling. Er musste keine weiteren Schreie mehr hören, um ein schmerzendes Ziehen im ganzen Leib zu verspüren. Sie quälte sich, sie quälte sich viel mehr, als es eine Frau tun sollte, die ein Kind zur Welt brachte. Marthas lauter Schmerz hatte Schelling wehgetan, aber das folgende Schweigen beruhigte ihn in keiner Weise. Im Hintergrund hörte er eilige Schritte, die in die Küche hinunterliefen und bald zurückkehrten. Sie erneuerten das warme Wasser.
»Kopf hoch«, ertönte es hinter dem Hausherrn.
»Jütte, was treibt Ihr noch hier?«, fragte er, ohne sich umzudrehen. »Die Familie wartet auf Euch.«
Schelling wusste, wie unhöflich es war, sich nicht dem anderen zuzuwenden, aber gegenüber war Uta aufgestanden, Musik begann zu spielen, mit stampfendem Rhythmus, wie man sie auf dem Jahrmarkt hörte. Oder in Gaststätten, in denen Männer wie Heinrich Schelling nicht verkehrten. Uta flog in den Arm eines Mannes, den Schelling nicht erkannte. Jetzt tanzten sie da drüben, wild und losgelassen.
Neben ihm tauchte Jütte auf, geräuschlos und zurückhaltend, wie es seine Art war.
»Ich war in der Küche«, sagte Jütte.
»Redet schon.«
»Die Magd sagt, es kann nicht mehr lange dauern.«
»Es dauert schon zu lange.«
»Die Magd sagt, manche Frau schüttet ihr Kind aus und steht auf.«
»Sie hat nicht von Martha gesprochen.«
Schweigen, im Hintergrund Türenklappern. Plötzlich kam Bewegung in Schelling. »Ich gehe hinauf.«
»Tut das nicht«, sagte Jütte. »Da oben regieren die Weiber. Davon verstehen wir nichts.«
»Ich muss mich kümmern, es zerreißt mich sonst.«
»Es sind sieben Frauen um die Herrin. Sie hat die allerbeste Versorgung.«
»Aber sie muss den schwierigsten Teil allein besorgen.«
»Trine Deichmann ist da.«
»Trine Deichmann ist die Bademome. Sie hat keine Schmerzen.«
»Sie ist die beste Bademome, die man sich denken kann.«
Darüber musste Heinrich Schelling nicht belehrt werden. Er war schon Mitglied im Magistrat gewesen, als es zur Abstimmung über die städtisch besoldeten Hebammen gekommen war. Trine Deichmann war die Dienstälteste von ihnen. Dabei war sie noch nicht alt, in den Dreißigern. Ihr guter Ruf eilte ihr voraus wie dem Knoblauch der Geruch. Trine hatte Lili auf die Welt geholfen und auch Paul. Aber als Schelling ihr vor zwei Stunden auf der Treppe begegnet war, hatte ihm ihr Gesicht nicht gefallen. Sie hatte ihn getröstet, alles werde gut gehen. Er müsse Geduld haben und an seine Frau denken, das werde ihr helfen. Aber ihr Gesicht hatte die Worte nicht unterstützt. Zu ernst, um zuversichtlich zu wirken.
»Wie sie tanzen«, sagte Jütte. Beim Brauer drüben ging es über Tische und Bänke.
»Sie rasen«, sagte Schelling. »Sie denken nur an sich.«
Er schämte sich sofort, aber nun war es zu spät. Er hatte laut werden lassen, wie angespannt er war. Aber auf wen wollte er in dieser Minute Rücksicht nehmen? Wem wollte er etwas vormachen? Jütte, dem Buchhalter, seit 21 Jahren im Geschäft, der gute Geist im Salzhaus Schelling, der Mann, der alles wusste, der sich an alles erinnerte, der alles parat hatte, an den man sich wandte, wenn ein Kontorbuch nicht zur Stelle war, weil er die Zahlen und Mengen herunterbetete, als würde er sie vor sich sehen?
Plötzlich ein Schrei. Die Musik im Brauhaus war laut, der Schrei war lauter. Schelling hatte fast die Tür erreicht, als es nicht mehr weiterging. Verdutzt schaute er auf die Hand, die ihn hielt. Jüttes Gesicht drückte keine Anstrengung aus, nur Ernst. Sie arbeiteten seit 21 Jahren Seite an Seite, aber sie hatten sich nie berührt. Schelling wischte sich übers Gesicht und sagte: »Sie leidet. Das ertrage ich nicht.« Und bevor Jütte etwas einwenden konnte: »Mich kümmert nicht, ob Frauen leiden müssen. Martha soll es nicht. Nicht so sehr. Bei Lili und Paul ist es anders gegangen.«
Drüben hörte die Musik auf, um drei Takte später mit neuem Tempo zu beginnen. Schelling, den es eben noch aus dem Raum gezogen hatte, fühlte sich fürsorglich umfangen und gelenkt. Wie unter Schock in Jüttes Gesicht starrend, bewegte sich der Salzkaufmann zu den Tönen der Jahrmarktsmusik, geführt von einem Mann, der 15 Jahre älter war als er.
Trine Deichmann tupfte mit dem Tuch über das Gesicht der Schwangeren und sagte: »Ruht Euch aus.«
Die Frau im Bett versuchte zu lächeln, doch ihre Gesichtszüge entgleisten. Trine sagte: »Ihr seid nicht allein.« Martha Schellings Schwester Appolonia trat ans Bett und ergriff die schweißnasse Hand der Frau.
Trine nutzte die Gelegenheit, um sich mit den anderen Frauen abzusprechen. »Es wird schwierig«, sagte sie.
»Ist es … ist es tot?«, flüsterte eine Nachbarin.
Die Wehen hatten fast aufgehört. Was Trine ertastete, fühlte sich nicht gut an. Das Kind lebte, es lag auch richtig, aber vor einer Stunde hatte es angefangen, sich zu bewegen. Man musste befürchten, dass es sich drehte. Wenn es mit den Füßen zuerst kommen würde, standen Martha Schelling die schlimmsten Minuten ihres Lebens bevor.
Die Magd, die für das Wasser und die Tücher zuständig war, ging mit dem Eimer zur Tür.
»Es ist noch nicht nötig«, sagte Trine Deichmann.
»Ich weiß«, sagte die Magd. »Aber es tut mir gut, wenn ich mich bewegen kann.«
An der Tür stehend, warf sie ihrer Herrin einen mitleidigen Blick zu. Das war Trine nicht recht. Sie durfte nicht zulassen, dass sich im Raum Verzweiflung breitmachte, mochte sie sich auch noch so warmherzig äußern. Die Gebärende war darauf angewiesen, in einem Kokon von Fürsorglichkeit zu atmen. Schmerz gehörte dazu, aber Schwangerschaft war keine Krankheit. Nicht wenn am Ende alles reibungslos vonstatten ging.
Eine Frau, die sie heute zum ersten Mal gesehen hatte, bat die Hebamme, mit ihr an den Ofen zu treten.
Mit den Worten: »Ich kenne einen Medicus«, kam die Frau unverzüglich zum Thema.
»Kein Medicus kann hier helfen«, sagte Trine kühl.
Die andere ließ sich von der Förmlichkeit der Hebamme nicht einschüchtern. »Ich spüre, dass es nicht gut aussieht. Und Ihr spürt es auch.«
»Es ist eine schwere Geburt. Kein Medicus könnte eine leichte Geburt daraus machen.« Mit Schaudern erinnerte sich Trine an die Wundärzte, mit denen sie es in der Vergangenheit zu tun bekommen hatte: Pfuscher, Trinker, Metzger.
»Dann soll ein Pastor kommen.«
Trine Deichmann lächelte. Daher wehte der Wind. Es ging nicht um den Menschen, sondern um die Seele.
»Ihr tut nichts«, behauptete die fremde Frau. »Ihr steht herum und wartet nur.«
Trine Deichmann galt als geduldige Hebamme und hielt sich dies als Vorteil zugute. Mit Schaudern war sie in der Vergangenheit Zeugin geworden, wenn andere Hebammen die Schwangere zum Pressen genötigt hatten. Wie besessen hatten sie den Leib bearbeitet und die Schwangere zum Niesen gebracht. Trine Deichmann war geduldig und wurde es mit jedem Jahr mehr. Die Natur würde wissen, wann die Zeit gekommen war. Das mochte dazu führen, dass die Schwangeren jammerten, aber sie jammerten in jedem Fall, denn in dieser Stadt sah man es nicht gern, wenn Geistliche ein Brimborium veranstalteten oder weise Frauen aus den Dörfern am Lager auftauchten, um einen Sud zu reichen, den sie aus Kräutern und Wurzeln gekocht hatten.
Die Magd kündigte eine Besucherin an. Im Hausflur wartete eine junge Frau, fast noch ein Mädchen. Sie sah verfroren aus, aber es war nicht nur die äußerliche Kälte, an der sie litt.
Als Trine Deichmann ihr gegenüberstand, schüttelte die junge Frau den Kopf und sagte: »Es ist auf der Welt. Aber ich freue mich nicht.«
Am letzten Tag des Jahrhunderts war geschehen, was jahrelang nicht passiert war: Zwei Frauen lagen gleichzeitig in den Wehen. Trine Deichmann hatte ihre junge Kollegin zur zweiten Schwangeren geschickt. Ein schwerer Verlauf in einer kleinen Hütte. Betrunkene Nachbarinnen, mit Kräutern und Branntweinflaschen hantierend. Ein Ehemann, der darauf bestand, bis zur letzten Minute dabeizubleiben. Unruhe, gereizte Debatten, wenig Unterstützung. Die junge Frau sagte: »Es sind Wilde. Alles war schmutzig. Sie brauchen uns nicht.«
»Rede keinen Unsinn«, sagte Trine Deichmann streng. »Sie haben einen Anspruch.«
Das verstockte Gesicht der Jüngeren verriet, was sie davon hielt. Dabei war die Geburt verlaufen, ohne dass die Hebamme eingreifen musste. Keine fünf Minuten, nachdem das Kind den ersten Schnaufer getan hatte, begann es im Zimmer nach Branntwein zu riechen. Die Hebamme hatte den Säugling gebadet. Der Vater, mittlerweile betrunken, hatte gegrölt: »Lass es nicht fallen, sonst müssen wir gleich ein neues machen.«
Trine Deichmann schickte die junge Hebamme nach Hause. Trine wusste, was die Junge dachte, aber sie war heute Abend nicht in diesem Haus, weil es sich um wohlhabende Bürger handelte. Sie hatte der Martha Schelling bei ihren ersten Kindern beigestanden, der Kontakt war danach nie mehr abgerissen.
»Ich fühle mich sicher bei Euch« – Sätze, die Trine in der Seele gut taten. Es gefiel ihr auch, wenn sie ihre Kinder groß werden sah. Denn es waren ihre Kinder, zu einem kleinen Teil. Trine Deichmann liebte ihren Beruf nicht nur, weil sie anderen Menschen helfen konnte. Sie half mit, Neues auf die Welt zu bringen, neue Gesichter, neue Talente, neue Herzen und Seelen. Jedes Kind war eine Chance, nicht weil es den göttlichen Atem in sich trug, sondern weil es die Erde heller machen konnte.
Beide Kinder der Martha Schelling waren liebenswert, die kluge, nachdenkliche Lili mehr als der kleine Paul, der wiederum mit seinen abstehenden Ohren, den Haaren, die kein Kamm bändigen konnte, seiner Wendigkeit und seinem Charme alle bezauberte. Trine hatte nichts gegen die Bewohner der Vorstadt, sie hatte ihnen keinen Ersatz geschickt, sondern Katharina, Tochter eines Wundarztes, die gelehrigste Schülerin, die sie je gehabt hatte.
Dann stand die Magd hinter ihr, Trine eilte die Treppe hinauf.
Ab jetzt ging nichts mehr glatt. Die Schwangere quälte sich bis vor die Bewusstlosigkeit. Sie ging ihn nicht, den letzten Schritt, die Frauen redeten ihr gut zu, tupften erst das Gesicht ab, bis Martha so sehr schwitzte, dass sie Stirn, Hals und Brust abwischten. Man musste die Schwangere festhalten, weil sie sonst aus dem Bett gestürzt wäre. Das war eine diffizile Angelegenheit, denn einerseits musste man Martha im Griff behalten, andererseits brauchte sie genügend Bewegungsfreiheit, um die Wehen zu unterstützen. Trine Deichmann ertastete, was sie nach dem Verlauf der letzten Stunden befürchtet hatte. Aber da sie das Schlimmste nicht wahrhaben wollte, rettete sie sich in fieberhaftes Handeln. Pausenlos gab sie in diesen Minuten Anweisungen: Sie bat um Hilfe, untersagte gewisse Handgriffe, dirigierte die Frauen von hierhin nach dorthin, redete zwischendurch Martha gut zu, die aber für Ansprachen nicht mehr erreichbar war.
2
Als die Türglocke zum vierten Mal ertönte, erhob sich Heinrich Schelling. Verwundert stellte er fest, dass ihm die Beine wehtaten, als habe er Salzsäcke geschleppt.
Das schwache Licht von den Wandleuchtern erhellte das glänzende Gesicht einer Frau. Einen Moment stutzte sie, sie hatte wohl nicht damit gerechnet, dass der Hausherr persönlich öffnen würde. Aber Hedwig Wittmer fing sich schnell. In ihrem dunkelroten Samtkleid mit dem auffälligen Dekolletee tanzte sie auf der Stelle, ob wegen der Kälte oder der ausgelassenen Stimmung, wusste nur sie allein. In einer Hand hielt sie einen Kelch, und er war nicht leer.
»Es ist nur, weil ich mich so freue!«, rief sie laut wie immer. »Wir bedauern so sehr, dass Ihr keine Gelegenheit habt, mit uns zu feiern, um …«
Sie brach ab, weil sie nicht länger umhin kam, den Gesichtsausdruck des Hausherrn zu deuten.
»Oh«, sagte die Gattin des Brauers leiser, »es ist also wahr, was man mir vorhin sagte. Jemand sah Trine Deichmann in Euer Haus gehen.«
»Ja«, sagte Schelling, »die Bademome ist da. Martha hat es nicht leicht.«
»Wenn Ihr Hilfe braucht … ich bin sofort bei Euch … das ist doch … aber ich rede und rede und währenddessen quält sich die arme Frau.«
Bevor Schelling begriff, wie ihm geschah, befand sich Hedwig Wittmer bereits auf der Hälfte der Treppe.
»Auf den Stuhl mit ihr!«, rief die Frau, die Trine Deichmann noch nicht gesehen hatte. Aber die Schwangere warf den Kopf nach rechts und links, bäumte sich auf, und es bedurfte der Kraft von zwei Frauen, um sie davor zu bewahren, sich und das Kind zu verletzen. Trine griff in die Gebärmutter. Was sie ertastete, war nicht der Kopf und auch kein Bein. Aber sie fühlte, dass es lebte und pulsierte. Einen Augenblick wurde die Hebamme von einer großen Müdigkeit ergriffen. Erfahren, wie sie war, konnte sie ihre Reaktion richtig einschätzen. Sie wehrte sich gegen das, was kommen würde und sah keine Möglichkeit, es zu verhindern.
Martha Schelling wurde in den Geburtsstuhl gehoben, der zuvor mit Tüchern ausgelegt worden war. In dieser halb sitzenden, halb liegenden Stellung sollte ihr das Folgende leichter fallen. Aber alles, was passierte, waren die fürchterlichen Schreie. Die Magd stürzte aus dem Raum und Trine Deichmann war, als würde sie in der Nähe Musik hören. Sie würde die Fruchtblase sprengen müssen. Aber plötzlich stand der Mann im Raum, Heinrich Schelling, weißblass, gut erkennbar, trotz des milden Lichts der Kerzen und des Ofenfeuers.
»So geht das nicht!«, sagte er verzweifelt, und Trine Deichmann rief: »Verlasst den Raum. Ihr bringt nur Unruhe.«
Das sah er nicht ein. Er war gekommen, um zu helfen, und obwohl das, was er sah, ihn fast von den Beinen holte, weigerte er sich, den Raum zu verlassen, stand im Weg, und jeder Schritt, den er tat, um Trines Anweisungen Folge zu leisten, führte zu neuem Malheur. Als die erste Schüssel umfiel und Trine sich in Wasser stehend wiederfand, ließ sie von der Schwangeren ab und herrschte Schelling an: »Geht jetzt! Geht sofort! Oder wollt Ihr schuldig werden?«
Er starrte sie an, als würde er ihre Sprache nicht verstehen. Plötzlich sah er sich umringt von Hedwig Wittmer und seiner Schwägerin Appolonia. Sie dirigierten ihn mit festem Griff aus dem Raum. Die Schwangere schrie und irgendwo in der Nähe ertönten Hoch- und Jubelrufe.
In den folgenden Minuten arbeiteten die Schwangere und Trine Deichmann Hand in Hand. Martha, mit weit aufgerissenen Augen ins Nichts starrend, den Kopf werfend und sich mit allen Gliedmaßen gegen die Schmerzen wehrend, war knallrot im Gesicht, am Hals und auf der Brust. Keine anderen Geräusche waren zu hören außer Marthas Stöhnen und Trines Anweisungen. Blut floss, Marthas Schoß wurde weit, und was aus ihm hervortrat, war glatt und schier und rot und lang. Es wollte kein Ende nehmen, aber es war kein Kopf und kein Arm und kein Bein. Martha stöhnte, Trine forderte sie auf, nicht nachzulassen. Hedwig Wittmer ging ihr zur Hand. Sie machte ihre Arbeit gut, die Farbe des samtroten Kleides fand ihre Entsprechung in ihren roten Händen und Unterarmen. Ihre Unterlippe war blutig gebissen, vor Anstrengung und Eifer, und als sie sah, was in Trines Händen lag, stieß sie einen seltsamen Laut aus, bevor sie zur Seite wegkippte. Schwer schlug sie, weil niemand darauf gefasst gewesen war, auf den Boden, wo sie regungslos liegen blieb.
Alle versammelten sich um das Kind, das auf dem Bauch von Martha Schelling lag, dann blickten alle Trine Deichmann an. An ihr war es jetzt, eine Bemerkung zu machen. Aber Trine nabelte ab, nahm das Kind und legte es in die Arme der erstbesten Frau. Dann kümmerte sie sich um Martha Schelling.
»Was ist das?«, fragte Appolonia. »Wollt Ihr uns nicht sagen, was das ist?«
»Später«, murmelte Trine, »erst kümmere ich mich um die Mutter.«
»Aber warum?«, rief Appolonia. Ihre Stimme klang schrill und alarmiert. »Wir müssen über das … über das da sprechen.«
»Später«, murmelte Trine, »erst die Mutter.«
»Aber warum?«
»Weil sie sterben wird, darum.«
»Was lest Ihr da?«
Heinrich Schelling fuhr zusammen. Sein Schreck war so groß, dass auch Lili zusammenzuckte.
»Kind, was willst du hier? Du solltest im Bett liegen und schlafen.«
Unschlüssig stand Schelling vor seiner Tochter. Sie hatte einen Mantel über ihr Nachthemd gezogen, ihre Füße steckten in Holzschuhen. Dennoch sah sie aus, als würde sie frieren. Im Büro besuchten seine Kinder ihn sonst nie. Als sie kleiner gewesen waren, hatte es Kämpfe darum gegeben. Danach nie mehr. Schelling hatte sich in den Schreibraum zurückgezogen. Es gab für ihn in dieser Nacht keinen geeigneten Ort. Hier war es immerhin ruhig. Eine einzige Kerze brannte.
»Was lest Ihr?«, fragte Lili.
Sie blickten sich an. Das Schlimmste war, dass Schelling in Lili seine Martha als junge Frau sah. Die Ähnlichkeit wurde mit jedem Jahr größer. Schelling hatte eine fast erwachsene Tochter. Das rührte ihn einerseits, aber er wusste, dass einiges dadurch schwieriger werden würde.
»Wie geht es ihr?«, fragte Lili.
»Bald ist es überstanden.«
»Aber es ist schwer, nicht wahr?«
»Ja.«
»Und wir können ihr wirklich nicht helfen?«
Er sah sie an.
Lili sagte: »Werde ich auch solche Schmerzen haben, wenn ich ein Kind bekomme?«
»Nein«, sagte er mit entschiedener Stimme, »du nicht.«
»Warum nicht? Ich habe doch auch ihre Haare und meine zweite Zehe ist länger als die erste, wie bei ihr. Warum soll ich dann nicht auch die Schmerzen meiner Mutter haben?«
Dann stand die Magd im Raum. Mit ihren zerzausten Haaren und den flammend roten Wangen sah sie aus, als habe sie gerauft. Sie stürzte auf Schelling zu, fiel vor ihm auf die Knie, packte seine Hand und drückte sie gegen ihre Wange. »Herr, es ist schrecklich«, sagte sie.
Mit großer Mühe gelang es ihm, das Mädchen zum Aufstehen zu bewegen.
»Sag, was ist passiert? Ist das Kind da?«
»Ja, Herr«, sagte sie und brach in Tränen aus.
»Ist es … ist es tot?«, fragte Lili beklommen.
Die Magd schüttelte den Kopf, ohne Lili anzusehen, starrte stattdessen Schelling an und flüsterte: »Aber die Herrin …«
Heinrich Schelling kniete vor dem Bett neben seiner Frau, hielt ihre Hand in beiden Händen und sprach zu ihr leise und eindringlich in einer Sprache, die nur die beiden verstanden. Trine Deichmann wusste nicht, ob er die blutigen Tücher gesehen hatte. Es war keine Zeit gewesen, sie verschwinden zu lassen. Jedenfalls hatte er das Kind nicht sehen wollen. Trine blickte zur Wiege hinüber, sie verschwand fast unter dem großen Tuch.
Martha Schelling war bei Bewusstsein, aber nicht ansprechbar. Ihr Mann hatte das sichere Gefühl, dass sie ihn wahrnahm. »Rede mit mir, Martha.« Er berührte ihr Gesicht, drehte es zu sich herum, sprach sie erneut an.
Währenddessen sagte Hedwig Wittmer leise zu Trine: »Ich bringe die Kröte fort.«
»Was meint Ihr damit?«
»Er soll sie nicht sehen. Er würde nicht darüber hinwegkommen.«
»Das Kind lebt.«
»Aber es wird sterben. Schnell, sehr schnell. Und es ist kein Kind. Es ist ein … ein irgendwas. Eine Kröte.«
»Ich will das Kind sehen«, sagte Schelling, der plötzlich vor der Hebamme stand.
»Das wollt Ihr nicht wirklich.«
Er forschte in Trines Gesicht, als gäbe es dort Winkel, die er bisher übersehen hatte. Er ging zur Wiege, zögerte und zog mit einer heftigen Bewegung das Tuch fort.
Es war totenstill im Raum. Schelling starrte in die Wiege. Dann drehte er sich um und sagte mit einer Stimme, die nicht zu diesem Mann gehörte: »Wie geht es meiner Frau?«
Trine sagte: »Sie ist sehr krank.«
»Wird sie sterben?«
Trine taxierte ihn. »Ja.«
Einen Moment dachte sie, er würde zusammenbrechen. Der Mann kniete vor dem Bett seiner Frau.
Die Magd sagte: »Die Kristallkugel sagt, sie wird leben.«
Schelling erhob sich und trat auf die Magd zu. Sie wich zurück.
»Was sagst du da?«, fragte er.
»Das ist Aberglaube«, sagte Trine.
Aber Schelling achtete nicht auf sie.
»Ich habe die Kugel befragt«, sagte die Magd, die mit jeder Sekunde selbstbewusster wurde.
»Weissagerei«, sagte Trine und dachte, damit sei alles gesagt.
Aber dann sagte Hedwig Wittmer: »Wenn es hilft.«
»Das ist Zauberei«, sagte Trine. Und mit entschiedener Stimme: »Ich möchte arbeiten. Wer hier nicht hergehört, möge gehen.«
Während sie nach Martha sah, um festzustellen, dass die Blutungen nachgelassen hatten, aber keineswegs gestoppt waren, registrierte sie aus den Augenwinkeln, wie Schelling den Raum verließ. Er war nicht allein.
Man kam gleich auf dem Treppenabsatz zum Thema.
»Es gibt Kräuter«, sagte Hedwig Wittmer eifrig. »Ich weiß das, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe.«
Und die Magd sagte: »Die Kugel sagt, die Hölzchen und Knochen helfen dem Kind. Dann helfen sie auch der Mutter.«
Schelling, betäubt von all dem, was er gerade gesehen hatte, wischte sich über die Stirn und fragte, worum es hier ginge. Es ging um die Zauberei vor der Geburt und nach der Geburt, um Wachsfiguren, die heimlich getauft waren und die im Zusammenhang mit oder auch ohne Hölzchen und Knochen dafür sorgten, dass die Geburt ohne Probleme stattfand, dass es dem Kind gut ging und der Frau ebenso.
»Gebete«, sagte Hedwig Wittmer eindringlich.
»Vom Pastor?«, fragte Schelling.
Die Nachbarin blickte ihn prüfend an und schüttelte den Kopf. Kein Pastor, die Hebamme müsse es machen. Oder eine weise Frau. Schelling hatte davon gehört, jeder hatte davon gehört. Jeder kannte weise Frauen, zumal wenn er auf dem Land groß geworden war. Heinrich Schelling war ein Freigeist. Er respektierte den Glauben, aber als Lutheraner war er in einem religiösen Klima aufgewachsen, das ihn früh zu dem geführt hatte, was er für die wahren Wurzeln der Kultur hielt: die klassischen Philosophen. So stand er dem Aberglauben spöttisch gegenüber.
Was die Nachbarin berichtete, war ihm neu. So hatte er nicht gewusst, dass seine Martha während der Geburt als unrein galt, was ein anderer Begriff sei für: in der Gewalt des Teufels. Plötzlich waren sie zu viert. Jütte, die treue Seele, hörte zu, was die Nachbarin zu erzählen hatte.
Ärgerlich sagte er: »Das ist Aberglaube. Wenn Trine Deichmann nicht helfen kann, kann es niemand.«
Hedwig Wittmer funkelte ihn kampflustig an. Sie war froh, dass sie einen Widerpart hatte, der sie nicht so einschüchterte wie Schelling, der von der Sorge um seine Frau gezeichnet war.
»Und warum weiht die Kirche dann das Taufwasser?«, fragte sie triumphierend. »Warum erlaubt sie, dass der Täufling mit Salz und Pfeffer bestrichen wird? Warum darf man ihn bepusten und mit Wasser besprengen? Ist das kein Aberglaube? Und was ist überhaupt Aberglaube? Es muss nur helfen, dann ist es richtig.«
»Die Kugel …«, warf schüchtern die Magd ein. Aber auf sie hörte niemand mehr.
Schelling dachte an die Amulette, die im Leben der Katholiken so eine große Bedeutung hatten. Er dachte an die Essenz aus Kräutern, die seinem Sohn damals geholfen hatte, den kranken Magen auszuheilen. Und so stand er kurz darauf vor Trine Deichmann und sagte: »Helft ihr. Nehmt alles, was Ihr wisst.« Trine Deichmann sah ihn aufmerksam an, als er fortfuhr: »Nehmt auch das, was Ihr sonst nicht nehmt.« Und leise, fast flüsternd: »Wenn es teuer ist, werde ich es bezahlen. Wenn es geschehen muss, tut es heimlich. Ich sorge dafür, dass alle den Raum verlassen.«
Trine Deichmann ging zur Wiege und wartete, bis er ihr folgte, was er nur widerstrebend tat.
Sie sagte: »Was ist das, was Ihr hier seht?«
»Es ist … ich sehe nichts.«
»Es ist Euer Kind.«
»Nein«, sagte Schelling heftig. »Das ist nicht mein Kind. Das ist kein Kind. Es mag leben, aber es ist …«
Dann geschah, was alle Anwesenden nie vergessen würden. Heinrich Schelling fiel auf die Knie, ergriff Trines Hände und sagte: »Helft meiner Frau. Nur das ist wichtig.«
»Es sieht nicht gut aus. Ich sehe wenig …«
»Redet nicht. Helft. Helft ihr.«
Er eilte zum Bett, fasste unter Marthas Oberkörper, und im hilflosen Versuch, Martha einerseits zu beschützen und sie andererseits der Fürsorge Trine Deichmanns anzuvertrauen, hielt er seine bewusstlose Frau und sagte: »Macht, dass sie lebt. Sonst habe ich nichts mehr, weshalb ich leben soll.«
Und aus seinen Augen flossen Tränen.
Das neue Jahr
1
Die Augen aufmachen und aus dem Bett springen war eins.
»Warte auf mich«, rief Paul. Da war Lili bereits aus dem Raum gelaufen, barfuß trotz des kalten Bodens stürmte sie eine Treppe höher. Die Schürze der Magd stoppte sie.
»Lass mich durch«, sagte Lili atemlos.
Aber die Magd hielt sie fest. Lili war 13 Jahre und nicht schwach, keine fünf Jahre jünger als die Magd. Die Mädchen rangen miteinander, bis Heinrich Schelling auf der Schwelle erschien. Dann war schnell ein Ende damit.
Er gab den mittlerweile aufgetauchten Paul in die Obhut der Magd. Paul lamentierte, aber die Aussicht auf eine Köstlichkeit in der Küche lockte ihn mit nach unten. Schelling führte seine Tochter in den Wohnraum.
Lilis erster Gedanke war: Es ist kalt. Sie haben nicht eingeheizt. Schlimmer als die Kälte war das Gesicht ihres Vaters. Sie kroch auf das Sofa und zog die nackten Beine unter das Nachthemd.
Schelling trat ans Fenster, ging dann im Raum herum, bevor er sich ebenfalls aufs Sofa setzte.
»Vater, Ihr habt gestern noch viel Wein getrunken«, sagte Lili.
Sie wollte, dass er lachte. Dieses schreckliche Gesicht musste verschwinden.
Schellings Brust entrang sich ein Seufzer. »Ach, meine Tochter«, sagte er und rang die Hände im Schoß.
Lili sagte leise: »Es ist ein Unglück geschehen.«
Spontan schüttelte Schelling den Kopf. Dann schloss er die Augen und senkte den Kopf. So hatte Lili ihren Vater noch nie erlebt. Sie fror, aber es war nicht mehr allein die äußerliche Kälte, die ihr in die Glieder kroch.
»Lili, du musst jetzt stark sein«, sagte Schelling.
Hoffnungsvoll fragte sie: »Haben wir ein Kind bekommen?«
Schelling ignorierte die Frage und sagte: »Deine Mutter …«
»Was ist mit ihr? Hat sie ihre Schmerzen hinter sich?«
»Ja, das hat sie, mein Kind.« Wieder sein Blick, bei dem Lili das Gefühl hatte, er sei jetzt nicht in diesem Raum. Da fiel es ihr ein: Im Büro waren ja heute keine Menschen, Jütte nicht, der freundliche junge Schreiber nicht und auch nicht der Däne, der seit einiger Zeit hier arbeitete und der so ein lustiges Deutsch sprach. Dabei war heute kein Sonntag, das wusste Lili genau.
»Vater, du musst es mir sagen. Ich bin groß genug.«
Er schüttelte den Kopf, schon tränenblind, dann brach es aus ihm heraus: »Deine Mutter ist tot. Jetzt sind wir ganz allein.«
Lilis Blick fiel auf die Stehpulte, an denen die Schreiber arbeiteten. So ein Pult stand auch in dem Zimmer, in dem sich die Kinder aufhielten, zurechtgezimmert für Lilis Größe. In der Werkstatt des Tischlers hatte sie damals so lange stillstehen müssen, bis er Lili ausgemessen hatte.
Die Wand hinter dem Pult war zugestellt mit Kontorbüchern, das älteste stammte aus dem Jahr 1519. Lilis Vater hütete es wie einen Schatz. An der gegenüberliegenden Wand hingen die Bilder der Schiffe, auf denen das Salz transportiert wurde – erst von Lüneburg in den Lübecker Binnenhafen und von dort über das Baltische Meer nach Dänemark, Schweden, und seit einiger Zeit auch nach Russland. Kleiner die Reihe mit den Porträts. Die Familien des Vaters und der Mutter, auch Ludowica, Lilis Tante, die Schwester des Vaters, die vor 11 Jahren von einer Reise nach Riga nicht mehr zurückgekommen war und mit ihr das Schiff, die Besatzung, die Ladung.
»Hast du mich verstanden?«, fragte Schelling.
Natürlich hatte sie verstanden, sie war ja nicht dumm. Die Mutter war gestorben. Sie hatte es nicht geschafft, ein Kind zur Welt zu bringen. Einen Abend und eine Nacht hatte sie geschrien, das war furchtbar gewesen. Jetzt war alles ruhig, das war noch furchtbarer.
»Jetzt muss sie nicht mehr leiden, nicht wahr?«, sagte Lili.
Schelling nickte, es ging über seine Kräfte, hier zu sitzen und in das verständige Gesicht seiner Tochter zu blicken.
Lili stand auf und ging zur Tür.
Schelling fragte: »Wo willst du hin?«
»Ich will sie sehen.«
Martha Schelling war im Schlafzimmer aufgebahrt worden. Sie trug weißes Leinen und um die Schultern feinste Spitzen aus Flandern. Kerzen brannten, auf den Stühlen saßen Frauen in Schwarz, die beim Anblick von Lili schlagartig aus ihrer stillen Trauer erwachten und neugierig die Lage peilten.
Lange stand Lili an der Tür. Die Mutter sah schön aus, die Haare fein gekämmt, die Gesichtszüge entspannt. Sie trat neben die Mutter, legte ihre kalte Hand auf die gefalteten Hände, und alles um sie herum war nicht mehr vorhanden. Heinrich Schelling kehrte die Trauerweiber hinaus und beobachtete von der Tür aus seine Tochter.
Die Mutter war nicht tot. Wer so freundlich aussah, befand sich lediglich in der Mitte eines tiefen Schlafs. Sie war erschöpft, die letzten Wochen waren zu viel für sie gewesen. Sie brauchte Erholung, Schlafen war das Beste für sie, und wenn der Schlaf länger dauerte, als man das kannte, durfte man nicht unruhig werden. Die Mutter brauchte Zeit, Lili war bereit, sie ihr zu geben. Natürlich musste sie das dem dummen Paul erklären. Das würde ein schweres Stück Arbeit werden. Aber die Mutter würde sich nur erholen, wenn ihre Kinder solange artig sein würden.
Lili berührte die Glieder der Kette, die um die Finger der Mutter geschlungen waren. Dass Bernstein so warm sein konnte. Das war die Wärme der Mutter, die sie für die Dauer des langen Schlafs an die honiggoldenen Perlen abgegeben hatte. Der Schreiber im Bureau, über dessen lustige Wörter sie immer lachen musste, hatte ihr davon erzählt, dass die Wärme aus dem Körper geht, wenn der Körper Ruhe braucht. So war das bei Menschen und Tieren und es war richtig so.
»Ihr müsst keine Angst haben«, sagte Lili leise. »Ich passe auf Paul auf. Und auf unseren Vater auch.«
2
Joseph Deichmann war ein Filou. Er wusste das, Trine wusste das, aber er liebte sie und sie liebte ihn, und so liebten sie sich immer noch mit einer Häufigkeit, die andere Frauen in Trines Alter nicht erlebten. Sie hatte dem Filou drei Kinder geboren, von denen zwei lebten und ihren Eltern eine Freude waren. Damit wollte es Trine bewenden lassen. Joseph sah das nicht so eng, wenn ihn die Lust überkam, reichte sein Interesse nicht weiter als bis zu ihrem Bauch, und es war an Trine, ernstlich mit ihm zu reden, um zu verhindern, was verhindert werden musste. Sie musste den geeigneten Moment abpassen, denn wenn erst einmal das Glitzern in Josephs Augen Einzug gehalten hatte, war es für Vernunft zu spät, und es dauerte eine halbe Stunde, nachdem sich sein Samen auf Trines Bauch verteilt hatte, bevor der Mann wieder ansprechbar war.
»Joseph Deichmann«, sagte Trine dann oft, »du bist verrückt nach Kindern. Soll ich dir welche besorgen, damit du ihnen Unterricht über Kräuter und Heilkunde erteilst?«
»Ich mag sie am meisten, wenn sie klein sind«, entgegnete der Filou. »Winzig müssen sie sein, dass man sie mit dem nackten Auge nicht erkennen kann.«
Nicht selten versuchte er dann seinen Samen, den er eben noch grunzend von sich geschleudert hatte, mit spitzen Fingern aufzusammeln, um, wie Joseph es nannte, »das, was ich nicht auf guten Boden einsäen darf, in einem Gefäß zu sammeln, bis du es dir anders überlegst.«
Dann lachte Trine und erinnerte ihn daran, dass er sich damit um eine spätere Freude brächte, was Joseph natürlich wusste, denn er war von Haus aus Apotheker, bevor er sich seiner jetzigen Profession als Gastwirt zugewandt hatte, und kannte sich in vielen Angelegenheiten des Leibes aus. So wusste er, dass der männliche Samen aus dem rechten Hoden stammte, der weibliche aus dem linken und dass Zwillinge entstanden, wenn sich die Samen nicht einigen konnten. Er wusste, dass die Pastoren nichts davon hören wollten, wenn der Samen nicht den Weg nahm, den die Natur für ihn vorgesehen hatte. Vor allem wusste er, welche Kräuter dafür geeignet waren, die Frucht des Leibes aus dem Schoß zu vertreiben. Einiges davon hatte ihm sein früherer Lehrherr beigebracht. Das meiste wusste er von seiner Frau, mit der er darüber jedoch kaum jemals sprach, denn Trine Deichmann war es untersagt, Mittel anzuwenden, die in den natürlichen Ablauf der Dinge eingriffen.
Trine Deichmann war eine von vier Frauen, denen der Magistrat von Lübeck einen Sold für ihre Arbeit zahlte. Diese Frauen von gutem Ruf und guter Hand halfen Schwangeren in der schweren Stunde und 14 Tage danach. Ihre Klientel waren reiche Frauen genauso wie arme. Trine Deichmann war am längsten im Amt, deshalb oblag es ihr, die Kolleginnen einzusetzen, sodass jede gleich viel Arbeit hatte.
Hebammen mussten selbst Kinder geboren haben. Von ihnen wurde also erwartet, dass sie verheiratet waren. Außerdem erwartete man, dass der Gatte einen seriösen Beruf ausübte. Gastwirt war keiner der drei seriösesten Berufe. Aber die Fluchbüchse, das Deichmannsche Gasthaus, gehörte zu den besseren der Stadt, und Joseph war klug genug, um auf manierliche Umgangsformen und Trinksitten zu achten. Bei ihm kehrten die Wohlhabenden und Beamten ein. Ja, es war vorgekommen, dass Joseph den Herrn Bischof begrüßen konnte, was keine Selbstverständlichkeit war, denn die Geistlichkeit führte seit Langem einen heldenhaften, aber vergeblichen Kampf gegen die Trunksucht der breiten Schichten. Ihren sinnfälligen Ausdruck fand die wilde Zecherei in der Praxis des Zutrinkens, einer geselligen Sitte, der sich kein Gast bei Gefahr für Leib und Seele verschließen mochte und die zielstrebig zu Volltrunkenheit mit ihren teils vergnüglichen, teils aggressiven Auswirkungen führte. In die sogenannte Fluchbüchse zahlte jedermann drei Pfennige ein, der die Regeln gesitteten Benehmens übertreten hatte. Der Inhalt der Büchse wurde regelmäßig an die Armen der Stadt ausgeschüttet.
Der jungen Person, Elsa Peurin, die am Vormittag vorsprach, trat Trine freundlich, aber abwartend gegenüber. Was Elsa, Frau des Schiffszimmerers Florian Peurin, als Erklärung für ihren Wunsch vorzubringen hatte, gefiel Trine nicht übel, zumal Elsa trotz ihrer Jugend schon auf Erfahrung in heilkundigen Angelegenheiten zurückblicken konnte. Bis vor einem Jahr hatte sie in einem Dorf in Mecklenburg gelebt, bevor sie ihrem Mann in die Stadt gefolgt war, wo er auf der Werft Beschäftigung gefunden hatte. Rosländer, der Reeder mit den guten Beziehungen zu den Holländern, drehte ein großes Rad, seitdem er sich Anteile des Transports an allerlei Gütern von Holland, Brügge und England über Lübeck in den Osten und Norden gesichert hatte. Hering, Wein, Salz, Tuche natürlich.
Elsa bewies großes Wissen in allen Angelegenheiten der Geburt, der Geburtskomplikationen und des folgenden Wochenbetts. Von Trine befragt, worauf sich ihre Kenntnis gründete, sprach sie von weisen Frauen in ihrer Familie und im Dorf, denen sie von früher Jugend an zugehört und auf die Finger gesehen habe. Trine wurde aufmerksam, sie legte keinen Wert darauf, das Dorf in die Stadt zu verpflanzen. Sie wollte keine Kräuterfrau mit einer Arbeit betrauen, für die gesichertes Wissen erforderlich war und keine zweifelhaften Kenntnisse in der Verwendung von Eisenkraut, Kampfer, Hanf, Dill und Schierling.
»Ich weiß, worauf Ihr anspielt«, sagte Elsa Peurin lächelnd.
»Es wäre mir lieber, Ihr wüsstet es nicht.«
»Aber muss eine Bademome nicht auch Kenntnisse in den unerwünschten Künsten besitzen?«
Elsa Peurin zögerte nicht, über Abtreibung und die Wege dorthin zu sprechen, machte jedoch deutlich, dass sie für solche Handlungen nicht zur Verfügung stehen würde. Vielmehr sprach sie über den rechten Glauben und Gottes Willen, keine Unterschiede zwischen den Menschen zu machen. »Schickt mich gerne zu den Ärmsten der Armen. Ich werde ihnen von allem, was ich weiß und kann, das Beste geben.«
Trine Deichmann war es nicht unlieb, eine Person zur Verfügung zu haben, die die Sprache der einfachen Menschen sprach. Es war die Sprache, die man in den Armenvierteln der Stadt antraf. Katharina, die in der letzten Nacht ins Haus des Salzkaufmanns gekommen war, um ihren Unmut loszuwerden, stammte aus Hamburg, einer Stadt, die sich nicht mit Lübeck messen konnte, aber eben einer Stadt. Obwohl frei von Dünkel, kam Katharina mit vielen Wöchnerinnen nicht zurecht. Mehr als einmal war es im Vorfeld der Entbindung zu Streit und Hader gekommen. Mehr als einmal hatte Trine Deichmann schlichtend eingreifen müssen, meist in der Weise, dass sie Katharina abgezogen und eine andere Bademome mit der Aufgabe betraut hatte.
Am Ende verteilte Trine Deichmann die bittere Medizin. Sie teilte Elsa Peurin mit, dass die vier städtischen Hebammenplätze derzeit belegt seien.
Darauf sagte Elsa: »Ich hörte, dass einer Frau in letzter Zeit nicht ganz wohl ist.«
Das traf zu. Elsa musste sich also vorher umgehört haben, denn Trine glaubte nicht, dass sie zufällig von der Krankheit der Emma Tüschen Kenntnis erhalten hatte, zumal Emma alles darauf anlegte, ihre Krankheit nicht publik werden zu lassen. Seitdem ihr Mann gestorben war, war sie auf jeden der 80 Gulden angewiesen, die sie für ihre Arbeit erhielt. Trine hielt ihr in jeder Weise den Rücken frei und hoffte, dass Emma sich wieder fangen würde. Deshalb machte sie der Anwärterin keine Hoffnung und war überrascht, als Elsa immer noch nicht aufgab. »Ich würde auch mitgehen«, sagte sie. »Die rechte Hand sein, helfen, wo Hilfe nötig ist.«
»Ohne Geld?«
»Der Lohn ist wichtig und auch gerecht. Auch er ist nicht alles.«
Elsa Peurin verstand es, ihre Worte gut zu setzen. Dennoch war Trine nicht wohl. Etwas an der Anwärterin ging ihr gegen den Strich, und sie atmete auf, als sich Elsa endlich verabschiedete.
Am ersten Tag des neuen Jahrhunderts waren die Kirchen der Stadt gefüllt wie selten. Die sechs großen Gotteshäuser kannten naturgemäß nur ein Thema: den Beginn einer neuen Ära, das Ende der alten und das ewige Fortschreiten der Zeit vor dem begrenzten Horizont des Menschen. Die wegweisenden Predigten waren im Rahmen der mitternächtlichen Gottesdienste gehalten worden. Im Dom hatte der Bischof zu Demut angesichts einer Schöpfung aufgerufen, der sich viele Menschen zu bemächtigen glaubten, bevor sie am Ende ihres Lebens erkennen müssten, wie klein ihr Anteil war und wie verwegen der Versuch, sich zu erheben.
Trine Deichmann war eine fromme Frau, niemand kam direkter mit dem größten Wunder des Lebens in Berührung. Wer anders als ein göttlicher Wille konnte den winzigen Gestalten Leben eingehaucht haben? Wer sonst sollte diese Macht besitzen? Die Fürsten? Menschen gab es länger als Fürsten. Die Pastoren? Trine kannte zu viele von ihnen, um das für möglich zu halten. Vielleicht hatte es einst eine Frau gegeben, die als Erste von allen Frauen aller Zeiten ein Kind auf die Weise zur Welt gebracht hatte, wie man es jetzt gewöhnt war. Vielleicht waren die kleinen Menschen bis dahin auf andere Weise zur Welt gekommen, in einem Ei oder durch bloßes Wünschen. Trine war weit zurückgegangen in der Geschichte der Menschen – weiter, als Joseph ihr zu folgen imstande war. Auf diesem Feld war sie allein, aber sie fühlte sich nicht einsam. Denn ob es so war oder sich anders zugetragen hatte, heute erleichterte sie kleinen Menschen den Weg auf die Welt und half ihren Müttern, die schweren Stunden zu meistern. Darauf war sie stolz. Sie hatte es in der Stadt zu einer Position gebracht, die ihr behagte. Trine Deichmann konnte selbstständig arbeiten, verantwortlich war sie allein einem Gremium patrizischer Frauen. In anderen Orten waren die Hebammen einem städtischen Arzt unterstellt. In ihrer Anfangszeit hatte Trine Ärzte kennengelernt. Ihre Unkenntnis auf allen Gebieten, die den Körper von Frauen, Geburt und Wochenbett betrafen, hatte sie schockiert. Die besseren Vertreter unter den Ärzten akzeptierten die traditionelle Aufgabenverteilung als beste Lösung für die, auf die es ankam: die schwangeren Frauen. Doch es gab auch andere Ärzte, sie betrachteten Hebammen als Konkurrenz und wollten für alle medizinischen Bereiche allein zuständig sein. Hebammen waren bei ihnen bestenfalls geduldet. Auch in Lübeck hatte es Jahre gegeben, in denen das Monopol der Hebammen auf der Kippe gestanden hatte. Am Ende war es der Einfluss patrizischer Frauen gewesen, der den Ausschlag gegeben hatte. Wenn sie kurz vor ihrer schweren Stunde standen, forderten sie eine Hebamme an und keinen Arzt. Sie taten das nicht, weil sie die Kenntnisse beider Parteien nüchtern und sachlich abgewogen hatten. Sie taten es, weil sie sich in Gegenwart einer Frau wohler fühlten. Es hatte dann einen spektakulären Todesfall gegeben – Roswitha Baas, Frau eines angesehenen Zuckerbäckers. Verantwortlich dafür war ein Medicus, den die Geburtssituation in Panik versetzt hatte, sodass er halb ohnmächtig aus dem Raum getaumelt war. Als eine Hebamme zur Stelle war, hatte Roswitha schon zu viel Blut verloren.
Die Hebamme war die junge Trine Deichmann gewesen. 12 Stunden hatte sie um das Leben von Mutter und Kind gekämpft. Damals hatte Trine noch nicht in städtischen Diensten gestanden. Als die Stadt eine neue Hebamme suchte, musste sie sich nicht bewerben. Sie wurde gebeten, das Amt zu übernehmen.
St. Aegidien war die kleinste Kirche der Stadt, Trine kam gern hierher. Einmal im Jahr gelang es ihr, Joseph zum Mitkommen zu bewegen, obwohl er Müdigkeit wegen der langen Nacht in der Gastwirtschaft vorschob. Sie hatten keinen weiten Weg.
Vom Gottesdienst bekam Trine nicht viel mit. Die vorgeschriebenen Bewegungen erledigte sie in halber Trance. Ab und zu rüttelte sie an Josephs Arm, worauf sein nach vorn gesunkener Kopf sich schuldbewusst zu ihr drehte. In Gedanken war sie im Haus des Salzkaufmanns. Der Auftritt von Heinrich Schelling hatte Trine mitgenommen. Der Tod war nicht das Ende der Welt, jede Hebamme ging mit ihm um und ertrug ihn, ohne zu verzweifeln. Aber zu dieser Familie gab es Beziehungen. Trine verstand Emma Tüschen, die es strikt ablehnte, in Häuser von Bekannten, Nachbarn und Verwandten zu gehen. Wenn man begann, mitzufühlen, war man angreifbar. Im Grunde hätte sich Trine jetzt erholen müssen, ausschlafen, essen, trinken, den Beginn des neuen Jahres feiern. Stattdessen dachte sie an die Kinder, Lili und den kleinen Paul. Schelling würde nicht so schnell wieder heiraten, auch nicht der Kinder wegen, zumal Lili schon 13 war und damit fast erwachsen.
Der Strom der Gläubigen quoll ins Freie. Das neue Jahrhundert war in aller Munde. Den Salzkaufmann entdeckte Trine im letzten Moment. Er saß in einer der hintersten Bänke, die man gemeinhin mied, weil es hier zog wie Hechtsuppe und es trotz der manierlichen Ausmaße des Kirchenraums weit war bis zur Kanzel. Der Kaufmann sah übermüdet aus. Er saß aufrecht, aber er wirkte nicht so, als würde er auf etwas Bestimmtes schauen. Die Frau neben Trine stieß ihrem Begleiter in die Seite und wies ihn auf den Mann in der Bank hin. Wussten sie es schon? Die Geschwindigkeit, mit der sich in Lübeck Neuigkeiten herumsprachen, war rasant. Schelling war ein prominenter Bürger. Man nannte ihn den Salzbaron, ein Ehrentitel, vom Vater übernommen, um dessen Erhalt der Filius hart kämpfen musste, denn die Konkurrenz war groß. Doch das Haus Schelling befand sich nicht auf dem absteigenden Ast. Als Mitglied des Magistrats setzte sich Schelling für das Wohl der Stadt ein. Er hatte die neue Bebauung durchgesetzt, seiner Frau hatten viele Arme, Witwen und Waisen Unterkunft und Verpflegung zu verdanken. In der letzten Zeit hatte sie die Errichtung von Stiftshöfen unterstützt, Wohnanlagen, in denen die Armen Aufnahme finden sollten.
Nach einem Schicksalsschlag wie dem der letzten Nacht war die Kirche ein angemessener Aufenthaltsort. Dennoch wunderte sich Trine Deichmann. Ihr war bekannt, dass der Salzkaufmann ein Freigeist war, ein milder Spötter, wenn es darum ging, naive Gläubigkeit zu geißeln. Auf seiner Fahne stand Vernunft. So wie er seine Firma führte, wollte er die Stadt und am liebsten das ganze Land regiert sehen. Die Religion stand da nur im Wege.
Einen Moment zögerte Trine. Sollte sie sich neben ihn setzen? Sie verzichtete darauf und nicht nur deshalb, weil Joseph mit Macht nach Hause strebte. Es war eine Aura um den Mann in der Kirchenbank, in die niemand eindrang.
Trine Deichmann spazierte Richtung Westen zum Heiligen-Geist-Hospital, Joseph, obwohl bereits leise grummelnd, blieb an ihrer Seite. Ständig erwiderten sie Grüße – von Menschen in vornehmer Kleidung und von anderen. Das Mädchen mit dem Tuch vorm Gesicht grüßte nicht, die junge Frau rempelte Trine grob an und eilte weiter ohne ein Wort der Entschuldigung.
3
Der Weg der Verhüllten durch die Gassen verlief auch im Weiteren nicht ohne Karambolagen. Es war nicht ersichtlich, ob sie vor etwas floh oder auf etwas zueilte. Sie verließ die besseren Viertel und wandte sich der Vorstadt zu, wo die Menschen schlechter gekleidet waren und Schweine zwischen den eng stehenden Häusern herumliefen. Die verhüllte Frau war in unauffälliges braunes Tuch gekleidet. Nur wer genau hinsah, konnte erkennen, dass dieses Tuch von feiner Qualität war. Mehrere Male bog sie ab und zögerte niemals. Als die Stadtmauer in Sicht kam, wandte sie sich nach rechts, lief zwischen zwei Häusern hindurch auf den Hinterhof und klopfte an die Tür eines schmalen, zweigeschossigen Gebäudes, das – obwohl nicht alt, dennoch windschief – mit einem halben Dutzend identischer Fassaden den Eindruck von Reihenhäusern vermittelte. Der Junge, der öffnete, trug ein schneeweißes Hemd mit einem kirschroten Fleck auf der Brust. Die Besucherin erschrak, aber da stand schon der Vater neben dem Kind und sagte, indem er einladend ins Innere wies: »Wir wissen, wie man ein neues Jahrhundert begrüßt.«
In der niedrigen Stube hielten sich mehr als ein Dutzend Menschen auf, bis auf eine erwachsene Frau und ein beinahe erwachsenes Mädchen alles Kinder. Das Jüngste konnte noch nicht laufen, das Älteste mochte 14 sein. Wiewohl alles in diesem Haus Armut atmete, waren die Kinder sorgfältig gekleidet. Alle Moden, die in den letzten 50 Jahren durch die Stadt gegangen waren, fanden sich an den schmächtigen Körpern wieder: knappe Hosen, überlange Kleider, Umhänge, seitlich geschlitzte Jacken, breite Gürtel mit imposanten Schnallen, Kapuze, Barett, Schleier, Haube.
»Ach, das ist schön!«, rief die Besucherin und wickelte sich aus dem Tuch. Zum Vorschein kam eine junge Schönheit, deren klassische Züge nur von der gen Himmel ragenden Nase nivelliert wurden. Die gelockten Haare waren eine Pracht, und das braune Samtkleid war kostbarer als alle anderen Kleidungsstücke im Raum zusammen.
Die älteste Frau erhob sich vom unbequemen Stuhl. Die wenigen Schritte zur Besucherin fielen ihr schwer und verzerrten das Gesicht, das plötzlich verhärmt aussah, während der Hausherr wie ein Hagestolz hin und her eilte, nach einem Kind schnappte und es der Besucherin präsentierte wie einen besonders wertvollen Hahn.