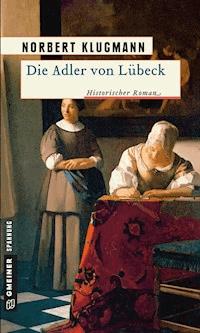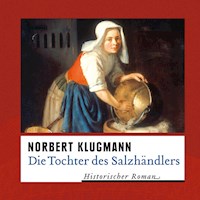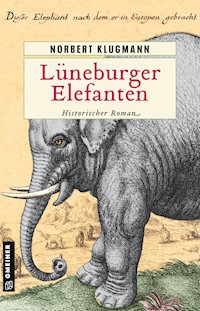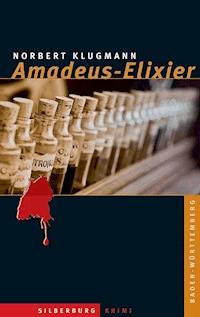Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Trine Deichmann
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Lübeck, Anfang des 17. Jahrhunderts. An einem frühen Maimorgen wird die Hebamme Trine Deichmann unsanft aus dem Schlaf gerissen. Vermummte bringen sie in einer Kutsche eilig Richtung Osten zu einem Schloss im Mecklenburgischen. Ein Zimmermädchen liegt dort in den Wehen und braucht ihre Hilfe. Was Trine nicht ahnt: Der Grund für die große Eile ist das in Kürze beginnende "Narrenreich", die 24-stündige Alleinherrschaft des Hofnarren Theophrastus von Bommelheim. Niemand darf in dieser Zeit die Residenz betreten oder verlassen. Auch Trine schafft es nicht mehr, rechtzeitig aus dem Schloss zu entkommen, denn Theophrastus hat seine Regentschaft eigenmächtig vorverlegt. Als am Abend nach einem Fest die Leiche eines Knechts gefunden wird, halten dies der Fürst und seine Gäste noch für einen großen Spaß. Doch dann lässt der Narrenkönig mehrere Galgen errichten. Und nur Trine Deichmann scheint angesichts des drohenden Blutbads einen klaren Kopf zu behalten ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Norbert Klugmann
Die Nacht des Narren
Historischer Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2008
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes »Streit des Karnevals mit der Fastenzeit« von Pieter Bruegel (Detail)
Gesetzt aus der 10,6/13,75 Punkt AGV GaramondMediäval
ISBN 978-3-89977-3022-0
Bibliografische Information
der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.ddb.de abrufbar.
1
Das Schwein guckte nach links, aber die Kutsche kam von rechts. Der Körper des Borstentiers geriet unter ein Vorderrad und wirkte dort als eine Art Bremse. Die beiden Pferde bäumten sich auf, der Kutscher ließ ihnen die Zügel, die Straße war so schmal, dass nicht daran zu denken war, seitlich auszubrechen. Das Schwein schrie wie am Spieß. Die Gestalt auf dem Kutschbock brüllte. Ihr Gesicht war bis auf einen Schlitz für die Augen von einem Tuch verhüllt. Pechschwarz saß die Gestalt vor der schwarzen Kutsche, deren eiserne Räder hart über das Kopfsteinpflaster rumpelten und noch lauter waren als die Hufeisen. Die Pferde wieherten, der Kadaver des Schweins flutschte weg und ließ die Kutsche wieder leicht laufen. Zwei Häuser weiter riss der Kutscher unnachgiebig an den Zügeln. Dampfend kamen die mächtigen Tierkörper zum Halten. Die Tür der Kutsche wurde aufgestoßen, drei vermummte Gestalten sprangen heraus. Sie vergewisserten sich, dass sie ungestört waren, und klopften an die Haustür aus zwei Flügeln. Als nicht reagiert wurde, schlugen sie mit behandschuhten Fäusten gegen das danebenliegende Fenster.
»Ja scheiß der Hund drauf, was für Vandalen veranstalten mitten in der Nacht so einen Lärm?!« Die kiebige Frauenstimme kam aus einem der oberen Fenster auf der anderen Straßenseite. Die Haustür wurde geöffnet, das verschlafene Mädchen, ein Tuch vor der Brust zusammengerafft, starrte die Gestalten an und wurde von ihnen ins Haus gedrückt. Ein Eindringling kümmerte sich um das Mädchen, die anderen beiden stürmten die Treppe hinauf. Der erste Gedanke des verängstigten Mädchens war: Sie sind nicht zum ersten Mal hier. Schockiert starrte sie auf den schwarzen Fleck, an dem bei Menschen das Gesicht sitzt. Es brannten nur die beiden Kerzen für die Nacht und sorgten für eine schreckliche Beleuchtung, denn man ahnte mehr als man sah, und die Gedanken waren frei, sich das Schlimmste vorzustellen.
»Was werdet Ihr mit mir tun?«, murmelte das Mädchen. Der schwarze Fleck grunzte, das Mädchen dachte: Es ist kein Mensch, es ist ein Tier. Die anderen vermummten Gestalten rissen im oberen Geschoss die Türen auf, dann standen sie Trine Deichmann gegenüber. In ihrem Schlafraum brannte kein Licht, dafür bezahlte der erste Eindringling einen hohen Preis, denn als der Schuss sich löste, hatte er noch nicht erkannt, dass die Hebamme eine Pistole hielt. Ein Schuss, ein Schrei, ein fallender Körper, der sich auf dem Boden zusammenkrümmte und die gut vernehmbaren Worte sprach: »Das Höllenweib hat mir ins Gemächt geschossen.«
»Nicht schießen!«, rief die zweite Gestalt. Bis eben hatte sie noch im Türrahmen gestanden, jetzt erklang ihre Stimme von weiter unten. »Ihr zieht Euch an, es ist sehr dringend!«, rief die unverletzte Stimme. In der Dunkelheit wurde hantiert: eilig, aber beherrscht.
Kerzen begannen zu brennen, Trine Deichmann hockte vor dem verletzten Mann und sagte: »Lasst die Hose fallen!« Diese Aufforderung versetzte den Mann in größere Aufregung als der Schmerz im Unterleib. Er weigerte sich und wollte lieber sterben, als sich vor einer fremden Frau zu entblößen. »Gut«, sagte Trine, »dann nutzt die letzten Minuten, bevor Ihr vor den Schöpfer tretet. Betet und bereut.«
»Aber Ihr könnt mich doch nicht…«
»Ich kann. Und ich werde.« Sie wandte sich an den zweiten Mann, der zwischen Schrank und Kommode hockte, und sagte: »Ich bin bereit. Wir brechen auf.«
Am Ende landeten sie doch zu viert in der Kutsche. Der mit der Verletzung presste beide Hände vor den Bauch und jammerte: »Ich ziehe Euch vor den Richter. Dafür werdet Ihr büßen.« Trine Deichmann schnaubte höhnisch und trug dem Dienstmädchen auf, hinter ihr aufzuräumen und alle Schäden zu protokollieren, die die Eindringlinge angerichtet hatten.
»Warum tut Ihr das?«, fragte der Unverletzte. »Haben wir Euch nicht immer anständig bezahlt?«
»Das Schwein hat sich nicht freiwillig auf die Straße gelegt.«
»Wer rechnet nachts mit frei laufenden Schweinen?«
»Wisst Ihr, was der Unterschied zwischen einem Bürger und Euch ist?«
»Ich bin schöner?«
»Nein, der Unterschied ist, dass ein Bürger in der Lage ist, ein Haus zu betreten, ohne Türen zu zerstören.«
»Ich blute«, stöhnte der Verletzte.
»Woher wollt Ihr das wissen? Es ist dunkel.«
»Ich habe daran geleckt.«
»Sehr mutig von Euch. Es könnte auch ein anderer Saft sein.« Trine tat der arme Teufel leid. Sie wusste, dass der Körper des Mannes Stellen besaß, an denen der Schmerz sich stärker sammelte als an anderen. Aber sie hatte sich so furchtbar erschreckt. Aus tiefem Schlaf war sie gerissen worden, der Traum war anregend gewesen und sie eine Königin, vor der alle knicksten. Genau die Art von Traum, die eine städtische Hebamme niemandem erzählen würde–außer ihrem Mann. »Ihr könnt froh sein, dass mein Joseph nicht im Haus war. Ihr wärt beide nicht aus eigener Kraft wieder herausgekommen.«
Insgeheim fluchte sie auf den Kerl und dachte: Du nimmst dir viel heraus in letzter Zeit. Wir müssen uns dringend unterhalten. Der Kutscher trieb die Pferde an. Nach Osten ging die Fahrt, sie rollten in den Morgen hinein. Im Mai konnten die Nächte noch sehr kalt werden, dennoch zog Trine den dicken Stoff vom Fenster fort. Sie fuhr nicht so oft Kutsche, um eine Fahrt nicht jedes Mal von Herzen zu genießen. Die Häuser der Stadt hatten sie schon hinter sich gelassen, der Weg führte in die mecklenburgischen Hügel, deren frisches Grün mit jeder Minute des jungen Tages an Kraft gewann. Der blutende Mann wurde immer schwächer. Sein Begleiter beugte sich zu Trine und flüsterte: »Soll ich ihm eine verpassen, damit Ihr nach ihm sehen könnt?«
»Nein, lasst ihn. Wer weiß, vielleicht kann der Frauenwelt nichts Besseres passieren als dass da unten endlich Ruhe herrscht.« Das Wimmern nahm zu, Trine griff in ihre Tasche, die fast jeder Lübecker kannte. Sie presste ihm ein Tuch auf die Nase, er wehrte sich, aber er war schwach. Zu zweit schickten sie ihn ins Land der Träume. Dann sah Trine nach dem Rechten. Eine Ader war nicht getroffen worden, die Kugel steckte auch nicht im Fleisch, sie war seitlich hindurchgeflogen, zwei Lappen Haut hingen herunter, Trine säuberte die Wunde, drückte die Hautlappen aufeinander und legte einen Verband an.
»Dafür, dass Ihr keine Ärztin seid…«, murmelte der zweite Mann.
»Nehmt Eure alberne Maske ab. Ihr solltet Euch schämen.« Trine befreite den Bewusstlosen von seinem Tuch. Darunter verbarg sich ein nicht mehr junges und gar nicht hässliches Mannsbild. »Wäre schade drum«, murmelte Trine. »Hat er Kinder?«
»Er befürchtet ja. Aber er weiß es nicht.«
»Ich verstehe, warum Ihr bei mir klopft und nicht beim Bischof.«
»Er wurde auch eingeladen, aber er hatte keine Zeit.«
»Er ekelt sich vor Euch und Eurer Gesellschaft.«
»So redet Ihr nur mit mir, weil Ihr denkt, Ihr könnt es Euch erlauben.«
»Und? Kann ich’s nicht? Wollt Ihr Eure sorgfältig manikürten Finger in den blutenden Leib der Schwangeren stecken?«
Er schwieg. Nur sein Gesicht verriet, dass er mit Vorstellungen kämpfte, die sein geistiges Auge nicht sehen wollte. Der Weg–weißer Sand durch Wiesen voll appetitlichem Grün–führte bergan. In einer lang gezogenen Kurve, die kein Ende nahm und so sanft anstieg, dass man sich beim Blick nach hinten wunderte, wie hoch man schon gekommen war, fuhr die Kutsche auf die Hügel zu. Dann kam der Scheitelpunkt, ohne Ankündigung lag das Schloss vor einem, davor Teich und Garten, dahinter im glasigen Dunst des Morgens das Meer, flach, friedlich, ohne Wellen–und über ihm der Himmel. Noch zwei Stunden, und das Meer würde überdacht sein von mildem Blau, darunter das Blaugrau des Wassers, davor die Bäume, Wiesen und Gärten mit so vielen Grüntönen, wie es Arten gab.
Trine Deichmann konnte sich nicht erinnern, dass sie um einen Halt gebeten hatte. Jedenfalls stand die Kutsche, als sie nach langer Zeit der Träumerei wieder wahrnahm, was um sie herum vorging. Sie sah den Mann an und sagte verschämt: »Ich kämpfe dagegen an. Es ist nichts als Gras und Baum und Wasser. Aber diese Komposition…«
»Ihr seid ja eine Dichterin. Und ich dachte, ihr Hebammen versteht euch nur auf handfestes Zupacken.«
2
Die junge Frau erblickte die Hebamme und begann zu pressen. Vier Frauen standen um sie herum, die sich nun schlagartig zu bewegen begannen. Es war, als hätten alle auf Trines Ankunft gewartet. Der Raum war klein, aber hell. Trine sorgte dafür, dass die Tücher vom Fenster kamen, damit es noch heller wurde. Sie wusch Hände und Arme und warf auf alles einen Blick. Sauber war’s und warm. Das Bett war nicht so weich, dass die Schwangere in ihm ersoffen wäre. Warmes Wasser stand zur Verfügung, die Küche war gleich um die Ecke. Man hatte der Schwangeren einen Tee aus Kräutern und starken Gewürzen zu trinken gegeben. Davon wurde die Gebärmutter warm, und alles würde leichter gehen
Drei der vier Frauen waren Kolleginnen der Schwangeren, die nicht älter war als 16. Vierschrötig, praktisch, zupackend waren die Frauen, genau die Art, die Trine schätzte, denn solche Frauen schwatzten nicht, sie packten zu, und selbst beim größten Hindernis kippten sie nicht aus den Latschen.
»Sie wollte viele Treppen steigen«, sagte die älteste der Frauen zu Trine. »Achthunderteinundachtzig. Ich wollt so gern die tausend schaffen«, keuchte die Schwangere. Gunda war ihr Name, sie war eins der Zimmermädchen auf dem Sommersitz.
Trine dachte: Hoffentlich gibt es einen Vater. Das Mädchen war drall und gut durchblutet, das Haar lang und dick, was man von ihrem Körper im Bett entdeckte, ließ Trine zu der Meinung kommen, ein heißblütiger Graf, Baron oder Freiherr könnte bei ihrem Anblick leicht in Wallung geraten sein, sodass er erst die gute Erziehung und dann die Kleidung fallen gelassen hatte, um zu tun, was er für seine Natur und sein Recht hielt. Viele Frauen entwickelten in den Stunden vor der Niederkunft bizarre Vorlieben. Manche wollten singen, manche verlangten nach frischer Luft. Die eine zog’s in den Zuber, diese wollte Treppen steigen. Das Kind lag gut, der Kopf zuerst. Weit weg von Lübeck musste Trine nicht damit rechnen, dass ihr ein übereifriger Arzt ins Handwerk pfuschte.
Plötzlich stand er in der Tür, die Frauen ließen sich durch sein Erscheinen nicht stören, nur Trine Deichmann starrte ihn an. Sie dachte sofort: Du musst woanders hingucken, was soll er von dir denken? Aber sie starrte ihn an, er nahm es hin, als habe er nicht im Ernst damit gerechnet, dass eine Fremde so tun könnte, als würde sie nicht wahrnehmen, was sie doch zweifellos sah: einen verwachsenen Mann, nicht größer als ein Kind von zehn Jahren, aber mit dem Gesicht eines Erwachsenen. Sein Rumpf war dick wie eine Trommel, die Beine wirkten darunter bleistiftdünn. Schief sah er aus, als sei ein Bein kürzer und er könnte im nächsten Moment zur Seite kippen. Sein Haar war lang bis über die Schultern. Dermaßen schwarzes Haar konnte er nicht von der Natur bekommen haben. Auch die Augenbrauen wirkten künstlich. Die Gegend um den Mund war mit Schönheitspflästerchen übersät. Wer hatte diesem armen Menschen das bloß angetan? Oder hatte er sich aus eigenem Antrieb so verunstaltet? Er trug ein rotes Wams von bestem Tuch, aus den Ärmeln lugte weiße Spitze. Auch um den Hals und vor der Brust bauschte sich Spitze. Er konnte sich darin unmöglich wohlfühlen.
Je länger man diesen Menschen ansah, umso mehr fand man, was an ihm alles nicht stimmte. Etwas war mit seinen Augen, eins guckte anders als das andere, aber er schielte nicht. Und die Stirn! Sie war zu mächtig für den schmächtigen Körper. Allerdings war der Kopf im Verhältnis zum Rest zu groß. Trine hätte gern einen Blick auf seinen Hals geworfen. Irgendetwas war mit dem Hals, auf einmal bekam die viele Spitze eine andere Bedeutung.
Und dann sprach das Männlein: »Helfen will ich, und Ihr sagt mir, was ich tun kann.«
Trine ließ die Worte in sich nachhallen. Wie konnte aus diesem kleinen Körper so eine volltönende Stimme kommen? Hatte dieser Zwerg eine Lunge mit drei Flügeln?
Nun wandte sich die älteste der Frauen an den Mann: »Macht Euch unsichtbar. Hier ist das Reich der Frauen.«
»Wollt Ihr damit sagen, ich gehöre ins Reich der Männer?«
Sie musterte ihn, ihre Kiefer mahlten. Sie rang mit einer Antwort, und sie würde nicht schmeichelhaft ausfallen. Aber Gunda verlangte nach Aufmerksamkeit, so blieben die verletzenden Worte ungesagt. Trine sagte: »Ich bin Trine Deichmann aus Lübeck.«
Er vollführte einen Diener. Trine hatte vorher gewusst, dass die Bewegung geziert und unnatürlich aussehen würde. Er sagte: »Das ist mir bekannt. Das ist jedem bekannt. Ich freue mich, Euch kennenzulernen, ich wünsche mir das lange schon. Vielleicht werdet Ihr Euch heute Abend fragen, mit wem Ihr heute Morgen gesprochen habt«, sagte das Männlein. Erneut ein Kratzfuß. »Theophrastus von Bommelheim.«
»Narrenheim«, murmelte eine der Frauen ohne aufzuschauen. Aber das Männlein hatte sie wohl verstanden.
»In der Tat bekleide ich das hohe Amt des Narren und bin nicht wenig stolz darauf. Gar manches Mal habe ich einige der Anwesenden zum Lachen gebracht.«
Gunda schrie, Trine warf dem Narren einen Blick zu, der kleine Mann zog sich zurück. »Was der wohl helfen will«, knurrte eine der Frauen. »Der weiß doch nichts vom Leben. Der weiß doch alles nur aus Büchern.«
Gunda veranstaltete kein Theater. Kein Zauberstein, keine Schlangenhaut, keine magischen Gegenstände, ein einziges Amulett hielt sie in der Hand und wollte es nicht hergeben. »Es ist vom Liebsten«, flüsterte eine der Frauen Trine zu. »Ich habe draufgebissen. Es ist echt.«
In den nächsten Minuten kam Trine, ohne es zu wollen, immer wieder neben die Vierte der Frauen zu stehen. Von den anderen kannte sie mittlerweile Namen und Rang im Schloss. Nur die Vierte hielt sich bedeckt. Trine Deichmann war eine kluge Frau. Sie kam mit jedermann gut aus, egal von welchem Stand er war. Aber sie konnte es nicht vertragen, wenn man sie anschwieg. So ging sie die Frau offensiv an, stellte Fragen, lobte ihre Umsicht und unterstellte, als alles nichts half, dass sie »vom Fach« sei.
»Ach was«, knurrte die Frau, »ich bin Wilhelmine, die mit den Hunden kann.«
»Pardon, ihr seid… was?«
»Hunde. Ihr kennt sicher Hunde.«
»Ja, ja, aber… wieso?«
»Sie gehorchen nur ihr«, mischte sich die Älteste ein. »Der Fürst hat die beiden tollsten getötet und dachte, es wird Ruhe sein. Aber sie hören nur, wenn Wilhelmine die Befehle gibt. Sie sagt das Gleiche wie der Fürst, sie darf nichts anderes sagen, kein Wort darf sie verändern. Aber bei ihr parieren die Hunde, und bei ihm gähnen sie.«
Das wollte Trine genauer wissen, aber nun kam Bewegung in Gundas Bett. Sie begann zu schreien, aber sie schrie nur, weil alle ihr dazu rieten. Eine Frau machte ihr Schreie vor, und Gunda schrie wie sie, aber bei ihr klang es wie ein Vögelchen. Bald schnaufte sie nur und sagte, so sei es ihr angenehmer.
»Im Wochenbett sind die Frauen so frei wie nirgends sonst«, behauptete Wilhelmine.
Das Kind glitt aus Gunda, als sei sie auf der Welt, um eine leichte Geburt zu haben. Niemand im Raum war verblüffter als die junge Mutter. »In einem Rutsch«, murmelte sie. »Ich verstehe nicht, warum sich alle so anstellen.«
Trine verstand es und die anderen Frauen auch. Aber jetzt war nicht Tag und Ort, um es Gunda zu sagen. Die junge Mutter war noch so aufmerksam, die Hebamme um ein besonders langes Stück Nabelschnur zu bitten. »Er wird sich freuen, wenn er ein langes Glied hat und nicht damit vorliebnehmen muss, was zufällig für ihn übrig blieb.« Sie bestand darauf, dass kein Stück von der Nabelschnur achtlos fortgeworfen würde. Jede zweite Mutter wollte es als Talisman behalten, mochte es in getrocknetem Zustand auch wenig hermachen. Immerhin verzichtete sie darauf, die Hebamme aufzufordern, den Kopf des Kindchens zu formen und zu modellieren. Möglich wäre es gewesen, denn die Knochen waren weich und nachgiebig. Die blutjunge Trine Deichmann hatte sich einige Male dazu hinreißen lassen, das Würmchen nach eigener Vorliebe zu gestalten.
Der Säugling wurde gereinigt und eingepackt. Seine Augen waren offen und klar, er hatte gekräht, um die Lungen zu erproben. Dann hatte er geschwiegen, um die Nerven der Anwesenden nicht zu strapazieren. »Eine langweilige Geburt«, murmelte Wilhelmine. »Da ist es ja schwieriger, ein Kaninchen zu schießen.«
»Das sind mir die liebsten«, entgegnete Trine. »Schnell, leicht, sicher. Alles lebt, alles lacht.«
Die Frauen stießen mit einem Gläschen Likör auf den glücklichen Verlauf an. Gunda wurde nun schlagartig müde, aber erst legten sie das Kind an. Anfangs fand der kleine Dussel die Brust nicht, und als er sie fand, behauptete Gunda, sie sei gebissen worden und man solle etwas dagegen unternehmen. Dann schliefen beide beim Trinken und Säugen ein: Mutter und Kind fielen die Augen zu, die Köpfe sanken auf die Seite, das Kind wurde in die Wiege gelegt, ein zierliches Bett aus bunt bemaltem Holz.
Jetzt konnte Trine endlich ihrer Neugier die Zügel schießen lassen. Es gab einen Rittmeister, nicht mehr jung und schon Witwer, der gerne mit den jungen Mädchen herumpoussierte und wohl selbst am meisten erschrocken war, als die Schwangerschaft feststand. Einige Wochen brauchte er, um einen Posten auf einem Landgut im fernen Osten zu finden. Niemand begriff, was ihn in die Flucht getrieben hatte. Finanziell war er gut gestellt, und Gunda wusste, was ein Mädchen von ihrem Stand verlangen und was es besser unterlassen sollte. Zu befürchten hatte er also nichts, dennoch brach er auf und war seitdem nicht mehr gesehen worden.
»Männer«, spuckte die älteste Frau verächtlich aus, »es ist kein Segen mit ihnen. Wir müssen einen Weg finden, sie überflüssig zu machen.«
»Ihr meint beim Kinderkriegen.«
»Sind sie es auf allen anderen Gebieten nicht schon längst?«
Darauf tranken sie noch ein Glas. Das dritte spendierte Trine aus der Flasche, die sie stets für den Fall dabeihatte, dass sich die Geburt in die Länge zog und schwache Nervenkostüme zu stabilisieren waren.
Sie erkundigte sich, ob die junge Mutter mit ihrem Kind auf dem Schloss bleiben dürfe oder ob man sie, wie üblich, in eine ungewisse Zukunft verjagen würde. Es sah gut aus für Gunda. Seit dem Tod seiner Frau war der Fürst weicher geworden. Um Fragen des Personals kümmerte er sich nicht; was der Hofmarschall beschloss, ging an ihm vorbei. Manchmal gab es aber eine Ausnahme, Trine konnte sich nicht vorstellen, dass ihre »Entführung« am Morgen eine eigenmächtige Aktion von Untergebenen des Fürsten gewesen war. Gerne hätte sie mit ihm gesprochen, und wenn es nur dazu gewesen wäre, ihm für seine Fürsorge zu danken. Aber ihre Stellung ließ es nicht zu, unangemeldet vor dem Fürsten zu erscheinen. Zwar herrschten in einem Sommersitz nicht so strenge Regeln wie im Stammschloss, doch dann sagte die älteste Frau: »Ich muss in die Küche zurück. Das Narrenreich beginnt gleich, alle sind schon wie von Sinnen.«
Trine Deichmann kannte diese Sitte vom Hörensagen. In den Residenzen, an denen Narren lebten, erhielten die Spaßmacher einmal im Jahr Gelegenheit, ein kurzweiliges Regiment zu errichten, bei dem es drunter und drüber ging, bei dem viel gegessen und noch mehr getrunken wurde und das in der Nacht mit einem Feuerwerk endete. Um das Feuerwerk tat es Trine leid, sie würde es verpassen.
»Ich breche auf«, sagte sie, »dann bin ich mittags wieder zu Hause.«
»Vergesst nicht, Euch bezahlen zu lassen«, sagte Wilhelmine im Hinausgehen.
Die Kutsche war verschwunden, Trine wartete. Einige Male überquerte ein Bediensteter den Paradeplatz vor dem Haupteingang. Jedes Mal geschah es im Laufschritt. »Eilig, eilig«, rief ein Dienstmädchen lachend und trabte mit zwei Armen voll Tischwäsche ins Schloss. Trine wurde ungeduldig, das ging bei ihr manchmal sehr schnell. Sie schlenderte zum Haupttor, weil sie von dort Stimmen gehört zu haben glaubte. Tatsächlich fand sie ihren Entführer im Gespräch mit zwei Uniformierten. Wie aus einer vergangenen Zeit sahen sie aus in ihren Rüstungen. Beide hatten Hellebarden mit langem Holzschaft und einem Beil an der Spitze. Tapsig wirkten sie. Konnte man in diesen schweren Rüstungen überhaupt laufen?
»Die Geburt ist glücklich verlaufen«, berichtete Trine. »Ihr müsst mich bezahlen, und dann warte ich auf die Kutsche.«
Die beiden Rüstungen glucksten vergnügt. Trine nahm das nicht ernst, hier schien es vor Narren zu wimmeln.
»Keine Kutsche«, sagte einer zu Trine.
Sie reagierte nicht, sie verstand ihn auch nicht. Ernst nahm sie ihn sowieso nicht. Aber dann stellten sich die beiden dicht vor Trine und platzierten ihre Hellebarden so auf den Boden, dass sie sich genau vor Trines Gesicht kreuzten.
»Lasst das«, knurrte sie und wollte die Lanzen zur Seite schieben. Das gelang ihr nicht. Fragend blickte sie ihren Entführer an.
Er zuckte die Schultern und murmelte: »Euer Geld sollt Ihr bekommen. Aber bis dahin habt Ihr 24 Stunden Zeit. Willkommen im Narrenreich.«
Bei Trine fiel der Groschen nicht. So sagte der Entführer: »Unser kleiner Narr hat den Termin vorverlegt. Das Narrenreich beginnt nicht um 12 Uhr mittags, sondern es begann bereits vorhin. Ich schlage vor, Ihr macht das Beste draus. Es wird Euch an nichts fehlen.«
»Ich werde ja wohl noch durchschlüpfen dürfen«, sagte Trine leichthin. Als sie die Blicke verfolgte, die die Männer wechselten, verflog ihre Zuversicht.
»Ein Tag Narrenreich«, sagte einer mit der Lanze. »Niemand kommt hinaus, niemand kommt herein. Wer Glück hat, überlebt.«
3
Trine Deichmann akzeptierte die Zurückweisung nicht. Was war das Narrenreich? Warum steckten die Wachen in altmodischen Rüstungen? »Sagt mir endlich Euren Namen«, forderte sie ihren Entführer auf.
Als er sie anblickte, erkannte sie, wie erschöpft er war. Das konnte nicht nur an der Kutschfahrt liegen, es lag wohl an den Stunden vor Beginn der Fahrt. Wässrig die Augen, faltig die Haut. Trine dachte: Wir kommen alle in die Jahre.
Er hieß Graf Teiler von Harnack. Trine wusste sofort, dass das nicht sein konnte. Niemand hieß Teiler. Aber er lebte in einer Welt, die nicht die ihre war. Sie kannte sich auf Schlössern und Burgen nicht aus. In diesem Sommersitz war sie heute zum dritten Mal. Mehr als eine Handvoll Räume hatte sie nie gesehen, außer mit dem Fürsten und Harnack hatte sie nur mit Bediensteten und den Schwangeren gesprochen. Wenn sich ein Mann bei der Schwangeren aufgehalten hatte, war er der Vater gewesen oder aus anderen Gründen nicht ansprechbar. Männer waren nicht günstig in diesen Stunden. Deshalb rochen sie auch nach Branntwein, deshalb standen sie ständig im Weg und stellten blödsinnige Fragen. Trine kannte sich in Lübeck aus, der großen Stadt im Norden mit ihren 25.000 Einwohnern, dem großen Hafen und den Verbindungen in alle Orte des nördlichen und östlichen Baltischen Meeres. Sie kannte viele arme und nicht wenige wohlhabende Bürger, mit einigen war sie seit Langem bekannt. Von einigen hatte sie Geschenke erhalten, und zumindest die Frauen erinnerten sich an Trine Deichmann als eine Person, die in den hektischsten und angsteinflößendsten Momenten Ruhe ausstrahlte, die dirigierte und anordnete, die nie zu sagen brauchte »Ich bin die Klügste«, weil das dem Dümmsten nach zehn Minuten klar wurde.
Trine Deichmann war die dienstälteste der vier städtischen Hebammen. Sie stand den Frauen in ihrer schwersten Stunde bei und verlangte für ihre Arbeit kein Geld, weil sie es von der Stadt erhielt. Ihr Ruf war weit gedrungen, so war der Fürst auf sie gekommen, denn mit Lübeck im strengen Sinne hatte er nichts zu tun und legte Wert darauf. Manchmal stand die Hütte, in der sich neues Leben ankündigte, vor den Toren der Stadt. Manchmal befand sie sich nicht mehr auf Lübecker Gebiet. Trine sah das nicht so eng, und weil sie es mit der Mogelei nicht übertrieb, ließ man es ihr durchgehen.
Wenn die Hütten so weit entfernt waren, dass man von ihnen nicht mehr die höchsten der Lübecker Kirchtürme sah, hatte Trine Deichmann nichts zu tun. Hier draußen herrschten die weisen Frauen, die gleichzeitig als Heilerinnen arbeiteten und manches Zauberkunststück auf Lager hatten. Aber bevor sie es zeigten, wurden die Türen geschlossen und die Fenster verhängt, denn der Übergang zur Hexerei war ein fließender, und so gern jedermann die Kunst der Hexe in Anspruch nahm, so sehr wurden die weisen Frauen von offiziellen Stellen argwöhnisch beäugt. Sie stellten keine Gefahr dar, man verfolgte und drangsalierte sie nicht. Aber man wollte sie nicht sehen und von ihrer Arbeit nichts wissen. Einmal im Jahr regte sich ein Medicus über eine Hexe auf und schlug Krach, wie es so albern nur ein Mann tun konnte. Dann nahm man den Zürnenden zur Seite und führte ihm vor Augen, dass er auf dünnem Eis wandelte. Denn wer sich eine Hexe zum Feind machte, sollte vorher wissen, auf was er sich einließ. Wenn er erst einmal im Baum oder an der Spitze eines Kirchturms hing, würde es zu spät dafür sein. Zwar glaubte der Medicus nicht an fliegende Menschen, aber er wollte nicht der Erste sein, bei dem er das Gegenteil erlebte. So ebbte der Aufstand ab, der Medicus richtete seinen Blick nach Lübeck, und die weisen Frauen verhielten sich still und leise und taten weiter das, was sie seit langer, langer Zeit getan hatten. Trine Deichmann kannte sie alle, aber Trine Deichmann konnte zur rechten Zeit reden und zur rechten Zeit schweigen. Vor allem achtete sie darauf, nicht mit den falschen Frauen gesehen zu werden. So kam es, dass ihr Kontakt zur Unterwelt sich auf die Besucher in der »Fluchbüchse« beschränkte, dem Gasthaus ihres Mannes Joseph.
»Soll ich Euch ein Zimmer anweisen?«, fragte Harnack. »Aber Ihr werdet nicht zum Schlafen kommen.«
Trine blickte ihn an, sie blickte in die eisernen Gesichter der Wachen. Sie war früh aufgestanden, aber sie träumte nicht. »Niemand weiß, wo ich mich aufhalte«, behauptete sie. »Man wird nach mir suchen. Ich muss jederzeit erreichbar sein, das gehört zu meinem Beruf.«
»Es gibt eine Gewalt, die höher ist als der Beruf«, entgegnete Harnack.
»Ihr wisst so gut wie ich, dass Ihr einem Lübecker nicht damit kommen dürft, dass das Wort eines Fürsten schwerer wiegt als das eines Patriziers.«
»Auch Lübecker lieben die Pracht und das Funkeln. Aber Ihr flunkert ja. Denn Euer Mädchen weiß Bescheid und wird alles ausrichten. Wie viele Kolleginnen habt Ihr unter Euch? Das Kinderkriegen wird nicht gleich zum Erliegen kommen, nur weil Trine Deichmann sich verspätet–ganz zu schweigen vom Kindermachen.«
Wo er recht hatte, hatte er recht. Aber er kannte Joseph Deichmann nicht. Der war schon bei alltäglichen Händeln zu mancherlei Unruhe fähig. Aus Sorge um seine Frau konnte er so mächtig sein wie eine kleine Armee. Trine blickte nach Westen, wo die Hügel unter einem immer blauer werdenden Himmel lagen. Dort würde Joseph mit seiner Armee auftauchen. Dort oben würde er überlegen, wie er weiter vorgehen würde. Nein, Harnack hatte recht. Joseph konnte am Tor rütteln und durch den Wassergraben waten, der das Anwesen umschloss. Spätestens dann würde er begreifen, dass hier ein Fest stattfand, ein Mummenschanz, eine Scharade, wie Trine Deichmann sie noch nie erlebt hatte. Sie spürte, wie die Neugier den Ärger zur Seite schob.
»Zeigt mir mein Zimmer«, sagte Trine zu Harnack.
Er zuckte zusammen, als sei er dabei gewesen, im Stehen einzuschlafen. Vom Haupttor und der Mauer ging man über den Rasen auf das Schloss zu. Streng genommen handelte es sich bloß um ein Herrenhaus, aber für jeden, der in einer Hütte lebte, war es ein Schloss. Die Lübecker besaßen eine Art, kräftig in die Breite und Höhe zu bauen, wenn sie zeigen wollten, was sie darstellten. Auch der Stammsitz des Fürsten weiter im Osten geizte nicht mit Türmen, Bergfried, hohen Mauern. Er besaß nichts von der Leichtigkeit eines modernen Schlosses, war noch ganz wehrhafte Burg, zu der die Wachen in den Rüstungen passten. Hier draußen, dicht am Meer, war alles verspielter und von menschlichem Maß. Man konnte sich dieses Schloss auch als Gutshof vorstellen, denn die Nebengebäude für Landwirtschaft und Vieh waren unübersehbar und nicht schamhaft in einer hinteren Ecke versteckt. Nur der Eingang sagte: Ich habe Macht, und du gehörst hier nicht her. Eine breite Treppe lief von zwei Seiten ins erste Geschoss hinauf, von wo man in den Eingangsbereich gelangte. Ein unteres und darauf zwei weitere Geschosse, weiß und in hellem Gelb getüncht und kaum verziert: So präsentierte sich der Sommersitz von seiner Schauseite. Wenn man ihn zum Meer hin umrundete, gelangte man auf den Hof. Auf zwei Seiten liefen Nebengebäude bis weit nach hinten, wo der große Nutzgarten anschloss. Von ihren früheren Besuchen wusste Trine, dass französische Gärten Pate gestanden hatten: eine zentrale Achse, deren gerade Wege seitlich in Kurven und Schnecken übergingen. Rechts außen das Labyrinth aus Liguster, höher als ein Mann groß war und von einer Weitläufigkeit, dass nur mutige Neulinge sich ohne kundige Begleitung in das Land Nirgendwo hineinwagten. Im Park selbst wechselten sich Rabatten mit niedrigen Blumen und solche mit mehrjährigen Stämmen und Büschen ab.
Jetzt im Mai zogen die Büsche noch alle Blicke auf sich. Was im Sommer erblühen sollte, reckte schüchtern die zarten Köpfe zur Sonne hin. Hier im Osten und dicht am Meer kam alles später als in dem nur eine Stunde Kutschfahrt entfernten Lübeck. Rechts, das wusste Trine, sie sah es nicht, lagen die Pferdeweiden. Dort fraßen sich die Gänse bis zum Herbst fett und rund; dahinter zogen Schafe und Ziegen in gemischter Formation über das Grün. Hier draußen ging alles einen gemächlichen Gang. Es waren die verlangsamten Abläufe aller Lebensäußerungen, die den Sommersitz seit nun zwei Jahrzehnten in die Herzen des Fürsten und seines Vaters gerückt hatten. Hierher zogen sie sich zurück, wenn ihnen der Rummel in der Residenz auf die Nerven ging. Begleitet wurden sie von einem abgespeckten Hofstaat, der aber noch mehr als 50 Personen stark war, zu denen die wenigen gezählt werden mussten, die ganzjährig hier lebten und im nasskalten Winter dicht zusammenrückten, wenn Russland und das Baltikum übers Meer eisige Luft und Schneemassen schickten, unter denen man sich duckte und die Tage zählte, bis im März die Luft nach Frühling zu schmecken begann.
Trine dachte: Wo sind sie alle plötzlich geblieben? Vor zwei Stunden hatte noch eiliges Hin und Her geherrscht, jetzt lag der weitläufige Hof menschenleer da.
Auch Harnack an ihrer Seite fiel die Leere auf. »Sie werden ihre Kugel kriegen«, murmelte er. Er sah, dass Trine nichts verstand. »Kommt mit mir«, sagte er.
Wie aufs Stichwort ertönten in der Werkstatt mit den offenen Türen Schläge auf hartem Eisen. Während der Hammer weiter schlug, kam aus der offenen Tür eine Frau. Sie war nicht mehr jung und noch nicht alt. Sie trug ein Kleid wie eine Nonne. Vor allem trug sie die Kugel. Mit beiden Händen hielt sie den schweren Ball, von dem eine Kette bis zu ihren Füßen ging. Wo und wie die Kette festgemacht war, sah man wegen des langen Kleides nicht. Aber die Kugel war schwer und machte jeden Schritt zu einer Anstrengung. Die Frau entdeckte die Zuschauer und murmelte: »Ich hatte schon seit Wochen keine gute Laune mehr. Jetzt weiß ich, warum.«
Fassungslos sah Trine der Frau hinterher, die sich mit schweren Schritten aufs Haupthaus zuschleppte.
»Sie hat in der Lotterie verloren«, erklärte Harnack. »Jeder von uns musste das Los ziehen, und drei bekamen die Kugel. Im letzten Jahr hatte ich das Vergnügen. Er wollte, dass jeder jedes Jahr die Kugel kriegen kann. Wir haben gedroht, ihn ins Meer zu werfen, erst dann gab er Ruhe.«
Trine Deichmann war eine Frau von schneller Auffassungsgabe. Das war auch notwendig, denn in der qualvollen Enge einer Wöchnerinnenstube, die immer überheizt war und in der zu viele Menschen durcheinanderliefen, fehlte die Zeit, um vollständige Sätze zu äußern. Oft musste ein Fingerzeig reichen, und wenn die entscheidenden Minuten gekommen waren, hätten Nachfragen Zeit gekostet, die nicht zur Verfügung stand. Aber diesmal hatte sie nichts verstanden, gar nichts, und teilte dies Harnack mit.
»Ich mache Euch keinen Vorwurf«, sagte er. »Ihr lebt in einer Welt, in der alles vernünftig ist. Ich lebe hier.« Mit großer Geste wies er in die Runde.
Aus der Richtung der Weiden erschien ein älterer Mann. In beiden Händen trug er eine große Zahl von Gänseküken. Alle waren winzig, kaum in dem Alter, in dem man sie Gössel nennt. Ein Draht führte durch ihre Hälse, so konnte der Mann in beiden Händen wohl jeweils 30 Tiere tragen. Er sah nicht glücklich aus, als er an Trine und Harnack vorbeischlurfte. »Ich bin der Schlachter«, murmelte er, »ich darf mich nicht beklagen. Ich schlachte, was gewünscht wird. Ich habe schon Kälber aus dem Leib der Mutter geholt, weil es jemanden gab, der wissen wollte, ob sie anders schmecken, wenn ihre Füße unsere Welt noch nicht betreten haben. Aber dies hier… dies ist nicht richtig. So klein, so klein.« Anklagend hielt er ihnen die Ringe mit den Gänseküken entgegen, dann ging er weiter.
Trine fragte: »Ist das dieser Sinn für groteske Situationen, von dem man in der Stadt erzählt? Lebt Ihr so? Warum lebt Ihr so?«
»Guckt mich nicht an«, murmelte der Graf. »Ich esse auch lieber eine ausgewachsene Gans. Das ist eine seiner Ideen. Und ich versichere Euch: Er hat hundert weitere Ideen, Ihr habt noch keine seiner zehn äußersten gesehen.«
Aus einer Werkstatt, die neben der Schmiede lag, trugen zwei Männer Bretter ins Freie. Sie legten sie dicht an der Hinterwand des Schlosses ab und holten weitere Bretter. Als alles zusammen war, auch Seile und Riemen, begannen sie, ein Gerüst zu bauen.
Trine sagte: »Lasst mich raten: Dies ist nicht die Vorbereitung für Malerarbeiten.«
»Ihr werdet lachen: Genau das ist es. Jedes Jahr findet das Duell der Farben statt. In diesem Jahr tritt Schwarz gegen Blau an. Blau hat im letzten Jahr gewonnen und wird auch diesmal wieder vorn erwartet.«
Auf einer Front von vier Metern Breite, so hoch wie die Fassade, würden am Nachmittag jeweils zwei Mannschaften gegeneinander antreten, um zu sehen, welche Farbe am schnellsten malte.
»Aber es liegt nicht an der Farbe, sondern an den Malern«, sagte Trine kopfschüttelnd.
»Das sagt Ihr nur, weil Ihr noch nicht darüber nachgedacht habt. Er hat Nächte darauf verwandt. Sprecht ihn darauf an und schließt mit dem Leben ab, denn seine Antwort wird erst zu Ende sein, wenn Ihr am Boden liegt und Euch vor Schmerzen windet.«
»Also ist das Narrenreich ein Jahrmarkt. Ein großer Spaß.«
»Groß ist es. Ein Jahrmarkt ist es nicht. Und ob es ein Spaß ist…?«
So verzagt hatte Trine den Grafen noch nicht erlebt. Er war ein Haudrauf, genau der Typ, den man nachts mit der Kutsche durch die Lande schickt, damit er die Hebamme zu einer Schwangeren entführt.
Durch den Eingang, den die Lieferanten nahmen, gelangten sie in die Küchenräume. Hier war Trine schon gewesen und hatte sich damals über die vollständige Ausstattung und die Größe gewundert. Gegen diese Räume war die gewiss nicht kleine Küche in Josephs Gasthaus ein Fliegenschiss. Alles war vom Feinsten: die Herde wie für die Ewigkeit gemauert; die kupfernen Töpfe und Pfannen so blank gewienert, als müssten sie als Spiegel dienen; die Holzvorräte so sinnvoll um den Herd gestapelt, dass man nach nur zwei Schritten einen Scheit in der Hand hielt. Überhaupt war dies eine Küche der kurzen Wege, was umso mehr auffiel, weil sie 20 Schritte in der Breite und noch mehr in der Tiefe maß. Gleich war man vom Tisch beim Herd; die Töpfe hingen in Griffweite über dem Herd; die Regale mit dem Mehl und dem Salz und dem wertvollen Zucker standen so nahe, dass auch ein schlechtes Auge die kleinen Aufschriften auf dem schönen Siegburger Steinzeug erkannte; im Becken schwammen Karpfen und Schleie die letzten Bahnen ihres Erdenlebens. Porzellan sah Trine nirgendwo. Die Importe aus dem fernen China waren so wertvoll, dass sie in eigenen Schränken, manchmal in speziellen Räumen, aufbewahrt wurden.
Zehn Köche, Mägde und Küchenjungen eilten hin und her, ohne sich ins Gehege zu kommen. Es gibt eine Betriebsamkeit, die den Zuschauer unruhig macht. Was Trine Deichmann sah, war das Gegenteil. Der Bäcker, schneeweiß in Hemd, Hose, Mütze, trug seine feine Mehlwolke fast unbeachtet von draußen zu einem Tisch, auf dem vor Kurzem Brot oder Kuchen geknetet worden war. Dieser Mann war mit den Nerven schlecht zu Fuß. Er rang mit seiner Fassung, aber er verlor sie nicht und murmelte, als er an Trine vorbeieilte: »Da macht man was mit.« An dem Tisch im Hintergrund bereitete der Schlachter die Gänse vor. Eine Magd ging ihm zur Hand, dass sie den Kopf schüttelte, sah man von Weitem.
»Es wird wohl viel gegessen werden«, sagte Trine.
»In diesem Jahr wieder«, antwortete der Graf. »Nach dem Aufstand im letzten Jahr… Er hat uns auf Kohlsuppe und Brot gesetzt. Dazu gab’s Wein, so schaurig sauer, wie Ihr ihn hoffentlich nie trinken musstet. Das Gefurze danach… erst haben wir gelacht, dann haben wir geweint, dann hat es einem die Därme zerrissen, und er hat in seine kleinen Hände geklatscht, denn das wollte er bewiesen haben.« Witternd blickte er sich um, kam dicht an Trines Ohr und flüsterte: »Er ist verrückt, daran kann kein Zweifel herrschen.«
»Er selbst hat damals nicht…?«
»Natürlich nicht. Er wusste ja, was in der Luft lag. Ein Wunder, dass das Schloss nicht in die Luft geflogen ist. Als sie betrunken waren, haben sie Feuer an die Fürze gehalten. Ein Fidibus vor den nackten Hintern! Die Stichflammen werde ich nie vergessen.«
»Jetzt lächelt Ihr.«
»Dabei ist mir nicht danach zumute.«
»Werden viele Gäste erwartet?«
»Sie sind alle schon da.«
»Also wird tatsächlich niemand mehr hereingelassen?«
»Die Wachen haben Befehl zu schießen. Pardon wird nicht gegeben. Ich rate Euch, alles ernst zu nehmen, was ernst genommen werden muss.«
»Sie können nicht überall zugleich sein.«
»Es sind mehr, als Ihr für möglich haltet.«
»Aber wenn ein Unglück passiert… der Wache wird es schlecht ergehen.«
»Haltet Ihr eine Belohnung von 100 Talern für schlecht? Ich wusste nicht, dass Hebammen so fürstlich entlohnt werden.«
»Es kann doch nicht belohnt werden, was unrecht ist?«
»Das geschieht auch nicht. Aber das Narrenreich hat seine eigenen Gesetze. Und die sagen: Es ist recht zu schießen. Einen Tag später mag es wieder anders aussehen.«
4
Über das hintere Treppenhaus stiegen sie ins zweite Geschoss hinauf. Der Flur wurde enger und die Decken niedriger, ohne beengend zu wirken.
»Hier bettet die Gesellschaft ihr Haupt zur Ruhe«, knurrte der Graf. »Wozu auch Ihr gehört.«
»Ach, deshalb kommt mir alles so bekannt vor. Harnack, was bedrückt Euch?«
Der Graf drückte die Tür am Ende des Flurs auf der linken Seite und stieß sich den Kopf, als sie wider Erwarten nicht zu öffnen war.«Was soll das?«, rief er erbost. Mit der flachen Hand schlug er gegen die Tür: »Öffnet! Sofort! Was sollen diese Späße? Späße könnt Ihr unten treiben.«
»Einige Minuten noch!« rief eine Stimme, die Trine schon einmal gehört hatte. Oder irrte sie sich? Jedenfalls war des Grafen Einsatz merkbar gebremst.
»Wir warten«, rief er halb so laut wie bisher. Und zu Trine: »Ihr bekommt nicht das erstbeste Zimmer, man gibt sich Mühe.«
»Das ist sehr freundlich, aber unnötig. Ich bin keinen Luxus gewohnt.«
»Man bringt seine Lebensart nicht mit aufs Schloss, das Schloss legt Euch seine Art zu Füßen.«
»Es steht nicht zufällig eine weitere Geburt bevor?«
»Wie kommt Ihr darauf?«
»Es war nur ein Gedanke.«
»Frauen von Eurer Art können wir hier gebrauchen. Ihr denkt pausenlos. Euer Mann darf nicht schwach sein.«
Misstrauisch geworden wollte sie Harnack ansehen, aber sein Gesicht war stets woanders. Sie standen an dem Fenster, das nach vorne hinausging. Von hier oben hatte man Blick auf den Verlauf der Mauer. Von hier oben verflog jeder Zweifel, bei der Macht der Wachen könne es sich um bloßes Gerede handeln. Trine Deichmann sah vier Männer. Alle trugen Rüstung. Jedem steckte ein Schwert an der Seite, ein Schwert von dem Ausmaß, dass ein einziger Schlag genügte, um den Gegner vom Kopf abwärts zu spalten.
»Was sagen die Nachbarn?«, fragte Trine.
»Wenn sie klug sind, schweigen sie. Wenn sie Ärger haben wollen, äußern sie eine Meinung. Ich kenne keinen, der das häufiger als einmal getan hat.«
»Gewalt?«
»Wo denkt Ihr hin? Oder haltet Ihr frisch erlegte Hasen und Rehe für eine Form von Gewalt?«
Trine Deichmann dachte nach und sagte: »360 Tage im Jahr hat der Fürst das Sagen und nur zwei Tage der kleine Mann. Was sollte da schon passieren können?«
»In zwei Tagen sprechen wir uns wieder. Gerne hier an diesem Fenster. Ich bin gespannt, dann Eure Meinung zu hören.«
»Aber man kann doch alles wiedergutmachen? Was aus dem Ruder läuft, kann repariert werden. Es gibt Ärzte, Handwerker, Künstler, Baumeister, Tagelöhner.«
»Gibt es Gott den Herrn?«
»Was fragt Ihr? Selbstverständlich gibt es ihn.«
»Ich frage mich, warum Ihr ihn in Eurer Aufzählung vergessen habt.«
»So schlimm ist es?«
Kurz blickte der Graf in Trines betretenes Gesicht, um zu sagen: »Falls unser Herr in der Lage sein sollte, Verwunderung zu empfinden, hat er sie hier empfunden. An dieser Stelle, an der wir beide stehen.«
Trine Deichmann lachte. Sie lachte lange, weil es ihr half, ihre Befangenheit abzustreifen. »Was Ihr redet«, sagte sie übertrieben munter, »Euer Reden gehört schon zum Narrenreich. Es ist wie im Karneval. Oben ist unten, und unten ist oben. Aber es gibt auch ein Vorher und ein Nachher. Die Wirklichkeit rahmt das Spiel ein. Es ist doch nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Es kann nicht anders sein.«
Lächelnd blickte der Graf sie an, und lächelnd sagte er: »Willkommen in meiner Wirklichkeit.«
Zehn Minuten später wurde von innen ein Schlüssel gedreht, die Tür schwang auf, eine groteske Gestalt dienerte und sagte: »Eintreten! Wohlfühlen! Staunen!«
Theophrast von Bommelheim trug eine Krone von ungeheuren Ausmaßen. Einen halben Meter war sie hoch, und obwohl sie nicht aus purem Gold war, war sie auch nicht aus Pappmaschee. Metall war dabei, man spürte das Gewicht, bevor man in Bommelheims Gesicht blickte. Denn auch in ihm entdeckte man das Gewicht.
»Was für ein Kunstwerk«, staunte Trine Deichmann.
»Nicht wahr«, erwiderte der kleine Mann betont nachlässig. »Es ist nicht schwer, so hoch zu sein wie der Fürst. Und noch einen Diamanten größer.«
Tatsächlich schloss ein hühnereigroßer Edelstein die Krone ab. Von intensivem Grün war er, aber Trine bezweifelte, dass es sich um einen Saphir handelte. Sie bezweifelte nicht, dass sich eine diesbezügliche Frage verbot. Andererseits… sie war nicht Teil des Narrenreichs, sie war eine Besucherin oder noch weniger: ein dienstbarer Geist. Sie stand nicht auf der Bühne, sie stand davor. Ihr mochten Fragen erlaubt sein.
Aber dann trat sie ein und vergaß ihre Gedanken. Im gesamten Raum gab es ein einziges Möbelstück, das Bett. Drei Wände waren deckenhoch mit Regalen verstellt. In allen Regalen standen Gläser, große Gläser, gefüllt mit Flüssigkeiten, die das, was in ihnen schwamm, vor der Zersetzung bewahrten. So viele Föten hatte Trine noch nie auf einmal gesehen. So viele Missbildungen, zusammengewachsene Köpfe und Rümpfe, Kinder, deren Kopf größer war als Rumpf und Beine zusammen; Schlangen, von denen nur das Skelett übrig geblieben war; Tiere, so viele Tiere, Fische, Vögel. Keines war normal gewachsen, und was am kleinsten und jüngsten war, oft nicht einmal geboren, war am stärksten verwachsen und entstellt. Die Gesichter, so es sie gab, waren friedlich, wie schlafend und sanft. Das Grauen rührte aus der Sprache der Körper.
Das gab es also alles, so konnte es gehen, wenn es nicht gut ging. Zu zehn Kindern, die Trine gesund auf die Welt geholt hatte, gehörte ein elftes oder zwölftes, das es nicht so weit geschafft hatte. Die Geburt war der Übergang von der Unsichtbarkeit zur Sichtbarkeit. Sie war nicht der Beginn und nicht das Ende. Auch das, was in den Gläsern schlief, war nicht der Anfang, aber es handelte sich um eine frühere Stufe. Von was? Vom Leben? Vom Sterben? Von Krankheiten? Von Schwäche?
»Nicht wahr«, sagte der kleine König, der begierig an Trines Gesicht hing, »erst wenn die Worte fehlen, erkennen wir, wie viel wir reden. Vor allem: wie viel dummes Zeug.«
Der Graf, der spontan auf den Flur zurückgetreten war, betrat erneut den Raum. Er hielt Abstand von den Regalen, als er sagte: »Ihr könnt nicht im Ernst glauben, dass die Frau hier schlafen wird.«
»Ich glaube es nicht nur, ich bin sicher und halte jede Wette. Sie wird sich sicher fühlen wie seit Langem nicht. Wenn sie sieht, was alles nicht zu ihrem Geschäft gehört, wird sie froh sein, dass ihre Spiegel nur eine Vorderseite haben.«
»Nicht alles geht glatt«, murmelte Trine. »Erst vor Kurzem war da ein Fischkind, das Karpfenkind…«
»Viel zu gesund«, sagte Bommelheim verächtlich. »War tagelang auf der Welt und lebte immer noch. Davon gibt es nichts zu lernen. Hier stehen die Granaten. Wer stirbt, bevor er angefangen hat, sich der Welt zu zeigen, will der Welt damit etwas mitteilen. Ihr redet Euch mit Krankheit heraus, mit Schicksal und Unglück. Aber es ist ein Kommentar. Unsere ach so schöne Erdenexistenz treibt die Empfindlichsten unter uns vorzeitig in den Tod.«
»Wenn Ihr zu reden anfangt, habe ich stets das Gefühl, als würde sich der Raum mit Exkrementen anfüllen.«
So bösartig hatte Trine den Grafen noch nie sprechen hören. Aber Bommelheim schien nicht überrascht zu sein, beleidigt schon gar nicht. »Entschlackt Euch nur noch einmal«, sagte er lächelnd, »in weniger als zwei Stunden werdet Ihr Euch an diese Minuten zurücksehnen, weil sie so friedlich, schön und appetitlich waren.«
Der Graf starrte den Mann mit der Riesenkrone an. Es sah aus, als würde er überlegen, was er ihm antun könnte–und was das für Folgen haben würde. Dann drehte er sich nicht einfach um, er warf sich regelrecht in die andere Richtung und verließ den Raum. Lange hörte man im Flur seine Stiefeltritte.
»Wenn ich nicht schon überzeugt wäre, müsste ich nur an solche wie ihn denken«, sagte Bommelheim. »Solche wie er reichen als Grund schon aus, das Narrenreich ins Leben zu rufen.«
»Wie lange gibt es denn diese… diese Übung schon?«
»Nennt es einfach Vergnügen, denn als Vergnügen empfinde ich es. Als was es die anderen empfinden, ist nicht von Belang, was mein Vergnügen weiter steigert. Ich habe für Euch eine Hauptrolle vorgesehen. Ich erwarte, dass Ihr sie würdig ausfüllt. Enttäuscht mich nicht. Ich kann fürchterlich werden, wenn ich zornig bin.«
»Aber Ihr werdet nicht größer.«
Darauf war er nicht gefasst gewesen, sie sah es ihm an. Sie fand sich nicht freundlich, aber ihr blieb nichts anderes übrig. Wenn sie herausfinden wollte, was ihr bevorstand, musste sie herausfinden, welche Gründe den kleinen König umtrieben.
»Nun gut«, sagte er achselzuckend.
Sie sah ihm an, dass er sich zusammenriss. Aber er hatte sich so viel Mühe mit Trines Raum gegeben, er wollte nicht zulassen, dass ein Wutanfall alles zerstörte, bevor der Raum seine Rolle spielen konnte.
»Es ist nicht so, dass ich diesen Satz zum ersten Mal höre«, sagte Bommelheim.
»Ich bin die Hebamme, weil ich Kenntnisse auf meinem Gebiet besitze. Ihr seid der Narr, weil Ihr klein seid. Das ist nicht schön, aber es ist so.«