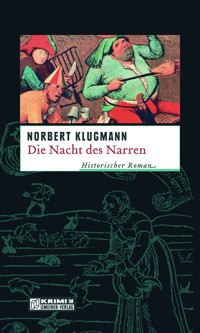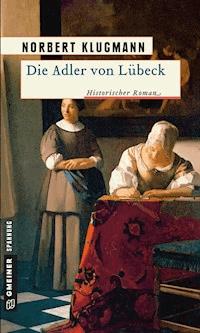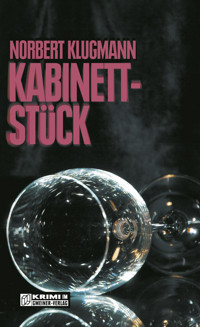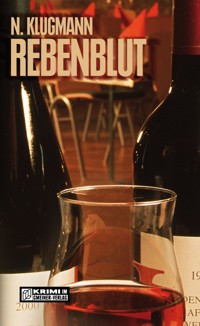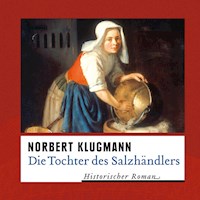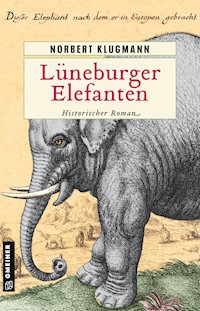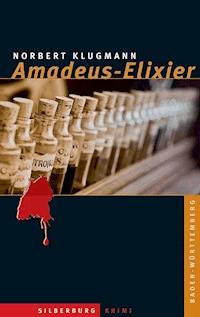Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Buchhändler Süß und Bürgermeister Wendlandt
- Sprache: Deutsch
Ein Dorf in Unruhe! Am Ortsrand von Wortleben entsteht ein neues Wohngebiet - aber nicht in der traditionellen Form großkotziger Fertighäuser im Bausparkassen-Stil. Stattdessen steht das jüngste KoDorf-Projekt vor der Fertigstellung: „Communitys für neues Leben und Arbeiten auf dem Land“. Ein Teil der Bewohner freut sich auf die neuen Nachbarn, viele bleiben skeptisch. Bürgermeister Wendlandt schwankt zwischen Gönnerhaftigkeit und Misstrauen. Und Buchhändler Uwe Süß fragt sich, was passiert, wenn seine Lebensweise nicht mehr so hip wirkt wie er bisher dachte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Klugmann
Wendlandt und Süß
Dorfroman
Zum Buch
Die Zukunft zieht ein Am Ortsrand des norddeutschen Dorfs Wortleben mit 3.018 Einwohnern entsteht ein neues Wohngebiet – aber nicht in der traditionellen Form großkotziger Fertighäuser im Bausparkassen-Stil. Stattdessen steht das jüngste KoDorf-Projekt vor der Fertigstellung: „Communitys für neues Leben und Arbeiten auf dem Land“. Nicht alle Dorfbewohner freuen sich über die neuen Nachbarn. Denn mit den digitalen Nomaden zieht eine exotische Lebensweise in Wortleben ein. Sie bringt neue Überzeugungen mit, neue Denkweisen und massenhaft Fremdworte. Plötzlich kommen sich viele Bewohner altmodisch, langweilig und fantasielos vor. Besonders die lokalen Politiker, allen voran Bürgermeister Wendlandt und Oppositionschef Süß, einziger Buchhändler im Ort, fühlen sich provoziert. Nur zögerlich bewegen sich die zwei Lebens- und Denkweisen aufeinander zu. Zu viel Neues auf leeren Magen – das mag man in Wortleben nicht. Wendlandt und Süß gegen die neuen Nachbarn? So einfach ist es nicht. Denn bisweilen leben die neuen Nachbarn nur ein Zimmer von den Alteingesessenen entfernt …
Norbert Klugmann, Jahrgang 1951, hat bisher 80 Romane veröffentlicht. Schwerpunkte sind Krimi, Drama, Satire, Melo, Jugendbuch. Klugmanns Stärken sind der Dialog und die Nachbarschaft von Alltag und Anarchie. Seine Vielseitigkeit zeigt sich in Romanen über die Welt des Sports, Geschlechterkriege, Karrieren, bizarre Charaktere, aktuelle Kommunalpolitik und historische Themen. Viermal begleitete er die Hebamme Trine Deichmann durch das Lübeck des 17. Jahrhunderts. Das süffige Genre des Weinromans bereicherte er mit drei Romanen um den smarten Marchese. 2022 erschien Klugmanns Roman über die deutschlandweit bekannte und bis heute andauernde Serie mit ca. 30 Unfällen von Hamburger Senioren beim Ausparken: „Bitte parken Sie nicht in unserem Schaufenster“.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Wirestock / istockphoto.com
ISBN 978-3-8392-7722-5
1
Trudchen Kubinke bei der Arbeit zuzusehen, war nichts für schwache Nerven.
»Trudchen, mach zu«, grummelte der alte Piesow, der mit zunehmendem Alter immer ungeduldiger wurde. »In fünf Stunden fängt die Tagesschau an.«
»Mach meine beste Scheibenschneiderin nicht nervös«, rief von nebenan Schlachter Rosellen, der gerade nach allen Regeln der Kunst ein Kaninchen enthäutete.
Piesow blickte erstaunt um die Ecke. Bisher hatte es noch kein Dorfbewohner geschafft, die junge Bedienung nervös zu machen.
»Mir geht Trudchens Lahmarschigkeit auf den Pinsel«, maulte der alte Piesow und handelte sich einen strafenden Blick von Anna Wendlandt ein.
»Du solltest in Zukunft nur noch 100 Gramm bestellen«, riet ein wartender Kunde. »Dann ist es nicht so schlimm, wenn die Wurst schimmlig wird.«
»Du hast recht«, entgegnete Piesow erfreut. »Weißt du was, ich bestelle 20 Gramm. Dann kriege ich noch was raus.«
»Wovon raus?«
»Vom Schimmel. Nein, vom Preis, vom Geld.«
»Du meinst, dann verwandelt sich der Schlachter in eine Sparkasse.«
»So sieht das aus! Ich wette, dass Rosellen dafür keine Genehmigung hat. Damit habe ich den Kerl in der Hand. Dann muss er freundlicher zu mir sein als bisher, weil seine Existenz von mir abhängt.«
»Und was stellst du dann mit deiner Macht an?«
»Ich schmeiße Trudchen raus. Damit ist das Problem erledigt. Darauf hätte ich auch früher kommen können. Aber man ist nie zu alt, um klug zu werden.«
Der Schlachter peilte die Lage, aber im Verkaufsraum ballte sich kein revolutionäres Potenzial zusammen. Was sollte er sich also aufregen? So lahmarschig konnte Trudchen gar nicht sein, dass die phlegmatische Bande zum Äußersten gegriffen hätte. Die Schlachter der Kreisstadt waren 15 Kilometer entfernt, Rosellen war für jeden einzelnen Kilometer dankbar, der die beiden Planeten trennte.
»Lass dich nicht hetzen, Trudchen«, sagte Anna Wendlandt, die Frau des Bürgermeisters, mitfühlend. Trudchen blickte vom Einwickelpapier hoch. In dieser Zeit hätte eine fixere Bedienung ein Viertel Mortadella aufgeschnitten. Und die wirklich Fixen ein halbes Pfund.
Plötzlich quietschte es draußen entsetzlich. Anna Wendlandt stürzte aus dem Schlachterladen, Rosellen hinterher. Der alte Piesow wartete ab, bis das akustische Signal in dem Durcheinander, das zwischen Trudchens Ohr und Hirn herrschte, ordnungsgemäß verbucht worden war. Dann eilte auch die Verkäuferin hinaus. Piesow langte in die Glasvitrine und verkostete nacheinander eine Scheibe Jagdwurst, eine Scheibe Gelbwurst und einen Happs frisch durchgedrehtes Mett.
Dann folgte er kauend den anderen und sah gerade noch, wie die Frau des Bürgermeisters Oma Tewer unter den Arm griff, während auf der anderen Seite Rosellen zupackte. Gemeinsam stellten sie die alte Frau auf ihre dünnen Beine.
»Sie Unhold«, zischte Anna Wendlandt dem Kombifahrer zu. Der hielt sich an seiner Kühlerschnauze fest, so sehr war ihm der Schreck in die Glieder gefahren.
»Die Oma ist mir direktemang auf den Kühler gehüpft«, protestierte der Fahrer matt. »Hat nicht rechts geguckt und nicht links …«
»… das musstu nicht sagen«, meckerte Oma Tewer. »Anna weiß gar nicht, was links ist, was, Anna? Bei euch zu Hause ist links nur noch das Moor. Und Scharbeutz, der Junggeselle, der wohnt auch noch links von euch, aber der ist ständig duhn, der hat doch …«
»Gott sei Dank, sie scheint heil zu sein«, sagte der Kombifahrer.
»Diese verdammte Straße«, kam unerwartet aus Trudchen heraus.
»Ohne Straßen kein Fortschritt«, behauptete der Kombifahrer.
Anna warf einen Blick auf sein Auto.
»Von Degenhardt?«, fragte sie. Alarmiert blickte der Fahrer seinen Wagen an, als habe Anna etwas entdeckt, was besser geheim geblieben wäre.
»Klar«, sagte der Angestellte der Pharmafirma dann hastig, »Einer muss euren Männern ja die Pflaster und Salben bringen, damit die Kälberchen und Ferkelchen dick und kugelrund werden.«
»Die Pest!«, rief Oma Tewer. »Uns fehlt die Pest! Corona bringt es doch nicht mehr. Alles umnieten in den Ställen und ganz von vorne anfangen, das ist meine Mei…«
»… eben«, unterbrach Anna mit sirrender Höflichkeit. »Eben, Amalie. Das ist ja das Traurige, dass du solche Meinungen hast.«
»Und dass ich sie sagen tu, meine Meinung«, meckerte die betagte Frau. »Das ist nämlich keine Diktatur hier«, informierte sie den Kombifahrer.
»Ach«, stieß der hervor.
»Nee, nee«, lachte die Seniorin. »Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Hart, aber gemütlich und meistens gerecht. Dafür sorgt schon Adolf. Adolf ist Annas Mann. Ist er doch noch, oder?«
»Und wer ist Anna«, fragte der Autofahrer verdutzt.
Oma Tewer blickte ihn mitleidig an. »Volksschule, wie? Oder Waldorf, was? Hat nicht weiter gereicht als Volksschule und Waldorf, wie? Tragisch, tragisch. Flüchtling?«
»Mein Mann ist hier der Bürgermeister«, teilte Anna Wendlandt dem Pharmavertreter mit und ließ die alte Frau versuchsweise los.
»Diese verdammte Straße«, wiederholte Trudchen, die Fleischereifachverkäuferin.
»Ich bin 50 gefahren«, behauptete der Vertreter. »Eher weniger. Da können Sie Ihre Uhr nach stellen.«
Trudchen blickte ihn an, als würde sie sich gerade vorstellen, wie sie ihn mit Hilfe der Schneidemaschine in eine große Zahl Scheiben zerlegte. »Ob 50 oder 45«, schnappte sie, »Sie haben Oma Tewer umgefahren. Sie haben Schuld auf sich geladen. Die Hölle ist Ihnen sicher, und von mir kriegen Sie nie mehr eine Scheibe. Ich beantrage, dass endlich eine Ampel hierherkommt.«
2
Adolf Wendlandt schlug beide Handflächen auf den Schreibtisch, stemmte sich in die Höhe und sagte mit der Stimme, die ein Viertel seiner Überzeugungskraft ausmachte: »Ich träume ja wohl.«
Uwe Süß studierte gelassen den Kalender an der Wand von Wendlandts Arbeitszimmer und sagte: »Frau Kubinke hat meinen Rat gesucht, den ich ihr nicht versagen konnte. Und auch nicht wollte.«
»Weil du so glücklich warst, dass sich endlich ein Dummer findet, der sich von dir Rat erhofft.«
»Den Rat gibt’s gratis obendrauf. Vor allem geht es darum, dass der Wille der Bevölkerung nach langer Zeit mal wieder Zugang zum politischen Entscheidungsprozess findet.«
Der Bürgermeister begab sich auf eine der Runden durch sein Büro, womit er ein Ausmaß von Verärgerung signalisierte, das nach einer körperlichen Reaktion verlangte.
»An Ihren Stiefeln klebt Lehm«, sagte Süß.
»Lehm kriegt man wieder weg. Was nur schwer wieder weggeht, ist dieses selbstgefällige Grinsen auf deinem Gesicht.«
»Wie gesagt: eine Bürgerin und nebenbei auch Wählerin. Und sie kam freiwillig. Freiwillig zu mir und nicht zu euch.«
»Gratuliere. Knapp zehn Jahre im trostlosen Amt des Oppositionsführers, und schon verirrt sich eine Bürgerin zu euch. Wenn es auch die größte Trantüte im ganzen Ort ist.«
»Trudchen ist nicht langsam, sie ist gründlich.«
»Und eine Trantüte.«
»Wir befinden uns in Norddeutschland und nicht in der Karibik. Hier darf man langsamer gehen …«
»… und denken.«
»Auch das. Denn nun hat sie ihre Sorge bei uns abgeladen, wo sie optimal aufgehoben ist. Der Lehm fällt ab! Das gibt doch Flecken auf Ihrem geschmackvollen Stragula.«
Wendlandt blieb vor Süß stehen und sagte knurrend: »Wenn in meinem Haus Dreck abfällt, macht meine Anna den weg. Es sei denn, ich habe die Toilette vollgekotzt, was höchstens zweimal im Jahr vorkommt: einmal beim Schützenfest und einmal nach der Weihnachtsfeier. Wie es guter alter Brauch ist. Ihre Frau hat es da natürlich besser. Bei ihr fällt kein Lehm ab, sondern höchstens ein Bein oder ein Stück Leber.«
»Meine Frau ist keine Chirurgin und auch keine Metzgerin, sondern Kinderärztin. Vor allem ist sie berufstätig, was man nicht von jeder Frau in unserer Gemeinde behaupten kann.«
»Abgesehen vom Lager.«
»Wir wollten doch diesen Ausdruck künftig vermeiden, weil er falsche Assoziationen hervorruft.«
»Dann eben die grüne Hölle.«
»Auch dieser Begriff ist weit entfernt von einer optimalen Beschreibung des Wohngebiets, das sich gerade zum Kraftquell von Wortleben entwickelt.«
»Vor 20 Jahren war es eine wunderschöne grüne Hölle. Naturbelassen und praktisch unzugänglich, bevor deine Gesinnungsgenossen begannen, die Natur zu zerstören, um Platz für ihre Carports und Steingärten zu schaffen.«
»Das war ein hässlicher Wanderweg von eineinhalb Metern Breite, da haben die Leute ihre Hunde ausgeführt, mehr ist da nicht passiert.«
»Aber nach jedem Meter Wanderweg kam der nächste Meter Wanderweg und danach … und danach … Du verstehst das Prinzip? Wir haben nur eine Schöpfung!«
»Wow! Dieses Wort aus dem Mund eines Großbauern, dessen Berufsstand wie kein zweiter in den letzten Jahrzehnten Natur zerstört hat.«
»Wir ernähren dich und deinesgleichen. Ohne uns könntet ihr nicht leben wie die Maden im Speck.«
»Ich bin Buchhändler, ich bin der beste Schutz gegen sinnlosen Fernsehkonsum. Ist das nichts?«
»Ich komme sehr gut ohne solche Geschäfte aus, wo du immer das Gefühl hast, dass du im nächsten Moment von einem umstürzenden Bücherregal erschlagen wirst. Ich habe schon davon geträumt.«
»Dann fang mit einem E-Book an. Das erhöht deine Lebenserwartung.«
»Auch noch in der Freizeit Bildschirme, radioaktive Strahlung und Stromschläge! Das könnte dir so passen. Erst attackiert ihr uns mit euren Röntgenstrahlen. Jetzt legt ihr mit Buchstrahlen nach! Irgendwie muss der werktätige Teil der Bevölkerung ja kaputtzukriegen sein.«
»Das ist polemisch.«
»Solang es wahr ist, kann ich damit leben. Was ich drüben im Lager besonders wenig leiden kann, ist diese Angewohnheit der Besserverdiener, ihre Großkotzautos unübersehbar vor dem Haus zu parken. Bevor du bei denen an der Tür klingeln kannst, ist dir schon die Lust vergangen.«
»Nicht jeder verfügt über Scheune und Gerätehaus, wo er seine Panzer unauffällig unterbringen kann.«
»Meine Fahrzeuge erfüllen einen nützlichen Zweck, sie sind Arbeitsgeräte. Ich brauche keine SUVs, die so hoch sind, dass man einen Tritt braucht, um den Sitz zu erreichen.«
»Ich gebe zu, es kam zu Übertreibungen.«
»Übertreibung ist gut! Übertreibung klingt wie Ausnahme und Ausrutscher. Im Lager sind sieben bis acht von zehn Wagen solche Panzer, die sogar im Stehen Benzin verbrauchen.«
»Das können Sie nicht wissen. Sie weigern sich ja mit Händen und Füßen, Ihren Fuß … ach du meine Güte! Ihre Spione sind wieder unterwegs! Sie schicken wieder ihre Kreaturen los, die sich nicht zu schade sind, anderen Menschen ins Fenster zu schauen. Und in den Carport. Womit tarnt ihr euch diesmal? Mit einem Sack über dem Kopf? Oder wieder mit diesen albernen Sturzhelmen, mit denen ihr alle ausseht wie Schwerbehinderte beim Ausflug?«
»Darf ich das so zitieren?«
»Muss nicht.«
»Ich würde aber doch gern …«
»Wie gesagt: muss nicht.«
Der Bürgermeister nahm wieder Platz. Eine Weile sprach niemand.
Dann sagte der Oppositionsführer: »Sie überlegen gerade, wie lange es noch dauern kann, bis aus den vielen neuen Hausbesitzern im Neuen Dorf Wählerstimmen werden.«
»Die wählen nicht. Keine Wahl könnte deren Lebensstandard verbessern. In der halben Stunde, die sie durch den Gang ins Wahllokal verlieren, können sie sich eine ihrer Serien ansehen oder auf der Terrasse herumschlaumeiern.«
»Im Neuen Dorf wohnen fast nur Briefwähler.«
»Warum überrascht mich das nicht? Dann müssen sie nicht Boden betreten, den unsereins betritt. Und im Wahllokal müssten sie ja einen Stift anfassen, den vielleicht gerade ein Bürgermeister angefasst hat.«
»Haben Sie Ihren Glücksstift verloren?«
»Ach ja, richtig. Noch ein Grund, warum diese Gutverdiener unter sich bleiben. Mich wundert, dass du und deine Brigade noch nicht den Antrag gestellt haben, für die nächste Wahl einen Stimmzettel-Bringdienst einzurichten. – Ich sehe dir an, dass du gerade darüber nachdenkst.«
»Mein Gesichtsausdruck ist stoisch und neutral.«
»Ausdruckslos. Das ist wahr. Wie hält deine Frau das jeden Tag aus? Oder lebt ihr in zwei Wohnungen? Zwei Betten?«
»Zwischen meine Frau und mich passt nicht mal ein Blatt Papier …«
»… passt kein Buch. Das wäre das passendere Bild gewesen. Und Trudchen kann sich ihre Ampel aus dem Kopf schlagen. Sag ihr das, wenn du sie siehst. Oder ich sag es ihr. Ich habe nämlich keine Probleme damit, politische Entscheidungen zu verkünden, hinter denen meine Partei, meine Überzeugung und ich persönlich stehen. Wir brauchen keine Verkehrsampel im Dorf. Ende der Durchsage.«
»Ich warne! Die Uhr tickt bereits, bis unsere neuen Mitbewohner die Straßen um die beiden Kindergärten und um die Schulen als Krisenregion erkennen werden.«
»Bis heute ist es ruhig geblieben. Und der spezielle Straßenverlauf spielt mir in die Karten. Unsere Kleinkinder-Hotspots sind weit von der Hauptstraße entfernt. Gefährlich wird es erst, wenn Trudchen ein Kind kriegt und es von seiner Mutter diese unübertreffliche Lahmarschigkeit erbt. Dann sehe ich für die Lebenserwartung des Zwerges schwarz.«
»Darf ich das so zitieren?«
»Muss nicht.«
»Sie wollen wirklich das Thema Ampel zum Heiligen Gral hochstilisieren? Verkehrsampeln besitzen einen hohen Nutzwert. Im Extremfall können sie Leben retten.«
»Ja, im Extremfall. Aber bis es so weit ist, steht das Ding rum und belästigt das harmonische Ortsbild. Und immer dieses Rot Gelb Grün Rot Gelb Grün und zurück. Davon kriegst du doch einen epileptischen Anfall, wenn du zehn Minuten davorstehst und dir das anguckst. Rot Gelb Grün Rot Gelb Grün …«
»Kollege Wendlandt!«, rief der Buchhändler, »wenn Ihnen die Arbeit im Dienst an unserer Bevölkerung Zeit lässt, geschlagene zehn Minuten darauf zu verwenden, das ordnungsgemäße Funktionieren einer Verkehrsampel …«
»Komm runter, Junge. Deine Vorträge haben die Neigung, ins Pathetische und Alberne abzurutschen.«
»Ich bin durchaus zu Sacharbeit fähig.«
»Sagt der Mann, der fünf Zentimeter davon entfernt ist, in seinem Buchladen eine Lottoannahme einzurichten, damit er mal wieder mehr als einen einzigen Kunden gleichzeitig sieht.«
»Wer sagt das? Woher wisst ihr das? Wen habt ihr bestochen? Und womit? Vor allem: womit?«
»Ruhig atmen! Ganz ruhig atmen! Deine drei Semester Betriebswirtschaft kann bei uns mittlerweile jeder Säugling herunterbeten, so oft lässt du das nebenbei fallen.«
»Es ist nicht gelogen.«
»Klar doch. Du und deine Genossen und die Wahrheit: Das ist ein infernalisches Trio, bei dem du die Pauke spielst. Wahrscheinlich seid ihr wirklich musikalischer als wir. Dafür sind wir erfolgreicher. 68,7 Prozent bei meiner ersten Wahl und bis heute immer wenigstens doppelt so viel wie ihr. Wo habt ihr gelegen, als du deine Visage zum ersten Mal einem Plakat zugemutet hast? Bei sieben?«
»17 Komma fünf.«
»Merk dir: Wer es nötig hat, die Stelle hinterm Komma zu erwähnen, ist eine arme Wurst.«
»Ihr werdet nie mehr 68 einsacken.«
»Denke ich auch. Was im Gegenzug aber nicht bedeutet, dass ihr jemals stark sein werdet. Es liegen einfach mehr Kugeln im Topf. In allen Farben: freundliche, bekannte, unvermeidliche. Und die anderen.«
»Aber wir, wir werden weiterwachsen.«
»Hältst du einen, der einen Meter 15 groß ist, weniger für einen Zwerg als einen, der einen Meter zehn groß ist?«
Wendlandt erhob sich und stiefelte, eine Lehmspur hinterlassend, durchs Arbeitszimmer zum schwarzen Sekretär, holte Flasche und Gläser heraus. In beide Gläser spuckte er hinein, aber nur eines wischte er trocken.
Süß sagte: »Meine Frau hat im Krankenhaus Kollegen, die für sie jeden gewünschten Test durchführen.«
»Worauf? Auf vegane Galle?«
»Auf alle Krankheitserreger, die Spucke enthalten kann.«
Nun wischte Wendlandt auch das andere Glas trocken.
»Komm, Junge«, sagte der Bürgermeister, »sollst auch nicht leben wie ein Hund. Ein kleiner Hund. So ein niedlicher, von dem niemand glaubt, dass er zubeißen kann. Und falls doch, glaubt niemand, dass das Schmerzen bereiten kann. Ihr seid zur Niedlichkeit verdammt. Genauso stelle ich mir die Hölle auf Erden vor.«
»Ich trinke für meine Partei.«
»Klar! Ich weiß doch, wie das ist, wenn du dich krummlegst und vorn und hinten nicht hochkommst.«
»Ich nehme das Getränk an. Man muss den Klassenfeind schädigen, wo es geht. Steter Tropfen höhlt den Stein.«
»Gut gebellt. Nicht wundern, wenn die Pulle, die alle Fraktionsvorsitzenden traditionell Weihnachten von der Gemeinde überreicht kriegen, nicht mehr ganz gefüllt ist.«
Ungläubig starrte Süß auf das kleine Namensschild. Es klebte am Hals der Flasche und trug die Initialen seiner Partei.
Sie brachten den Kümmel auf den Weg alles Irdischen.
»Guter Stoff«, sagte Wendlandt schmatzend. »Der hilft dem Vati auf die Mutti.«
Er ließ sich in den Stuhl fallen, wegen dem es seinerzeit im Gemeinderat zur Kampfabstimmung gekommen war, und fragte:
»Will Trudchen einen Bürgerantrag starten oder schickt sie euch in dieses sinnlose Gefecht? Ich kann dir schon heute auf einen Zettel schreiben, wie die Abstimmung ausgehen wird.«
»Lass stecken«, murmelte Süß.
Das orangefarbige Telefon klingelte.
»Wendlandt, was gibt’s schon wieder? – Sag bloß. Wie viel denn? Für 50 Sauen? – Der Sauhund. – Sauerei sondergleichen. – Sauber. Ich verlasse mich ganz auf dich. Ende der Durchsage.«
»Na, wieder eine Ihrer schäbigen Transaktionen auf den Weg gebracht?«, fragte Süß neidisch.
»Der Karren muss laufen. Wenn man ihn ein wenig anschiebt, läuft er geschmeidiger. Kennst du bestimmt aus deinem Buchladen. Wenn man die Tür abschließt und die gefangenen Kunden einige Tage auf Wasser und Brot setzt, werden sie in höchster Not vielleicht ein Taschenbuch kaufen, um wieder freizukommen.«
»Meine betriebswirtschaftliche Bilanz kann sich sehen lassen.«
»Na, das ist doch schön für dich. Wie lange hast du gebraucht, um die letzte Bilanz fertigzustellen? Mehr oder weniger als 20 Minuten?«
»Wie gesagt …«
»Und der werten Parteikasse geht’s auch gut soweit? Habt ihr im jährlichen Spendenaufkommen mittlerweile die haushohe 50-Euro-Grenze übersprungen?«
»Allerdings, auch wenn wir nicht die ganz großen Unterstützer haben wie gewisse Parteien, die mit dem Großkapital kungeln.«
Um seinen Grimm abzubauen, stand er auf und schritt die Wände des Büros ab. Er deutete auf eine Stelle an der Wand:
»Warum hängt hier nicht noch ein sechster Kalender von einer dieser Giftfirmen?«
»Lieber einen soliden Samenhandel-Kalender als solche Hochglanzdinger in gewissen Geschäften, wo nichts drauf ist als Sonnenuntergänge, verkrüppelte Bäume und ein paar verhungerte Wellen, die an den Strand schlabbern, von dem der Fotograf vorher den Plastikmüll weggeräumt hat.«
»Waren Sie in letzter Zeit heimlich im Laden? Ich kann mich gar nicht an einen alten Mann in Cordhosen erinnern, der sich zur Tarnung einen Rauschebart umgebunden hatte.«
»Komm her«, sagte der Bürgermeister und hielt Süß das Kümmelglas entgegen. »Bist ein scharfer Hund, Süß. Hast den falschen Namen und bist in der falschen Partei. Hast einen Beruf, den wir hier nicht brauchen, und deine Fachwerkruine wird euch eines nahen Tages über euren gut frisierten Köpfen zusammenbrechen. Prost.«
»Prost, Bürgermeister. Oder um es historisch korrekt zu sagen: Noch-Bürgermeister.«
Wendlandt leerte das Glas. »Ich weiß ja, dass deine Farbe zu langfristigen Denkweisen neigt. Aber dass ihr nun schon bei Jahrhunderten angekommen seid, da klingt eine Prise Hoffnungslosigkeit durch.«
»Vergiss Berlin nicht.«
»Was ist Berlin? Eine Hauptstadt unter 200 Hauptstädten auf der Erde. Was ist Wortleben? Einzigartig. Sonst noch Fragen?«
Zur Buchhandlung war es ein Fußmarsch von acht Minuten. 20 Meter vor dem Elektrogeschäft beschleunigte Uwe Süß seine Schritte, kurz vor den beiden Schaufenstern fiel er sogar in Trab. Er wollte sich gerade der Illusion hingeben, es geschafft zu haben, als hinter ihm das quengelige Organ von Rudi Herbst ertönte: »Hast du das Mammut erlegt, Uwe?«
Süß winkte ab und machte, dass er in seinen Laden kam.
Svenja, das entzückende, wenn auch faule Lehrmädchen, hockte im Schaufenster und tat, als würde sie umdekorieren. Hätten nicht drei männliche Halbwüchsige vor dem Fenster gestanden, hätte sie ihren Chef sogar täuschen können.
»Komm da raus«, fauchte er. »Wir sind kein Varieté.«
»Aber Herr Süß«, maulte Svenja und riss die Augen bis zum Anschlag auf. Immerhin verließ sie ihre Bühne, und die Milchbärte trollten sich.
3
»Ihr seid schöne Politiker«, sagte Trudchen Kubinke verächtlich.
Neun Augenpaare blickten sie hasserfüllt an.
»Das liegt alles nur an unserer Schleimscheißertaktik«, behauptete Ferdi Düver, der radikale Zimmermann der Partei.
»Nach Russland gehört der«, wisperte Rudi Herbst, dessen gesellschaftliches Bewusstsein seit Übernahme des väterlichen Elektrogeschäfts eine nicht zu übersehende Rechtsentwicklung erfahren hatte.
»Disziplin, Genossen«, mahnte Uwe Süß. »Wir haben heute einen Gast, den wollen wir nicht verprellen.«
Er hob das Glas Richtung Katzentisch. Der Gast hob seinen Orangensaft und prostete zurück.
»Noch ein Lehrer«, knurrte Ferdi Düver ohne Begeisterung. »Das hätte es in den guten Zeiten nicht gegeben. Da haben die Schulmeister im Frühjahr und Herbst einen Schinken bekommen und, wenn der eigene Junior besonders begriffsstutzig war, einen Ballon Obstwein obendrauf. Das musste reichen für einen Schulmeister. Aber heutzutage …«
Uwe Süß, Vorsitzender des Ortsvereins seit seinem Zuzug vor knapp sechs Jahren aus der großstädtischen Welt, bemühte sich, nicht wieder die Hände zu wringen. Man hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, dass diese unbewusste Geste einen defensiv-weinerlichen Eindruck hinterlassen würde – besonders bei Nicht-Genossen. Vor allem bei Nicht-Genossen. Das war ärgerlich, denn jeder Nicht-Genosse ist gleichzeitig ein Noch-Nicht-Genosse. Mit Ausnahme einer Handvoll Nicht-mehr-Genossen, die sich mit einer weiteren Kategorie überschneiden, den Nie-mehr-Genossen (auch bekannt als Nicht-mehr-in-diesem-Leben-Genossen).
»Bitte, Genossen«, legte der Vorsitzende nach, »ein Blick auf unseren Mitgliederstand müsste ausreichen, um euch den Ernst der Lage vor Augen zu führen. Bei anderen Parteien sieht es teilweise besser aus, bei denen führt die Bereitschaft, sich auf der kommunalen Ebene zu engagieren, zu erfreulicheren Ergebnissen. Wir sind momentan das Schlusslicht. Natürlich wird das nicht so bleiben. Aber momentan: Schlusslicht.«
Süß riss sich zusammen, er musste aufhören, das Wort ein weiteres Mal laut auszusprechen. Er kannte dieses Phänomen an sich. Zwei- oder dreimal im Jahr spürte er die unwiderstehliche Bindung an einen Begriff, die ihn zu überwältigen drohte und auf die seine Umwelt stets erstaunt, distanziert und empört reagierte – meist alles innerhalb von 60 Sekunden. Schlusslicht war so ein Wort.
»14 Mitglieder«, sagte Süß leise. »Wir liegen in Niedersachsen an drittletzter Stelle. Hinter uns liegen nur noch ein Moordorf, eine Hallig und ein Ortsverein in einer Gemeinde, in der 98 Prozent der Bewohner katholisch sind. Und wenn ich katholisch sage, dann meine ich: richtig katholisch, mit allen Schikanen. Praktisch sind wir bereits Letzter. Wir sind doch der einzige Ort, den man mit normalen Maßstäben messen kann.«
»Mit halbwegs normalen Maßstäben«, warf Rudi Herbst ein.
»Und wie viele liegen vor uns?«
Alle starrten Ferdi Düver an.
»Sag’s schon«, forderte der radikale Zimmermann. »Sprich es aus. Es wird uns guttun, wenn wir es aus berufenem Mund hören. Nenn eine Zahl. Nicht wieder dieses Schwurbeln, zu dem du leider Gottes neigst. Wir sind große Jungs, wir können was vertragen.«
»Streng genommen sind wir nicht alle große Jungs«, stellte Trudchen klar. »Denn das ist unser zweites Problem. Wir sind zu männlich.«
Darauf wäre so viel zu sagen gewesen. Nicht nur todernste Sachen, gerne auch lockere und muntere Reaktionen. Es war nicht allein die gute Erziehung, die den Männern die vorlauten Mäuler verschloss. Vor allem waren es der Zeitgeist und diese neuartigen Spielregeln im Bereich der öffentlichen Rede. Was früher fröhlich-vorlaut herausgekräht worden war, musste jetzt ein halbes Dutzend Kontrollinstanzen durchlaufen, die ausnahmslos im Inneren der männlichen Genossen stationiert waren. Das machte nichts einfacher und alles schwerer. Denn selbst im nicht wahrscheinlichen Fall, dass die inkorrekten Einwürfe alle Instanzen überstanden hatten, man musste sie auch noch vernehmbar aussprechen – und danach musste man bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, von denen die meisten absehbar waren und unangenehm ausfallen konnten. So war es zwar immer noch möglich, in der Tradition der freien Rede unter Genossen wider den Stachel zu löcken. Aber früher waren die Reaktionen einfach positiver ausgefallen. Schenkelklopfer, Schulterklapse, wiederholte Schläge mit der flachen Hand auf die Tischplatte, gefolgt von spontanen Bestellungen einer Runde Kleiner Flieger, worunter die legendären Nullkommazwei-Gläser zu verstehen sind.
Früher gab es mehr Genossen mit brüllendem Gelächter. Früher galt es als Beweis eines offenen gesellschaftlichen Umgangs, wenn man freimütig gestand, den Ortsverein aufzusuchen, um sich mal wieder richtig zu amüsieren.
Und warum war das früher so leicht und locker? Weil viele Ortsvereine reine Männerklubs waren. Falls Genossinnen vorkamen, dann stets wenige, und in der Regel lachten sie gern und laut und ohne Ende. Sie verstanden Spaß, konnten über sich selbst und ihr Geschlecht lachen. Einige von ihnen waren im Besitz eines knallharten Humors, den sie bevorzugt gegen die Männerwelt richteten. Dann hieß es: gute Miene zum bösen weiblichen Spiel machen und die eigene Mimik auf Vorurteilslosigkeit einfrieren, während man in seinem Inneren den Schrecken einschloss, den die Natter am Tisch, die man bis eben noch für eine Genossin gehalten hatte, gegen die hosentragende Hälfte der Menschheit abschoss – immer wieder und immer ordinärer und mit Bezeichnungen für männliche Körperteile, die die Hälfte der Genossen an diesem Abend zum ersten Mal hörte.
Damit war bei Trudchen Kubinke nicht zu rechnen, dafür fehlte es ihr an Grundschnelligkeit und wohl auch an Lebenserfahrung.
Aber am Ende war es dennoch nicht mehr so wie früher. Dass man damit leben musste, wusste man durch Vorträge, zu denen die eigene Lebensgefährtin gebeten hatte. Man wusste es aus den pflaumenweichen Beschwörungen des Vorsitzenden. Und man erfuhr es aus dem Fernsehen, wann immer man es einschaltete und welchen Sender man auch wählte.
In anderen Parteien gab es auch mehr Frauen als früher und sogar mehr als bei den Genossen. Was prinzipiell absurd war, denn die frühen Genossen hatten das Wahlrecht gegen die frühen Mitglieder der konkurrierenden Parteien erkämpft.
In den ersten Jahren nach der Vereinigung war in vielen Ortsvereinen die Angst vor der Ankunft neuer Mitglieder aus der ehemaligen DDR umgegangen. Angeblich war man im Arbeiter-und-Bauern-Trabi-Staat vor Auswüchsen und Übertreibungen der Gleichberechtigung nicht zurückgeschreckt, und es war zu befürchten, dass diese Menschen bei Umzügen in die westlichen Gaue davon ausgingen, ihre frühere Lebensweise in bewährter Manier fortzusetzen. Sie wussten es ja nicht besser.
Dieser Kelch war an einigen Ortsvereinen vorbeigegangen, an anderen nicht. Aber die, die sogar bis heute heil davongekommen waren, mussten näherkommende Einschläge aus einer unerwarteten Ecke hinnehmen: beispielsweise durch den Zuzug eines Buchhändlers, der seine Bücher mitbrachte, sie in die Regale einer früheren Schusterei stellte, und zwar streng alphabetisch. Und der, weil er damit nicht ausgelastet war, im Handstreich gleich den darbenden Ortsverein der Genossen mit übernahm. Das war schon fünf Jahre her, aber einige Genossen wurden das Gefühl nicht los, die neue Zeit sei erst vor wenigen Wochen über sie hereingebrochen. Sie machten gute Miene zum neuen Spiel, redeten sich den mickrigen Stimmenzuwachs bei der letzten Wahl schön und freuten sich auf jede Sitzung des Ortsvereins wie kleine Kinder auf den Kindergeburtstag. Denn nur in dieser Runde und in diesen Stunden schwammen sie in einem Gefühl, das weit über die engen Grenzen von Wortleben hinausreichte.
In diesen Stunden gelang es ihnen sogar zu vergessen, dass Trudchen Kubinke noch gar kein eingeschriebenes Mitglied war. Sie war nur die einzige Frau unter 3018 Einwohnern, die man jedes Mal dazu überreden konnte, den Sitzungen des Ortsvereins ihre Aufwartung zu machen. Ob es sich dabei um eine Bereicherung handelte, darüber gingen die Meinungen auseinander. Aber Trudchen war eine Frau, wenn auch nur im weitesten Sinn, deshalb stellte man keine hohen Ansprüche, womit man sich auch nur selbst ein Bein gestellt hätte.
Man hatte der drallen Fleischerei-Fachverkäuferin den Himmel auf Erden versprochen. Na gut, nicht direkt den Himmel. Aber ein Tagesausflug nach Helgoland war für manchen im Ort ein Traum, wenn auch offenbar nicht für Trudchen. Vielleicht bewegte sich ein Katamaran für sie einfach zu schnell von A nach B. Vielleicht befürchtete sie, dass er abheben und in eine fliegende Fortbewegungsweise übergehen könnte, sodass er an Helgoland vorbeiflog auf den Atlantik hinaus, von wo es nur ein Katzensprung bis nach Amerika war – wenn auch ein ordentlicher Katzensprung.
»Wenn wir die Ampel ins Dorf holen, wird Trudchen ja vielleicht Mitglied bei uns.«
Uwe Süß hatte die versammelte Aufmerksamkeit. Einerseits war das seit Langem sein Traum. Aber in der Wirklichkeit fühlte sich so viel Zuwendung eher bedrohlich als beglückend an. Offenbar brauchte es Übung, um zum Volkstribun zu werden. So wie es Übung braucht, um ein guter Autofahrer zu werden. Und ein raffinierter Liebhaber. Und ein Ehegatte, der nicht zweimal pro Abend die Fernbedienung verlegt.
»Ich lass mich nicht kaufen«, maulte Trudchen. »Das ist unmoralisch. So haben mich meine Eltern nicht erzogen.«
Mehr als ein Anwesender stellte sich in diesem Moment vor, wie die Eltern Kubinke ihrer kleinen Tochter am Frühstückstisch einhämmern, im Leben bloß nichts übereilt zu machen. Nie so schnell, dass dabei ein Luftzug entsteht. Nie, um anderen Menschen zu gefallen. So gesehen, hatte wohl selten ein Kind die elterlichen Erwartungen so perfekt erfüllt wie Trudchen, wenn sie im Schlachterladen Tag für Tag die Bildung von Warteschlangen vorantrieb. Aber ihre Eltern waren keine Kunden bei Rosellen, sie wohnten nicht in Wortleben, nicht mal im Norden, und waren somit Teil einer Welt, deren Entfernung die Einheimischen eher in Lichtjahren als in Kilometern maßen.
»Wenn Oma Tewer so weitermacht, wird sie nächste Woche von einem Lkw plattgebügelt«, knurrte Ferdi Düver. »Wenn wir Pech haben – und mein Gefühl sagt mir: Wir werden Pech haben –, ist der Fahrer einer von uns. Dann ist nicht nur Oma Tewer platt, sondern auch gleich unsere Partei.«
»Dann müssen wir uns ja nicht groß verändern«, maulte Rudi Herbst.
»Rudi, wann hat deine Frau zum letzten Mal ›mein Sonnenschein‹ zu dir gesagt?«
»Sie hat noch nie ›mein Sonnenschein‹ zu mir gesagt. Wir sind eine anständige Familie.«
Schlagartig wusste jeder Anwesende eine Anekdote über Oma Tewers unkonventionelle Art der Straßentraversierung beizutragen. Erst letzte Woche war der Jüngste von Fritz Wuermeling mit dem Rad auf die ortsbekannte Wuermeling-Nase gefallen, um Oma Tewer nicht in die Hacken zu fahren. Zum Dank hatte sie den weinenden Knaben zweimal mit ihrem Einkaufskorb geschlagen.
»Das war ja nur ein Weg«, wiegelte Rudi Herbst ab. »Aber sie rennt auch über die Hauptstraße. Guckt nicht rechts, guckt nicht links.«
»Links ist, wo wir sind«, murmelte Ferdi Düver. »Kein Wunder, dass da keiner hinguckt.«
»Dabei würde dann nichts passieren«, sagte Süß. Es war als Trost gemeint, aber Ferdi Düver entgegnete mit diesem Mix aus Brodeln und Lethargie: »Genau. Genau das ist es. Wo wir sind, passiert nichts. Es reicht nicht mal, eine alte Frau von den wackligen Beinen zu holen. Früher hat es nicht zu den Aufgaben unserer Chefs gehört, die eigene Grube noch tiefer auszuheben. Da hat man den Klassengegner in der Grube versenkt, und gut war’s.«
»Früher war nicht alles besser«, stellte Rudi Herbst klar. Er wollte gar nicht widersprechen, er hasste es, in einer Minderheit die Minderheit zu bilden. Aber er konnte seinen Drang, Unklarheiten zeitnah richtigzustellen, einfach nicht abstellen. Bei seiner Frau machte er sich damit auch nicht beliebt. Und kaum ein Kunde im Laden schätzte es, wenn Rudi ihm die Schuld daran gab, dass Toaster, Fernbedienung oder Kaffeemaschine den Geist aufgegeben hatte.
»Wenn wir die Ampel beantragen, ist das ein Beitrag zur Verkehrssicherheit«, behauptete Süß. »Sicherheit macht sich immer gut.«
»Sicherheit kommt noch vor Sichtbarkeit«, ertönte es in der Runde.
»Sicherheit ist ein Begriff, den die Schwarzen besetzt haben. Sie glauben, er ist ihr Eigentum. Wenn wir ihnen auf ihrem eigenen Hof Konkurrenz machen, beißen die sich vor Ärger in den Schwanz.«
»Sieht aber hässlich aus, so ein Trumm von Ampel.« Das war typisch Hillmer. Tagelang gab er keinen Mucks von sich, aber wenn Süß dabei war, seine Argumentationskette zu entwickeln, schoss er quer.
»Und wir müssen auch über die Stromkosten reden«, rief Jungsozialist Volker. »Das geht natürlich mit Sonnenkollektor oder Wasserkraft. Nur Nachhaltiges ist christlich. Und umweltbewusst. Und gesund. Und …«
»Es ist gleich 22 Uhr«, unterbrach ihn Ferdi Düver mit Blick auf seine Armbanduhr von Tchibo. »Da müssen alle ins Bett, die jünger sind als 18. Putz dir schon mal die Zähne.«
Der 17-jährige Oberschüler Volker verstand die Spitze. »Eines Tages gehe ich zu den Grünen«, drohte er. »Dann könnt ihr mir 100 Euro anbieten, und ich komme nicht wieder zurück.«
»Die nehmen dich nicht«, behauptete Ferdi. »Verscheißern können die sich alleine. Sind ja schon feste dabei. Lahmer Haufen, nur Lehrer und andere Besserwisser.«
»Ich gebe dir 120, wenn du sofort gehst«, sagte Süß. Er hatte einen Rochus auf den altklugen Knaben, zumal der ihn an sich selbst als junger Mann erinnerte. Aber der junge Uwe hatte es nie zum stellvertretenden Schulsprecher und verantwortlichen Redakteur der Schulzeitung gebracht.
»Geld ist nicht gut«, sagte Hillmer. »Geld stinkt. Aber die Idee an sich ist gut. Wir sollten Preise ausloben für jeden Neuzugang. Uwe könnte jedem neuen Mitglied ein Buch schenken.«
»Oh Gott, er will uns umbringen«, stöhnte Ferdi Düver.
»Zum Thema, Leute«, mahnte Süß. Er kannte die Neigung seiner Kadetten, jede Möglichkeit zur Ablenkung zu nutzen.
»Wo soll sie eigentlich hin, die Ampel?«, fragte Volker unerwartet.
Süß hätte den altklugen Knaben küssen mögen.
»Wir treten in die Sachdiskussion ein«, sagte er Hände reibend.
»Die Ampel muss natürlich in die Hauptstraße«, sagte Rudi Herbst. »Ich würde mich bereit erklären, den Platz vor meinem Laden zur Verfügung zu stellen. Fällt mir nicht leicht, aber was tut man nicht alles für die Gemeinschaft.«
»Deine Doppelzüngigkeit erreicht langsam das Niveau der Klassenfeinde«, knirschte Ferdi. »Wir denken an Sicherheit und Menschenleben. Alles, woran du denkst, ist, die armen Seelen in deinen teuren Laden zu locken, während sie sich beim Warten auf Grün die Beine in den Leib stehen.«
»Vor meinem Laden ist am meisten Betrieb«, behauptete Herbst.
Gutmütiges Gelächter hob an.
»Stell das Blinkeding doch gleich in dein Schaufenster«, schlug Ferdi vor. »Dann muss jeder erst deine überteuerten Japaner und Koreaner begucken, bevor er endlich auf die andere Straßenseite flüchten darf.«
»Die Ampel gehört neben die alte Eiche«, rief der Gasthörer aus dem Hintergrund.
Alle drehten sich zu ihm um. Aber er war Lehrer, er knickte nicht ein, wenn er in ablehnende Gesichter blickte.
»Protest!«, rief der Jungsozialist. »Scharfer Protest. Das gibt unserer Eiche den Gnadenstoß, zentnerweise Kohlenmonoxid und Schwefel.«
»Hallo! Elektroautos?«, rief Rudi Herbst.
»Na endlich!«, rief Uwe Süß. »Das lag ja schon lange in der Luft.«
»Was lag schon lange in der Luft?«
»Dass du der Erste sein wirst, der mit einem dieser Protzautos die Hauptstraße auf- und abfährt und so tut, als ob die Luft mit jeder Fahrt sauberer wird.«
»Drüben im Lager stehen schon welche«, rief Trudchen.
»Was drüben im Lager passiert, ist so interessant wie das, was auf dem Mars passiert«, entgegnete Süß.
»Ich habe gehört, sie kriegen bald eine eigene Ladestation.«
»Sehr gut. Dann schließt sich der Kreis.«
»Welcher Kreis? Und warum ist das schlecht?«
Das wusste Süß auf Kommando auch nicht. Aber die Erwähnung des Neubauviertels löste regelmäßig in ihm etwas aus. Nicht nur Neid auf die privilegierte Wohnlage. Nicht nur die Erkenntnis, dass ihm gute 100.000 fehlten, um sich auch nur eine der schlichteren Doppelhaushälften leisten zu können. Nicht nur die Schmach, in Diskussionen mit seiner Gattin kein Bein auf die Erde zu kriegen. Seit mehreren Jahren ließ sie keine Gelegenheit aus, ihn daran zu erinnern, wer im Haus das Geld verdiente. Dummerweise verschaffte ihr der Ärztinnenjob Welpenschutz. Wenn er den Anwalt der Kultur und Bildung hervorkehrte, zählte sie lässig an den Fingern die Zahl der von ihr in den letzten Tagen geretteten Leben auf. Er war sicher, dass sie übertrieb. Aber ihm fehlten die nötigen Informationen. Es war ihm nie gelungen, zu ihren Kolleginnen eine Nähe herzustellen, die ihn an den Strom der endlos fließenden Informationen anschließen würde. So war er hilflos Veras verbalen Manipulationen ausgeliefert.
»Wie wär’s mit der Hauptstraße an der Stelle, wo sich morgens und mittags die Kinder zwischen Bushaltestelle und Grundschule ballen?«
»Die kommen doch aus allen Richtungen«, konterte Rudi Herbst. »Die sind blitzschnell auf ihren kleinen Beinchen. Die erwischt kein Auto, auch nicht, wenn es sich Mühe gibt.«
»Bindet die Ampel doch Oma Tewer auf den Rücken. Dann ist das Ding immer da, wo es am dringendsten gebraucht wird.«
Süß fühlte sich zu einer Klarstellung herausgefordert: »Genosse Hillmer, wir führen hier eine Sachdiskussion. So eine Ampel wiegt doch gut und gerne …«
»Wenn ich kurz zusammenfassen dürfte …«
Stöhnen hob an, und Doktor Stuthe blickte sich erstaunt um. Er hatte seit einem Jahr kein Gefühl dafür entwickelt, dass seine zusammenfassenden Monologe nicht in die Landschaft passten. Die Genossen liebten es, das Für und Wider zu erörtern, leidenschaftlich und mit dem Willen zum Detail, das mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar war.
Hals-Nasen-Ohren-Facharzt Stuthe aus dem Krankenhaus der Kreisstadt war keine 48 Stunden nach dem Einzug in seinen 220-Quadratmeter-Bungalow in die Partei eingetreten. Uwe Süß hatte mit dem Landesvorstand in der Hauptstadt telefoniert und sich fernmündlich ein Lob abgeholt. Bürgermeister Wendlandt hatte alle Mediziner, von denen er wusste, dass sie eingeschriebenes Mitglied bei den Schwarzen waren, nach Herkunft, persönlichen Schwächen und Vorstrafen ausgefragt. Nachdem ihm der achte Arzt bestätigt hatte, dass Stuthe einfach gern politisierte, hatte er entnervt die Informationsbeschaffung eingestellt. Wendlandt befürchtete einen Dammbruch, wenn Vertreter der Akademikerschaft und aus dem hoch angesehenen Ärztestand sich mit der Minderheit in Wortleben gemeinmachten.
»Das Wort hat Genosse Gesundheit«, sagte Süß.
»Ich geh einen Strahl in die Schüssel stellen«, kündigte Ferdi Düver an. »Ist mein persönlicher Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Kommt jemand mit?«
Hillmer, Rudi Herbst und Süß standen auf.
»Darf ich auch?«, rief Volker erwartungsvoll.
»Wenn du 18 bist.«
20 Minuten später fragte Uwe Süß in die Runde: »Also was nun?«
Zuversicht auf allen Gesichtern. Die Abstimmung ging einstimmig an den Ampelstandort Hauptstraße.
»Ja, Genosse Walter, du willst etwas sagen? Ist das dein Ernst? Denk gut nach, was du sagen willst. Du weißt, was nach deinen letzten vier bis fünf Handzeichen stattfand?«
»Ich habe mich damals möglicherweise nicht klar genug ausgedrückt«, behauptete Walter Rottian. »Wird nicht wieder passieren.«
»Sehr beruhigend. Und nun los.«
Walter brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass es sich bei seinem Handzeichen vor einer Minute ursprünglich um eine Meinungsäußerung gehandelt hatte.
»Okay, dann will ich mal«, sagte er und blickte in aufmunternde Gesichter. Er begriff nicht, warum alle in diesem Moment eine weitgehend identische Miene an den Abend legten. »Mein Name ist Walter Rottian. Ich bin hier, um …«
»Anfangen!«
»Sehr gut. Genau. Mein Name ist Walter, ich wohne in der … ist ja klar, und dies wollte ich sagen: Angenommen, wir beantragen die Ampel. Weiter angenommen, wir kriegen die Ampel sogar durch. Angenommen, die Ampel wird dann auch tatsächlich gebaut und funktioniert eins a. Stichwort: Rot und Grün, Rot und Grün, ihr versteht das Prinzip?«
»Weiter!«
»Sehr gut. Genau. Was wollen wir tun, Genossen und Gast in der Ecke, damit die Bevölkerung, also die Bewohner von Wortleben, mit einem Wort: unsere lieben Wortlebener die verdammte Ampel annehmen und nicht fünf Meter daneben über die Straße trotten, wie das die Leute seit Jahrhunderten tun und damit gut gefahren sind? Beziehungsweise gegangen.«
Rottian hob den Arm und bestellte bei der im Hintergrund herumschleichenden Kellnerin einen Halben.
»Die gehen da rüber«, behauptete Doktor Stuthe. »Das entspricht dem Herdentrieb im Menschen.«
»Meine ich ja«, sagte Rottian. »Wir müssten einen stellen, der acht Stunden am Tag über den Zebrastreifen geht, immer hin und her, erst in die eine Richtung, dann in die andere, damit jeder kapiert, was alles möglich ist an einer Ampel, damit die Leute ein Vorbild haben. Ohne Vorbild ist alles nichts, was ich, nebenbei gesagt, …«
»Danke, Walter, vielen Dank für den aufschlussreichen Beitrag, der uns allen zu denken gibt.«
Uwe Süß wusste genau, wo im Ortsverein die Opposition saß. Rottian hatte zwar ein großes Maul, aber er riss es selten auf, weil er faul war und somit keine unkalkulierbare Gefahr für Süß darstellte.
»Wir stimmen jetzt ab«, sagte der Parteiführer energisch. In solchen Momenten, die viel zu selten waren, fühlte sich Süß von sich selbst jedes Mal mitgerissen. »Und auf der nächsten Ratssitzung kämpfen wir wie die Löwen. Wer unentschuldigt fehlt, wird das lange bereuen.«
Der Antrag wurde einstimmig angenommen, drei Minuten später standen neun unerwartete halbe Liter auf den Tischen. Nur vor Walter Rottian standen zwei.
4
Wenn Uwe Süß von einer Parteiversammlung nach Hause kam, pflegte er das Besprochene (Ortsverein) beziehungsweise Erlittene (Ratssitzung) mit seiner Ehefrau Vera – Kosename Doktor Vera, wahlweise Rübchen – nachzubereiten, egal ob sie vor dem Fernseher saß, auf dem Sofa lag oder schlafend im Bett. Diese Begegnungen konnten sich bis tief in die Nacht erstrecken. Die Kinderärztin war ihrem Gatten eine kongeniale Ratgeberin. Bisweilen kam es sogar vor, dass Uwe Süß ihren Rat befolgte. Obwohl er sie streng genommen fast nie um einen Rat ersuchte. Denn er wollte ja erzählen, wollte sich wahlweise als Helden und Manipulator oder Opfer unentschuldbarer Intrigen darstellen – je nachdem, was ihm stärker die Luft abschnürte und den Blutdruck an die 200 herantrieb.
»Rübchen, ich bin wieder da!«, rief er beim Betreten des Terracotta gefliesten Flurs. Statt Rübchen trottete Moppel auf ihn zu. Wahrscheinlich kam der übergewichtige Kater zufällig des Weges. Denn zu Gesten der Freundschaftlichkeit oder auch nur von Interesse an seinen Ernährern hatte sich Moppel seit Langem nicht mehr aufgerafft. Süß wusste keine einleuchtende Antwort auf die Frage, warum sie ihren unleidlichen Hausgenossen Tag für Tag durchfütterten und ihm alle 36 Stunden ein sauberes Klo bereiteten, was im Monat Kosten von 70 Euro verursachte, die Süß viel sinnvoller zur Abzahlung der horrenden Hypotheken verwenden wollte. Zumal die regelmäßigen Besuche beim Tierarzt weitere Euros verschlangen. Doch war es schwer, mit einer Kinderärztin auf sachlicher Grundlage über Routine-Untersuchungen zu streiten.
Moppel war nicht allein dicklich, sein Fell war von einem schmutzigen Weiß, das Uwe auf den Tod nicht leiden mochte. In seinen Augen wirkte das Tier permanent verdreckt.
Vor allem aber mangelte es Moppel an Charme, er schnurrte nicht einmal. Dafür schnappte er manchmal ohne Vorwarnung zu. Es war kein Biss im eigentlichen Sinn, es schmerzte auch nicht, aber es war ein Missbrauch von Vertrauen und kostete Moppel weitere Punkte auf der nach unten offenen Sympathieskala.
Im Garten saute er sich jedes Mal ein und er putzte sich kaum jemals. Der Kater war unempfindlich für alle abscheulichen Gerüche, die er am Fell ins Haus trug. Dass Moppel unter Mundgeruch litt, passte zu diesem Wesen wie die Faust aufs Auge. Dass er wegen seiner chaotisch in alle Richtungen wachsenden Krallen regelmäßig beschnitten werden musste, weil selbst Veras Kunst nicht hinreichte, rundete das negative Gesamtbild dieser Kreatur aufs Schönste ab.
Die Eheleute vermieden es, über Moppel zu sprechen. Dafür war eine schwache Minute von Uwe verantwortlich. Im Verlauf einer an sich unaggressiven Diskussion hatte er sich zu einer folgenreichen Bemerkung hinreißen lassen, an der die Beziehung bis heute schwer trug: »Wenn es bei uns jemals brennen sollte, ist das feiste Vieh das Letzte, was ich retten werde.«
»Hallöchen, Dicker«, sagte Süß, bückte sich und war bereit, Moppel übers Fell zu streichen. Er tat das nicht freiwillig und schon gar nicht gerne. Monatelang hatte er versucht, das 22 Pfund schwere Trumm zu ignorieren. Es war ihm ein inneres Missionsfest gewesen, als das Tier darauf mit vegetativen Sperenzien reagierte. Das war besser als nichts, doch leider verlegte sich Moppel darauf, seinen Durchfall nicht etwa im Garten oder in der innerhäusigen Toilette abzulassen. Er suchte sich dafür den Kachelboden der Küche aus. Süß war eingekesselt von Katzenexperten, die den Bewohnern dringend nahelegten, ihre emotionale Beziehung zu Moppel kritisch zu hinterfragen. Optimalerweise selbstkritisch. Seitdem beachtete Süß das Tier wieder, und Moppel schiss nicht mehr in die Küche.
An diesem Abend lief es wie jeden Abend. Nicht, dass Moppel seinem Beschützer um die Beine ging oder sich am Schienbein rieb – nein, er begann unverzüglich, an der Mahagonitür zu kratzen und weckte in Sekundenschnelle bei seinem Ernährer alle schlafenden Aggressionen. Süß öffnete die Tür, träge schleppte sich der Kater in die Nacht.
»Rübchen, gib Laut«, rief Süß lockend und strich vorfreudig erregt auf der Suche nach seiner Gattin durchs Erdgeschoss. Er fand sie im Wohnraum, den er mit einer Flasche Bier betrat.
»Huch!«, rief Birgit Kuhlmann, und Süß war bedient.
Birgit Kuhlmann war eine notorische Huch-Ruferin und machte aus jedem Furz ein Donnerwetter. Kein Ereignis war für sie zu unbedeutend, um es nicht durch ein groteskes »Huch« hochzujazzen.
Er beugte sich über das Sofa und verabreichte seiner Frau einen Kuss auf die Wange. Das tat er allerdings erst nach 20 Sekunden. Zwischen Vera und Uwe glomm seit geraumer Zeit eine Fehde, die in den Kussgewohnheiten der Eheleute ihren Ursprung fand. Vor einem halben Jahr hatte Vera ihrem Ehemann vorgeworfen, sie zur Begrüßung und zum Abschied nicht mehr mit der früher üblichen Inbrunst zu küssen. Als Beweis führte sie an, dass er seit Neuestem nichts weiter tat, als seine Wange neben ihr Gesicht zu halten, wohl in der irrigen Annahme, dass Vera den Wink schon verstehen werde. Uwe begriff bis heute nicht, was an diesem Tun verwerflich sein sollte.
Ihm ging es nicht ums Prinzip, das bestätigte er immer wieder gern, zur Not sogar unaufgefordert. Es ging ihm darum, seiner Frau die Unangemessenheit ihres Verhaltens vor Augen zu führen. Die Folge war ein bis heute andauernder ehelicher Stellungskrieg, der seinen praktischen Ausdruck in zwei Gesichtern fand, die maximal 60 Sekunden nebeneinander ohne Berührung verharrten, bevor schließlich der jeweils ungeduldigere Teil der Kontrahenten einen Kuss auf den Weg brachte.
»Ach, muss das schön sein, nach so vielen Jahren noch verliebt zu sein«, jubilierte Birgit Kuhlmann. Das Ehepaar Süß blickte sie erstaunt an. Birgit und Vera hatten sich während des Studiums in Frankfurt kennengelernt. Es hatte da wohl einen männlichen Kandidaten gegeben, in den sich beide verguckt hatten. Obwohl Süß nicht wusste, wie das funktionieren sollte, hatte diese Phase die Frauen einander nähergebracht. Ihr Kontakt war nie abgerissen und hatte auch fortbestanden, nachdem Uwe seine Vera zum Umzug ins nördliche Wortleben überredet hatte. Seitdem kam Birgit zweimal im Jahr vorbei und schwärmte der neidischen Vera tagelang die Ohren von den Segnungen der Großstadt voll. Uwe Süß sah diesen Besuchen stets mit Skepsis entgegen. Denn die Woche nach Birgits Abreise war erfüllt mit einer schlecht gelaunten Gattin.
»Ach, Uwe«, sagte Birgit nach bewährtem Muster, »wie haltet ihr beiden das nur in dem Kuhdorf aus?«
Die verächtliche Wortwahl sowie sämtliche in der Frage enthaltenen Unterstellungen empörten den Lokalpolitiker.
»Ihr Stadtleute vertragt eben keine himmlische Ruhe mehr.«
»Quatsch«, sagte Vera, und Uwe verspürte wieder diese Schmerzen in der Herzregion. Vera neigte dazu, ihren Mann im Regen stehen zu lassen und respektlos über Wortleben, seine Bewohner und seine Bedingungen herzuziehen. Seitdem der Buchhändler hier lebte, hatten die Kontakte zu vielen alten Freunden gelitten. Der Schritt von der Metropole in die Provinz ist ja nicht allein in Kilometern zu messen, und Süß fand gleich zu Beginn der verbalen Kampfhandlungen die passenden Worte: »Entweder du lebst in Plastik, Hektik und Teuer oder du gehst an die Wurzeln zurück.«
Nicht zum ersten Mal ließ Vera die Zimmerluft auf eine Weise über ihre Stimmbänder gleiten, dass es sich für Uwe wie eine höhnische Sinfonie anhörte.
»Hier spielt die Musik, Birgit«, sagte er. »Was ihr in der Stadt treibt, ist heiße Luft, nichts weiter. Glaubst du, ich vermisse eine Oper und 50 Kinos und Konzerthäuser, die eine Milliarde gekostet haben, damit die Besserverdienenden sich dort für ihr Abo den Arsch wundsitzen?«
»Niemand vermisst eine Oper«, konterte Birgit.
»Bei euch ist alles so indirekt«, fuhr er fort. »So tot und theoretisch. Ihr habt Kontobewegungen, bei uns bewegen sich die Ähren auf den Halmen und …«
»… und die Maiskolben auf den maschinenoptimierten Industriefeldern«, gab Vera zum Besten.
»Guck nur mal aus dem Fenster«, forderte Birgit den Einheimischen auf. »Kein Licht. Schwarz wie die Nacht. Zum Fürchten ist das.«
»Fürchten ist gut!«, rief Uwe. »Bei uns erfährst du, was Nacht überhaupt bedeutet. Bei uns siehst du den Nachthimmel. Zu uns kommen immer mehr Touristen, die sich dieses Naturwunder leisten wollen. Echte authentische Nacht. Ich kämpfe jedes Mal mit den Tränen, wenn ich das sehe.«
»Er übertreibt nicht«, sagte Vera. »Er stößt sich das Knie am Zaun und ist ergriffen von der Begegnung mit dem Authentischen.«
»Dann ist es ja gut, dass du mit einer Frau zusammenlebst, die sich mit Erster Hilfe auskennt«, sagte Birgit. Sie hatte schon seit mehreren Minuten nicht mehr Huch gesagt. Er rang mit der Versuchung, zur Abwechslung derjenige zu sein, der mit Zahlen um sich warf. Eineinhalb Millionen leere Wohnungen warteten in Deutschland in dieser Minute auf neue Bewohner. Bezahlbare Wohnungen in kleinen Städten und harmonisch angelegten Dörfern. Aber niemand wollte sie beziehen, lieber legte man für winzige Butzen ohne Luxus jeden Monat 1.500 Euro auf den Tisch, damit man sich als Bewohner einer großen Stadt bezeichnen konnte.
Er sagte: »Wir sind nicht so oft ins Theater gefahren, wie wir uns vorgenommen haben, das gebe ich zu. Das liegt aber nicht an Wortleben, sondern an mir. An meinen Verpflichtungen. Die Verpflichtungen von deinem Mann.«
»Du wirst nie Bundeskanzler werden.«
»Du könntest recht haben.«
»Du wirst nicht mal Ministerpräsident werden.«
»Möglich, aber noch nicht bewiesen. Ich habe auch nie gesagt, dass kleine Orte alle Bedürfnisse abdecken können.«
»Seltsam, dass man aber manchmal denkt, du würdest gerade über das Paradies sprechen, während du in Wirklichkeit über Wortleben sprichst oder über das Wendland oder über andere ländliche Regionen, wo angeblich gerade viel in Bewegung geraten ist. Ich bin früher so gern ins Theater gegangen. Wir ziehen raus aus der Stadt. Und auf einmal reicht die Zeit nicht mal, um nach Lüneburg oder Celle zu fahren, obwohl die Fahrt von hier nach dort genauso lange dauert wie in Frankfurt die Fahrt von einem Ende zum anderen.«