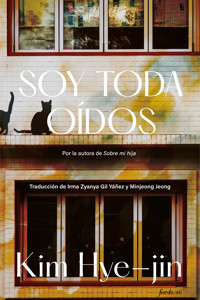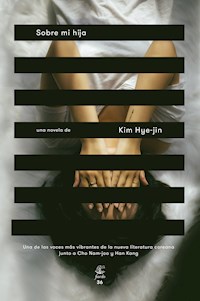Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Kim Hye-jin, die neue literarische Entdeckung aus Südkorea, erzählt die Geschichte einer Frau, deren Weltbild angesichts des queeren Lebensentwurfs ihrer Tochter aus den Fugen gerät.
Seit Jahren teilen Mutter und Tochter wenig mehr als ein wortkarges Mittagessen pro Woche. Zwischen ihren Nudelschalen türmt sich ein Berg aus Ungesagtem. Die Mutter, Pflegerin im Seniorenheim, führt ein unauffälliges, bescheidenes Leben. Ihre Tochter Green hat einen anderen Weg gewählt: Sie hat keinen Mann, kaum Einkommen und liebt eine Frau. Als das Paar bei der Mutter einziehen muss, prallen die radikal verschiedenen Lebensentwürfe aufeinander.
Mit großer Sensibilität und sanfter Wucht ergründet Kim Hye-jin die Ängste einer Generation, die sich dem selbstbestimmten Leben ihrer Kinder stur in den Weg stellt. Ein notwendiger Roman über die Enge und Starrheit von Tradition und die Möglichkeit zum Wandel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Kim Hye-jin, die neue literarische Entdeckung aus Südkorea, erzählt die Geschichte einer Frau, deren Weltbild angesichts des queeren Lebensentwurfs ihrer Tochter aus den Fugen gerät.Seit Jahren teilen Mutter und Tochter wenig mehr als ein wortkarges Mittagessen pro Woche. Zwischen ihren Nudelschalen türmt sich ein Berg aus Ungesagtem. Die Mutter, Pflegerin im Seniorenheim, führt ein unauffälliges, bescheidenes Leben. Ihre Tochter Green hat einen anderen Weg gewählt: Sie hat keinen Mann, kaum Einkommen und liebt eine Frau. Als das Paar bei der Mutter einziehen muss, prallen die radikal verschiedenen Lebensentwürfe aufeinander.Mit großer Sensibilität und sanfter Wucht ergründet Kim Hye-jin die Ängste einer Generation, die sich dem selbstbestimmten Leben ihrer Kinder stur in den Weg stellt. Ein notwendiger Roman über die Enge und Starrheit von Tradition und die Möglichkeit zum Wandel.
Kim Hye-jin
Die Tochter
Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee
Hanser Berlin
Die Bedienung serviert zwei Schüsseln mit heißen Udon-Nudeln. Das Gesicht meiner Tochter wirkt etwas müde, eingefallen und gealtert, als sie Löffel und Stäbchen aus dem Besteckkorb nimmt.
»Hast du meine Nachricht gelesen?«, fragt sie.
»Ja, ich wollte antworten, aber dann kam etwas dazwischen, und ich habe es vergessen.« Ich sage das, als sei nichts dabei. Aber es ist eine Lüge. Tatsächlich bin ich völlig erschöpft, weil ich mir über die Angelegenheit das ganze Wochenende lang den Kopf zerbrochen habe. Doch nun sitze ich vor ihr ohne eine Lösung oder wenigstens einen Plan.
»Wo warst du denn am Wochenende?«
Ich nenne den Namen einer Freundin, die sie auch kennt, und gebe vor, mich mit ihr zum Essen getroffen zu haben. Meine Tochter macht Anstalten, weiterzufragen, begnügt sich dann aber mit einem simplen »Aha«. Als fühle sie sich verpflichtet, Anteil zu nehmen, fügt sie hinzu: »Es gibt gerade eine Menge Festivals. Das wäre doch mal eine nette Abwechslung.«
»Ach, dafür fehlt mir einfach die Muße.«
Ich fische eine dicke Nudel aus meiner Schale heraus und zwinge mich, sie zu essen. Früher, als ich noch jung war, habe ich Nudelgerichte geliebt. Sie waren fester Bestandteil meiner täglichen Mahlzeiten. Ich mag sie noch immer, bekomme aber hinterher Probleme mit der Verdauung. Wie oft muss ich meinen aufgeblähten Bauch massieren oder, kaum dass ich mich zum Schlafen hingelegt habe, wieder aufstehen und herumlaufen. Älter zu werden heißt, alle Vergnügungen nach und nach aufzugeben.
Eine Gruppe junger Menschen, vermutlich Studenten, kommt herein, während einige Büroangestellte, die gerade mit dem Essen fertig sind, zur Kasse eilen. Ausgelassenes Gelächter und laute Stimmen erfüllen den Raum. Überall sind nur junge Leute. Dazwischen ich, mit meinen Falten und Altersflecken. Dünne Haare und ein krummer Rücken vervollständigen mein desolates Erscheinungsbild. Ich passe nicht hierher. Ich habe das Gefühl, als würde jeden Augenblick jemand eine abfällige Bemerkung über mich machen. Aufmerksam wandern meine Augen hin und her. Meine Tochter leert ihre Schüssel zügig. Mir schwirrt immer noch meine Hauptsorge durch den Kopf. Soll ich etwas sagen? Darf ich das überhaupt? Oder lieber nicht? Habe ich nicht sogar eine Verpflichtung dazu? Aber da ist etwas, wovor ich Angst habe. Wie mir meine Ablehnung vergolten würde.
»Wie du weißt …« Es dauert lange, bis ich meinen Mund aufbringe. Wie du weißt, in dieser Floskel und wie ich sie sage, wird meine ablehnende Haltung mehr als offensichtlich. Meine Tochter begreift, und für einen Moment verrät ein Flackern in ihren Augen ihre Enttäuschung.
»Ich weiß, dein Einkommen reicht hinten und vorne nicht«, sagt sie. Dann sieht sie mich gespannt an und wartet darauf, dass ich etwas erwidere. Ich kann mir die steigenden Wohnkosten, die durch die Decke gehen, während man schläft, nicht mehr leisten. Die Preise kennen kein Halten. Aus dem Spiel, in dem jeder rennt und springt und sich die Anstrengungen, mitzuhalten, aufschaukeln, bin ich schon längst ausgeschieden.
»Wie du weißt, ist dieses Haus das Einzige, was mir geblieben ist«, entgegne ich.
Eines der Häuser, die sich wie verfaulte Zähne dicht in einer engen Gasse am Stadtrand aneinanderreihen. Ein baufälliges zweistöckiges Haus, seiner Besitzerin ganz ähnlich, vornübergebeugt, mit abgenutzten Gelenken und mürben Knochen. Ein Haus, das nichts mit der restlichen Bausubstanz dieser Welt gemein hat, die sich tagtäglich selbstbewusst erneuert. Es ist das Einzige, was mein Mann mir hinterlassen hat. Ein sichtbares Objekt. Das Einzige, über das ich Kontrolle und Eigentumsrecht habe.
»Ich weiß, ich weiß es sehr gut. Aber ich habe keine andere Wahl, als dich um Hilfe zu bitten. Wen soll ich denn sonst fragen? Du bist doch meine Mutter«, murmelt meine Tochter vor sich hin, während sie in ihrer Schüssel rührt. Ihr Tonfall schwankt zwischen Resignation und Erwartung. Dann sagt sie schließlich noch etwas, ein verzweifelter, letzter Vorschlag. Sie werde mir monatliche Zinsen zahlen, wenn ich ihr eine beträchtliche Summe vorschießen würde. Wahrscheinlich hat sie an die zwei Mietwohnungen im Obergeschoss gedacht, deren Badezimmerdecken mit Wasserflecken übersät sind, deren Linoleumböden überall abgenutzt und zerrissen sind und bei denen ununterbrochen Wind, Staub und Lärm durch die alten Holzfensterrahmen dringen. Sie will wissen, wie viel ich bekommen kann, wenn ich den jetzigen Mietern kündige und neuen Mietern eine hohe Kaution abverlange.
Die derzeitigen Mieter loszuwerden und neue an Land zu ziehen, die bereit sind, eine höhere Einlage zu zahlen, ist jedoch nicht so einfach. Vor einigen Tagen kam die frisch vermählte Mieterin einer der beiden Wohnungen im Obergeschoss zu mir herunter und beschwerte sich, dass von der Küchendecke Wasser tropfe. Sie sagte, ich solle den Schaden ordentlich reparieren lassen, durch einen Fachmann und nicht durch einen abgehalfterten Heimwerker. Dabei trug sie eine Miene zur Schau, die eine Mischung aus Ärger, Verlegenheit, Verständnis und Zögern verriet.
»Ich verstehe. Bitte haben Sie etwas mehr Geduld.«
Das war es, was ich antwortete, doch im Augenblick kann ich leider nichts machen. Ich habe einfach keinen Spielraum, die Reparaturkosten zu übernehmen, zumal ich keine Ahnung habe, wie teuer es wird. Der Neuvermählten geht es wohl nicht anders, so oft, wie sie zu mir kommt und mich um Hilfe bittet.
Unter dem Tisch wippt meine Tochter mit den Füßen. Die Sohlen ihrer Turnschuhe sind schief abgelaufen. Der Saum der Jeans ist aufgegangen und unansehnlich fransig. Weiß sie wirklich nicht, dass solche Kleinigkeiten darüber bestimmen, welchen Eindruck ein Mensch auf andere macht? Warum stellt sie all die Dinge, die niemanden etwas angehen, wie ihre prekäre Lage, ihre Nachlässigkeit und das mangelnde Feingefühl, einfach so zur Schau? Warum gibt sie anderen Anlass, sie falsch einzuschätzen? Warum vernachlässigt sie Dinge wie Anstand, Würde, Sauberkeit und Ordnungsliebe, die sonst von allen so wertgeschätzt werden? Mühsam halte ich zurück, was ich sagen möchte.
»Mama, hörst du mir zu?«, bedrängt mich meine Tochter.
Nach einer Weile lege ich meine Stäbchen beiseite und wische mir den Mund ab, bevor ich mit ihr Blickkontakt aufnehme. Stimmt. So funktioniert Familie. Ich bin alles an Familie, was dieses Kind hat. Das heißt es wohl, eine Familie zu sein. Wahrscheinlich ist es wegen des Hauses. Ja, allein weil ich ein Haus besitze. Alles, was ich sage, ist:
»In Ordnung. Lass uns eine Lösung finden.«
*
»Hey, wie viel hast du in dein Kuvert gesteckt?«, flüstert mir die Frau des Professors ins Ohr. Aber ihre Stimme ist laut genug, dass alle Umstehenden zu uns her blicken. Ich bleibe am Eingang des Gebäudes stehen und tätschele sanft ihre Hand.
»50.000 Won. So viel, wie es mir meine Lage erlaubt. Was kann ich denn sonst tun?«
Die Frau des Professors holt einen Umschlag aus ihrer Handtasche und schiebt brummend noch 20.000 Won, etwa 15 Euro, ins Kuvert. »Wozu so viel? 30.000 hätte völlig genügt.«
Jedes Mal, wenn sich die Frau bewegt, verströmt sie den intensiven Geruch eines billigen Rosenparfüms. Ihre bordeauxrote Handtasche quillt vermutlich über vor solchen billigen Kosmetika. Dinge mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum oder von schlechter Qualität, die sie großzügig hergeben kann, ohne dass ihr etwas daran verloren geht. Ich habe dergleichen gelegentlich von ihr geschenkt bekommen, die Cremes und Öle aber nie wirklich benutzt. Zwar denke ich immer wieder daran, doch dann vergesse ich es bei der passenden Gelegenheit. Seit einer Weile zählt die Vergesslichkeit zu meinen ständigen Begleitern, die ein kurzes helles Aufflackern der Erinnerung sogleich mit Dunkelheit umhüllt.
»Die Betreffende ist tot, was bringt ihr das Geld? Da haben nur die Kinder was davon. Stattdessen sollte man lieber zu Lebzeiten ein Essen veranstalten. Meinst du nicht? Wir sollten solche Traditionen abschaffen. Was nützt das hier schon?« Die Frau hört nicht auf zu reden, selbst nachdem sie durch die Drehtür in das Gebäude entschwunden ist.
Ich wende mich von der grellen Beleuchtung und ihrem hellen Widerschein in den Blumengebinden ab. Während ich die große Informationstafel studiere und nach dem Trauerzimmer suche, entschlüpft mir ein: »Grässlich. Fürchterlich.«
Wenn man bedenkt, wie oft wir von der verstorbenen Frau Song eingeladen wurden, ist das weit mehr als 100.000 Won wert. Ach was, die Summen sind nicht im Entferntesten vergleichbar! Frau Song war stets eine Geberin gewesen. Genau genommen waren ihre Voraussetzungen, spendabel zu sein, nicht besser als unsere. Und dennoch drängte sie sich oft vor, wenn es ans Bezahlen ging. Manchmal bereitete sie anderen damit Unbehagen, aber so sorgte sie zumindest dafür, immer Menschen um sich zu haben. Wie dem auch sei, jetzt zu erleben, dass sich ihr gegenüber jemand so dermaßen geizig verhält wie die Frau des Professors, ist abstoßend. Sie sagte einmal, ihr Mann sei Professor, doch ich bin ihm nie begegnet, und sie hat auch nicht weiter erwähnt, wo und was er lehrt. Eigentlich ist das für alte Leute wie uns nicht mehr so wichtig. Mit zunehmendem Alter ist es leichter, Menschen aus anderen Schichten zu treffen, von denen man als junger Mensch nicht geglaubt hätte, sie irgendwann kennenzulernen, weil man von einer unsichtbaren Grenze umgeben war.
Das mag daran liegen, dass Menschen sich im Alter immer ähnlicher werden, denn das Älterwerden betrifft jeden gleichermaßen. Ebenso wie die Suche nach einer Anstellung, von denen es für ältere Arbeitnehmer viel zu wenige gibt.
Aber das sage ich nicht laut.
Ich finde den Kondolenzraum für Frau Song, gehe hinein und begrüße einen der Trauernden, der ihr Sohn sein muss. Während des Leichenschmauses schlürfe ich nur das Pilzwasser, das ich mir in einer Thermoskanne mitgebracht habe. Die Frau des Professors isst von einem scharfen Fleischeintopf, in den sie reichlich Reis gegeben hat. Dazu nimmt sie einige Scheiben getrocknetes Schweinefleisch. Dann öffnet sie ihr Klapp-Handy und zeigt mir eifrig Bilder von ihrem Sohn und ihrem Enkel.
»Hast du ein Taschentuch? Gibt es irgendwo eine Tüte?«, fragt sie mich. Daraufhin beugt sie sich zu mir herüber, zieht die nutzlos gewordene Plastikverpackung eines Einwegtellers zu sich heran und schiebt die übrig gebliebenen trockenen Häppchen von dem Teller vor mir hinein. Ich nehme schweigend die Teller aus unserer Umgebung und reiche sie ihr.
»Mein Enkel liebt das. Nur die Schwiegertochter macht Theater, wenn ich ihren Sohn mit so etwas füttere. Aber was soll ich machen? Ich muss es ihm eben heimlich zustecken.«
»Ja, pack nur genug ein«, entgegne ich beiläufig, doch ich beachte die angerichteten Speisen überhaupt nicht. Ich fürchte mich zu sehr davor, von der Energie oder der Aura derjenigen Seelen, die die Grenze zum Jenseits bereits überschritten haben, auf unheilvolle Weise berührt zu werden. Plötzlich fällt mein Blick auf eine Person, die mir gegenüber an eine Wand gelehnt dasitzt. Aus ihren Augen spricht Resignation. Sie scheinen alles zu wissen und mir zu sagen, dass ich als Nächstes dran bin, weshalb ich hastig meinen Blick abwende. Altern ist wie ein Spiel, in dem jeder die Augen schließt und bis drei zählt, während ein Mitspieler sich von hinten anschleicht, sein Opfer bei den Schultern packt und erschreckt. Frau Song starb aus heiterem Himmel, ihr Herz hatte eines Tages nach getaner Arbeit aufgehört zu schlagen. Herzinfarkt: Der Tod als Diagnose. Wie nah ist er mir bereits gekommen? Warum bin ich so sicher, dass er nicht mehr weit ist?
Vor einigen Monaten erhielt ich Besuch von einem Verwandten der Mieterin, die in der Eckwohnung im ersten Stock meines Hauses wohnte. Schon früher waren Leute zu mir gekommen und hatten sich als ihre Freunde oder Liebhaber ausgegeben, aber ich hatte keinem von ihnen den Wohnungsschlüssel gegeben. Wie könnte ich bloßen Lippenbekenntnissen glauben?
»Ich kann sie nicht erreichen. Ich brauche dringend eine Unterschrift und wusste nicht mehr, was ich tun soll, daher bin ich hergekommen.«
Der Mann, der an diesem Tag vor mir stand, behauptete, der jüngere Bruder der Mieterin zu sein. Als ich jedoch nicht darauf reagierte, fuhr er fort, es handele sich um die Grabumbettung des verstorbenen Vaters. Er zog sogar ein Dokument heraus und zeigte es mir. Während ich dastand und in den ersten Stock hinaufsah, ging der Mann einfach die Außentreppe hinauf. Kurz darauf drang das Geräusch einer sich öffnenden Tür zu mir herunter. Dann war es eine ganze Weile still.
»Hallo! Hallo, junger Herr!«, rief ich hinter dem Mann her, aber ich folgte ihm nicht.
Schließlich kam er mit starrer Miene die Treppe hinunter. Dann wandte er sich an mich: »Meine Schwester ist in ihrem Zimmer. Was soll ich jetzt tun? Ich werde es melden müssen. Anzeigen.«
Er eilte durch das Hoftor hinaus und kehrte nie wieder zurück. Ein Krankenwagen kam und transportierte den Leichnam der Frau ab. Bald traf die Polizei ein, und während man mich bis zum Abend festhielt und mir allerlei Fragen stellte, schien der junge Mann bereits über alle Berge zu sein und war unauffindbar.
»Haben Sie den Bruder meiner Mieterin gefunden?« Als ich den zuständigen Kommissar unter einigen Schwierigkeiten am nächsten Tag telefonisch erreichte, erwiderte er:
»Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Die Familie will die Verstorbene nicht abholen. Sie müssen die Entsorgung ihres Hausstands selbst organisieren. Um die Leiche kümmert sich der Staat, aber mit weiterer Hilfe ist nicht zu rechnen. Die Frau hat doch gewiss eine Kaution für die Wohnung hinterlegt, nicht wahr? Verwenden Sie zunächst das Geld, um die Wohnung in Ordnung zu bringen. Und rufen Sie bitte nicht wieder an. Wir haben hier alle Hände voll zu tun.« Mit diesen Worten legte er auf, sodass ich nicht nachfragen konnte, wann und wodurch die Mieterin gestorben war.
Erst zwei Tage später betrat ich die Wohnung. Wie lächerlich mein Verhalten doch war. Da stand ich am helllichten Tag, wenn die Bäume draußen die sanften und warmen Sonnenstrahlen gierig aufnehmen und Knospen treiben, zögernd in der Tür und umklammerte die Klinke! Die Wohnung enthielt nichts, was meine Ängste befeuert hätte. Da waren nur Dinge, wie sie eine alleinstehende Frau besitzen würde, arrangiert und ordentlich aufgereiht nach ihrem Geschmack, ihrer Gewohnheit und für den Alltag bereitgelegt. Ein Tod also, der ohne Warnung, Symptome, Vorankündigung oder andere Anzeichen eines Tages einfach eingetreten war.
»Ein bedauerliches Ereignis«, murmle ich vor mich hin, während ich die alten Menschen um mich herum betrachte. Dann muss ich daran denken, dass es niemanden überraschen würde, wenn einer von ihnen gleich morgen das Zeitliche segnete. Welch trauriges Ableben. Natürlich wäre mit den üblichen spöttischen Bemerkungen zu rechnen, der Betreffende habe wahrlich lang genug gelebt. Die Hinterbliebenen werden nüchtern analysieren, wie der Verstorbene sein Leben geführt hat, anstatt von ganzem Herzen zu trauern. Wenn es nichts gibt, was sie kritisieren oder verurteilen können, werden sie ihn bald vergessen haben. Als hätte es ihn nie gegeben. Ich verlasse den Leichenschmaus. Mein Blick fällt kurz auf den Sohn von Frau Song, der in einem schwarzen Anzug mit weißer Armbinde Beileidsbekundungen empfängt und den Kondolenzraum hütet.
*
»Es wird ja als Schamanen-Krankheit bezeichnet, wenn jemand ohne ersichtlichen Grund krank wird. Dann muss die Betroffene durch ein Ritual dem zuständigen Geist huldigen. Wer das verweigert, vererbt die Krankheit an das eigene Kind weiter. Wer will das schon verantworten? Also beschließt man eben, alles selbst auf sich zu nehmen«, rede ich vor mich hin. Wenn ich an meine Tochter denke, versteife ich mich gelegentlich auf diese Vorstellung. Muss ich vielleicht eine Strafe erdulden? Ist etwas Verqueres von mir auf meine Tochter übergegangen? Tsen sitzt im Rollstuhl und schaut aus dem Fenster. Dahinter spritzt ein Angestellter den großen Parkplatz ab. Das Wasser schießt aus dem Schlauch, verteilt sich in einem gefächerten Strahl und steigt nach dem Auftreffen auf dem Boden als Dunst in die Luft.
»Möchten Sie nach draußen?«, frage ich Tsen, ohne den Vorschlag ernst zu meinen, und blicke dabei zu ihr. Eine Frau, die zu lange gelebt hat. Eine Frau mit Erinnerungen, die irgendwo versickern. Eine Frau, die die Geschlechtergrenzen hinter sich gelassen hat und nur noch Mensch ist, wie bei ihrer Geburt vor langer Zeit.
Manchmal kommt mir das Leben dieser kleinen, mageren und unscheinbaren Frau wie eine Lüge vor.
Sie ist in Korea geboren, hat in den USA studiert, in Europa gearbeitet und widmete nach ihrer Rückkehr in die Heimat ihr ganzes Leben Menschen, die in keiner unmittelbaren Verbindung zu ihr standen. Ich kann nicht glauben, dass sich in ihr, unverheiratet und kinderlos, eine riesige Weltkarte entfaltet, voller Erinnerungen an Gegenden, in denen ich noch nie war, und zugleich voller weißer Flecken aus endloser Einsamkeit. Sie erhält das ganze Jahr über keinen Besuch.
An einem Tisch auf der anderen Seite des Raums entsteht ein Tumult. Ein alter Mann schimpft laut, schleudert eine Fernbedienung von sich und wirft durcheinander, was sonst noch auf dem Tisch liegt. Seine Betreuerin, die Frau des Professors, ist nirgends zu sehen. Sie hat sich vermutlich versteckt und telefoniert heimlich oder nascht etwas. Ich beeile mich und fahre Tsen im Rollstuhl aus dem Raum. Ohnehin kann ich solche alten Männer mit meiner Kraft nicht bändigen.
Vor dem Abendessen öffnet jemand die Zimmertür und ruft nach mir. Es ist Herr Kwon, der Verwaltungsdirektor. Als ich in den Flur trete, fragt er, ob ich morgen eine Stunde früher zur Arbeit kommen könne. Ein Fernsehsender habe sich angesagt, um eine Reportage über Tsen aufzunehmen. Ich erkläre mich einverstanden. Direktor Kwon neigt höflich den Kopf. Glaubt man der Frau des Professors, ist er mir besonders wohlgesonnen. Auf mich wirkt er eher bemüht, die Regeln des Anstands einzuhalten. Ich weiß, dass sein Verhalten die Haltung des übrigen Personals bestimmt. Sollte ich angesichts der Tatsache, dass sich die meisten älteren Pflegerinnen offensichtlich mit niedrigen Löhnen, schlechter Behandlung und Geringschätzung abfinden müssen, für sein Bemühen dankbar sein? Es liegt wahrscheinlich an Tsen, die ich betreue. Hier ist es wichtig, welche Art von Patienten eine Pflegerin in ihrer Obhut hat. Zumindest in Tsens Gegenwart verhalten sich alle respektvoll und höflich.
»Hat Sie wirklich keine Familie?«, fragt eine neue Pflegerin neugierig.
Ist Tsen jedoch nicht dabei, ändert sich das Benehmen. Besonders Menschen wie die Frau des Professors zeigen dann schnell ihr wahres Gesicht.
»Was ist mit der Familie? Die sind eh alle gleich.«
Nur wenige Kinder besuchen ihre Eltern regelmäßig, nachdem sie sie in ein Pflegeheim gegeben haben. Obwohl sie das genau weiß, scheint die Frau des Professors die Hoffnung in ihr eigenes Kind nicht aufgeben zu wollen.
»Mit oder ohne eigene Kinder alt zu werden, macht einen großen Unterschied. Es tut mir wirklich weh, zu sehen, dass Tsen schon seit Jahren so allein ist. Also, egal wie schwierig die Kindererziehung ist, gib dir Mühe damit. Das ist deine Vermögens- und Alterssicherung.« Mit diesen Worten reagiert die Frau des Professors auf die Frage der Neuen, die ich ignoriert hatte, und schnalzt mit der Zunge. In solchen Situationen merke ich, dass ich nicht in einer Position bin, mir meinen Umgang auszusuchen. Passe ich mich, indem ich mit Menschen wie der Frau des Professors spreche und ihr beipflichte, dem Bild an, das junge Menschen von uns alten Leuten haben? Nähre ich das Klischee, engstirnig und voll von Vorurteilen zu sein und nur dem Staat auf der Tasche zu liegen? Die junge Pflegerin antwortet »Ja, ja«, scheint aber von den Worten der Frau des Professors nicht überzeugt zu sein. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie sich noch nicht an die Arbeit bei uns gewöhnt hat. Sie wird es nicht leicht haben, sie hat die Patienten der verstorbenen Frau Song übernommen. Nach anfänglicher körperlicher Erschöpfung gewöhnt man sich irgendwann an die aufreibende Arbeit. Viele kündigen jedoch wieder, bevor sie an diesen Punkt kommen. Die meisten Pflegerinnen, die dauerhaft bleiben, sind Menschen, die außerhalb der Einrichtung keine Perspektive haben.
Ich gehe in Tsens Zimmer und sehe nach, ob sie es bequem hat. »Alles in Ordnung? Ich komme morgen früh wieder.«
Sie ergreift meine Hand und fragt: »Wo ist dein Haus? Ist es weit weg? Oder ist es in der Nähe?«
Ich sage, es läge nicht weit entfernt und sei mit dem Bus schnell erreichbar.
Tsen nickt zufrieden und ermahnt mich sanft: »Na dann. Pass auf dich auf. Achte auf den Verkehr.«
Daran, wie sie das sagt, erkennt man, wie klar sie im Kopf ist. Ich streiche mit meiner Hand über ihre Stirn. Das Gesicht einer Frau, die gut zwanzig Jahre älter ist als ich. Die Haut ist faltig und rau, aber ihre Züge sind immer noch fein. Ich drücke Tsens Hände und wünsche ihr eine gute Nacht, bevor ich aus dem Zimmer gehe. Die schwach dosierte Schlaftablette, die sie eingenommen hat, sollte ihr helfen, bald in tiefen, erholsamen Schlaf zu fallen.
Ich ziehe mich um und mache mich auf den Heimweg. Vor dem Aufzug treffe ich die Frau des Professors und die neue Pflegerin, die mich schon erwarten. Wir nicken der Krankenschwester der Nachtschicht zu und verlassen das Gebäude. Vom anderen Ende der Gasse dringt laute Musik zu uns herüber. Die enge Seitenstraße mündet in eine Kreuzung, an der sich Geschäfte und Kneipen aneinanderreihen, die bis spät in die Nacht hell beleuchtet sind. Erst jetzt fällt die Anspannung von mir ab, und meine Knie beginnen zu schmerzen.
»Wolltest du nicht deine Tochter treffen? Wie ist es gelaufen?«
Es ist später Abend, aber die Luft hat die Hitze des Tages konserviert. Dazu meine eigene Körperwärme, die oben am Kragen entweicht.
»Lang kann ich es nicht mehr hinauszögern. Doch wann in aller Welt soll ich die Zeit dazu finden?«, weiche ich ihr aus. Ich weiß, warum sie so nachbohrt, sie will ihre guten Ratschläge und klugen Kommentare loswerden. Natürlich ist es das nicht wert, sich auf ihre unnötige Einmischung einzulassen, aber ich kann dabei kaum ruhig bleiben. Die Frau des Professors stimmt mir zu und holt ihr Handy heraus. Dann zeigt sie uns Bilder von ihrem Enkelkind.
»Was für ein aufgewecktes Kind! Wie alt ist er?« Die junge Pflegerin reagiert mit den üblichen Floskeln höflicher Anteilnahme. Ich sage nichts und tue die ganze Fahrt über so, als würde etwas in meinem Handy meine ganze Aufmerksamkeit erfordern. Ich trete eilig auf den Bordstein hinaus und verabschiede mich:
»Bis morgen. Kommt gut nach Hause!«
In Sommernächten fällt mir das Einschlafen schwer, wegen des Lärms, der durch das Fenster dringt. Vorbeiknatternde Motorräder von Lieferdiensten, das Geschrei des zankenden Ehepaars im Obergeschoss. Im Licht des Fernsehers klebe ich ein Wärmepflaster auf mein Knie und reibe mit einer Salbe meine Schultern ein. Dann hole ich eine halbe Wassermelone aus dem Kühlschrank und löffele sie gierig. Danach gibt es nichts mehr zu tun.
Ich liege im dunklen, stillen Zimmer, und das Gedankenkarussell beginnt sich zu drehen: Endlose Schinderei. Die Erkenntnis, dass mich niemand von diesem harten Job erlösen kann. Die Sorge um die Zukunft, wenn ich nicht mehr in der Lage sein werde, zu arbeiten. Meine Sorgen drehen sich ständig ums Überleben, nicht um den Tod. Solange ich lebe, muss ich diese deprimierenden Gedanken ertragen. Das ist mir erst spät klar geworden. Wahrscheinlich ist das jedoch keine Frage des Alters. Vielleicht stimmt es, was die Leute sagen, dass das ein Problem unserer Zeit ist. Ja, die heutige Zeit. Die junge Generation. Meine Gedanken wandern wie selbstverständlich zu meiner Tochter. Sie ist Mitte dreißig, und ich bin über sechzig, und hier stehen wir. Wie wird die Welt aussehen, die meine Tochter im Gegensatz zu mir noch erleben wird? Wird es eine bessere sein? Oder wird die Welt zugrunde gehen?
Am nächsten Morgen wasche ich Tsen und ziehe ihr eine frische Windel an. Dann krame ich etwas von meinem schlichten Make-up hervor und schminke sie.
»Habe ich Ihnen schon einmal von meiner Schulzeit erzählt? Ich bin auf dem Land zur Schule gegangen. Die letzten drei Jahre der Oberstufe habe ich bei einer Freundin gewohnt. Weil unsere eigene Wohnung so weit ab vom Schuss lag, dass ich mit dem Bus dreimal hätte umsteigen müssen. Meine Freundin lebte damals bei ihrer älteren Schwester, die in einer Fabrik arbeitete. Es war eine kleine Einzimmerwohnung mit Küchenecke. Wenn ich mich recht entsinne, war diese Schwester selbst kaum älter als einundzwanzig. Aber ich hatte damals schreckliche Angst vor ihr, keine Ahnung, warum. Na ja, ein Unterschied von ein, zwei Jahren fühlt sich in diesem Alter riesig an.«
»Was? Wo willst du hin?« Tsen reißt die Augen weit auf. Meine Hand, die gerade Rouge auf ihrer Wange verteilt, hält für einen Moment in der Bewegung inne.
»Nein, nein, das war früher, da bin ich aufs Gymnasium gegangen. Vor langer Zeit. Das ist lange her. Jaja, die Schule.«
Als ich Tsens Augenbrauen nachziehe, kommt Herr Kwon herein. »Die Fernsehleute sind da. Sie warten im Foyer. Sind Sie bereit?«
Alle anderen Patienten sind entweder im Gemeinschaftsraum oder in einem der Behandlungszimmer. Tsens Gesichtsausdruck wirkt starr. Geht es ihr nicht gut? Ich stelle ihr einige Fragen, auf die sie nicht antwortet.
»Wollen wir gehen?« Herr Kwon drängt zur Eile.
Ich trage hastig Lippenstift auf Tsens Lippen auf, bevor ich ihm zunicke. »Soll ich sie begleiten?«
»Das wäre nett von Ihnen.«
Herr Kwon, der uns leise folgt, wendet sich mit einer Bitte an mich: »Man weiß nie, was passiert, also seien Sie wachsam. Es ist immens wichtig, zu zeigen, wie gut wir uns hier um die Patienten kümmern. Das ist kostenlose Werbung für uns.«
Ich sage ihm, dass ich mir Mühe geben werde.
*
»Sie haben 1989 ein Buch mit dem Titel ›Grenzkinder‹ geschrieben. Es sind Geschichten von Kindern, die zur Adoption in die USA gebracht wurden. Brand Kim? Oder war das Brand Lee? Ich war beeindruckt von der Geschichte dieses zehnjährigen Jungen. Fünf Jahre verbrachte dieses Kind bei einer westlichen Familie, bis schließlich seine Adoption wieder rückgängig gemacht wurde. Stimmt es, dass Sie diesen Fall persönlich recherchiert haben? Es würde mich sehr interessieren, wo und wie Sie darauf aufmerksam wurden«, sagt ein junger Mann mit runder Brille. Seine dünne Stimme vibriert zunächst wie eine Stimmgabel, bevor sie ruhiger wird. Als ein zweiter junger Mann, der die Kamera bedient, ihm ein Zeichen gibt, rückt der erste seine Brille zurecht und fährt fort: »Können Sie mir dann etwas über das Ausbildungszentrum in Los Angeles erzählen? Dem Buch zufolge ist es ein alternatives Bildungszentrum. Damals war das so ziemlich die erste Einrichtung, die sich an Kinder mit Migrationshintergrund richtete, nicht wahr? Sie schreiben, dass Sie ganz auf sich gestellt waren, die Finanzierung der Einrichtung auf die Beine zu stellen und die Genehmigung zu erhalten. War das nicht ein enorm schwieriges Unterfangen?«