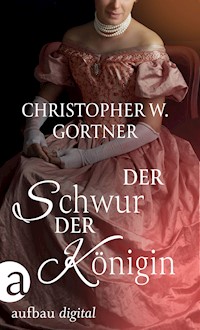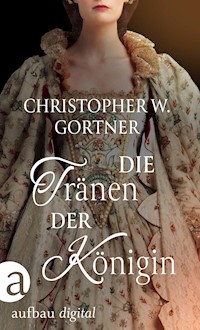
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit 13 Jahren erlebt Johanna von Kastilien die Vereinigung des Königreichs Spaniens unter ihren Eltern Isabella und Fernando mit. Intelligent, schön, und stolz auf ihre Herkunft kämpft Johanna gegen ihr Schicksal an, als sie als zukünftige Braut des Habsburgers Philip des Schönen auserwählt wird. Aber als sie in Flandern dem attraktiven und sympathischen Prinzen gegenübersteht schlagen ihre Gefühle um.
Doch weiß sie noch nicht, dass dieser Mann, nicht nur die größte Liebe ihres Lebens sein wird, sondern auch ihre bitterste Enttäuschung ...
Opulent und mitreißend: ein Roman über Johanna, die letzte Königin Spaniens
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Mit 13 Jahren erlebt Johanna von Kastilien die Vereinigung des Königreichs Spaniens unter ihren Eltern Isabella und Fernando mit. Intelligent, schön, und stolz auf ihre Herkunft kämpft Johanna gegen ihr Schicksal an, als sie als zukünftige Braut des Habsburgers Philip des Schönen auserwählt wird. Aber als sie in Flandern dem attraktiven und sympathischen Prinzen gegenübersteht schlagen ihre Gefühle um.
Doch weiß sie noch nicht, dass dieser Mann, nicht nur die größte Liebe ihres Lebens sein wird, sondern auch ihre bitterste Enttäuschung …
Opulent und mitreißend: ein Roman über Johanna, die letzte Königin Spaniens.
Über Christopher W. Gortner
Christopher W. Gortner wuchs in Südspanien auf. In Kalifornien lehrte er an der Universität Geschichte mit einem Fokus auf starke Frauen inder Historie. Er lebt und schreibt in Nordkalifornien. Im Aufbau Taschenbuch ist bereits sein Roman »Marlene und die Suche nach Liebe« erschienen.
Mehr Informationen zum Autor unter www.cwgortner.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christopher W. Gortner
Die Tränen der Königin
Roman
Deutschvon Peter Pfaffinger
Für meine Mutter, Maravillas Blanco,und meinen verstorbenen Vater, Willis Always Gortner II.;für Spanien; für eine lebenslange Liebe zu Büchernund für den Mut zur Beharrlichkeit.Und nicht zuletzt für Ericmit seinem unerschütterlichen Glauben.
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Tordesillas, 1550
1492–1500:Infantin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
1500–1504:Erzherzogin
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
1504–1505:Erbin
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
1506–1509:Königin
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Tordesillas, 1554
Nachwort
Danksagung
Impressum
Tordesillas, 1550
Mitternacht ist meine Lieblingsstunde geworden.
Die Geräusche der Nacht sind weniger aufdringlich, die Schatten gleichen einer vertrauten Umarmung. Im Licht einer einzigen Kerze wirkt meine Welt viel größer, als sie ist, nämlich so groß, wie sie es früher war. Ich nehme an, es liegt am zersetzenden Gift der Sterblichkeit, wenn man erleben muss, wie sich die Zeit verengt und zusammenzieht, wenn man sich dessen bewusst wird, dass nichts jemals wieder so groß, so offen und so unerreichbar wirken wird, wie es uns in unserer Jugend erschien.
Wenige haben so viel Anlass gehabt wie ich, über das Verstreichen der Jahre zu sinnieren. Aber erst jetzt, in dieser stillen Stunde, in der sich alle um mich herum dem Schlaf ergeben haben, kann ich wirklich klar sehen. Sie ist ein Trost, und das Wissen, das ich ihr verdanke, ein Geschenk, das ich nicht für Beschuldigungen oder nutzloses Bedauern vergeuden will. Die Geschichte mag vielleicht nicht vergeben, aber ich muss es tun.
Darum dieses leere Blatt, die gespitzte Feder und das Tintenfass. Meine Hand zittert nicht zu sehr; die Schmerzen in meinen Beinen sind nicht so schlimm, dass ich nicht in diesem mächtigen, wenn auch etwas abgewetzten Stuhl sitzen könnte. Heute Nacht sind meine Erinnerungen lebendig und alles andere als flüchtig. Sie beschwören Bilder herauf, Bilder, die mich locken, nicht quälen. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich den Rauch und den Jasmin, das Feuer und die Rose, sehe die zinnoberroten Mauern meines geliebten Palastes, wie sie sich in den Augen eines Kindes spiegeln. Und mit diesen Eindrücken begann es, begann alles, als Granada fiel.
So werde ich heute Nacht von der Vergangenheit Zeugnis ablegen. Alles werde ich festhalten, was ich erlebt und beobachtet habe, alles, was ich getan habe, jedes Geheimnis, das ich verborgen habe.
Ich werde mich erinnern, weil eine Königin nie vergessen kann.
1492–1500Infantin
»Prinzen heiraten nicht aus Liebe«
Gattinara
Kapitel 1
Ich war dreizehn Jahre alt, als meine Eltern Granada eroberten. Das geschah 1492, im Jahr der Wunder, als dreihundert Jahre maurischer Herrschaft der Macht unserer Armeen erlagen und die zerschlagenen Königreiche Spaniens endlich wieder vereinigt wurden.
Seit meiner Geburt war ich auf Kreuzzug gewesen. Oft war mir erzählt worden, wie die Geburtswehen meine Mutter ausgerechnet in dem Moment niederwarfen, als sie sich anschickte, mit ihrer Streitmacht zu den Belagerungstruppen meines Vaters zu stoßen, und sie aufs Kindbett zwangen – eine Störung, die ihr überhaupt nicht behagte. Schon binnen weniger Stunden vertraute sie mich einem Kindermädchen an, damit sie sich aufs Neue in ihre Schlachten stürzen konnte. Zusammen mit meinem Bruder Johann und meinen vier Schwestern hatte ich von Anfang an nur das Chaos eines umherziehenden Königshofs gekannt, der sich in allem nach den Erfordernissen der Rückeroberung, des Kreuzzugs gegen die Mauren, gerichtet hatte. Eingeschlafen und aufgewacht war ich stets bei ohrenbetäubendem Getöse, veranstaltet von Tausenden Seelen in Rüstung; von Lasttieren, die Katapulte, Belagerungstürme und primitive Kanonen schleppten; von endlosen Wagenkolonnen, beladen mit Kleidern, Ausrüstungsgegenständen, Vorräten und Werkzeugen. Selten hatte ich Marmor unter den Füßen oder ein Dach über dem Kopf genießen dürfen. Das Leben bestand aus einer Serie von Pavillons, errichtet auf steinigem Gelände, und aus ängstlichen Lehrern, die beim Herunterleiern ihrer Lektionen zusammenzuckten, sobald brennende Pfeile über sie hinwegzischten oder Steingeschosse in der Ferne eine Festung zertrümmerten.
Mit der Eroberung von Granada änderte sich alles – für mich und für Spanien. Die hochbegehrte Bergzitadelle war das prächtigste Juwel in der versinkenden Welt der Mauren, und meine Eltern, Isabella und Ferdinand, Ihre Katholischen Majestäten von Kastilien und Aragonien, schworen, sie eher bis auf die Grundmauern niederzureißen, bevor sie sich noch länger den Trotz der Frevler bieten ließen.
Ich habe das Bild noch vor Augen, als stünde ich im Eingang zu unserem Pavillon: längs der Wegesränder die Reihen von Soldaten, in deren zerbeulten Brustharnischen und Lanzen die Wintersonne glitzerte. Sie warteten, die eingefallenen Gesichter vorgereckt, als hätten sie Not und Elend nie kennengelernt und die zahllosen Entbehrungen und Toten in zehn langen, von Schlachten geprägten Jahren in diesem Moment völlig vergessen.
Mich durchlief ein Schauer. Von der sicheren Hügelkuppe aus, auf der unsere Zelte standen, hatte ich beobachtet, wie Granada fiel. Ich verfolgte die Flugbahn der brennenden Steine, die in Pech getränkt, angezündet und gegen die Stadtmauern katapultiert worden waren, und sah, wie Gräben ausgehoben und mit vergiftetem Wasser gefüllt wurden, damit niemand sie durchqueren konnte. Wenn der Wind aus der richtigen Richtung wehte, vernahm ich bisweilen sogar das Stöhnen der Verwundeten und Sterbenden. Solange die Stadt schwelte, flackerte in der Nacht auf den Stoffplanen unseres Zelts ein gespenstisches Wechselspiel aus Licht und Schatten, und jeden Morgen waren unsere Gesichter und sämtliche Kissen von Asche bedeckt, wie auch unsere Teller und überhaupt alles, was wir aßen oder anfassten.
Ich konnte kaum glauben, dass es wirklich vorbei war. Ich kehrte ins Zelt zurück und stellte verdrießlich fest, dass meine Schwestern sich immer noch mit ihren Kleidern abmühten. Ich war als Erste aufgewacht und hatte sogleich meinen neuen karmesinroten Brokatumhang angelegt, nachdem meine Mutter für jede von uns einen angefordert hatte. Ungeduldig mit den Füßen stampfend, schaute ich zu, wie unsere Kinderfrau Doña Ana die mit Spitzen besetzten Schleier ausschüttelte, die wir immer in der Öffentlichkeit tragen mussten.
»Dieser verfluchte Staub!«, stöhnte sie. »Er ist sogar in die schöne weiße Bettwäsche eingedrungen! Ach, ich kann die Stunde gar nicht erwarten, in der dieser Krieg zu Ende ist!«
»Diese Stunde ist da!« Ich lachte. »Heute übergibt Boabdil den Schlüssel für die Stadt. Mama wartet schon im Feld auf uns und …« Ich unterbrach mich. »Bei allen Heiligen! Isabella, du hast doch nicht vor, von allen Tagen ausgerechnet heute Trauer zu tragen?«
Unter der schwarzen Haube flammten die blauen Augen meiner älteren Schwester auf. »Was weißt du, ein Kind, denn schon von meinem Kummer? Einen Ehemann zu verlieren ist die schlimmste Tragödie, die einer Frau zustoßen kann. Ich werde nie aufhören, um meinen geliebten Alfonso zu trauern.«
Isabella hatte einen Hang zum Dramatischen, aber ich weigerte mich, ihr das durchgehen zu lassen. »Du warst noch keine sechs Monate mit deinem geliebten Prinzen verheiratet, als er vom Pferd gefallen ist und sich das Genick gebrochen hat. Du redest doch bloß deswegen so, weil Mama erwähnt hat, dass sie dich mit seinem Cousin verloben möchte – das heißt, falls du je damit aufhörst, die verzweifelte Witwe zu spielen.«
Die züchtige Maria, ein Jahr jünger als ich und ebenso altklug wie humorlos, mischte sich ein. »Johanna, bitte! Du musst Isabella etwas mehr Respekt zeigen.«
Ich warf ärgerlich den Kopf zurück. »Soll sie erst Respekt vor Spanien zeigen! Was wird Boabdil denken, wenn ihm die Infantin von Spanien wie eine Krähe gekleidet gegenübertritt?«
»Boabdil ist ein Häretiker!«, blaffte Doña Ana. »Seine Meinung ist ohne Belang.« Sie drückte mir einen Schleier in die Hand. »Hört auf zu plappern und helft lieber Katharina.« Geronnene Milch hätte nicht saurer sein können. Andererseits hätte ich wohl durchaus auch den einen oder anderen Gedanken an die Zumutung erübrigen können, die der Kreuzzug für die müden Knochen unserer Kinderfrau bedeutet hatte. Gehorsam ging ich zu meiner jüngsten Schwester hinüber. Wie Isabella, unser Bruder Johann und bis zu einem bestimmten Grad auch Maria ähnelte Katharina unserer Mutter: rundlich, klein, wunderschöne blasse Haut, blondes Haar und Augen von der Farbe des Meeres.
»Du siehst bezaubernd aus«, versicherte ich ihr und legte ihr den verzierten Schleier über den Kopf.
»Du auch«, flüsterte die kleine Katharina. »Eres la más bonita.«
Ich lächelte. Katharina war acht Jahre alt. Die Kunst, Komplimente zu machen, musste sie erst noch lernen. Sie konnte unmöglich gewusst haben, dass ihre Worte mich in dem Gefühl bestärkt hatten, unter meinen Geschwistern einzigartig zu sein. Das Aussehen verdankte ich bis hin zu einem leichten Schielen eines meiner bernsteinfarbenen Augen und der nicht so modischen olivbraunen Haut meinen Verwandten väterlicherseits. Ich war die Größte von uns allen und zudem die Einzige mit üppigen kupferfarbenen Locken.
»Nein, die Schönste bist du«, widersprach ich und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Als ich die Finger um ihre Hand schlang, ertönte in der Ferne der Klang von Trompeten.
Doña Ana winkte uns zu sich. »Schnell! Ihre Majestät wartet!«
Gemeinsam eilten wir zu einem weiten verkohlten Feld, wo ein mit einem Baldachin überdachtes Podium errichtet worden war.
Meine Mutter stand dort in ihrem hochgeschlossenen malvenfarbenen Gewand, um ihr Haarnetz ein Diadem. Wie immer in ihrer Gegenwart beugte ich unwillkürlich leicht die Knie, um meine hohe Gestalt zu verbergen.
»Ah!« Sie winkte mit ihrer beringten Hand. »Kommt her! Isabella und Johanna, ihr stellt euch rechts von mir auf, und ihr, Maria und Katharina, links von mir. Ihr seid verspätet. Ich war schon etwas besorgt.«
»Vergebt uns bitte, Eure Majestät«, bat Doña Ana mit einer tiefen Verbeugung. »Die Truhen waren voller Staub. Ich musste die Roben und Schleier Ihrer Hoheiten ausschütteln.«
Meine Mutter musterte uns. »Sie sehen vorbildlich aus.« Dann bildete sich eine Falte auf ihrer Stirn. »Isabella, hija mia, schon wieder in Schwarz?« Ihr Blick wanderte zu mir herüber. »Johanna, richte dich auf!«
Während ich gehorsam die Knie durchstreckte, erreichte uns aus viel größerer Nähe eine neuerliche Trompetenfanfare. Meine Mutter bestieg das Podest, auf dem ihr Thron stand. In der Straße tauchte in einem Wirbel von flatternden Standarten die Kavalkade der Grandes auf, der hohen Fürsten und Edelleute Spaniens. Ich hätte vor Aufregung fast geschrien. An der Spitze des Zugs ritt mein Vater, unverkennbar mit seinem schwarzen Wams und seinem berühmten roten Umhang, der seine breiten Schultern betonte. Sein mit schwarzen und goldenen Decken in den Farben von Aragonien herausgeputztes andalusisches Streitross tänzelte. Hinter ihm ritt mein Bruder Johann, dessen zerzaustes weißblondes Haar sein schmales gerötetes Gesicht umrahmte.
Ihr Auftauchen entlockte den Soldaten spontane Jubelrufe. »Viva el Infante!«, schrien die Männer und schlugen mit ihren Schwertern gegen die Schilde. »Viva el Rey!«
Als Nächstes folgten feierlich die Bischöfe. Aber erst als der Zug das Feld erreichte, bemerkte ich inmitten all dieser Männer den Gefangenen. Die Männer wichen zurück. Auf ein Zeichen meines Vaters hin wurde der Gefangene gezwungen, von dem Esel, auf dem er hockte, abzusteigen und zu Fuß weiterzugehen. Unter wildem Gelächter geriet er sogleich ins Stolpern.
Ich schnappte nach Luft. Seine bloßen Füße waren blutbedeckt. Dennoch fiel mir auf, mit welch natürlicher Würde er seinen Turban aufwickelte, beiseitewarf und sein dunkles Haar entblößte, das ihm über die Schultern fiel. Er war nicht das, was ich erwartet hatte, und schon gar nicht der häretische Kalif, der uns bis in unsere Träume verfolgt hatte, nachdem seine Horden von den Festungswällen Granadas kochendes Pech auf unsere Soldaten geschüttet und brennende Pfeile abgeschossen hatten. Dieser große, schlanke Mann mit der braunen Hautfarbe hätte ebenso gut ein kastilischer Fürst sein können, so wie er gemessenen Schrittes das Feld bis zu meiner Mutter überquerte, als stolzierte er, in edle Gewänder gehüllt, durch einen Audienzsaal. Als er vor ihrem Thron auf die Knie fiel, erhaschte ich einen Blick auf seine müden grünen Augen.
Boabdil senkte den Kopf, nahm von einer goldenen Kette um seinen Hals einen Eisenschlüssel und legte ihn zum Zeichen seiner Niederlage meiner Mutter zu Füßen.
Von den Rängen erschollen höhnische Beifallrufe. Mit unbewegter Miene, die sowohl seine abgrundtiefe Verachtung als auch grenzenlose Verzweiflung zu erkennen gab, wartete Boabdil, bis das Gejohle sich gelegt hatte, ehe er mit wohlgesetzten Worten für Toleranz warb. Als er geendet hatte, richtete er wie alle Übrigen die Augen auf die Königin und wartete.
Meine Mutter erhob sich. Sie mochte klein von Gestalt sein, permanent überschattete Augen und eine schlaffe Haut haben, doch ihre Stimme trug über das weite Feld und verriet die Autorität der Herrscherin über Kastilien.
»Ich habe diese Bitte gehört und nehme die Unterwerfung des Mauren mit demütiger Gnade an. Ich habe nicht den Wunsch, ihm oder seinem Volk weiteres Leid zuzufügen. Seine Soldaten haben tapfer gekämpft, und zur Belohnung biete ich all jenen, die durch die Taufe zur Heiligen Römischen Kirche konvertieren und sich zum wahren Glauben bekennen, ein Leben in Freiheit auf unserem Boden an. Denjenigen, die das nicht tun, wird eine sichere Überfahrt nach Afrika gewährt – unter der Voraussetzung, dass sie nie mehr nach Spanien zurückkehren.«
Mein Herz setzte einen Schlag aus, als ich Boabdil zusammenzucken sah. Mit einem Mal begriff ich: Dieses Angebot war für ihn schlimmer als die Todesstrafe. Er hatte Granada übergeben und damit das Ende einer Jahrhunderte währenden maurischen Herrschaft in Spanien besiegelt. Er hatte nicht vermocht, seine Zitadelle zu verteidigen, und ersehnte darum einen ehrenhaften Tod für sich. Stattdessen sollte er bis ans Ende seiner Tage die Schmach der Niederlage und die Erniedrigung einer Ausweisung ins Exil ertragen.
Ich warf einen Blick auf meine Mutter und bemerkte an ihren gestrafften Lippen, wie zufrieden sie war. Sie wusste genau Bescheid. Sie hatte diesen Zug geplant. Mit diesem Akt der Gnade in einem Moment, in dem er am wenigsten damit gerechnet hatte, zerstörte sie die Seele des Mauren.
Mit aschfahlem Gesicht richtete sich Boabdil auf. An seinen Knien klebte verbrannte Erde.
Schon umringten ihn die Edelleute und führten ihn ab. Ich wandte die Augen ab. Mir war klar, dass er, wäre er der Sieger gewesen, ohne zu zögern den Tod meines Vaters, meines Bruders und jedes einzelnen Edelmannes und Soldaten auf diesem Feld befohlen hätte. Mich und meine Schwestern hätte er versklavt und meine Mutter erniedrigt und hingerichtet. Er und seinesgleichen hatten Spanien zu lange geschändet. Endlich war unser Land unter einer Krone, einer Kirche und einem Gott vereint. Ich hätte über seine Unterwerfung jubeln müssen.
Und doch verspürte ich den brennenden Wunsch, ihn zu trösten.
In einer prächtigen Prozession hielten wir Einzug in Granada. Zuvorderst wurde hoch über unseren Köpfen das im Laufe der Zeit angeschlagene Kreuz getragen, das Seine Heiligkeit, der Papst, zur Weihung der Moscheen der Häretiker gesandt hatte. Ihm folgten die Edelleute und die Geistlichen.
Im Hintergrund gellte schrilles Heulen durch die Luft. Die jüdischen Lagerhäuser wurden systematisch konfisziert. Gefüllt mit duftenden Gewürzen, Seide und Samt in langen Bahnen und Kisten voller medizinischer Kräuter, stellte der Markt Granadas wahren Reichtum dar, und um Plünderungen zu verhindern, hatte meine Mutter die Sicherung der Waren angeordnet. Später wollte sie die Güter nach einer Bestandsaufnahme und Bewertung verkaufen lassen, um die Schatztruhen Kastiliens wieder aufzufüllen.
Ich ritt an der Seite meiner Schwestern und unserer Anstandsdamen und starrte die verwüstete Stadt in ungläubigem Staunen an. Zertrümmert und von Flammen versengt, säumten verwaiste Ruinen unseren Weg. Unsere Katapulte hatten unzählige Mauern niedergerissen, und von den Steinhaufen wehte der Gestank von verwesendem Fleisch herüber. Ich sah ein ausgemergeltes Kind reglos neben dem Kadaver eines Tiers stehen, der noch immer an einen Pflock gebunden war. Als wir vorbeizogen, sanken ausgezehrte Frauen in den Ruinen auf die Knie. Ich stellte mich ihren unergründlichen Blicken. Kein Hass, kein Bedauern funkelte in ihren Augen – sie wirkten, als wäre das Leben selbst aus ihnen herausgepresst worden.
Wir begannen, die Straße zur Alhambra zu erklimmen, dem legendären Palast, den die Mauren, von ihrem Triumph berauscht, errichtet hatten. Jetzt wollte ich die Erste sein, die die sagenumwobenen Mauern erblickte. Ich konnte einfach nicht mehr dem Drang widerstehen, mich in meinem Sattel aufzurichten und durch die von den Pferden aufgewirbelten Staubwolken hinüberzuspähen.
Plötzlich schrie jemand auf.
Sofort zügelten die Frauen um mich ihre Tiere. Erschrocken drehte ich mich um, ehe ich mich wieder auf die Straße vor mir konzentrierte.
Und erstarrte vor Schreck.
Wie eine Luftspiegelung ragte dort vorn ein mächtiger Turm in den Himmel. Auf seiner Brustwehr konnte ich eine kleine Gruppe von Gestalten erkennen. Der Wind zerrte wütend an ihren Schleiern und zarten Schals; auf den metallenen Fäden, die in ihre Umhänge gewoben waren, glitzerte das Sonnenlicht.
In meinem Rücken zischte Doña Ana: »Schnell! Haltet dem Kind die Augen zu! Sie darf das nicht sehen!«
Ich wirbelte in meinem Sattel zu Katharina herum. Mit ängstlichen, verwirrten Augen starrte mich meine Schwester an, bevor ihr eine der Damen ihren Schleier über das Gesicht zog. Ich klammerte mich an meine Zügel und blickte wieder nach vorn. Ein Warnschrei stieg mir in die Kehle, als ich, gelähmt von Entsetzen, beobachtete, wie die Frauen von der Brustwehr ins Freie traten wie Vögel, die sich in die Luft schwingen.
Um mich herum schnappten die Damen wie aus einem Mund nach Luft. Einen Moment lang schwebten die Gestalten in der Luft – gewichtslos, während ihre Schleier sich blähten. Dann stürzten sie wie Steine in die Tiefe.
Ich schloss die Augen und zwang mich zu atmen.
»Seht Ihr?« Doña Ana lachte. »Boabdils Harem. Sie haben sich geweigert, den Palast zu verlassen. Jetzt wissen wir, warum. Diese heidnischen Huren werden bis in alle Ewigkeit in der Hölle schmoren.«
Bis in alle Ewigkeit.
Die Worte hallten in meinem Kopf wider – eine schreckliche Strafe, die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Warum hatten sie das getan? Wie hatten sie das nur tun können? Unablässig sah ich diese zerbrechlichen Gestalten in der von stecknadelkopfgroßen Lichtflecken durchbrochenen Dunkelheit hinter meinen Augenlidern. Als wir unter dem Torbogen der Alhambra hindurchritten, deutete ich nicht wie die anderen Hofdamen auf die über die Felsen unten zerstreuten, zerschmetterten Leichen und beteiligte mich auch nicht an ihrem Lachen.
Meine Eltern, Johann und Isabella ritten mit den Edelleuten voraus. Maria, Katharina und ich blieben mit unseren Kinderfrauen zurück. Ich nahm Katharina bei der Hand und beschwichtigte sie, denn sie spürte sehr wohl, dass etwas Schreckliches geschehen war. Gleichzeitig schielte ich mit einem Auge zur Zitadelle. Da ihre geflieste Fassade das Nachmittagslicht zinnoberrot widerspiegelte, wirkte sie wie blutgetränkt – ein Ort des Todes und der Zerstörung. Und dennoch war ich von ihrem exotischen Glanz überwältigt.
Die Alhambra war ganz anders als jeder Palast, den ich bisher besucht hatte. In Kastilien dienten Königsresidenzen zugleich auch als von Wassergräben umgebene Festungen, gesichert mit dicken Mauern. Der Maurenpalast hatte das nicht nötig. Geschützt durch einen felsigen Abhang, räkelte er sich im Schatten von Zypressen und Pinien auf seinem Plateau wie ein Löwe.
Doña Ana winkte Maria zu sich, woraufhin wir zusammen mit unseren Anstandsdamen in den Audienzsaal marschierten. Während sich Katharina immer noch an meine Hand klammerte, sog ich alles in mich auf. Und mein erster Eindruck von der atemberaubenden Pracht der Welt des Mauren ließ mein Herz heftiger pochen.
Vor mir erstreckte sich ein gewaltiger safrangelber Raum, verziert mit schimmernden Perlen. Zerkratzte Türen, schmale Treppen, die einen erdrückten, oder enge Gänge gab es hier nicht. Stattdessen geleiteten mich geschnitzte Torbögen in Gemächer mit wabenförmig gewölbten Wänden, von wo aus man einen flüchtigen Blick auf mosaikartig geflieste Terrassen erhaschen konnte. Unter von Rauch verdunkelten Wandbehängen in jeder nur denkbaren Farbtönung hielten glasierte Porzellanvasen Wache. Federkissen und Diwane waren willkürlich über den Boden verteilt, als hätten sich die Bewohner des Palasts soeben zur Ruhe begeben. Mein Blick fiel auf einen Schal, der zusammengerollt zu meinen Füßen auf dem gefliesten Boden lag. Aus Furcht, eine der Konkubinen hätte ihn vielleicht während der verhängnisvollen Flucht zum Turm fallen lassen, scheute ich davor zurück, ihn zu berühren.
Offenbar hatte ich bisher in völligem Unwissen gelebt. Niemand hatte mir gesagt, dass Häretiker etwas derart Schönes schaffen konnten. Ehrfürchtig blinzelte ich zur Kuppel empor. Ringsum starrten mich die gemalten Gesichter toter Kalifen mit lakonischem Tadel an. Ich geriet ins Schwanken. Mit einem Schlag begriff ich, warum die Konkubinen den Tod gewählt hatten. Wie Boabdil konnten sie es nicht ertragen, fern von diesem Eden zu leben, das ihr Zuhause gewesen war.
Der Duft von Muskat wehte an mir vorbei. Von überall erklangen die Geräusche von Wasser, ein ständiges Murmeln von Bächen in Rinnen, die in die Marmorböden geschnitzt waren und die sich in Alabasterbrunnen auf der Terrasse ergossen, aus denen sich tanzende Fontänen erhoben.
Ich verharrte. Durch die Säulen sickerte ein Seufzen, von dem sich mir jäh alle Nackenhaare aufstellten. »Hermana«, flüsterte Katharina, »was ist das? Hörst du es auch?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich konnte es nicht erklären.
Wer hätte mir geglaubt, wenn ich gesagt hätte, dass ich das Klagelied des Mauren hören konnte?
Kapitel 2
Drei verzauberte Jahre lang war Granada unsere Zuflucht vor dem aufreibenden Leben am Königshof. Seit der erfolgreichen Rückeroberung verwandte meine Mutter ihre ganze Kraft darauf, Spanien zu stärken und Allianzen mit anderen Herrschern zu schmieden. Ihre Pflichten zwangen sie immer noch dazu, einen großen Teil des Jahres auf Reisen zu verbringen, doch sie erachtete es für das Klügste, sich mit uns wenigstens in den Sommermonaten an einem dauerhaften Wohnsitz aufzuhalten, weitab von den Seuchen und der Hitze, die Kastilien heimsuchten.
Im Jahr nach dem Fall Granadas wurde die Verlobung meiner Schwester Katharina mit dem ältesten Sohn Heinrichs VII. von England gefeiert, was mich daran erinnerte, dass auch ich schon in meiner frühen Kindheit versprochen worden war, und zwar an Philipp von Flandern, den Sohn des Habsburger Kaisers. Das beunruhigte mich allerdings nicht übermäßig. Die einzige von meinen Schwestern, die tatsächlich verheiratet war, war Isabella, und bevor sie nach Portugal gegangen war, nur um weniger als ein Jahr später als Witwe zurückzukehren, waren ihr mehrere andere Verlobungen in Aussicht gestellt worden. Ich wusste, dass die wenigsten Prinzessinnen im Hinblick auf ihre Zukunft ein Wörtchen mitzureden hatten, und ich hatte nicht die geringste Lust, über eine Zukunft zu grübeln, die weit entfernt schien und sich von heute auf morgen ändern konnte.
In Granada war meine Welt voller jugendlicher Versprechen. Nach dem täglichen Unterricht in Geschichte, Mathematik, Sprachen, Musik und Tanzen liefen meine Schwestern und ich oft auf die herrliche überdachte Terrasse am Rande der Gärten hinaus, wo wir uns im ewigen Zeitvertreib der Frauen in Königsfamilien übten: in der Kunst des Stickens. Uns war allerdings eine ganz besondere Aufgabe gestellt worden, denn unsere schlichten Tücher sollten gesegnet und dann den Kirchen überall im Lande zugesandt werden, um dort die Altäre als Gabe der Infantinnen zu zieren.
Ich verabscheute das Nähen. Von Natur aus ungeduldig, empfand ich es in meinem fünfzehnten Lebensjahr als nahezu unmöglich, länger still zu sitzen. Meine Altartücher, die allesamt mit durchbrochenen Mustern und verknoteten Fäden übersät waren, taugten bestenfalls zum Aufwischen der Kirchenböden. Normalerweise tat ich nur so, als würde ich sticken, während ich in Wahrheit aufmerksam Doña Ana beobachtete, um den richtigen Zeitpunkt für mein Entkommen abzupassen.
Die Erzieherin saß unter der Überdachung. In den Händen hielt sie ein Buch, aus dem sie uns über die Leiden irgendeines heiligen Märtyrers vorlas. Es dauerte nie lange, bis ihr der Kopf nach vorn sank, ihre Lider immer heftiger flatterten und der vergebliche Kampf gegen den Schlaf endgültig verloren war.
Als ihre Augen endlich zufielen, ließ ich noch ein paar Minuten verstreichen, ehe ich meine Stickerei beiseitelegte, mir die Pantoffeln von den Füßen streifte und mich vorsichtig von meinem Hocker erhob.
Maria und Isabella tauschten Vertraulichkeiten aus. Als ich mit den Hausschuhen in den Händen an ihnen vorbeischlich, zischte Isabella: »Johanna, wohin willst du denn?«
Ohne auf sie zu achten, winkte ich Katharina zu mir. Meine kleine Schwester sprang sofort auf. Ihre Stickerei ließ sie achtlos zu Boden fallen. Lächelnd flüsterte ich: »Komm mit, Pequeñita, ich muss dir was zeigen.«
»Eine Überraschung?« Aufgeregt schleuderte Katharina ihre Hausschuhe von sich, nur um jäh innezuhalten, sich die Hand auf den Mund zu legen und besorgt zu Doña Ana hinüberzuspähen. Doch unsere Erzieherin schlummerte friedlich weiter. Um sie jetzt zu wecken, müsste schon ein Elefant vorübertrampeln. Ich unterdrückte ein plötzlich in mir hochsteigendes Kichern.
Maria dachte natürlich wieder einmal, die Welt würde untergehen, wenn auch nur eine von uns vom Pfad ihrer Pflichten abwich. In entsetztem Ton flüsterte sie: »Johanna, du holst dir noch den Tod, wenn du barfuß herumläufst! Setz dich wieder. Du kannst doch Katharina nicht ohne ordentliche Eskorte in die Gärten hinausführen!«
»Wer sagt denn, dass wir keine Eskorte haben?«, entgegnete ich und krümmte den Zeigefinger zu einer lockenden Geste. Schon löste sich hinter einer der Säulen auf der Terrasse ein Schatten und näherte sich.
Die Gestalt blieb erwartungsfroh vor mir stehen. Unter ihrem lockigen Haar, das von derselben Farbe war wie die darin eingeflochtene Rabenfeder, schimmerten mir verhüllte schwarze Augen entgegen. Obwohl sie die übliche Tracht der Kastilierinnen trug, umwehte sie immer noch eine sich hartnäckig haltende Aura von Zinnober und klirrenden Armreifen. Ich lächelte unwillkürlich, als ich bemerkte, dass auch sie barfuß war.
Ihr Name war Soraya. Sie war in einem Versteck im Harem der Alhambra gefunden worden, und niemand wusste, ob sie eine Sklavin gewesen war, die die Konkubinen bei ihrem Selbstmord zurückgelassen hatten, oder die Tochter einer der Nebenfrauen des Kalifen. In ihrer arabischen Sprache hatte sie um Gnade gefleht und war bereitwillig zum Christentum konvertiert.
Da sie kaum älter als dreizehn Jahre war, machte es ihr nicht viel aus, welchen Gott sie anbetete, wenn sie nur am Leben blieb. Ich bedrängte meinen Vater, sie mir als Zofe zuzuteilen, was er mir schließlich trotz der Einwände meiner Mutter gestattete. Soraya wich nie von meiner Seite, in der Nacht schlief sie am Fuß meines Betts, tagsüber trottete sie hinter mir her wie eine Katze. Ich verbrachte täglich Stunden damit, sie Spanisch zu lehren, und sie lernte schnell, auch wenn sie es ansonsten vorzog zu schweigen. Sie war auf den überall gegenwärtigen Namen Maria getauft worden, reagierte aber nie darauf, sodass wir am Ende ihren ursprünglichen Namen akzeptierten.
Ich betete sie an.
»Diese häretische Sklavin?«, zischte meine Schwester Isabella. »Das ist doch keine richtige Eskorte!«
Trotzig warf ich den Kopf zurück, ergriff Katharina und Soraya bei den Händen und schlich mit ihnen zu den Gärten hinaus.
Angestrengt darauf bedacht, unser Kichern zu ersticken, stahlen wir uns in eine Rosenlaube, die dem Kalifen früher als verschwiegener Winkel gedient hatte. Soraya kannte die Gärten wie ihre eigene Tasche; zahllose Male hatte sie mich schon auf verbotene Exkursionen mitgenommen, und so wusste sie genau, wohin ich wollte. Inzwischen hatte die Dämmerung damit begonnen, den Himmel in violette Schlieren zu hüllen. Soraya bemerkte das und alarmierte mich mit einer eindringlichen Geste. Ich machte einen erschockenen Satz, mit dem ich Katharina beinahe umstieß. »Beeil dich! Soraya sagt, dass wir zurückmüssen, bevor es dunkel wird!«
Während ich Katharina hinter mir herzerrte, jagte Soraya schon voraus. »Nicht so schnell, Johanna«, keuchte meine Schwester. »Ich kann nicht so gut laufen wie ihr zwei.« Trotzig stemmte sie die Beine in die Erde. »Mir tun die Füße weh!« Sie ließ ihre Hausschuhe fallen und schob ihre mit Grasflecken verschmierten Füße hinein. »Und du hast dir das Kleid aufgerissen, als wir durch die Büsche gekrochen sind«, fügte sie hinzu. »Das ist schon das dritte Kleid, das du diese Woche kaputt gemacht hast. Doña Ana wird schimpfen.«
Ich warf einen verächtlichen Blick auf den Riss. Als ob mich Doña Anas Zorn kümmerte! Mittlerweile hatten wir die unteren Gärten erreicht. Vor uns türmte sich am Rande der tiefen Schlucht eine zerbröckelnde Mauer auf. In der Ferne zeichneten sich die von Höhlen durchlöcherten Sacromonte-Berge ab. Soraya stand bereits vor der Mauer. Sie deutete nach oben.
Ich hob die Augen zum amethystfarbenen Himmel. »Da!« Über uns flatterte ein einsames Tier auf. Ihm folgte ein zweites, noch eines und wieder ein anderes, bis zahllose von diesen Wesen sich zu einem gitterartigen Gebilde zusammenwoben und dabei, ohne einander zu berühren, so schnell mit den Flügeln flatterten, dass die Bewegungen sich nicht mit dem Auge erkennen ließen.
Ein Schauer überlief mich. Ich wusste, dass sie uns nichts antun würden, und hatte sie auch schon mehrere Male beobachtet, doch das half nicht, den Anflug von Angst zu ersticken.
Katharina presste sich an mich. »Was … was ist das?«
»Das, was ich dir zeigen wollte. Das, Pequeñita, sind Fledermäuse.«
»Aber … aber Fledermäuse sind böse! Doña Ana sagt, dass sie in den Haaren nisten!«
»Unsinn. Das sind doch nur Tiere.« Ich konnte den Blick nicht abwenden, so sehr verzauberte mich ihre Lautlosigkeit. Auf einmal wünschte ich mir, auch ich könnte so durch die Luft schwirren, mit einer Haut dunkel wie die Abenddämmerung.
»Schau genau hin. Siehst du, wie sie über uns hinwegfliegen, ohne einen Laut von sich zu geben? Und selbst in der tiefsten Dunkelheit verirren sie sich nie.« Ich blickte Katharina an. Sie war blass geworden. Seufzend ließ ich mich auf ein Knie sinken. »Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich auch Angst. Aber sie haben mich überhaupt nicht beachtet. Ich war wie Luft für sie.« Ich lächelte sie aufmunternd an. »Du brauchst keine Angst zu haben. Fledermäuse fressen Obst, nicht Menschen.«
»Woher weißt du das?«, fragte sie mit zittriger Stimme.
»Weil ich sie schon mal beobachtet habe. Ich habe gesehen, wie sie gefressen haben. Schau nur.« Aus der Tasche meines Kleids zog ich einen Granatapfel. Mit einem kräftigen Biss in die harte Haut legte ich die glitzernden roten Kerne bloß, kratzte sie heraus und schleuderte sie in die Luft.
Schon stieß eine Fledermaus herab, um die fallenden Kerne zu fangen. Katharinas Augen weiteten sich. Ich nahm sie wieder bei der Hand, und wir schlichen näher heran. Ehrfürchtig starrte sie das wundersame, hässliche Tier an, dessen winziger Körper ein Fell hatte wie eine Ratte und dessen lederartige Flügel so erstaunlich beweglich waren. Bald tauchten noch mehr von diesen Tieren auf, und zwar so dicht über unseren Köpfen, dass wir den Luftzug spürten. Sie schossen bis fast auf den Boden herunter, wo ich die Kerne verteilt hatte, schwebten aber weiter in der Luft, als könnten sie sich nicht recht entscheiden. Ich wollte noch mehr Kerne mit meinen rot befleckten Fingern hochwerfen, als Katharina meine Hand fester packte. »Nein«, wisperte sie. »Hör auf.«
»Aber sie tun dir nichts. Das verspreche ich dir. Du brauchst keine Angst zu haben.«
»Ich … ich habe keine Angst. Ich will bloß nicht, dass du das machst.«
Wie gerne hätte ich noch mehr von diesen Wesen angelockt! Ich hatte schon öfter mit den Kernen experimentiert. Auf die Idee, dass ich sie anlocken konnte, war ich allerdings erst heute gekommen. Doch während ich noch mit mir debattierte, flogen die Fledermäuse mit einem Quietschen auf. Kreischend sprangen Katharina und ich zurück und rissen die Arme über den Kopf. Während die Tiere zu ihren Gefährten zurückkehrten und sich wieder an dem sonderbaren Tanz in der Luft beteiligten, entdeckte ich, dass Soraya lächelte. Jetzt lachte auch ich.
Katharina funkelte mich an. »Du hattest Angst! Du hast gedacht, dass sie uns was antun!«
Ich nickte. »Ja«, gab ich zu. »Offenbar bin ich gar nicht so tapfer.«
Das letzte Sonnenlicht erstarb. Die Fledermäuse schossen hin und her, angezogen von der Feuchtigkeit, die von den vielen Brunnen der Alhambra aufstieg. Normalerweise blieben sie bis zum Einbruch der Nacht oben, um dann in einer Wolke zu den über die Gegend verstreuten Obstgärten zu ziehen, wo reiche Ernte auf sie wartete. Nur heute Abend war das anders. Mir fiel auf, dass ihr Flugverhalten so unregelmäßig war, als wüssten sie nicht, wohin sie wollten. Hatte unsere Anwesenheit sie durcheinandergebracht?
»Vielleicht sind wir ihnen gar nicht so gleichgültig, wie ich dachte«, überlegte ich laut. Katharina blickte mich fragend an, während über uns die Fledermäuse durcheinanderwirbelten wie Blätter in einem plötzlichen Windstoß.
Bedauernd trat ich den Rückweg zum Palast an. Soraya tauchte neben mir auf und zupfte mich am Ärmel. Meine Augen folgten den ihren, bis ich eine lange Reihe von brennenden Fackeln bemerkte, die sich, getragen von Sklaven, zur Zitadelle hinaufzog.
»La Reina«, flüsterte Soraya. »La Reina su madre está aquí.«
Ich wandte mich mit einem verlegenen Lächeln an Katharina. »Wir sollten jetzt lieber zurückgehen. Mama ist da.«
Doña Ana empfing uns in heller Aufregung. »Wo habt Ihr gesteckt? Ihre Majestät ist eingetroffen!« Sie ergriff Katharina bei der Hand, und während sie Soraya mit einer Geste zurück zu unseren Gemächern schickte, funkelte sie mich wütend an. Dann scheuchte sie uns durch die Gänge zum Empfangssaal.
Isabella und Maria waren bereits da. Angestrengt bemüht, Isabellas Blick auszuweichen, stellte ich mich neben Maria. Auch diese starrte mich streng an. »Doña Ana war außer sich«, fuhr sie mich an. »Warum musst du sie so ärgern?«
Ich gab keine Antwort, sondern konzentrierte mich auf die Höflinge, die in diesem Moment hereinströmten, und hielt vor allem Ausschau nach meinem Vater. Zu meiner großen Enttäuschung vermochte ich ihn nirgendwo zu entdecken. Meine Mutter war also allein nach Granada gekommen.
Ich zuckte zusammen, als Erzbischof Cisneros mit wehender Franziskanerkutte und nur Ledersandalen an den Füßen eintrat. Er war der mächtigste geistliche Würdenträger von Kastilien, Oberhaupt der Diözese Toledo und unser neuer Generalinquisitor. Cisneros, ein Protegé von Torquemada, so hieß es, hatte in diesen Sandalen den Weg von Sevilla her zu Fuß zurückgelegt, um Gott für die Erlösung von dem Mauren zu danken.
Ich glaubte das alles sofort. Cisneros hatte sein ganzes Trachten darauf gerichtet, die Häresie in Spanien auszumerzen. In diesem Sinne hatte er sämtliche Juden und Mauren vor die Wahl gestellt, entweder zu konvertieren oder das Land zu verlassen, wenn sie nicht hingerichtet werden wollten. Viele hatten die Flucht gewählt, statt in der ständigen Gefahr zu leben, von seinen Spionen und Informanten verraten zu werden. Und es gab jetzt viele, die geschworen hatten, die conversos zu jagen, die ihren verbotenen Glauben im Geheimen ausübten. Meine Mutter hatte Cisneros’ Machenschaften einen Riegel vorschieben müssen, als er versucht hatte, auch Mitglieder ihres Hofstaats zu überprüfen, von denen einige jüdischer Herkunft waren. Das hatte ihn allerdings nicht daran gehindert, eine Massenverbrennung von über hundert Häretikern auf einem einzigen riesigen Scheiterhaufen zu veranstalten – ein grässlicher Tod für jeden Menschen, egal, welchem Glauben er angehört. Für mich roch dieser Mann nach Schwefel, und ich war erleichtert, als er, ohne mich eines Blickes zu würdigen, an mir vorbei in einen Vorraum stolzierte.
Kurz darauf zeigte sich meine Mutter.
Mit fest um ihr Kinn zugebundener Leinenhaube schritt sie zwischen den sich verbeugenden Höflingen hindurch. Seit der Rückeroberung war sie dick geworden und bevorzugte schlichte Kleidung. Heute trug sie jedoch ihren Lieblingssaphir, in den die gebündelten Pfeile und das Joch des von ihr und meinem Vater gewählten Emblems graviert waren.
Wir versanken in einem tiefen Knicks. »Richtet euch auf, hijas«, forderte sie uns auf. »Lasst mich euch anschauen.«
Ich dachte daran, den Rücken durchzustrecken und die Augen zu senken.
»Isabella«, bemerkte meine Mutter, »du siehst blass aus. Ein bisschen weniger Beten würde dir vielleicht guttun.« Sie zog weiter zu Katharina, die ein spontanes »Mama!« nicht mehr rechtzeitig unterdrücken konnte und sich damit einen Tadel einhandelte, der sie erröten ließ. »Katharina, vergiss deine Manieren nicht!«
Dann, Cisneros dicht hinter sich, blieb sie vor mir stehen.
Ich spürte ihre Missbilligung wie einen Schwerthieb. »Johanna, hast du eure Geburtenfolge vergessen? Als meine Drittälteste musst du in der Abwesenheit deines Bruders neben Isabella stehen.«
Ich hob die Augen. »Vergebt mir, Mama … ich meine Majestad. Ich … ich kam verspätet.« Während ich sprach, versuchte ich, meine vom Granatapfel verschmierten Hände hinter dem Rücken zu verbergen.
Meine Mutter schürzte die Lippen. »So, so, ich verstehe. Wir unterhalten uns später.« Sie trat einen Schritt zurück, denn ihre nächsten Worte waren an uns alle gerichtet. »Ich freue mich, wieder mit meinen Töchtern zusammen zu sein. Ihr dürft jetzt zum Abendgebet gehen, und dann gibt es euer Abendbrot. Ich komme später zu jeder von euch, sobald ich meine Pflichten erledigt habe.«
Nach einem weiteren Knicks eilten wir durch die Halle davon, wobei alle am Hof sich tief verbeugten, sobald wir vorbeirauschten. Bevor wir hinaustraten, wagte ich einen besorgten Blick über die Schulter.
Doch meine Mutter hatte sich bereits abgewandt.
Nach dem Abendessen wurde ich vorgeladen. Zusammen mit Soraya trabte ich los, und während ich im Vorraum zu den Gemächern der Königin auf einem Hocker saß und wartete, ließ sich meine Gefährtin mit träger Anmut auf einem Kissen in der Ecke nieder. Wann immer sie konnte, zog sie den Boden Stühlen vor.
Meine Augen waren auf das flackernde Licht gerichtet, das die Öllampen auf die kunstvolle honigwabenartig gemusterte Decke warfen. Meine Hände nestelten unentwegt an meinen Röcken. Soraya hatte mir geholfen, mich in eines meiner steifen Gewänder für förmliche Anlässe zu zwängen. Es schien geschrumpft zu sein, seit ich es zuletzt getragen hatte. Das Mieder spannte sich um meine voller gewordenen Brüste, und der Saum berührte kaum noch die Knöchel. Mit dreizehn Jahren hatte ich meine erste Blutung gehabt, und seitdem kam es mir so vor, als führte mein Körper ein Eigenleben: Meine Beine wuchsen in die Länge wie bei einem Fohlen, und an Stellen, die zu berühren Doña Ana mir verboten hatte, bildete sich ein feiner rötlicher Flaum. Soraya hatte meine Haare in ein mit Perlen besetztes Netz geflochten, und in dem vergeblichen Bemühen, die sprießenden Sommersprossen loszuwerden, die meine häufigen Ausflüge ins Freie ohne Kopfbedeckung verrieten, hatte ich mir das Gesicht geschrubbt, bis die Wangen brannten.
Während ich dasaß und wartete, überlegte ich die ganze Zeit, was meiner harren mochte. So früh im Jahr zeigte sich meine Mutter nur selten in Granada. Dass sie schon Mitte Juni gekommen war, musste doch sicher bedeuten, dass irgendetwas nicht stimmte. Ein ums andere Mal versuchte ich mich selbst zu beschwichtigen, dass das nichts mit mir zu tun haben konnte; zumindest fiel mir beim besten Willen kein Vergehen ein, außer vielleicht meine gelegentlichen Ausflüge in die Gärten, aber das waren doch bestimmt nur Bagatellen. Trotzdem war ich äußerst beunruhigt – wie immer, wenn eine Begegnung mit meiner Mutter bevorstand.
Die langjährige Freundin und Lieblingshofdame meiner Mutter, die Marquise de Moya, erschien in der Tür. Sie schenkte mir ein beruhigendes Lächeln. »Princesa, Ihre Majestät möchte Euch jetzt empfangen.«
Die Marquise war immer nett zu mir gewesen. Wenn mir eine Strafe gedroht hätte, hätte sie mich gewarnt. So marschierte ich mit frischer Zuversicht in die Gemächer meiner Mutter, wo ihre anderen Damen beim Ausräumen der Reisetruhen innehielten, um vor mir zu knicksen. Als ich das Schlafgemach meiner Mutter erreichte, blieb ich vor der Tür stehen. Ohne ausdrückliche Erlaubnis meiner Mutter durfte ich nicht eintreten.
Ihr kleines Zimmer war mit Kohlebecken und Lüstern erleuchtet. Ein großes Fenster gegenüber der Tür bot einen weiten Blick auf das Tal. Auf dem Schreibpult stapelten sich Bücher und Dokumente. Das matte und angeschlagene silberne Schwert der Rückeroberung, das meine Mutter in jeder Schlacht vor sich hergetragen hatte, hing deutlich sichtbar an der Wand. Ihr Bett schmiegte sich halb hinter einem Paravent aus Sandelholz in eine Ecke. Im Einklang mit der asketischen Lebensweise meiner Mutter waren die Marmorböden unbedeckt.
Ich kniete mich auf die Schwelle. »Ich bitte um die Erlaubnis, in der Gegenwart Ihrer Majestät eintreten zu dürfen«, rief ich, woraufhin sich meine Mutter aus dem Schatten des Pultes löste. »Du hast meine Erlaubnis. Tritt ein und schließ die Tür.«
Ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen. In angemessenem Abstand wartete ich und knickste erneut.
»Du kannst näher kommen«, bemerkte sie trocken.
Ich gehorchte. Und fragte mich dabei unwillkürlich (wie immer, seit ich zurückdenken konnte), ob ihr gefiel, was sie sah. Obwohl ich sie beinahe schon um eine Handbreit überragte, fühlte ich mich immer noch wie ein kleines Mädchen, das um Lob heischte.
Meine Mutter trat um den Lichtschein herum, den die Kerzen aussandten. Sie musste mir mein Unbehagen angemerkt haben, denn sie sagte: »Was siehst du, hija, dass du mich derart anstarrst?«
Sofort schlug ich die Augen nieder.
»Ich wünschte, du würdest dir das abgewöhnen. Seit du klein warst, hast du immer alles angestarrt, als wäre es eigens zur Befriedigung deiner Neugierde ausgestellt.« Sie wies auf den Hocker neben ihrem Pult. »Weißt du, warum ich dich habe rufen lassen?«
Plötzlich packte mich Angst. »Nein, Mama.«
»Eigentlich sollte ich dich bestrafen. Doña Ana hat mir berichtet, dass du deine Schwestern und die Stickarbeit heute Nachmittag verlassen und stattdessen Katharina die Gärten gezeigt hast. Wie ich erfahren habe, verschwindest du öfter auf diese Weise, ohne ein Wort der Erklärung oder Entschuldigung. Was haben diese Ausflüge zu bedeuten?«
Ihre Frage verblüffte mich; dass sie Interesse an dem zeigte, was ich dachte, war selten der Fall. Mit leiser Stimme antwortete ich: »Ich bin manchmal gerne allein, damit ich bestimmte Dinge beobachten kann.«
Sie ließ sich auf dem gepolsterten Stuhl vor dem Pult nieder. »Was, um alles in der Welt, ist so fazinierend, dass du allein sein musst, um es zu beobachten?«
Von den Fledermäusen konnte ich meiner Mutter unmöglich erzählen. Sie würde das nie verstehen. »Nichts Besonderes«, sagte ich. »Ich liebe eben die Einsamkeit; das ist alles. Ständig bin ich von Dienern und Lehrern umgeben, und dann nörgelt auch noch Doña Ana an mir herum.«
»Johanna, es ist ihre Aufgabe, dich zu leiten.« Sie beugte sich vor, und ihr Tonfall wurde noch eindringlicher. »Wann wirst du begreifen, dass du nicht einfach tun kannst, was dir gerade gefällt? Erst war es deine Faszination für alles, was mit Mauren zusammenhängt. Du hast sogar darauf bestanden, dass dieses Sklavenmädchen dich bedient. Und jetzt dieser sonderbare Hang zur Einsamkeit. Du hast doch sicher einen Grund für dieses ungewöhnliche Verhalten.«
Meine Schultern spannten sich. »Ich glaube nicht, dass es so ungewöhnlich ist.«
»Ach?« Sie wölbte die Augenbrauen. »Du bist sechzehn Jahre alt. Als ich in deinem Alter war, kämpfte ich für Kastilien. Ich hatte weder die Zeit noch die Neigung, mich mit irgendwelchen Zerstreuungen abzugeben, die meine Erzieher beunruhigten. Ebenso wenig, würde ich sagen, solltest auch du deine Zeit damit vergeuden. Doña Ana sagt mir, dass du dich rebellisch und eigenwillig gebärdest und ihr in allem widersprichst. Das ist nicht das Verhalten einer Infantin des Hauses Trastámara. Du bist die Nachfahrin von Königen. Du hast dich entsprechend deinem Rang zu betragen.«
Ihr Tadel war nichts Ungewohntes, aber trotzdem traf er mich. Und genau das hatte sie auch beabsichtigt. Wie konnte ich nur mein bisher völlig unbedeutendes Leben mit ihren monumentalen Leistungen vergleichen? Über mein betretenes Schweigen befriedigt, zog sie eine Kerze zu sich heran, öffnete ein Portefeuille und entnahm ihm einen Bogen Velinpapier. »Dieser Brief ist für dich.«
Ich musste mich zügeln, um ihn ihr nicht aus der Hand zu reißen. »Ist er von Papa? Kommt er uns besuchen? Bringt er Johann mit?«
Kaum hatten diese Worte meinen Mund verlassen, als ich sie auch schon bedauerte. Mit gepresster Stimme erwiderte meine Mutter: »Dein Vater und dein Bruder sind immer noch in Aragonien. Dieser Brief ist von Erzherzog Philipp.« Sie reichte mir den Bogen. »Bitte lies ihn mir vor. Er ist in Französisch abgefasst, eine Sprache, die ich lieber nicht spreche.«
War sie den ganzen Weg hierhergekommen, nur um mir einen weiteren langweiligen Brief vom Habsburger Hof zu überbringen? Ich war nahe dran, erleichtert aufzuatmen, als mir in den Sinn schoss, dass etwas Wichtiges dahinterstecken musste, wenn meine Mutter nur wegen dieses Briefs von Granada angereist war. Von plötzlicher Unruhe befallen, studierte ich den Brief. Es handelte sich um teures, geschmeidiges Leder, das so oft abgeschabt und eingeweicht worden war, bis es die Konsistenz von Papier erreicht hatte. Ansonsten wirkte das Schreiben kaum anders als die Briefe, die im Laufe der Jahre regelmäßig eingetroffen waren – bis ich die hingekratzten Sätze bemerkte, die eine im Umgang mit der Schreibfeder ungeschickte Hand verrieten. Ich warf einen Blick auf die Unterschrift: ein gekringeltes P über dem Stempel mit den Insignien der Habsburger. Das musste ein Brief von Philipp persönlich sein.
»Ich warte«, drängte meine Mutter.
So begann ich zu lesen, wobei ich den Inhalt sofort ins Spanische übersetzte. »›Ich habe den Brief empfangen, den Eure Hoheit mir unlängst zu senden geruhte. Darin spürte ich Eure Zuneigung. Seid versichert, dass Eure ehrenhaften Worte in keines anderen Mannes Ohren süßer klingen, noch Eure Versprechungen größeres Entzücken auslösen könnten …‹« Ich runzelte die Stirn. »Von was für einem Brief spricht er da? Ich habe ihm nie geschrieben.«
»Du nicht«, sagte meine Mutter. »Aber ich. Lies weiter.«
Ich beugte mich wieder über das Schreiben. »›Umso beglückender ist er für jemanden, der Eure Zuneigung erwidert. Ich muss Euch mitteilen, welch ernste Liebe ich in dem Wissen empfinde, dass ich Eure Hoheit bald sehen werde. Ich bete zu Gott, dass Eure Ankunft hier und die Abreise meiner Schwester Margarete nach Spanien schnell herbeigeführt werden, damit sich die Liebe zwischen uns und unseren Ländern bald erfüllen kann.‹« Ich blickte erschrocken auf. Mit einem Schlag hatte ich begriffen. »Er … er spricht von einer Heirat?«
Meine Mutter lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. »Allerdings. Es ist Zeit, dass du nach Flandern gehst und die Ehe mit Philipp besiegelt wird, während seine Schwester Margarete als die Braut deines Bruders hierherkommt.« Sie hielt inne. »Ist das alles, was er schreibt?«
Mir fiel auf einmal das Atmen schwer. Die Buchstaben verschwammen vor meinen Augen. »Es gibt noch ein Postskriptum von einem gewissen Besançon. Er rät mir, Französisch zu lernen, da es die am flämischen Hof gesprochene Sprache sei.«
»Besançon?« Meine Mutter schnitt eine Grimasse. »Er mag der Erzbischof von Flandern und erste Berater des Erzherzogs sein, aber in seinen Manieren ist er bei weitem zu französisch, zumal er genau weiß, welche Gefühle wir gegenüber dieser Nation von Wölfen hegen.« Ihr Blick nahm einen abwesenden Ausdruck an. »Egal. Frankreich wird früh genug in seine Schranken verwiesen. Dieses Land plagt uns schon seit Jahren, erst mit seinen Übergriffen auf Aragonien und jetzt auch noch mit der Drohung, deinem Vater seine Rechte auf Neapel streitig zu machen. Es ist höchste Zeit, dass wir ihrer Unverschämtheit ein Ende bereiten.«
Ein grimmiges Lächeln kroch über ihre Lippen. »Kaiser Maximilian und ich haben uns darauf geeinigt, auf jegliche Mitgift zu verzichten, allein schon wegen der horrenden Kosten für den Transport. Aber nach seinem Tod wird sein Sohn Philipp das Reich erben, während seiner Tochter Margarete mehrere bedeutende Territorien in Burgund zufallen. Und wenn deine Schwester Katharina den englischen Kronprinzen geheiratet hat, werden wir mit einem Schlag eine Großmacht mit Familienbanden in ganz Europa sein, und Frankreich wird es nie wieder wagen, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen.«
Ich saß wie festgewurzelt auf meinem Hocker. Wie konnte sie über Politik sprechen, wenn gerade mein ganzes Leben durcheinandergewirbelt worden war? Erwartete sie tatsächlich, dass ich für ein fremdes Land und einen unbekannten Mann meine Heimat, meine Familie verließ, nur damit sie Frankreich einen Schlag versetzen konnte? Das konnte nicht geschehen – doch nicht mir!
Meine Stimme zitterte. »Aber … warum ich? Was habe ich getan, um das zu verdienen?«
Sie stieß ein trockenes Lachen aus. »Du sprichst, als ob das eine Strafe wäre. Aber diese Nachricht kann dich doch wohl kaum überraschen. Du weißt, dass du Philipp seit deinem dritten Lebensjahr versprochen bist.« Sie starrte mich durchdringend an. »Ich kann mich doch darauf verlassen, dass du nicht vergessen hast, wie wichtig es ist, dass du deine Pflicht Spanien gegenüber erfüllst?«
Obwohl ich die Warnung in ihrem Ton hörte, vergaß ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass es weder klug noch vorteilhaft war, Isabella von Kastilien zu widersprechen. Das Einzige, was ich in diesem Moment denken konnte, war, dass sie Spanien nie verlassen hatte. Wie konnte sie das dann von mir erwarten?
Ich hob die Augen. »Das habe ich nicht vergessen. Aber ich möchte Philipp von Habsburg nicht heiraten.«
Ich bemerkte, wie sich ihr Griff um die geschnitzten Armlehnen verstärkte. »Darf ich nach dem Grund fragen?«
»Weil … weil ich ihn nicht liebe. Er ist ein Fremder für mich.«
»Ist das alles? Ich kannte deinen Vater bis zu unserer Hochzeit nicht, aber das hat mich nicht daran gehindert, meine Pflicht zu erfüllen. Durch unsere Ehe ist Spanien unter Gott vereint worden. Zuerst kam unsere Pflicht, aber die Liebe folgte bald nach. Diejenigen, die Gott miteinander vereint hat, werden immer zur Liebe finden.«
»Aber Papa ist Spanier, aus Aragonien. Ihr musstet nicht wegziehen, Mama.«
»Wenige Frauen aus Königsfamilien können einen Landsmann heiraten. Dein Vater war ein Segen für mich, das ja, aber wie du wohl weißt, haben uns viele kastilische Fürsten wegen unserer Verbindung bekämpft. Sie hielten Ferdinand nicht für würdig, mein Gemahl zu sein. Die Grandes wollten, dass ich stattdessen einen der Ihren heiratete und Aragonien unter die Gewalt Spaniens brachte, nur damit sie ihre Macht steigern konnten. Und fast hätten sie mich sogar dazu gezwungen. Aber Gottes Wille war stärker. Er führte Ferdinand und mich zusammen, damit wir uns gegen die Häretiker vereinen konnten, und jetzt verbindet Er zu Spaniens Wohl dich mit Philipp.«
Ich brauste auf. »Papa war von edelster Abstammung! Er war Prinz und wurde König von Aragonien und dazu der Gemahl der Königin. Aber was ist schon Flandern? Ein erbärmliches Herzogtum – und Philipp nichts als ein Erzherzog!«
»Er mag ein Erzherzog sein, aber er ist auch der Erbe eines Kaisers. Außerdem ist Flandern alles andere als erbärmlich. Als Teil des habsburgischen Reichs hat es die Niederlande unter seiner Kontrolle und schützt ihre Grenzen vor den Franzosen. Darüber hinaus ist Philipp wohlhabend und friedlich. Seine Untertanen sind ihm so sehr ergeben, dass sie ihn ›der Schöne‹ nennen. Und er ist nur ein Jahr älter als du. Jede Prinzessin würde sich über alle Maße glücklich schätzen, einen solchen Mann heiraten zu dürfen.«
»Dann schickt ihm doch eine andere!«, entfuhr es mir, bevor ich mir auf die Zunge beißen konnte. »Maria ist niemandem versprochen. Sie könnte mich ersetzen, und er würde den Unterschied gar nicht bemerken. Es ist schließlich nicht so, dass wir uns kennen würden.«
»Dich ersetzen?« Meine Mutter richtete sich kerzengerade auf. »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast annehmen, dass du mir widersprichst.«
Ich zuckte zurück. »Das … das wollte ich nicht, Mama. Aber wenn ich schon heiraten muss, dann wäre mir ein spanischer Fürst lieber.«
Sie schlug so wütend mit der Hand auf ihren Stuhl, dass mir das Klirren ihrer Reifen in den Ohren dröhnte. »Jetzt reicht es mir! Einen spanischen Fürsten will sie? Als ob ich jemals eine Tochter von mir einem dieser Aasgeier ausliefern würde, die sich Grandes nennen! Diese Kerle haben Spanien mit ihrer Raffgier und ihrem Ehrgeiz ruiniert. Wäre ich nicht gewesen, würden sie uns immer noch im Chaos hausen lassen und sich die Taschen mit maurischem Gold vollstopfen. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Du wirst eine habsburgische Kaiserin sein. Für diese ehrwürdige Pflicht habe ich dich auserwählt.«
Ich hätte eigentlich Angst bekommen müssen. Ich hätte begreifen müssen, dass ich diese Schlacht verloren hatte. Stattdessen entgegnete ich mit einer stählernen Stimme, die ich kaum als die meine erkannte: »Ich habe nie darum gebeten.«
Mit einem zornigen Schnauben sprang sie auf und stolzierte zum Fenster. Die Sekunden schienen sich zu Jahren zu dehnen. Als meine Mutter schließlich den Mund öffnete, sprach sie mit schneidender Stimme. »Du wirst tun, was dir befohlen wird. Flandern ist ein hochachtbares Königreich, in dem Philipp seit seiner Kindheit herrscht. Sein Stammbaum ist makellos und sein Hof für seine hohe Kultur berühmt. Ich versichere dir: Du wirst dich dort sehr rasch heimisch fühlen.«
Tränen brannten hinter meinen Lidern. Ich sah meine Kindheit wie eine Illusion verschwinden, und mein sorgenfreier Nachmittag in den Gärten war wohl der letzte dieser Art gewesen, den ich in meinem Leben genossen hatte. Was kümmerten mich Philipps Ruf oder sein Hof? Er besaß nichts, was je der Schönheit Spaniens gleichkommen würde.
Plötzlich tat sich ein Abgrund in mir auf. »Mama, bitte. Muss ich das tun?«
Sie drehte sich um. »Die Cortes haben ihre Zustimmung erteilt, die Verlobungsverträge sind unterschrieben. Ich kann nicht das Wohl Kastiliens außer Acht lassen, nur weil du es so wünschst.«
Das Zimmer drehte sich um mich. Ich konnte meine Mutter kaum noch verstehen, als sie zu ihrem Pult zurückkehrte. »Du wirst nicht allein nach Flandern fahren. Doña Ana wird dich als deine höchste Hofdame begleiten. Außerdem wirst du deinen eigenen Hofstaat haben, der dich bedient. Und natürlich wird Philipp für dein Wohlergehen sorgen, wie ein guter Ehemann das auch sollte. Du wirst merken, dass die Sorgen, die du dir machst, nur vom überreizten Zustand einer neuen Braut herrühren. Wir alle haben uns in unserer Zeit so gefühlt.«
Mein Hofstaat war also bereits ausgewählt worden, und sie hatte sogar bestimmt, wie mein Mann mich behandeln würde. Erneut hatte ich das Bild von Boabdil vor Augen, wie er auf der verkohlten Erde vor meiner Mutter kniete.
Ich kämpfte die brennenden Tränen zurück. »Wann?«, fragte ich. »Wann muss ich abreisen?«
»Frühestens in einem Jahr. Aber wir haben viel zu tun.« Sie verfiel in einen geschäftsmäßigen Ton. »Ich weiß, welche Fortschritte du in deinen Studien gemacht hast. Aber da du wenig Gelegenheit hattest, dein Französisch zu üben, werde ich einen erfahrenen Lehrer anstellen, der dir dabei helfen wird. Außerdem musst du deine Fähigkeiten in der Musik und im Tanzen weiter vervollkommnen. Anscheinend schätzen die Flamen dies sehr.«
So war das also: Meine Zukunft war mit derselben Präzision geplant worden, die die Königin schon in ihrem Krieg gegen die Mauren bewiesen hatte. Ich war nichts als ein weiterer Soldat in ihrer Armee, eine weitere Kanone in ihrem Arsenal.
In diesem Moment hasste ich sie.
Sie tauchte ihre Feder ins Tintenfass und zog den Stapel Dokumente auf dem Pult näher zu sich heran. »Ich habe mich um meine Arbeit zu kümmern. Morgen setzen wir nach dem Unterricht deine Antwort an Philipp auf. Gib mir jetzt einen Kuss und sprich deine Gebete.«
Morgen schien eine Ewigkeit entfernt zu sein. Ich spürte meine Beine kaum, doch irgendwie schaffte ich es, die Wange meiner Mutter mit einem Kuss zu streifen, zu knicksen und zur Tür zu staksen. Als ich schon die Hand auf der Klinke hatte, zögerte ich. Ich dachte, meine Mutter hätte vielleicht ein Einsehen und riefe mich zurück, weil sie mich doch unmöglich so gehen lassen konnte.
Aber sie hatte sich bereits über ihre Korrespondenzen gebeugt.
Die Finger um den Brief gekrallt, trat ich in den Korridor. Sofort erhob sich Soraya vom Boden und blickte mich fragend an. In meine Gemächer konnte ich jetzt nicht zurückkehren. Meine Schwestern waren bestimmt noch wach und würden keine Ruhe geben, bis sie die Nachricht aus mir herausgepresst hatten. Und dann – o Gott! – würde ich heulen wie ein kleines Kind, wie eine Idiotin, wie Isabella in ihrem endlosen Kummer! Nein, ich konnte mich ihnen jetzt nicht stellen. Noch nicht. Ich brauchte Zeit für mich allein an irgendeinem abgeschiedenen Ort, wo ich meinem Zorn und meinem Kummer freien Lauf lassen konnte.
Ich hob meine Röcke und lief los. Nur knapp vermied ich einen Zusammenprall mit erschrockenen Wächtern und Sklavenmädchen, die hastig vor mir knicksten und dabei sonnengetrocknete Leinsamen aus ihren Körben verloren. Als wären mir Verfolger auf den Fersen, rannte und rannte ich, bis ich keuchend in einem unüberdachten Hof anlangte. Soraya blieb dicht hinter mir.
Wohltuend ergoss sich der Duft von Jasmin über mich. Über mir hing ein Sichelmond an dem mit leuchtenden Sternen übersäten Nachthimmel. Das Wasser aus den Mäulern der Steinlöwen plätscherte in den Brunnen, und während es mir um die Füße strömte, drehte ich mich um und sog den Anblick der Alhambra in mich ein: ihre geschwungenen Bögen, die kunstvollen Ziergiebel, die Marmorskulpturen.
Die Stille war eine liebe Gefährtin. Alles hatte sich verändert. Diese Welt, die ich so sehr liebte, sie würde nicht um mich trauern. Sie würde meine Abwesenheit nicht einmal spüren. Sie würde einfach weiterexistieren, in ihrer Schönheit zeitlos in sich ruhend und gleichgültig, während ihre Mauern die Echos der Verschwundenen schluckten.
Ich spürte Soraya an meiner Seite, spürte, wie ihre Hand sich um die meine schloss, und ließ meinen Tränen in zornigem Schweigen freien Lauf.
Kapitel 3
Um der schlimmsten Hitze zu entgehen, brachen wir am Abend von Granada auf. Eine mühselige Reise stand uns bevor, mit wochenlangen Ritten auf dem harten Rücken unserer Maultiere. Bevor wir uns auf die gewundene Bergstraße hinunter in die Täler Andalusiens begaben, blickte ich noch einmal über die Schulter.
Die Alhambra ruhte, von der Abenddämmerung violett gefärbt, auf ihrem Berg. Über ihren Türmen entfaltete sich der Himmel wie ein mit Millionen Glassternen besticktes violettes Tuch. Eine Handvoll winkender Bauern säumte die Straße. Von den vielen Bauernhöfen, allesamt kleine Tupfer in dieser weiten Landschaft, drang Hundegebell zu uns herüber. Es war wie am Ende jedes Sommers, als würden wir nächstes Jahr wie gewohnt zurückkehren. Dann passierten wir einen Steinhaufen, von dem es hieß, dass Boabdil von hier aus zum letzten Mal den Anblick von Granada genossen hätte und in Tränen ausgebrochen sei.
Wie er fragte ich mich, ob ich meinen geliebten Palast je wiedersehen würde.
Drei Wochen später erreichten wir die ausgedörrte Hochebene von Kastilien und die Stadt Toledo. Beim Näherkommen sahen wir, wie das auf seinem felsigen Berg über dem Fluss Tagus kauernde Toledo von der sinkenden Sonne angestrahlt wurde – eine wunderschöne Ansammlung von weißen und ockerfarbenen Gebäuden, gekrönt von der Kathedrale. Ich hatte schon immer die gewundenen, schmalen Gassen gemocht und auch den Geruch von Brot, das in den Morgenstunden gebacken wurde, das plötzliche Entfalten von Blütenkelchen, flüchtig erspäht im Garten hinter den Toren des Kreuzgangs, und nicht zuletzt die herrlichen von Mudejaren errichteten Torbögen, deren Schnitzereien die Geheimnisse der besiegten Mauren bargen.
Jetzt empfand ich die Stadt jedoch als Gefängnis, in dem ohne mich über meine Zukunft entschieden worden war. Toledo war der offizielle Versammlungsort der kastilischen Cortes, des Rats aus Fürsten und den von jeder größeren Stadt Kastiliens gewählten Ständevertretern. Meine Mutter hatte die ausufernde Macht der Cortes beschnitten, doch bei der Erhebung von Steuern, bei größeren Ausgaben, Verbindungen zwischen königlichen Familien und der Regelung ihrer Nachfolge musste sie nach wie vor den Rat um seine Zustimmung bitten.
Es waren diese Cortes, die meiner Verlobung zugestimmt hatten.
Als wir die steile Straße zur Burg Alcázar hinaufritten, presste ich die Lippen zusammen. Während der gesamten Reise hatte ich kaum ein Wort gesagt, und meine Laune verdüsterte sich noch mehr, als ich mich erst einmal im Inneren dieser alten Festung befand, einem höhlenartigen Labyrinth mit Wänden, die so feucht waren, dass sie förmlich trieften. Nach den mit Oleander bestreuten Terrassen der Alhambra hatte ich hier das Gefühl zu ersticken. Und als ob das noch nicht ärgerlich genug gewesen wäre, begannen nun auch noch meine Französischstunden, abgehalten von einem völlig humorlosen Lehrer, der mich mit endlosen Vorträgen traktierte und täglich dem mühseligen Aussprechen von Vokalen unterwarf.
Vier Stunden lang drillte er mich jeden Tag, und das mit einem Akzent, der so widerwärtig wie sein Atem war. Es bereitete mir einen schalen Trost, wenn ich meine Verben absichtlich verstümmelte und ihn dabei beobachtete, wie er vor Zorn erbleichte. Bis eines Nachmittags – er leierte wieder einmal vor sich hin, während ich mit geballten Fäusten danebensaß – Pferde mit klappernden Hufen in den Burghof preschten.
Sofort stürmte ich zu der schmalen Schießscharte und presste die Stirn gegen den Schlitz, um einen Blick auf die Ankömmlinge zu erhaschen.