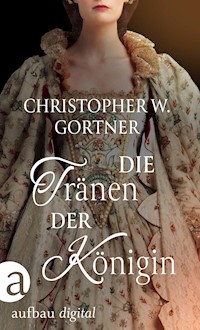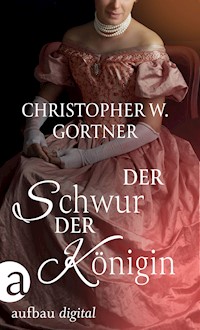9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Tudor Saga
- Sprache: Deutsch
London 1558: Nach Marys blutiger Regierungszeit besteigt ihre Schwester, Elizabeth Tudor, den englischen Thron. So kann auch Elizabeths getreuer Spion, Brendan Prescott, endlich aus dem Exil an den Hof zu seiner großen Liebe Kate zurückkehren. Doch die junge Königin hat einen Auftrag für ihn, der ihn nach Yorkshire führt. Dort ist ihre Hofdame, Lady Perry, nach einem Familientreffen spurlos verschwunden. An der rauen Küstengrafschaft kommt Brendan einer Verschwörung auf die Spur, die nicht nur Elizabeth stürzen, sondern auch das tödliche Geheimnis seiner eigenen Herkunft enthüllen könnte ...
Dritter Teil der großen Tudor Saga von C.W Gortner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
London 1558: Nach Marys blutiger Regierungszeit besteigt ihre Schwester, Elizabeth Tudor, den englischen Thron. So kann auch Elizabeths getreuer Spion, Brendan Prescott, endlich aus dem Exil an den Hof zu seiner großen Liebe Kate zurückkehren. Doch die junge Königin hat einen Auftrag für ihn, der ihn nach Yorkshire führt. Dort ist ihre Hofdame, Lady Perry, nach einem Familientreffen spurlos verschwunden. An der rauen Küstengrafschaft kommt Brendan einer Verschwörung auf die Spur, die nicht nur Elizabeth stürzen, sondern auch das tödliche Geheimnis seiner eigenen Herkunft enthüllen könnte.
Dritter Teil der großen Tudor Saga von C.W Gortner.
Über C.W. Gortner
C.W. Gortner wuchs in Südspanien auf. In Kalifornien lehrte er an der Universität Geschichte mit einem Fokus auf starke Frauen inder Historie. Er lebt und schreibt in Nordkalifornien. Im Aufbau Taschenbuch ist bereits sein Roman »Marlene und die Suche nach Liebe« erschienen.
Mehr Informationen zum Autor unter www.cwgortner.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christopher W. Gortner
DieTudor-Fehde
Historischer Roman
Übersetztvon Peter Pfaffinger
Übersicht
Titelinformationen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Danksagung
Anmerkung des Übersetzers
Impressum
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
371
372
373
375
376
377
Für Erik
Die Vergangenheit ist nicht heilbar.Elizabeth I.
BASEL, 15581
In schwarzen Samt gehüllt, das wallende dunkelblonde Haar wirr im Gesicht, stand sie vor mir. Schatten begleiteten sie, als sie sich langsam der Pritsche näherte, auf der ich wie gelähmt lag. Schon griffen ihre langen Finger nach den Bändern ihres Mieders und begannen, sie zu lösen.
Ich war zu keiner Regung fähig, konnte kaum atmen. Begierde brannte in meinen Adern. Ich hörte mich stöhnen; und dieser eine matte Laut brach meinen Widerstand. Sie war so nahe bei mir. Und dann, endlich, griff ich in ihr üppiges Haar, spürte ihre warme Zunge in meinen Mund gleiten und ihre elektrisierende Berührung, als sie an meinen Kleidern zerrte, mir die Hose herunterriss und mein steifes Glied umfasste.
»Ich möchte etwas anderes als Angst kennen«, flüsterte sie. »Ich möchte Sehnsucht spüren, selbst wenn es nur dieses eine Mal ist.« Ihre Robe war vorn geöffnet. Ich starrte sie, mit wild pochendem Herzen, an, obwohl ich in einem dunklen Teil meiner Seele wusste: Wenn ich jetzt fortfuhr, würde es kein Vergessen, kein Entkommen mehr geben; bis ans Ende meiner Tage würde ich mit Gewissensqualen leben müssen, weil ich die Frau betrogen hatte, die ich wahrhaftig liebte und die weit entfernt von mir auf mich wartete, ohne etwas zu ahnen.
Doch als ihre dunkle Samtrobe zu ihren Füßen lag und ich sie in ihrer ganzen Schönheit vor mir sah, ihre makellose Haut, die Brüste mit den rosa Knospen und ihre Rippen, die sich wie die Saiten einer Lyra unter ihrer blassen Haut abzeichneten, konnte ich nicht länger denken. Sie ließ sich auf mich sinken, und ich drang mit einer Wildheit in sie ein, die ihr ein lustvolles Seufzen entlockte. Immer leidenschaftlicher stieß ich zu, bis wir uns gemeinsam im selben Rhythmus bewegten.
Im nächsten Moment ergoss sich mein Samen in sie. Unvermittelt schlang sie die Schenkel um mich, und ich schrie laut auf. Doch während mich noch Wonneschauer überliefen und unsere Glut langsam abkühlte wie der Rauch über einem gelöschten Feuer, legte sich ihre Hand kalt auf meine Brust. Ich blickte auf und ihr direkt in die Augen, gerade als sie ein Messer mit glitzernder Klinge hob und es mir in den Leib jagte, mitten ins Herz …
»Nein!«
Den Schrei immer noch auf den Lippen, schoss ich in meinem schmalen Bett hoch. Keuchend kämpfte ich darum, mich in der Wirklichkeit zurechtzufinden, die sich bruchstückhaft um mich herum abzeichnete. Schließlich schlug ich die Decke zurück, rutschte zur Bettkante und ließ den Kopf auf die Hände sinken. Tief durchatmen, sagte ich mir. Das hat es nie gegeben. Es war ein Traum. Sie ist verschwunden. Tot. Ich stand auf, die Reste des Albtraums immer noch an mir wie Spinnweben, und bemerkte plötzlich, dass mein Nachthemd von Schweiß durchnässt war. Ich riss es mir vom Leib und tappte nackt zur Anrichte, auf der sich die Kupferschüssel und der Wasserkrug befanden. Wie beißend kalt es war, spürte ich erst, als ich das eisige Wasser direkt aus dem Krug trank. Kaum hatte es sich in meinem Magen ausgebreitet, befiel mich ein Zittern.
Hastig kehrte ich zum Bett zurück und wickelte mich in die raue Wolldecke. Mit hochgezogenen Schultern auf der Matratze kauernd, spähte ich durch das schiefe Glasfenster meiner engen Dachkammer, das wie ein nach innen gewölbtes Auge in die Wand eingelassen war. Draußen war es immer noch dunkel, und die Türmchen und Giebel dieser fremden Stadt bildeten vor dem Himmel eine dunkle gezackte Silhouette. Während die Erinnerung an meinen Verrat in die Tiefen meines Bewusstseins zurückwich, in die ich sie verbannt hatte, um überhaupt weiterleben zu können, hellte sich langsam die schwarzblaue Nacht auf, und ein über den Horizont kriechender gold- und rosafarbener Schimmer kündigte den neuen Tag an.
Wie lange war es her? Manchmal vergaß ich es beinahe. Tief musste ich in meinem Gedächtnis danach graben. Es waren nun schon fast vier Jahre. Vier lange Jahre, seit ich vor meinen Feinden geflohen war und alles zurückgelassen hatte, Besitztümer wie Menschen.
Freiwillig hatte ich mich nicht von England abgewandt. Bei meinem letzten, quälenden Auftrag am Hof, der meinen geliebten Junker und fast auch mich selbst das Leben gekostet hatte, war es mir zwar noch mit Mühe und Not gelungen, Elizabeth zu retten, doch ich hatte nicht verhindern können, dass ihre Halbschwester Mary sie in den Tower sperrte. Nach zwei Monaten schrecklicher Kerkerhaft wurde Elizabeth entlassen und unter Aufsicht in ein abgelegenes Schloss verbannt. Meine geliebte Kate blieb an ihrer Seite, doch mir war es nicht gelungen, in ihrer Nähe zu bleiben. Die Königin hatte mich des Hofes verwiesen, und ich suchte auf dem Landsitz meines Mentors William Cecil Zuflucht. Freilich hielten uns Cecils Informanten weiterhin über Elizabeths Lebensumstände auf dem Laufenden, woran sich auch dann nichts änderte, als Mary in ihrem Eifer, Gott und ihrem Gemahl, Prinz Philipp von Spanien, gefällig zu sein, eine grauenhafte Verfolgung ihrer protestantischen Untertanen anzettelte. Als sich dann die Nachricht verbreitete, dass Mary sich guter Hoffnung wähnte, zog sich die Schlinge um meinen Hals zu. Marys vertrauter Ratgeber, der kaiserliche Botschafter Simon Renard, den ich kurz zuvor übertölpelt hatte, hetzte seine Häscher auf mich. Cecil bekam Wind davon und traf im Geheimen Vorbereitungen, mich hierher, in die von Calvinisten beherrschte Schweiz, zu entsenden, wo auch einer seiner Agenten, Francis Walsingham, unmittelbar nach Marys Thronbesteigung Zuflucht gefunden hatte.
Zitternd ließ ich die Luft entweichen. Langsam begann sich der Knoten in meiner Brust aufzulösen. Warum jetzt? Warum hatte ich zum ersten Mal nach so langer Zeit wieder von Sybilla Darrier geträumt? Monatelang hatte ich kaum noch an sie gedacht, und das, obwohl ich jeden Tag, ja, jede Stunde mit den Folgen ihrer Machenschaften leben musste.
Warum verfolgte sie mich immer noch?
Die Minuten krochen dahin. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Schließlich hörte ich unsere Hauswirtin, Gerthe, die Treppe hinunterpoltern, in den Zimmern die Öfen einschüren und den Tisch für das Frühstück decken. Ich schlug die Bettdecke erneut zurück, wusch mich hastig mit dem im Krug verbliebenen Wasser und stieg schlotternd in meine unauffällige Tarnkleidung – schwarze Strumpfhose, Kniehose und schlichtes Wams –, die mich als calvinistischen Kaufmannslehrling auswies.
»Schon auf?«, begrüßte mich Gerthe fröhlich auf Deutsch, als ich den kleinen Raum betrat, wo wir unsere Mahlzeiten einnahmen. Gerthe war eine rundliche, geschäftige Person unbestimmbaren Alters, die in keinerlei Hinsicht außergewöhnlich wirkte. Frauen wie sie sah man tagtäglich zu Hunderten auf den Straßen, Bedienstete in Haushalten, die – auf den ersten Blick zumindest – ganz genauso wirkten wie der unsere. Und das war wohl der Grund, warum Walsingham sie ausgesucht hatte. Ihrer Loyalität versicherte er sich vermutlich, indem er sie hin und wieder zu sich ins Bett nahm. So war es gewiss auch in dieser Nacht gewesen; zumindest ließ ihr träges Gebaren das erahnen.
Ich schenkte ihr ein Lächeln und setzte mich an den Tisch. Sogleich trug sie Ziegenkäse, dunkles Brot und warmes Bier auf. »Ist Herr Thorsten schon wach?«, fragte ich zwischen zwei Bissen, sorgsam darauf bedacht, Walsinghams Decknamen zu verwenden.
Sie nickte, während sie sich am Herd zu schaffen machte. »Er hat das Haus aber schon früh verlassen. Ihr sollt in seinem Kontor auf ihn warten, hat er gesagt.« Jetzt blickte sie über die Schulter. »Greift zu. Ihr müsst mehr essen. Ihr seid blass, Herr Johann. Ihr müsst bei Kräften bleiben. Die Winter hier sind kalt, und ich habe das Gefühl, dass uns ein besonders strenger bevorsteht. Gestern Abend hat es schon den ersten Schnee gegeben.«
Mein Alias war lächerlich, doch Walsingham hatte darauf bestanden. Bei einem so gängigen Namen wie Johann, meinte er, würden keine Zweifel aufkommen. Angesichts meiner – wohlwollend ausgedrückt – dürftigen Kenntnisse des Deutschen und des Schweizerischen gab er mich als den Sohn eines Cousins aus, der sein Heimatland wegen der Verfolgung durch die Katholiken hatte verlassen müssen. Wer vor den Häschern der römischen Kirche floh, war in Basel willkommen, ohne dass man ihm Fragen stellte. Inzwischen wusste jeder Protestant auf dem europäischen Festland, welche Gräueltaten Mary Tudor in England unter seinen Glaubensbrüdern anrichtete.
Mit dem Begriff »Kontor« täuschte Walsingham elegant darüber hinweg, dass er mich dort die Feinheiten unseres Gewerbes lehrte. Sobald ich aufgegessen und mich bei Gerthe bedankt hatte, erklomm ich wieder die Treppe, ging vorbei an meinem Gemach den Korridor hinunter und blieb vor der letzten Tür stehen. Sie war verschlossen. Aus der Innentasche meines Wamses zog ich den Schlüssel und sperrte auf. Drinnen wartete Walsingham bereits auf mich.
»Gerthe hat gesagt …«, begann ich, und er nickte.
»Ich weiß. Verschließt die Tür. Ich habe mich ins Haus geschlichen, als sie im Brunnen draußen Wasser schöpfte. Setzt Euch. Es ist höchste Zeit, dass wir anfangen.«
Mit Augen, kalt wie die eines Luchses, starrte er mich an. Sein bohrender Blick vermochte es stets aufs Neue, mich zu verunsichern. Unter den offenen Ärmeln seines schwarzen Wamses lugten seine spinnenartigen Hände hervor. Dürr und feingliedrig, aber mit markantem Gesicht, stets umschatteten Augen und gepflegtem Bart, schien er alterslos zu sein, auch wenn er in Wahrheit noch keine dreißig Jahre alt war. Auf diejenigen, die ihn nicht kannten, wirkte er völlig harmlos in seinen von oben bis unten schwarzen Kleidern und der Kappe auf dem vorzeitig kahl werdenden Kopf – eine Ausstattung, die eher zu einem hugenottischen Pastor gepasst hätte als zu einem Geheimagenten in Diensten Cecils, sodass ich mich jetzt fragte, warum ich ihn jemals gefürchtet hatte. Walsingham war ich kurz nach meiner Ankunft am Hof zum ersten Mal begegnet, als ich noch Lord Roberts milchbärtiger Junker war. Bei meinem ersten Auftrag trat er als mein Verbindungsmann auf. Weil er sich stets leise wie eine Katze heranschlich, hatte ich ihn als beängstigend empfunden. Doch als ich nach der Überquerung des Ärmelkanals und dem Ritt durch die Niederlande bei ihm aufgetaucht war, hatte Walsingham mich höflich, wenn auch nicht übermäßig warmherzig, empfangen.
Bald gewann ich einen tieferen Einblick in seine Persönlichkeit. Er mochte keine Bedrohung für mich darstellen, aber gefährlich war er gleichwohl. Kaum war ich unter dem schmalen Giebeldach seines Hauses im Geschäftsviertel des von internationalem Tratsch überfluteten Basel eingezogen, als er damit begann, mich in die schaurigen Künste unseres Handwerks einzuweisen. In den Jahren, seit er England verlassen hatte, war er weit gereist: bis zu den Höfen Italiens und anderer, noch weiter entfernter Länder, wo Intrigen den Alltag bestimmten und in einem fort Versuche stattfanden, Feinde aus dem Weg zu räumen – häufig mit äußerst ausgeklügelten Methoden.
Bei Fehlern und Irrtümern hatte Walsingham keine Geduld. Ich war hier, um zu lernen, hielt er mir vor und forderte mich – fast ohne Vorbereitung – mit obskuren Texten und Rätseln heraus, die mir hinsichtlich meiner Rechenfähigkeiten und meines Gedächtnisses wahre Heldentaten abverlangten. Er lehrte mich nicht nur, mit beiden Händen, sondern auch rückwärtszuschreiben, sodass meine Botschaft nur in einem Spiegel gelesen werden konnte. Darüber hinaus musste ich täglich mein Geschick mit Schwert und Dolch verfeinern und endlos lange Stunden üben, bis meine Schenkel und Arme vor Erschöpfung brannten.
Noch anstrengender war das Erlernen der geheimnisvollen Kunst, mich aller Empfindungen zu entledigen – laut Walsingham eine Methode, die fernöstliche Meuchelmörder in Vollendung beherrschten. Ich schulte mich darin, den Fluss meines Bluts so zu verlangsamen, dass es nur noch durch die Venen kroch, und musste dann bei Schneestürmen nackt und regungslos vor einem offenen Fenster sitzen, mit nichts als meinem Atem, um meine Glieder zu wärmen. Er ließ mich barfuß über Glassplitter laufen, ohne dass ich mir meinen Schmerz anmerken lassen durfte, und meine Ausdauer bei Läufen über Hindernisse üben, die er in der Nacht davor in den Gassen aufgebaut hatte. Mein Körper war seine Maschine, die er darauf abrichtete, Fremde zu verfolgen, die meine Nähe nicht mal erahnen sollten, und ihre Geheimnisse aufzudecken. Es verblüffte mich, wie viel ich über jemanden in Erfahrung bringen konnte, während er sich unbeobachtet wähnte. Zugleich erschreckte es mich, wozu Menschen aus Grausamkeit oder böser Absicht in der Lage waren – alles Taten, die, wie Walsingham mir versicherte, Erpressung erst ermöglichten.
Nur ein Mal widersetzte ich mich, nämlich als er mir befahl, über den Rhein zu schwimmen. Ich müsse lernen, meine Wasserscheu zu überwinden, beharrte er. Die Augen zu Schlitzen verengt, dozierte er: »Jede Schwäche könnte Eure Vernichtung bedeuten.«
Doch ich schüttelte heftig den Kopf. »Dann lasse ich es eben darauf ankommen!« Mochte er mir noch so viele Vorträge über die Überwindung der eigenen Gefühle und der Unzulänglichkeit unseres Körpers halten, freiwillig würde ich mich nie wieder in tiefes Wasser stürzen.
Obwohl ich nie Lob oder ermutigende Worte von ihm zu hören bekam, stellte ich nach und nach fest, dass er von mir durchaus beeindruckt war. Ich war in ein Land gekommen, dessen Sprache in meinen Ohren wie sinnloses Gurgeln klang, und in eine Stadt, in der ich nichts und niemanden kannte. Trotz meines jugendlichen Alters von gerade erst fünfundzwanzig Jahren war ich nach zwei Missionen zu Elizabeths Schutz bereits ein Veteran und hatte jede Hoffnung, irgendwann ein normales Leben führen zu können, aufgeben müssen. Ich hatte nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mochte es kosten, was es wollte, eines Tages würde ich große Leistungen vollbringen. Wenn die Zeit kam, musste ich bereit sein.
Wie Cecil mir einst erklärte: Mein Schicksal hatte mich zum Spion bestimmt.
Jetzt bemerkte ich auf dem Tisch vor Walsingham eine schlichte Holzschachtel mit geöffnetem Deckel. Darin befanden sich Phiolen in mehreren Reihen, alle mit identischen Korken versiegelt. Ich widerstand dem Drang, die Augen zu verdrehen. Was mir nun bevorstand, war seine neueste Foltermethode, mit der wir uns schon seit mehreren Wochen beschäftigten. Ich nahm auf meinem Stuhl Platz und wartete, bis er das erste Fläschchen entkorkte und vor mich stellte.
Ich nahm es in die Hand und hielt es mir unter die Nase. Dann atmete ich tief ein, aber nicht so tief, dass irgendein Bestandteil in meine Lunge eindringen konnte, und konzentrierte mich ganz auf den Geruch.
»Zitrone«, erklärte ich schließlich, »und Moschus …« Ich zögerte, versuchte, eine rätselhafte Note zu bestimmen, die mich anzog, sich mir aber beharrlich verweigerte. Was war das nur? Diesen Geruch kannte ich doch! Ich hatte ihn schon ein Mal in der Nase gehabt. War er Teil eines Parfums? Oder wies er auf eine giftige Substanz hin?
Walsinghams Stimme riss mich aus meinem Grübeln. »Gift oder Parfum? Ihr habt nicht den ganzen Tag lang Zeit, um Rückschlüsse auf den Inhalt zu ziehen! Wenn es Gift ist, bleibt Euch in den meisten Fällen weniger als eine Minute, bis das ausgewählte Opfer stirbt.«
Ich starrte ihn böse an. Das Grauen, das sich hinter seinen Worten verbarg, hatte ich bereits am eigenen Leib erlebt. Ich hatte einen Jungen, meinen Freund und Junker Peregrine in den Armen gehalten und mit ansehen müssen, wie er qualvoll starb, nur weil ich nicht schnell genug gehandelt hatte. Davon wusste Walsingham natürlich. Und er nutzte es zu seinem Vorteil, um mich zu einem Gefühlsausbruch zu provozieren.
»Ihr setzt mir das vor und erwartet, dass ich es binnen – wie viel? – fünf Sekunden identifiziere?«, rief ich und war mir klar darüber, dass ich genau das tat, was er beabsichtigt hatte. »Es ist ein Parfum.«
»Falsch. Und Ihr müsst es in weniger als fünf Sekunden entziffern.« Seine knochigen Finger tippten gegen die Phiole vor mir. »Mandeln«, belehrte er mich, und ich sackte auf meinem Stuhl zusammen. »Doch, ja«, fuhr er mit dieser unerträglichen Überlegenheit fort, die ich noch mehr hasste als diese leere Schiefertafel, die er anstelle eines Gesichts trug. »Von den üblichen Giften werden die meisten leicht nach Mandeln riechen, wenn Ihr Euch nur genug darin übt, diese Note zu entdecken. Allerdings gibt es natürlich auch Ausnahmen.«
»Aber das hier war keine«, brummte ich.
Die Lippen nachdenklich geschürzt, verkorkte er das Fläschchen wieder und steckte es in die Holzschachtel zurück. Dann ließ er auf der Suche nach der nächsten Herausforderung die Hand über den Reihen der Phiolen schweben. Gift oder Parfum?
Abrupt schob ich meinen Stuhl zurück. »Genug! Ich kann nicht mehr. Meine Nase ist noch ganz verstopft von all den Gerüchen, mit denen Ihr mich gestern malträtiert habt.«
Obwohl er seine Züge vollkommen beherrschte, sodass er oft eher aus Stein denn aus Fleisch zu sein schien, flackerte in seinem Blick beißender Sarkasmus auf. Schließlich sagte er: »Ich frage mich, ob Ihr Euch an dem Tag, an dem Ihr zur Verteidigung der Königin gerufen werdet, auch so fühlen werdet. Das ist unser Beruf, Prescott! Wir sind Agenten. Wir können nicht einfach die Waffen strecken, auch dann nicht, wenn wir müde sind, denn unser Leben ist nichts im Vergleich zu demjenigen, das wir schützen müssen. Beim letzten Mal hättet Ihr beinahe versagt, und sie ist gerade noch davongekommen. Jetzt müsst Ihr alles opfern, was Ihr fühlt und denkt, wenn Ihr ihre Waffe werden wollt.«
Ich biss die Zähne aufeinander. So ungern ich es zugab, aber er hatte recht. Ich wäre damals wirklich beinahe gescheitert und hatte mich bei dieser Gelegenheit von der Illusion verabschieden müssen, ich könne mir noch irgendeine Ähnlichkeit mit dem Mann bewahren, der ich früher gewesen war. Es war einfach zu viel geschehen. Ich war der Grund für zu viele Verluste gewesen. Die Erinnerung an Sybilla, nackt in meinem Gemach, eine Sirene des Betrugs, kehrte zurück und packte mich mit eisernem Griff.
Wäre ich besser vorbereitet gewesen, hätte sie nicht derart viel zerstören können.
Und Peregrine wäre vielleicht noch am Leben.
Ich zupfte mein Wams zurecht und stellte mich vor das schmale Fenster des kahlen Raumes, in dem ich zusammen mit diesem Mann, für den ich keinerlei Zuneigung empfand, so viele Stunden verbracht hatte – bei drückender Hitze und klirrender Kälte. Und während ich auf die Stadt hinausschaute, befiel mich auf einmal Heimweh. Ich vermisste England. Ich vermisste es mit jeder Faser meines Herzens, und das, obwohl mein Leben von Lügen und Leid beherrscht gewesen war und ich in meiner eigenen Heimat ebenso sehr ein Fremder war wie hier. Ich vermisste die grünen Hügel, die erhabenen Eichen und den silbrigen Regen. Am meisten vermisste ich Kate, auch wenn mir klar war, dass ich keinen Anspruch mehr auf sie erheben konnte, nicht nach allem, was ich getan hatte.
»Wir nehmen unsere Reue mit, wohin wir auch immer gehen«, ließ sich Walsingham in meinem Rücken hören und bewies wieder einmal diese gespenstische Fähigkeit, meine Gedanken lesen zu können. Beim ersten Mal hatte ich an einen unheimlichen Zufall geglaubt. Als sich diese Anlässe häuften, begann ich, ihn für einen Seher zu halten. Inzwischen wusste ich, dass das nur einer seiner Kartenspielertricks war, den er bis zur Perfektion beherrschte, da er jahrelang die innere Zerrissenheit der Menschen um ihn herum beobachtet hatte.
Ich stieß ein unsicheres Lachen aus. »Bin ich immer noch so leicht durchschaubar? Ich muss eine schreckliche Enttäuschung sein.«
»Nur für mich«, entgegnete er trocken.
Dann hörte ich Papier rascheln. Seufzend drehte ich mich um und wappnete mich gegen einen weiteren endlosen Tag, gefüllt mit unverständlichen Inschriften, deren Entzifferung von mir erwartet wurde. Neben dem Erkennen von Giften gehörte die Entschlüsselung von Geheimcodes zu meiner täglichen Fron. Er erklärte mir, dass es gebildeten Männern wie mir größte Schwierigkeiten bereitete, durch die offensichtliche Unordnung hindurch zu der darunterliegenden Struktur zu gelangen, die sehr wohl vorhanden war. »Jeder Code hat einen Makel«, verkündete er. »Keiner ist unbezwingbar. Aber wir lassen uns von dem scheinbaren Chaos verwirren und überwältigen, ganz so wie sein ›Schöpfer‹ es beabsichtigt hat. Dabei vergessen wir, dass er auch nur ein Mensch ist und ein anderer seinen Trick durchschauen kann.«
Mich vermochte das freilich nicht zu ermutigen, zumal das Blatt, mit dem ich es zu tun hatte, aussah, als wäre eine Ratte mit Pfoten voller Tinte darübergehuscht. Aber da ich nichts anderes zu tun hatte, fand ich mich mit dieser Aufgabe ab, über der ich den ganzen Tag bis zum Abendessen brüten würde, ehe ich …
Mein Herz machte einen Satz. Walsingham hielt einen Papierbogen und ein gebrochenes Siegel hoch. »Ein Brief«, sagte er, »von Mylord Cecil.« Als er sah, dass ich förmlich erstarrt war, verzogen sich seine Lippen, als setzte er zu einem bei ihm höchst seltenen Lächeln an. »Ich wollte eigentlich warten, bis wir unser Tagwerk verrichtet haben. Aber das ist uns ja wohl gelungen.«
Er hielt mir den Bogen entgegen. Ich riss ihn ihm aus der Hand und wollte schon zu lesen beginnen, als ich bemerkte, dass er in Cecils üblicher Verschlüsselung abgefasst war. So zwang ich mich zu mehr Geduld. Sorgfältig wandte ich den Code an, den ich längst auswendig kannte, und übersetzte die Zeichen in ein verständliches Englisch.
Ich blickte auf. »Hier steht …« Vor Fassungslosigkeit wurde meine Stimme hart. »Und Ihr sagt mir das erst jetzt?«
»Es hätte ja nichts geändert. Wir können hier nicht einfach abreisen.«
»Aber Elizabeth … in diesem Brief steht, dass sie schon dabei ist, ihren Hof in Whitehall einzurichten!« Ich platzte fast vor Empörung. »Und dass Königin Mary bereits seit über einer Woche tot ist!«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich befolge nur Cecils Anweisungen. In seinem ersten Brief hat er mich über die Erkrankung der Königin in Kenntnis gesetzt, nachdem man herausgefunden hatte, dass sie gar nicht guter Hoffnung war, sondern in Wahrheit einen bösartigen Magentumor hatte. Als Nächstes hat er angekündigt, dass er beizeiten die nötigen Vorbereitungen treffen würde. Die Schiffspassage musste gebucht und die Pässe ausgestellt werden. Mich beauftragte er damit, die Schließung dieses sicheren Hauses und den Transport der Möbel zu beaufsichtigen. Hier tummeln sich papistische Spione, die uns mit Sicherheit ebenso aufmerksam beobachten wie wir sie. Wir müssen abreisen, ohne Aufsehen zu erregen, und uns von der Gemeinde der englischen Protestanten fernhalten, die ins Exil gegangen sind und jetzt auf Elizabeths Geheiß zurückkehren. Heimlichkeit ist und bleibt das oberste Gebot.« Er klappte seine Schachtel zu. »Wir reisen morgen bei Morgengrauen ab. Ihr könnt mit dem Packen anfangen.«
Ich funkelte ihn aufgebracht an. Bis auf meine Kleider und ein paar Bücher hatte ich nichts zu packen. »Ich kann in weniger als einer Stunde fertig sein«, stieß ich zwischen zusammengepressten Zähnen hervor.
Seine Augenbrauen hoben sich. »Dann schlage ich vor, Euch in Geduld zu üben. Die bloße Tatsache, dass ich Euch daran erinnern muss, beweist, dass Ihr noch lange nicht fertig ausgebildet seid.« Er wandte sich zur Tür. Seine Schachtel hatte er unter den Arm geklemmt. »Wir nehmen uns eine Stunde Zeit für die Reisevorbereitungen und gehen dann noch einmal den Code durch, den Ihr gestern Abend nicht entschlüsseln konntet.« Sein Ton wurde schärfer, als ich zu einem Protest ansetzte. »Bis wir an den Hof zurückgekehrt sind, Master Prescott, steht Ihr unter meinem Befehl. Habt Ihr das verstanden?«
Ich bejahte einsilbig, während ich den Brief mit der Ankündigung von Elizabeths Thronbesteigung in der Faust zerknüllte. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich mich einen Teufel um meine Angst vor tiefem Wasser und Walsinghams Befehlsgewalt über mich geschert und wäre auf der Stelle nach England zurückgeschwommen.
Walsinghams Schnauben ließ erkennen, dass er auch diesmal wieder meine Gedanken las.
LONDON2
Vier Tage später gingen wir in Dover an Land. Danach hieß es abwarten, bis die Ladung gelöscht war und wir unser Gepäck zurückbekamen. Als wir uns schließlich durch die Horden von Reisenden zu dem Gasthof drängten, wo die von Cecil für uns angeforderten Pferde warteten, war ich so weit, dass ich mir fast wünschte, ich wäre tatsächlich geschwommen. Eine Überquerung des Ärmelkanals mit seinen unberechenbaren Strömungen und plötzlich aufkommenden Stürmen war zu jeder Jahreszeit beschwerlich, doch jetzt, Mitte November, da der Winter bereits seine Krallen ausgefahren hatte, war die Reise ein einziges Fegefeuer gewesen und hatte mir den Magen restlos geleert.
Ich musste so schrecklich aussehen, wie ich mich fühlte, denn Walsingham hob bei meinem Anblick die Augenbrauen. »Ich kann mich darauf verlassen, dass Ihr reiten könnt? Zur Stadt ist es noch ein weiter Weg, und ich möchte nicht in einer dieser überfüllten Hafenkaschemmen mit ihren Wucherpreisen für ein erbärmliches Zimmer absteigen müssen.«
»Ich kann reiten«, murmelte ich, obwohl ich umhertorkelte wie ein neugeborenes Fohlen und immer noch den üblen Geschmack meiner Gallenflüssigkeit im Mund hatte. Als wir die für uns bestimmten Pferde erreichten, wurde mir bewusst, dass ich es kaum noch erwarten konnte, meinen Cinnabar wiederzusehen, den ich vor vier Jahren auf Cecils Gut zurücklassen musste. Hoffentlich hatte jemand daran gedacht, meinen Hengst an den Hof zu bringen. »Allerdings ist es mir ein Rätsel, wie wir auf diesen Kleppern weit kommen sollen«, fügte ich hinzu, während wir unsere Taschen an die Sättel schnallten und vor dem Aufsteigen den Pferdeäpfeln auswichen. »Die scheinen ja schon jetzt halb tot zu sein.«
»Seit Elizabeth den Thron bestiegen hat, sind in einem fort Boten über den Ärmelkanal gejagt, und zwar in beide Richtungen«, erwiderte Walsingham und breitete seinen Umhang sorgfältig über seinen Sattel. »Wahrscheinlich gibt es gar nicht genug von diesen Gäulen für all diejenigen, die derzeit Geheimbotschaften senden und empfangen wollen. Wir können von Glück reden, dass wir überhaupt Pferde haben. Genauso gut hätten wir auch mit der übrigen Meute in einen Karren gesteckt werden können.« Verächtlich ließ er den Blick über die Stadt schweifen, deren königliche Festung aus weißem Stein auf dem Kalkfelsen hockte und über das Labyrinth aus gewundenen Gassen und windschiefen Häusern wachte, in dem eine gewaltige Menschenmenge zu erkennen war, deren Rufe, Schreie und Flüche zu uns herüberwehten. Über uns kreisten laut krächzende Möwen und Saatkrähen. Walsinghams Nasenflügel blähten sich, als könnte er innerhalb dieses infernalischen Pestgestanks, zu dem sich die Gerüche von Exkrementen, ungewaschener Körper und Müll vermengten, einzelne Duftnoten erkennen.
»Wenn das so weitergeht, überrennen sie uns noch«, prophezeite er. »Das sind alles zurückkehrende Exilanten. Es sind einfach zu viele, und wir sind zu wenige. Ich nehme an, dass man keinen einzigen Pass überprüfen wird. Wer Geld und eine einigermaßen flinke Zunge hat, wird sich mit Bestechung Einlass verschaffen.«
Ich bekam eine Gänsehaut, und seine Züge verdunkelten sich. Den Blick erneut abschätzend auf die Stadt gerichtet, brummte er: »Schreibt Euch das hinter die Ohren: Auf diese Art schleicht sich das Chaos herein.«
Mit einem Ruck an der Kandare wendete er seine Stute und ritt zur Straße voraus.
Zu Pferde erwies Walsingham sich als ebenso schweigsam wie auf dem Schiff und teilte mir nur das mit, was für unser Weiterkommen nötig war. Gleichwohl blieb uns in der Nacht nichts anderes übrig, als uns eine Bleibe zu suchen. Obwohl unsere Pferde robuster waren, als der anfängliche Eindruck vermuten ließ, hatten sie wie wir eine Rast nötig, und sobald wir die vielen Karren und Kutschen weit genug hinter uns gelassen hatten, die von Dover aus in alle Winkel des Königreichs aufgebrochen waren, wählte Walsingham eine an der Straße gelegene Herberge für uns aus.
Unser Zimmer war armselig. Bis auf eine verschmutzte Matratze und einen wackeligen Stuhl gab es keine Möbel. So zogen wir es vor – in unsere Umhänge gehüllt und mit unseren Taschen als Kissen –, auf dem Boden zu schlafen, denn keiner von uns wollte sich Ungeziefer einhandeln. Gleichwohl zerquetschte ich in dieser Nacht eine ganze Reihe von Flöhen und kratzte mir am Morgen den Hals und die Arme wund. Als wir nach einem Frühstück, bestehend aus altem Brot, schalem Bier und verschimmeltem Käse, aufgetragen von einer mürrischen Dienstmagd, die eine Blase auf der Lippe hatte, wieder losritten, dämmerte mir langsam, dass durchaus einiges für die strenge protestantische Atmosphäre und die blitzblank geschrubbten Pflastersteine von Basel sprach.
Walsingham gab keine Bemerkung dazu ab, doch auch ihm musste der Unterschied aufgefallen sein. Wir hatten ein schmuckes Haus in einer schmucken reformierten Stadt verlassen und nach einem dreitägigen Ritt durch Burgund und die französischen Niederlande Calais erreicht, wo wir an Bord eines Schiffs gegangen waren, nur um wie ein Spielball der Wellen hin und her geworfen zu werden. Und nun kehrten wir zusammen mit Hunderten anderer Flüchtlinge zurück, die wie eine riesige Viehherde durch die Straßen von Dover trampelten. Wie kam Walsingham mit alldem zurecht, mit dieser Umwälzung, die uns jetzt eingeholt hatte? Während wir an den Eichenwäldchen längs der Straße vorbeiritten und mit Wasser gefüllten Gräben auswichen, in denen sich ein bedrohlicher, bleierner Himmel spiegelte, musste doch auch ihm bewusst geworden sein, dass die Fundamente unserer Welt im Begriff waren, sich zu verschieben.
Doch Walsingham ritt einfach weiter, als berührte ihn all das gar nicht. Schon bald bestätigte ein beißender Wind meine trüben Gedanken und grub mir seine Zähne in den Nacken. In Erwartung eines Gewittersturms mitsamt eisigem Regen hüllte ich mich in Wams und Umhang und zog die Mütze tiefer ins Gesicht. Vor uns tauchten Gruppen anderer Reisender auf: zu Fuß, auf Maultieren oder in Karren. Einige trieben Viehherden vor sich her, zu ihren Füßen bellende Schäferhunde. Immer voller wurde die Straße, bis wir unsere Pferde zügeln mussten. Als ich spürte, dass meine Stute unruhig wurde, spähte ich ins trüber werdende Dämmerlicht und entdeckte endlich den rauchigen Dunst, der wie so oft über dem schimmernden Band der Themse hing. Vor mir ringelte sich, dem Schwanz eines Drachen gleich, der Fluss. Darüber spannte sich, von zwanzig steinernen Stützpfeilern getragen, die gewaltige London Bridge. Und dahinter drängte sich das alte London, das längst über seine von Flechten überwucherten Stadtmauern hinausgewachsen war, sodass sich vor seinen Toren ein Flickwerk von Gärten, Obstwiesen und Wohnvierteln für Wohlhabende gebildet hatte.
Mir schnürte sich die Brust zusammen. Wann immer ich in London gewesen war, wurde unweigerlich bald darauf mein Leben bedroht. Diese Stadt war einfach kein sicherer Aufenthaltsort für mich, und als spürte er meine Beklommenheit, warf mir Walsingham einen nachdenklichen Blick zu. Erst nahm ich an, er wolle mich damit tadeln, doch dann sagte er leise in einem einfühlenden Ton, wie ich ihn noch nie von ihm gehört hatte: »Heimzukehren fällt einem nie leicht, es sei denn, man ist ein Dummkopf. Hier gehört Ihr hin. Hier seid Ihr …«
»Wir gehören hierher«, unterbrach ich ihn mit einem angespannten Lächeln.
Er nickte. »Richtig: Wir. Vergesst das nie. Von uns hängt jetzt alles ab.«
Wir gaben unsere Pferde in dem uns empfohlenen Stall in Southwark ab, obwohl Walsingham unwirsch kundtat, dass er keinerlei Lust hatte, es mit der Menschenmenge aufzunehmen, die am Great Stone Gate, dem massiven Tor am Südende der London Bridge, in einer langen Schlange darauf wartete, die Brücke überqueren zu dürfen. Da jedoch bereits die Nacht anbrach und damit bald wieder die Ausgangssperre in Kraft treten würde, schlossen wir uns einer Horde von ungeduldigen, müden Reisenden an, die am Steg von St. Mary Overie auf ein öffentliches Boot warteten. Der Gestank von Exkrementen und Abfällen in den Straßen war noch genauso grässlich, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und sogar hier, im Vergnügungsviertel gegenüber dem alten London, wo es von Bordellen, Spielhöllen, Tavernen und Gruben für die Bärenhatz wimmelte, hing eine Atmosphäre von Misstrauen, Angst und Armut in der Luft. Ausgemergelte Gestalten hasteten in alle Richtungen, ohne einander auch nur eines Blickes zu würdigen. Früher war das ganz anders gewesen. Fremden waren die Londoner zwar vorsichtig und reserviert begegnet, hatten untereinander aber sehr wohl einen freundlichen Umgang gepflegt. Einen möglichen Grund für diese Veränderung offenbarte ein einsamer Galgen vor dem Great Stone Gate: Daran baumelte die verwesende Leiche eines Protestanten ohne Kopf und Glieder, deren Verfall schon so weit fortgeschritten war, dass ihre von Krähen angefressenen Rippen zwischen den Hautfetzen hervorlugten. Für mich war offensichtlich, dass man die übrigen Körperteile dieses armen Kerls an anderen Toren aufgehängt hatte, wie es bei Verrätern der Brauch war. Als ich hinter der Leiche unzählige Bettler auf brandigen Beinstümpfen für die Nacht in Hauseingänge kriechen sah, wandte ich mich endlich von der Stadt ab. Doch der Anblick, der sich mir jetzt bot, war auch nicht gerade erbauend: Ausgemergelte Köter und verwilderte Straßenkinder balgten sich auf Abfallhaufen um weggeworfene Essensreste. Walsingham rief ein privates Boot herbei, und prompt stürzten sich einige dieser Waisenkinder auf uns. Schon streckten sie uns ihre schmutzigen Hände entgegen, bettelten um Almosen und vermochten es nicht, den verschlagenen Ausdruck in ihren hohlwangigen Gesichtern und stumpfen Augen zu verbergen. Wie ein Wolfsrudel umzingelten sie uns und griffen nach allem, was wir bei uns trugen. Da ich es in Southwark schon einmal mit solchen verwilderten Kindern zu tun gehabt hatte, hatte ich die Geldbörse und alles andere, was gestohlen werden konnte, in meine tiefsten Taschen gestopft und hielt die Schwertscheide eng an mich gepresst. Die Lippen angewidert verzogen, kramte Walsingham eine Silbermünze hervor und schleuderte sie weg, so weit er konnte.
Knurrend wie Hunde stürzten die Kinder hinterher. Gleich darauf, gerade rechtzeitig, legte das Boot an. Eilig schulterten wir unsere Taschen und kletterten an Bord. Breitbeinig hockte ich mich in die Mitte der Bank und klammerte mich links und rechts an der Kante fest. Walsingham warf mir einen Blick zu, dann befahl er dem Bootsmann: »Nach Westminster, und zwar schnell, bevor die Gezeiten wechseln!«
Als das Boot in die Mitte der Themse hinausschlingerte, fing er an, festgeklebten Schlamm von seinem Umhang zu zupfen. In unserem Rücken glitzerten die Lichter von Southwark wie weit entfernte Sterne. Die Laterne des Bootsmannes schaukelte an ihrem Haken und warf wild flackernde Schatten auf Walsingham, wodurch sein knochiges Gesicht noch eingefallener wirkte. »Ordnung und Kontrolle«, murmelte er, als führte er ein Selbstgespräch, »müssen bei ihr an erster Stelle kommen. All diese« – er schnaubte, wie um einen abscheulichen Geruch zu vertreiben – »Überbleibsel der papistischen Raserei müssen beseitigt werden.«
In seinen normalerweise kühlen Tonfall hatte sich ein zorniger Unterton geschlichen, doch bevor ich ihn darauf ansprechen konnte, sagte der Bootsmann: »Aye, Mary, die Blutige, hätte uns alle verbrannt, obwohl sie doch nur mit unserer Unterstützung auf den Thron gekommen is’. Gott sei Dank sind wir das Luder los, sag ich. Sie mag ja Königin gewesen sein, aber über ihren Tod is’ keiner traurig.«
Seine Worte riefen in mir meine letzte Erinnerung an die Königin wach, der ihre Untertanen den Beinamen »die Blutige« gegeben hatten. Wieder sah ich sie in ihrem Gemach im Whitehall-Palast stehen und mich wütend anstarren. Sie wusste genau, dass nichts, was sie sagte oder tat, jemals die magnetische Anziehungskraft ihrer Schwester übertreffen konnte. »Sie hätte bestimmt auch noch unsere Bess umbringen lassen«, knurrte der Fährmann und spuckte Schleim ins Wasser. »Ja, glaubt mir ruhig: Sie hätte unserer Prinzessin den Kopf abgeschlagen, so wahr wir hier sitzen!«
»Schon recht, guter Mann«, brummte Walsingham, »jetzt muss der Schöpfer über sie entscheiden.«
»Das Höllenfeuer verdient sie, nichts anderes! Soll sie doch einen Geschmack von dem kriegen, was sie hier angerichtet hat! Manche mögen ja dafür beten, dass die Heiligen sie durchs Fegefeuer führen, aber ich hoffe, dass sie gleich zum Teufel geht.«
Walsingham schnitt eine Grimasse. Als strenggläubiger Protestant lehnte er sowohl die Vorstellung von Erlösung durch das Fegefeuer als auch den Heiligenkult ab. Die Erklärung das Bootsmannes musste ihn schmerzhaft daran erinnert haben, dass in England in Religionsfragen immer noch tiefste Verunsicherung herrschte. Bei vielen waren der alte und der reformierte Glauben vermutlich zu einem kaum verstandenen Gedankenkonstrukt verschmolzen, das sich die Leute für ihre jeweiligen Bedürfnisse zurechtbogen. Allein schon diese Vorstellung war Walsingham ein Gräuel. Gewiss war er fest entschlossen, gleich in der ersten Audienz bei unserer Königin die Frage der religiösen Einheitlichkeit anzusprechen.
Der Gedanke an Elizabeth ließ mein Herz höher schlagen, als wir uns den überfluteten Steinstufen von Westminster näherten. Wir verließen das Boot und legten das kurze Wegstück nach Whitehall zu Fuß zurück. Die Nacht drängte tiefschwarz und kalt heran. In Halterungen angebrachte Fackeln versprühten Ruß, als wir beim Holbein-Glockenturm vor einem Wachposten stehen blieben. Walsingham zückte die Dokumente, die Cecil uns geschickt hatte, um unseren Einlass in den Palast zu gewährleisten. Während die Wächter die Schreiben inspizierten, betrachtete ich die imposante Ziegelfassade des Palastes, aus dem man mich mit Schimpf und Schande verjagt hatte.
Die senkrecht unterteilten Fenster leuchteten förmlich von Kerzenlichtern, und hinter dem Glas bewegten sich die Schemen von Dutzenden Höflingen. Gedämpftes Gelächter drang an meine Ohren. Im Burghof hinter dem Tor erspähte ich ein in Zobel und Samt gehülltes Paar, das gerade durch einen Bogengang den Palast betrat. Whitehall war kein großes Ganzes, sondern ein verwirrendes Labyrinth aus miteinander verbundenen Gebäuden – ein riesiges, noch lange nicht vollendetes Stückwerk. Unter anderem hatte es den alten Palast der Erzbischöfe von Cork geschluckt, den König Henry von Kardinal Wolsey beschlagnahmt hatte, nachdem dieser nicht in der Lage gewesen war, die von Henry für die Vermählung mit Anne Boleyn benötigte Annullierung seiner ersten Ehe durchzusetzen. Letztlich war es sein Scheitern in dieser Sache, das Wolsey das Leben kostete. Vom König des Hochverrats bezichtigt, starb er auf dem Weg zum Tower. Sechs Jahre später ereilte Königin Anne, Elizabeths Mutter, auf Henrys Betreiben hin ein ähnliches Schicksal: Sie wurde hingerichtet. Ich fragte mich, wie sich Elizabeth wohl in dem Wissen fühlte, dass sie jetzt die Herrscherin über jenen Palast war, der den Aufstieg und Fall ihrer Mutter und beinahe ihren eigenen Sturz gesehen hatte.
Ich zuckte zusammen, als Walsingham mich unvermittelt am Ellbogen fasste. »Kommt«, murmelte er, »wir müssen den Weg zum Thronsaal finden. Ihre Majestät hält heute Abend offenbar einen Empfang ab, und es sind keine Pagen verfügbar, die Cecil unsere Ankunft melden könnten.«
Die ausgelassene Stimmung, die uns im Palast empfing, stellte einen bemerkenswerten Kontrast zu der Atmosphäre dar, die bei meinem letzten Aufenthalt hier geherrscht hatte. War damals nach der Niederschlagung einer Rebellion gegen Mary jeder Zugang verriegelt und streng bewacht gewesen, so erstrahlten jetzt die breiten, mit Teppichen belegten Korridore und Galerien im Glanz funkelnder Juwelen, und von allen Seiten hallte Gelächter wider, da Unmengen von Höflingen zum großen Thronsaal strömten. Ich selbst hatte mich auch schon in Whitehall aufgehalten und innerhalb seiner Mauern Geschehnisse beobachtet, die jedem das Herz brechen und ganze Leben verändern konnten, doch nie hatte ich hier so viele Menschen gesehen wie heute. Und alle waren prächtig herausgeputzt!
Zuerst haderte ich noch mit meinem wenig präsentablen Erscheinungsbild, bis ich bemerkte, dass niemand uns auch nur die geringste Beachtung schenkte. An meiner Seite bewegte sich lautlos und kaum sichtbar Walsingham: in seinen schwarzen Kleidern wie der Schatten einer Katze mitten in einer Herde von Pfauen. Unter seinem Bart schob er den Unterkiefer vor. Er brauchte kein Wort zu sagen, um mir zu verstehen zu geben, wie heftig er einen derart unkontrollierten Zugang zur Königin missbilligte.
Bei der großen Flügeltür, die in den Thronsaal führte, wollten wir noch einmal unsere Umhänge überprüfen, doch dafür ließ man uns keine Zeit. Die von hinten wie eine unaufhaltsame Welle herandrängenden Höflinge schoben uns unerbittlich weiter in den riesigen Saal, unter dessen hoher, blau gestrichener Balkendecke der Rauch hing – ein Himmel, verborgen hinter Nebelschwaden; die über den schwarzweiß gefliesten Boden gestreuten und längst zertrampelten Binsen bildeten eine glitschige Wiese.
Die Kakophonie war ohrenbetäubend. Die Luft war durchdrungen von der Hitze schmelzenden Wachses, die die vielen in den Ecken angebrachten oder an Ketten über unseren Köpfen aufgehängten Kandelaber ausstrahlten; von Moschusgeruch; von auf nackter Haut aufgetragenem Parfum; von Schweiß, Fett und verschüttetem Wein. Eine Gruppe junger Hofdamen flanierte an uns vorbei. Eine davon, in ihrem dunkelblauen Satinkleid ein durchaus hübsches Ding, warf mir einen unmissverständlichen Blick zu. Und als in meiner Leistengegend wider Erwarten Hitze aufwallte, fiel mir zu meinem Erschrecken ein, dass ich nicht mehr mit einer Frau zusammen gewesen war, seit …
Hastig schaute ich weg. Doch während sie von ihren Gefährtinnen weiter in die Menschenmenge hineingezogen wurde, flüsterte ihr eine der Damen in einer für meine Ohren bestimmten Lautstärke zu: »Er mag ja ganz leidlich aussehen, aber hast du ihn gerochen? Jede Wette, dass er sich seit Wochen nicht gebadet hat! Und wer kommt in einem solchen Zustand schon an den Hof – außer ein Papist?«
Dazu bemerkte Walsingham trocken: »Wir sind jetzt also Papisten, wie?« Auf der Suche nach einem Weg zu dem Podest, das sich über den Saal erhob, sah er sich um. Überall standen dicht gedrängt die Höflinge, allesamt mit Schmuck behängt. Da ich mich schon öfter in diesem Saal befunden hatte, hatte ich eine Ahnung davon, wie es um unsere Aussichten bestellt war, zum Podest zu gelangen. Angesichts unserer ungepflegten Erscheinung bezweifelte ich sehr, dass wir durchkommen würden, ohne von den Wachen ergriffen zu werden.
»Vielleicht sollten wir uns erst einen kleinen Trunk genehmigen«, regte ich an, als ich einen Pagen ein Tablett durch die Menge balancieren sah.
»Wein?«, fauchte Walsingham, als hätte ich vorgeschlagen, über die Themse zu schwimmen. Im nächsten Moment warf er mir seine Tasche zu und stürmte los, sich wie eine Sichel durch die Menge schneidend. Die Leute schimpften und murrten zwar, aber sie wichen aus. Ich folgte ihm mit unserem Gepäck durch die so entstandene Schneise. Flüchtig erhaschte ich links von mir einen Blick der jungen Hofdame von vorhin. Sie zwinkerte mir zu. Ihre Freundinnen stupsten sie kichernd in die Rippen.
Plötzlich verwehrten uns Leibgardisten in grünweißer Livree mit ihren Spießen den Weg, hinter ihnen das große Podest mit dem leeren Thron und dem berühmten, aus Kalkstein von Caen gemauerten Kamin. Elizabeths Günstlinge unter den Adeligen drehten sich um und starrten uns an. Mich befiel ein unbehagliches Gefühl. Männer mit Hakennasen, säuberlich gestutzten Bärten und verächtlich blickenden Augen bauten sich vor mir auf, ehe sie plötzlich auseinandertraten und den Blick auf einen anderen hohen Herrn freigaben, dessen Hand selbstsicher auf der gepolsterten Armlehne des Throns ruhte. Es war kein Geringerer als mein vormaliger Dienstherr, Lord Robert Dudley.
3
Er sah besser aus als erwartet – auch wenn ich nicht mit ihm gerechnet hatte. Ich unterdrückte einen Fluch. Warum hatte ich das nicht bedacht? Er trug ein edles aschgraues Samtgewand, durchsetzt mit elfenbeinfarbener Seide, das an den Ärmeln mit Saatperlen im Muster eines Bären und eines gezackten Stabs bestickt war, dem Wappen seiner Familie. Seine breiten Schultern und die muskulösen Beine, auf die er so stolz war, passten trefflich zueinander; nichts an ihm erinnerte mehr an den abgemagerten Gefangenen, den ich zuletzt im Tower gesehen hatte. Und ohne jede Vorwarnung brandete die lang aufgestaute Wut in mir hoch. Seit ich als Findelkind in die Obhut seiner Familie gekommen war, hatte Dudley sich daran ergötzt, mich zu quälen. Der in seinen Augen auflodernde Hass verriet mir, dass auch er das nicht vergessen hatte.
Er trat einen Schritt vor. »Was«, zischte er, »machst du hier?«
Ich sah ihm fest in die Augen. Durch meine Übungen gestählt, war ich zuversichtlich, dass ich ihm in einem Kampf mehr als gewachsen sein würde. Sein Gebell ängstigte mich schon lange nicht mehr. Doch bevor ich etwas erwidern konnte, sagte Walsingham ehrerbietig: »Mylord mögen mir verzeihen, aber ich wurde von Mylord Cecil hierherbefohlen. Dieser junge Mann ist mein Diener und …«
»Diener?«, knurrte Dudley. »Seit wann ist dieser Köter irgendjemandes Diener? Dazu ist er gar nicht fähig! Beißt in jede Hand, die ihn füttert. Bei Gott, ich habe nicht übel Lust, ihn in einen Sack zu stecken und zu ertränken.« Er machte tatsächlich Anstalten, mit geballten Fäusten vom Podest herabzusteigen, als eine gebieterische Stimme rief: »Mylord, ich muss doch bitten! Diese Herren sind meiner Einladung gefolgt!«
Ich fuhr herum. Zu meiner grenzenlosen Erleichterung erkannte ich Cecil, der nun auf uns zutrat. Im Augenblick hatte ich nicht die geringste Lust auf einen Kampf mit Robert Dudley, doch seiner starren Haltung und dem wütenden Blick in Cecils Richtung nach zu urteilen, hegte ich keinen Zweifel daran, dass ich mich ihm früher oder später würde stellen müssen.
Von seinem zügigen Marsch durch den Saal war Cecil ein wenig außer Atem. Schnell schätzte er uns mit dieser meisterhaften Ungezwungenheit ab, die alles, was er tat, so wirken ließ, als gäbe es keinen besseren Zeitpunkt dafür. Allerdings sah er müde aus. Mittlerweile achtunddreißig Jahre alt, hatte er sich – wie es bei Männern dieses Alters häufig vorkam – ein Bäuchlein zugelegt, zweifellos eine Folge der deftigen Kost, die er auf seinem Landsitz mit seiner ihm ergebenen Gattin, Lady Mildred Cecil, genoss. Sein rostroter Bart dagegen war frei von verräterischem Grau geblieben und sein Gesichtsausdruck nach wie vor aufmerksam.
»Master Walsingham, wir hatten gar nicht so früh mit Euch gerechnet.« Mich begrüßte Cecil nicht, und ich senkte in gespielter Unterwürfigkeit den Kopf. Wie Walsinghams Antwort sogleich bestätigte, war offenbar tatsächlich vereinbart worden, dass ich mich als Diener ausgeben sollte.
»Bitte entschuldigt unser ungelegenes Kommen. Die Reise war kürzer als gedacht, und um die Brücke zu vermeiden, habe ich ein Boot genommen. Aber mein Diener und ich sind im Augenblick ganz gewiss nicht gesellschaftsfähig. Wenn man uns ein Gemach zur Verfügung stellen könnte …?«
Dudley stieß ein Hohnlachen aus und drehte sich mit aristokratischer Jovialität zu den anderen Lords um. »Habt Ihr das gehört, hohe Herren? Ein Gemach hätten sie gerne! Vielleicht sollten wir ihnen auch noch mit feinem Leinen und einem heißen Bad aufwarten, hm?« Sein Wiehern erstarb abrupt, und er wirbelte wieder zu uns herum. »Falls Ihr es noch nicht gehört haben solltet – Ihre Majestät hat erst heute den Thron bestiegen. Leider haben wir gegenwärtig keine Räume zu vergeben. Es sei denn, Ihr möchtet Euch in einer der Hundehütten niederlegen.« Er durchbohrte mich mit seinem höhnischen Blick. »Euer Diener ist sicher mit dergleichen vertraut, hat er doch sein Leben unter Hunden verbracht.«
Ich hielt das Gesicht weiter abgewandt; sonst hätte ich noch meinen Abscheu verraten. Dabei fiel mir auf, dass Cecil es trefflich verstand, seine eigene Abneigung gegen Dudley zu verbergen. Er war vertraut mit dessen herrischer Art und wusste auch, wie tief die Kluft zwischen meinem früheren Dienstherrn und mir war. Doch Dudley war immer noch ein Kindheitsfreund und enger Vertrauter der Königin, und bei seiner Antwort gelang es Cecil anscheinend mühelos, den gebührenden Respekt an den Tag zu legen. »Mylord, uns ist selbstverständlich bekannt, wie wenig Platz gegenwärtig am Hof verfügbar ist. Dennoch bin ich mir sicher, dass Ihrer Majestät daran gelegen ist, unseren Gästen eine angemessene Unterkunft zur Verfügung zu stellen.«
Dudleys Gesicht verfärbte sich rot vor Zorn, doch bevor er eine scharfe Antwort geben konnte, verstummten mit einem Schlag alle Anwesenden im Saal. Gleich darauf lief ein Wispern durch die Reihen der Höflinge. Hastig zupften die Adeligen auf dem Podest ihre Wämser zurecht und verneigten sich. Dudley zeigte indes keine Regung, sondern starrte mich weiterhin hasserfüllt an: ein Blut verheißendes Versprechen, das den Saal um uns herum zu leeren schien, sodass nur noch wir übrig blieben. Mit den Lippen formte er die Worte »Du gehörst mir, Prescott«, dann wandte er sich schwungvoll ab, vollführte eine bis zur Perfektion eingeübte Verneigung und überließ es mir, genau in dem Moment herumzuwirbeln, als die Königin Einzug hielt.
Elizabeths Erscheinen zeigte eine sofortige Wirkung. Jeder Einzelne schien den Atem anzuhalten, als ihre zierliche Gestalt durch eine Welle von Knicksen und Verbeugungen schwebte. Sie trug einen mit Juwelen geschmückten Bisamapfel in der Hand, und eine leichte Röte auf ihren schmalen Wangen betonte ihre Blässe. Bekleidet war sie mit einem Gewand aus Siena-Damast; ihr feuerrotes Haar war geflochten und von einem achatbesetzten Netz gebändigt, das ihren langen alabasterfarbenen Hals betonte. Schön war sie streng genommen nicht – dafür war ihre Stirn zu hoch, die Nase zu markant und das Gesicht zu schmal, doch sie strahlte einen solchen Glanz aus, dass die meisten sie für wunderschön hielten. Ihre bernsteinfarbenen Augen glitzerten mit einer Intensität wie bei einer Löwin, die mich seit jenem Tag vor fünf Jahren in ihren Bann gezogen hatte, als sie mich zum ersten Mal angeblickt hatte. Jetzt, da sie eine Vielzahl von Versuchen, sie einzukerkern oder hinzurichten, überlebt hatte, schien sie das scheinbar Unmögliche vollbracht zu haben und war Königin geworden. Und ich war einer von denjenigen gewesen, die dafür gekämpft hatten, diesen Moment herbeizuführen. Das Herz schwoll mir bei ihrem Anblick, sodass ich zu keiner Regung mehr fähig war, bis eine ihrer rotgoldenen Augenbrauen sich wölbte.
Hastig ließ ich mich auf ein Knie nieder, wenn auch sehr wackelig. Meine unbeholfene Huldigung entlockte ihr ein verstohlenes Lächeln, das sich ebenso schnell auflöste, wie es entstanden war. Im nächsten Moment rauschte sie an mir vorbei, um das Podest zu erklimmen. Ihre Hofdamen eilten hinterher und ließen sich auf gepolsterten Kissen zu ihren Füßen nieder.
Ich wagte einen Blick nach oben zu diesen Frauen. Mit angehaltenem Atem machte ich mich darauf gefasst, Kate in ihrer Mitte zu entdecken. Zu meiner Erleichterung und zugleich auch Enttäuschung befand sich die Frau, die ich liebte und dennoch betrogen hatte, nicht darunter.
Mit einer Handbewegung gestattete Elizabeth allen Anwesenden, sich wieder aufzurichten. An ihrem Ringfinger prangte der Siegelring, den ich zuletzt ihre Schwester Mary hatte tragen sehen. »Feiert weiter«, forderte Elizabeth die Gäste mit leicht heiserer Stimme auf. »Ich werde in Kürze alle empfangen.« Während die Höflinge ihre unterbrochenen Gespräche wiederaufnahmen, wandte Elizabeth ihre Aufmerksamkeit uns zu.
»Nun?« Sie musterte uns nacheinander. »Ich spüre Unfrieden. Möchte mich jemand aufklären?«
Dudley drängte sich vor. »Eure Majestät! Ich ließ Mylord Staatssekretär Cecil gerade wissen, dass wir angesichts des Ranges und der großen Zahl an Personen, die schon jetzt am Hof Unterkunft suchen, nicht auch noch diese … Neuankömmlinge, die sich in seiner Begleitung befinden, unterbringen können.«