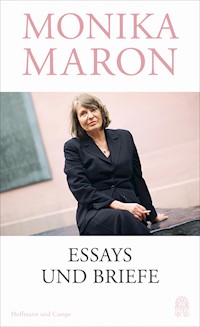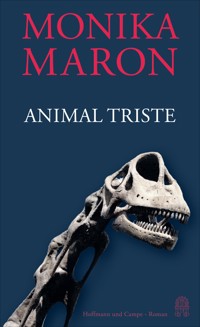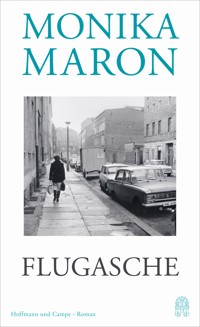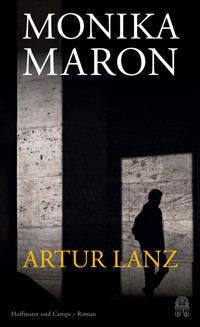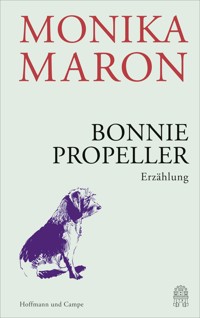10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Historischen Instituts in Ost-Berlin eines Morgens plötzlich ihre Beine nicht mehr spürt, bleibt sie fortan im Bett. Sie geht weder ihrem Berufs- noch Privatleben nach und entzieht sich ihrer "lebenslangen Dienstverpflichtung". Vermisst wird sie nicht, nicht einmal von ihrem langjährigen Partner, den sie erst kürzlich verlassen hat. Gänzlich in die Einsamkeit zurückgezogen lebt sie ausschließlich in ihren Erinnerungen, Träumereien und Fantasien. "In Die Überläuferin wollte ich keinen Unterschied zwischen Traum und Leben machen. Ich will das Wort ,Traum' nicht aussprechen. Es enthält immer eine Art Fluchtgedanken. Stattdessen meine ich einfach das Ausdenken, den Entwurf vom Leben. Im Übrigen ist Literatur sowieso eine Art Traum, das nicht gelebte Leben." Monika Maron
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Monika Maron
Die Überläuferin
Roman
Hoffmann und Campe
Für Wilhelm
Zum dritten Mal war es Nacht, der Mond tanzte auf einem unsichtbaren Seil von einer Straßenseite auf die andere, dafür brauchte er zwei Stunden, das wusste sie aus früheren Nächten. Seit zwei Tagen lag, saß sie im Bett, auf dem Teppich, im Sessel, und es wunderte sie, dass sie seit zwei Tagen weder Hunger verspürte noch Durst noch ein aus der Nahrungsaufnahme resultierendes Bedürfnis. Seit vierundfünfzig Stunden hatte sie nicht geschlafen und war auch jetzt nicht müde. Dabei hätte sie in den letzten Jahren eher über ein unersättliches Schlafbedürfnis, das sich in den Wintermonaten zur Schlafsucht steigerte, klagen können als über durchwachte Nächte. Trotzdem befremdeten sie ihre andauernd wachen Sinne weniger als die allgemeine Bedürfnislosigkeit ihres Körpers, der alle lebenserhaltenden Funktionen zu erfüllen schien, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Selbst der Gedanke an gespickten Rehrücken mit Morchelsoße löste kein Hungergefühl in ihr aus, nicht einmal Appetit. Sie konnte sich ihren Zustand nicht erklären, hoffte nur, er würde anhalten, ohne dass sie darüber zum Skelett abmagerte, da er sie vor sonst unüberwindbaren Hindernissen bewahrte. Niemand musste so für sie einkaufen, kochen, und das Wichtigste: Sie brauchte kaum Geld. Und fast schien es, als könnte sie mit diesem glücklichen Umstand rechnen, denn sie fühlte sich kräftig und gesund, wenn sie von den Beinen absah, die sie gar nicht fühlte, als hätte ihr Körper endlich verstanden, was sie lange schon von ihm gefordert hatte. Immer hatte er sie mit Almosen vertröstet: die Mandeln, die Galle, am Ende sogar eine Niere. Aber nie hatte die Freiheit länger gedauert als einige Wochen, höchstens Monate. Jetzt endlich, glaubte Rosalind, hat er begriffen, dass die lumpigen kleinen Organe, die zu opfern er bereit war, nicht taugten, um ein Entlassungspapier aus lebenslanger Dienstverpflichtung zu erlangen.
Zu den Absonderlichkeiten, die ihr seit drei Tagen widerfuhren, gehörte, dass ihr Telefon in dieser Zeit nicht ein Mal geläutet hatte. Es gab nicht viele Menschen, von denen Rosalind annehmen konnte, dass sie sie schon nach wenigen Tagen vermissen würden. Einer aber war verpflichtet, ihr Fernbleiben zu bemerken: Siegfried Barabas, Vorstand jener historischen Forschungsstätte, der Rosalind vor fünfzehn Jahren als Absolventin zugeteilt worden war und in der sie seitdem, wenn nicht Wochenenden, staatliche Feiertage, Urlaub oder Krankheit sie davon befreiten, um sieben Uhr fünfundvierzig eines jeden Tages zu erscheinen und bis siebzehn Uhr eines jeden Tages zu verbleiben hatte.
Jeden Tag um sieben Uhr fünf derselbe Weg durch die kleine schattige Straße, in der sie wohnte, hinunter bis zur Becherstraße, frühere Breite Straße (Straßen ergeht es mit ihren Namen ähnlich wie den Frauen, sie sind geborene, verheiratete, geschiedene, wieder geborene, je nachdem, welchen Männern oder Regierungen sie gerade angehören). Die Becherstraße fünfzig Meter westwärts bis zur Haltestelle der Straßenbahnlinie sechsundvierzig in Richtung Kupfergraben, dreißig Minuten Fahrt bis zur Weidendammer Brücke, den Schiffbauerdamm entlang neben der mit hohen Wellblechplatten verbarrikadierten Spree. Vor zwei Jahren hatte man die Platten angebracht. Rosalind hatte vom Fenster ihres Arbeitszimmers aus beobachten können, wie der Fluss nach und nach hinter dem grauen Blech verschwand, wohl um ihn vor den Sprüngen Fluchtwilliger zu schützen oder diese vor der Versuchung, die der freie Flug der Möwen, bedenkenlos auf Nahrungssuche zwischen Bodemuseum und Lützowufer, in ihnen hätte wecken können. Den Schiffbauerdamm entlang über die Albrechtstraße, unter der S-Bahn-Brücke hindurch, auf der die Züge in den Westen fuhren, im nächsten Jahrtausend auch für sie, Rosalind, wenn sie nicht vorher gestorben war. Noch einige Schritte bis zu dem schmalen grauen Haus, neben dessen Eingangstür ein gusseisernes Schild seine Zugehörigkeit zu der bedeutendsten Wissenschaftsinstitution des Landes bekundete. Vorbei am Pförtner, einem entgegen dem Ruf seines Berufsstandes freundlichen Mann, der infolge eines Unfalls, bei dem er das rechte Bein verloren hatte, nicht mehr als Lokomotivführer arbeiten konnte, stattdessen nun aus der Pförtnerloge heraussah wie ehemals aus der Lokomotive, einen Arm rechtwinklig über die Brüstung gelehnt, die Augenlider leicht zusammengekniffen, als müssten sie den Fahrtwind abwehren. Zwei Stockwerke hoch über den glatt gebohnerten, an den Rändern schon ausgefransten Linoleumbelag, Frau Petris tadelnder Blick wegen der fünfminütigen Verspätung; Barabas’ neuerliche Änderungswünsche an ihrem letzten Aufsatz. Dann ihr Zimmer, acht Quadratmeter, ab sechzehn Uhr Sonne, Zeitschriften, Karteikarten, die vernagelte Spree, die Schreibmaschine, die Zöllner auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit, die Hunde, von denen man sagte, sie seien blut- und rauschgiftsüchtig, das jeden Tag.
Schon nach einem halben Tag ließ Barabas für gewöhnlich bei erkrankten Mitarbeitern anrufen, um eine Entschuldigung für das unerlaubte Fernbleiben vom Arbeitsplatz einzuholen, undenkbar, dass er in ihrem Fall auf eine solche Auskunft verzichten sollte. Aber sie wollte jetzt nicht an Barabas denken. Was ihr gerade geschah, war zu wunderbar, als dass sie es schon vermischen wollte mit den todlangweiligen Banalitäten ihres bisherigen Alltags, vor denen sie sich geflüchtet hatte. Vielleicht war das Barabassche Institut abgebrannt, und man beklagte sie inzwischen als ein verschüttetes Opfer der Katastrophe, oder sie hatten einfach vergessen, dass es sie gab. Barabas hatte am Dienstag die gepolsterte Tür seines Zimmers geöffnet, während er überlegte, welchen seiner Mitarbeiter er zu sieben Uhr fünfundvierzig zu sich bestellen lassen wollte, und hatte dabei auf Rosalind nicht mehr kommen können, weil sie aus seiner Erinnerung gelöscht war wie ein Programm aus einem Computer.
Nachdem Rosalind von der Haltbarkeit ihres Zustandes überzeugt war, begann sie darüber nachzudenken, wie die unvorstellbare Menge Zeit, die ihr plötzlich zur Verfügung stand, zu verwerten sei. Die erste Überlegung galt dem Begriff, den sie der Zeit zuordnen wollte, von dem auch abhing, wie die Tätigkeit zu benennen wäre, in der sie mit der Zeit verfahren wollte; ob es sich tatsächlich um eine Menge Zeit handelte, die sie so oder so verteilen könnte, bis sie aufgebraucht war; oder ob sie die Zeit als einen Raum ansehen wollte, der angefüllt wurde mit Ereignissen und Gedanken. Es fiel ihr schwer, sich zwischen diesen beiden und, wie ihr schien, einander feindlichen Gesinnungen zu entscheiden. Der verschwenderische und freigiebige Charakter der ersten war ihr sympathisch und entsprach ihrem derzeitigen Bedürfnis nach Verzicht. Zugleich aber erschien es ihr leichtsinnig, wenn eine Person in ihrer Lage das Einzige, was sie besaß: einen Überfluss an Zeit, der Vergesslichkeit überlassen wollte wie ein Baum seine welken Blätter dem Herbstwind. Sinnvoller wäre es, dachte sie, die Zeit als einen bemessenen Raum zu betrachten, in dem sie die Erlebnisse sammeln wollte wie Bücher in einer Bibliothek, ihr jederzeit zugängliche und abrufbare Erinnerungen. Eine einzigartige Möglichkeit, nie mehr etwas hinter sich lassen zu müssen, nie wieder eine Zeit verlassen zu müssen für eine andere. Sie könnte fortan bleiben, während sie fortging, und fortgehen, während sie blieb. Auch vergangene Zeiten könnte sie in diesen Raum denken und mit beliebiger Zukunft zu dauernder Gegenwart verschmelzen. Eine nicht endende Orgie phantastischer Ereignisse stand ihr bevor, ein wunderbares Chaos ohne Ziel und Zweck, sofern die gewohnte Ordnung ihres Gehirns das zuließ.
Beginne ich also mit der ersten Katastrophe meines Lebens, Ursache aller folgenden, in Tragik und Größe der ersten niemals vergleichbar. Nur die letzte, mein Tod, wird, das hoffe ich, der ersten ebenbürtig sein. Meiner Geburt.
Die letzte Nacht vor meiner Geburt verbrachten meine Mutter und ich schon im Krankenhaus. Ich hatte keine Lust zum Geborenwerden und verhielt mich still. Meine Mutter aber, das spürte ich deutlich, wollte mich loswerden. Auch die anderen, nach ihrer barschen Stimme, an die ich mich genau erinnere, waren es die Krankenschwestern, fragten alle halbe Stunde, wie weit es mit mir inzwischen sei und ob ich mich endlich auf den Weg gemacht hätte. Meine Mutter drückte und presste mich mit ihren Muskeln, dass ich hin und her gestoßen wurde, wovon mir eine ausgeprägte Abneigung, eine Phobie geradezu, gegen jede Art von Rempeln und Drängeln verblieben ist. Plötzlich erschrak ich heftig, weil meine Mutter sich heftig erschrocken hatte, und langsam drang auch bis zu mir, gedämpft durch die Membran des mütterlichen Bauches, das mir schon bekannte Geräusch der Sirene. Meine Mutter vertauschte ihren Platz im Bett mit dem darunter. Wir kauerten auf der Erde, und meine Mutter unterließ es jetzt, ihre Muskeln gegen mich einzusetzen. Sie tat mir leid, weil sie so zitterte, wodurch das Wasser, in dem ich hockte, in kleinen aufgeregten Wellen plätscherte, was mir angenehm war. Auch später, in meiner Kinderbadewanne, mochte ich solche Wellen. Mein sanftes, unschuldiges Wohlbefinden wurde jäh gestört durch erdbebengleiche Detonationen, verursacht von Bomben, die links und rechts von uns einschlugen. Meine junge Mutter, so jung, wie ich sie nie in meinem Leben sah, weinte und jammerte, während ich hoffte, so noch in ihrem Schoß sterben zu dürfen und um einen eigenen, kalten, schmerzhaften Tod herumzukommen. Aber meine Mutter schien das Gegenteil zu wünschen. Sofort nach den Detonationen setzte sie ihre feindlichen Muskelbewegungen gegen mich wieder ein, heftiger als zuvor, sodass die Blase davon sprang und mein Lebenswasser auslief. Meine Mutter hockte immer noch unter dem Bett und schrie ängstlich nach den Schwestern angesichts des aus ihr laufenden Wassers, von dem sie, zu jung und unerfahren im Kinderkriegen, nicht wusste, was es damit auf sich hatte. Die Schwestern kamen an unser Bett, fanden uns aber nicht darin, weil wir ja darunter hockten, was die Schwestern nicht sehen konnten, da wegen der Fliegerangriffe das Licht abgeschaltet war. Hier, wimmerte meine Mutter, die sich, inzwischen von heftigem Geburtsschmerz befallen, kaum mehr rühren konnte, hier bin ich. Die Schwestern zerrten uns grob und laut schimpfend unter dem Bett hervor und warfen uns wieder darauf. Mir verging endgültig die Lust zum Geborenwerden, und ich überlegte, wie ich es jetzt, in so fortgeschrittenem Stadium, noch verhindern könnte. Ich legte mir die Nabelschnur um den Hals und hoffte, sie würde mich erdrosseln, während die Mutter mich ausstieß. Als ich in den Strudel geriet, entglitt mir die Schnur, und mir fehlte die Kraft, das Ganze zu wiederholen. Draußen blendete mich die Finsternis, in die ich geboren war, dass ich fast erblindete, und die Sirene gellte Entwarnung über die Reste der Stadt, dass ich sie bis heute höre, wenn es sehr still ist. Ich schrie, so laut ich konnte, um Hilfe. Aber nicht einmal meine Mutter verstand, was ich schrie. Und hätte sie es verstanden, sie hätte mich doch nicht zurückgenommen. Sechs Wochen verzieh ich ihr nicht, dass sie mich geboren hatte, erst danach öffnete ich die Augen und sah sie zum ersten Mal an.
Außer der mangelhaften Lust zu leben haben mir die Umstände meines Geborenwerdens zweierlei hinterlassen: die Unfruchtbarkeit meines Leibes und ein Interesse am Tod, das schon das Befremden meiner Umgebung hervorrief, als ich noch ein Kind war. Mein Vater bezichtigte mich bis zu seinem Tod vor sechs Jahren, ich hätte schon als Vierjährige den Wunsch gehabt, ihn umzubringen, da ich fast täglich darauf bestanden hätte, ihn mittels einer Müllschippe und eines Handfegers zu beerdigen. Krieg und Gefangenschaft hatten ihn für solche Spiele unbrauchbar gemacht, trotzdem hätte er mir sicher verziehen, wären seine Gefühle zu mir nicht gestört gewesen durch den Zweifel, in mir wirklich die Frucht seines Samens zu sehen. Später, als sich an mir ein erblicher Augenfehler seiner Familie zeigte, wurde jeder Zweifel getilgt, aber da war ich schon sechs Jahre alt, und er hatte es verlernt, mich zu lieben. Welche Gründe ich tatsächlich hatte, den Vater täglich zu begraben, erinnere ich nicht. Dass ich seine Abwesenheit gewünscht habe, glaube ich nicht, denn ich war froh, zu den Kindern zu gehören, die über einen Vater verfügten. Damals war der Tod alltäglich. Alle sprachen von Toten wie von Lebenden, was sie gesagt hatten, wessen Eltern oder Kinder sie waren, wie man mit ihnen im Kino war. Onkel Paul war tot, meine Großeltern waren tot, die Tochter vom Kaufmann Kupitzki war tot, weil sie die Stoffballen aus dem brennenden Haus hatte retten wollen, Tante Lotte war gestorben, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Sohn gefallen war. Von allen Toten hatte ich durch Fotografien und Erzählungen ein deutliches Bild, als würde ich sie kennen, und sie wären nur gerade verreist. Tante Lotte, die ich wirklich gekannt hatte, durfte ich Maiglöckchen aufs Grab legen, weil das ihre Lieblingsblumen waren und sie sich darüber freuen würde, wie meine Mutter sagte. Wer sich freuen konnte, lebte, wenn auch unsichtbar wie ein Luftzug. Es wäre mir nicht eingefallen, ein Kind im Spiel sterben zu lassen. Der Tod stand nur den Erwachsenen zu, und nur sie wussten, was er zu bedeuten hatte. Der Vater musste die Hand schlapp über die Sessellehne fallen lassen und durfte sie nicht anspannen, wenn ich sie pendeln ließ. Er musste fühllos sein, bis ich ihn begraben hatte, und erwachen, sobald ich es befahl. Sei tot, wach auf, sei tot, wach auf, wie Schneewittchen und Dornröschen aufgewacht waren. Ich glaube, ich fand Trost in diesem Spiel; der Trost lag in der Widerrufbarkeit des Todes, die ich erhoffte, wie ich vor meiner Geburt schon die Zurücknahme meines Lebens erhofft hatte. Ich wünschte die Auferstehung aller Toten, die ich schon gesehen hatte; die Erinnerung an sie als einen Irrtum, einen korrigierbaren Irrtum aufzuklären, damit ich sie vergessen durfte, die vielen Toten an einem Sonntag im Februar, als wir, meine Mutter und ich, Ida in den Trümmern des Neanderviertels suchten. Meine Mutter trug ihren schwarzen Mantel aus Fohlenfell, den mein Vater ihr aus Paris geschickt hatte, und sie hatte sich, wohl weil Sonntag war, ihre schönen Lippen blutrot gemalt. So fuhren wir, ich auf ihrem Arm, mit der U-Bahn zum Neanderviertel, in dem Ida wohnte und das, wie man im Radio gemeldet hatte, am Tag zuvor bombardiert worden war. Schon im U-Bahn-Schacht quoll uns ein widerlicher unbeschreiblicher Gestank entgegen. Draußen stand ein kalter staubiger Qualm über den zusammengestürzten Häusern, wovon mir übel wurde und meine Augen tränten. Da ich auf den Armen meiner Mutter saß und mein Gesicht in dem schwarzen glatten Fell ihres Mantels vergrub, sah ich zuerst die Leichen nicht, über die wir stiegen. Erst als ich das Beben im Körper meiner Mutter spürte und das Schluchzen hörte, durch das es hervorgerufen war, blickte ich über ihre Schulter auf die leblosen, verrenkten, zum Teil von Trümmern halb verdeckten Körper unter uns. Mehr als die Toten beunruhigte mich das Weinen meiner Mutter. Ida weinte, ich weinte, aber sie weinte nicht, jedenfalls nicht, wenn ich sie dabei hätte sehen können. Erst acht Jahre später erlebte ich zum zweiten Mal, dass sie weinte. Sie kniete vor dem offenen Küchenschrank, um die Kaffeedose herauszuholen, als im Radio »Unsterbliche Opfer« erklang. Der Generalissimus war gestorben. Ich schämte mich, weil ich nicht weinen musste wie meine Mutter, und fragte sie erst am nächsten Tag, ob man bei Staatstrauer Rollschuh laufen dürfe. Meine Mutter stieg in ihren Stiefeln mit den hohen Absätzen vorsichtig über die Leichen hinweg, damit wir nicht stolperten und zwischen sie fielen. Idas Haus gab es nicht mehr, nur noch einen Haufen rosiger Steine über Möbeln und anderen Lebensresten, aus dem hier und da Arme und Beine Verschütteter ragten. Meine Mutter weinte, und ihre Tränen liefen über ihren Mund und mischten sich mit der roten Farbe darauf zu kleinen Rinnsalen, die ihr wie Blut aus den Mundwinkeln flossen. Wat heulstn, du kannst dir wenigstens noch die Lippen anmaln, dit könn die hier nich mehr, sagte ein Mann, der die Leichen von der Straße aufsammelte und sie an einer unzerstörten Hauswand stapelte, zu meiner Mutter. Sie weinte immer heftiger, sodass sie durch die Tränen kaum noch sehen konnte und wir beinahe über die Beine einer toten Frau gefallen wären. Ida ist tot, Ida ist tot, jammerte meine Mutter und suchte an den vielen umherliegenden Füßen nach den roten Skistiefeln, die Ida bei Fliegerangriffen immer anzog, damit sie, falls sie ausgebombt würde, noch etwas Warmes an den Füßen hätte. Wir fanden Idas rote Skistiefel nicht, wir fanden auch Ida nicht. Nach drei Tagen stand sie vor unserer Tür, nachdem man ihre Rauchvergiftung im Krankenhaus notdürftig kuriert hatte. Ida lebte, Ida war nicht tot, Ida wäre beinahe gestorben, es sei ein Wunder, dass sie noch lebte, sagte Ida, sagte meine Mutter, Ida war ein Grenzfall zwischen Leben und Tod. Später vergaßen wir das wieder und gewöhnten uns an Idas geschenktes Leben, bis sie starb, mehr als dreißig Jahre später, da fiel es mir wieder ein, dass es beinahe keine Ida gegeben hätte in meinem Leben. Später, als ich ohne die Vermittlung Erwachsener meine eigene Bekanntschaft mit dem Tod suchte, war das die große Versuchung: auf der Schwelle stehen, ohne sie zu überschreiten. In einer Winternacht, nur mit einem Nachthemd bekleidet, auf dem Balkon hocken und warten, ob die tödliche Lungenentzündung mich anfällt; auf dem U-Bahn-Steig die Zehenspitze über die Bahnsteigkante schieben und wippen, während der Zug einfährt. Hundertmal habe ich mir meinen Tod ausgedacht, mit dem ich meine Eltern strafen wollte.
Als ich dreizehn war, musste ich am Blinddarm operiert werden. Zwei Tage vor meiner Einlieferung ins Krankenhaus sagte ich beim Abendbrot zu meinen Eltern, dass ich mich vor der Operation fürchte. Meine Mutter beruhigte mich, es sei ein harmloser Eingriff, bei dem mir nichts geschehen könne.
Woher willstn das wissen, sagte mein Vater und schlürfte die Bohnensuppe, grüne Bohnen mit Rindfleisch, gibt genug Leute, die daran sterben.
Der wünscht, dass ich tot bin, dachte ich.
Meine Mutter schwieg.
Der Vater schlürfte weiter die Suppe.
Als ich ihm aus der Küche ein Bier holen musste, hörte ich, wie meine Mutter sagte: Musst du ihr solche Angst machen, Herbert.
Ich öffnete die Flasche in der Küche und spuckte in das Bier.
Den Gedanken, die Eltern durch meinen Tod zu strafen, gab ich auf. Seitdem wünschte ich den Tod meines Vaters. Ich habe den Gedanken nie in diesen Worten gedacht, ich wünschte nur seine Abwesenheit. Er soll weg sein, dachte ich; den Rest überließ ich einem gerechten Schicksal, für das ich nicht verantwortlich war. Er lebte noch zwanzig Jahre, und als er starb, habe ich die Unwiderruflichkeit des Todes zum ersten Mal schmerzlich empfunden. Als die Männer ihn aus dem Haus trugen, hielt ich ihnen die zweiflüglige Schwingtür auf, mit jedem Arm einen Flügel, sodass die Träger sich unter meinen ausgestreckten Armen bücken mussten. Während sie sich mühten, die Bahre mit der Leiche durch das Hindernis zu bugsieren, zu dem ausgerechnet ich auf seinem letzten Weg aus diesem Haus geworden war, streifte mich eins seiner kalten, starren Gliedmaßen. Er war im Sitzen gestorben und lag demzufolge, da die Leichenstarre noch nicht von ihm gewichen war, mit vorgestreckten und gekrümmten Armen und Beinen auf der Bahre. Er erinnerte an ein geschlachtetes Tier, das man, an Vorder- und Hinterfüßen zusammengebunden, über eine Stange gehängt hatte. Die Männer hatten ihn in weiße Tücher geschlagen, die durch Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurden. An manchen Stellen klafften die Tücher, und nacktes, von Leichenflecken rosa gefärbtes Fleisch war sichtbar. Ich folgte ihnen bis zum Gartentor, ging ihnen nach auf die Straße, sah zu, wie sie ihn in das Auto schoben, das grau war und auch sonst als Leichenwagen nicht erkennbar. Die Männer verabschiedeten sich mit stummem, ernstem Kopfnicken. Als sie in die Fahrerkabine stiegen, sah ich, wie der Beifahrer das Radio einschaltete. Ich stellte mich in die Mitte des Fahrdamms und sah ihnen nach, bis sie in die Hauptstraße einbogen. Dann war ich sicher: Er war weg. Ich ging zurück ins Haus, langsam, mit ungläubigem Blick auf die veränderten Dinge. Auf dem Weg wird er nicht mehr gehen, die Rose hat er gepflanzt, aber ich werde sie sehen, das Haus hat ihm gehört, und ich werde darin sein. Die Mutter weint um ihn, und ich werde sie trösten. Ich habe gesiegt, dachte ich. Mir blieb die Genugtuung, die Scham darüber und die Gewissheit, dass es so, wie es jetzt war, endgültig bleiben würde, durch nichts mehr zu mildern, jeder Korrektur entzogen, die Antwort war ausgeblieben und konnte nun nicht mehr erfolgen. Ich hätte ihn lieben wollen, bis gestern; heute war er tot.
Dass mein Vater durch meinen Tod nicht zu strafen war, dass ich ihn vielmehr strafte, indem ich lebte, dass ich eine lebende Strafe für den war, der mich gezeugt hatte, minderte nicht mein angeborenes Interesse für den Tod. Je älter ich wurde, umso dringlicher suchte ich seine Nähe, ohne die ich mich wehrlos und ausgeliefert fühlte. Er war meine Garantie für die Vermeidbarkeit von unerträglichem Unglück oder körperlichem Schmerz. Manchmal traf ich mich mit ihm. Wir verabredeten uns auf einem See, im Wald oder bei mir zu Hause. Er kam in verschiedener Gestalt, als Herr in eleganten Kleidern, als behaarter Grobian, auch als Frau ist er gekommen. Ich buhlte um ihn, nackt legte ich mich neben ihn und bot mich ihm an. Er nahm mich nicht. Er durchschaute mich und wusste, ich würde im letzten Augenblick aufspringen und vor ihm davonlaufen. Er aber hätte sich zu erkennen gegeben. Als er sich mir zu erkennen gab, habe ich ihn zu spät erkannt. Mit einem blassrosa Menschenmund lächelte er mich an aus einem Hundegesicht, erhob sich auf die Hinterbeine, legte mir seine Pfoten schwer auf die Schultern und tanzte mit mir, während ich meine Hände tief in sein Fell grub und bei ihm Schutz suchte vor ihm, wie ich als Kind im Schoß meiner Mutter Schutz gesucht hatte vor ihrem Schlag, oder wie ich mich später an den Schultern der Männer zu schützen gesucht hatte vor ihren Insektenforscherblicken, die mir galten. Wir tanzten in wilden Drehungen, bis der Rhythmus meines Herzens einem Trommelwirbel glich und der rasende Kreislauf der Farben mich aus dem Gleichgewicht stürzte. Erst als ich aus meiner Ohnmacht erwachte, erkannte ich ihn. Zum ersten Mal war er mir als mein eigener Tod erschienen.
Zum letzten Mal begegnete ich ihm an Idas Bett. Ein kühler sonniger Tag im September. Auf dem Markt hatte ich für mein letztes Geld Blumen gekauft, dreißig rote Rosen.
Is ja n richtjer Brautstrauß, hatte der Händler gesagt.
Der ist für eine, die stirbt, sagte ich.
Ach, na sowat, sagte der Mann.
Ida lag allein in einem weißen Zimmer, ein Schlauch lief von irgendwo unter ihrer Bettdecke in einen Glasbehälter. Ida röchelte in der Agonie, jeder Atemzug schien sie ihre letzte Kraft zu kosten und Schmerz. Die Rosen stellte ich in einem Uringlas, das die Schwester mir zu diesem Zweck gegeben hatte, auf die Konsole vor dem Spiegel, damit sie sich verdoppelten und damit Ida, falls sie die Augen noch einmal öffnete, sie sehen könnte.
Idas Atem klang unmenschlich wie das eiserne Stampfen einer Maschine. Ich nahm ihre Hand, die heiß war. Ida, sagte ich, vielleicht hörte sie es. Die Rosen stellte ich nach einer Zeit vor das Fenster, sodass ich sie sehen konnte, wenn ich dem Anblick von Idas Gesicht mit der verkrusteten Höhlung, die der Mund war, für einige Sekunden entrinnen wollte. Einmal öffnete sich leise die Tür in meinem Rücken, und die Schwester steckte ihren Kopf durch den Spalt, um zu kontrollieren, ob Ida mit dem Sterben fertig war. Warum kann sie nicht einfach aufhören zu atmen, dachte ich, warum muss der Mensch atmen, wenn es ihn nur noch quält. Streng dich nicht so an, sagte ich zu Ida und streichelte ihren Arm, hab keine Angst und widersprich ihm nicht, er behält doch recht. Sie muss es gehört haben, denn langsam wurde ihre Hand kühler und der Atem ruhiger. Dann waren wir allein in dem Raum, ich und er, und ich sah, wie er Ida endlich, scheinbar sanft, in sich aufsog, während Idas Lunge das Kämpfen aufgab und sich begnügte mit dem, was sie ohne Anstrengung bekam, bis Ida kaum noch atmete, nur hin und wieder noch, und ich von jedem Atemzug glaubte, er sei ihr letzter gewesen. Einer war es dann, ein mattes, erleichtertes Ausatmen nur. Es stimmt, dachte ich, der Mensch haucht sein Leben aus.
Die Schwester fragte, ob ich Idas Sachen gleich mitnehmen könnte, wegen des Platzmangels. Aus Ida war schon die letzte Farbe gewichen. Auch das stimmte: Tote sehen wächsern aus. Erst als ich fragte, ob ich irgendwo eine Zigarette rauchen dürfte, sah die Schwester mich an und führte mich am Ellenbogen aus dem Zimmer. Als ich nach fünf Minuten zurückkam, hatten sie Ida weggefahren. Von den Rosen hätte sie ihr drei aufs Bett gelegt, sagte die Schwester.
Danach habe ich ihn nicht mehr getroffen.
Hier unterbrach Rosalind ihren Gedanken, zum einen, weil eine trunkene Fliege in ziellosen Sturzflügen durch das Zimmer schoss und sie mit ihrem aufdringlich monotonen Dröhnen störte, zum anderen, weil der Gedanke, obgleich sie seinen Ausgangspunkt so weit wie möglich vom Augenblick fortgelegt hatte, immer engere Kreise zog und Rosalind, würde sie ihn so fortdenken, wie sie begonnen hatte, bald vor die Frage stellen würde, warum sie überhaupt noch lebte. Auf die Frage gab es keine Antwort, so viel wusste sie aus früheren Anstrengungen, sie zu finden. Sie lebte, weil sie nicht gestorben war – und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Sie verzichtete darauf, sich der Frage weiter zu nähern.
Sie kauerte in ihrem Sessel, hinter dem Fenster löste der beginnende Tag die grauen Konturen der gegenüberstehenden Häuser zaghaft aus dem Dunkel. Der neue Tag, der sie so wenig anging wie alle neuen Tage, die ihm folgen würden. Sie war frei, das sagte sie sich immer wieder, und trotzdem endeten ihre Gedanken in den gleichen Fragen, in denen sie früher schon geendet waren. Wie sollte sie so schnell auch ein anderes Denken lernen, dachte sie, Denkwege sind wie Straßen, gepflastert oder betoniert, unversehens ging man sie wie gewohnt, suchte bestenfalls eine bisher nicht wahrgenommene Abzweigung oder schlug sich einen kleinen Pfad nach links oder rechts ins Unbekannte. Ihr verzweigtes System aus Haupt- und Nebenstraßen, Gassen und Trampelpfaden, für ihr bisheriges Leben durchaus tauglich, erwies sich nun als Falle, in der sich jeder Gedanke fing. So, dachte Rosalind, würde alle Gegenwart und Zukunft nichts anderes hervorbringen als die ständige Wiederholung der Vergangenheit, was sie nur langweilen würde und ihr nicht helfen konnte. Geheimpfade, Schleichwege, unterirdische Gänge und Gebirgsgrate brauchte sie. Früher hatte sie solche Wege gekannt. Früher, das war so ein Wort; Ida, erzähl mal was von früher; mit ›früher‹ begannen die prosaischen Märchen. Früher lag nicht so weit zurück wie Es war einmal, es war aber auch nicht vorgestern. Also in der Zeit zwischen Es war einmal und vorgestern war Rosalinds Denken geheimnisvolle Wege gegangen, fast so geheimnisvolle wie Marthas Denken. Nur kannte Martha noch Wege durch die Luft, die hatte Rosalind nie gefunden.
Martha traf ich im Sommer vor fünfzehn Jahren. Die Stadt war verlassen. Ich hatte nicht gewusst, wohin ich hätte verreisen sollen, und war zu Hause geblieben. Abends ging ich manchmal in das Café unweit meiner Wohnung, in der Hoffnung, doch noch einen Bekannten zu finden. Immer, wenn ich an das Café kam, saß an einem der abseits stehenden Tische eine junge Frau. Obwohl sie von auffälliger Schönheit war, saß sie immer allein. Sie war sehr zart, hatte dunkle, von schweren Lidern halb verdeckte Augen und fast schwarzes Haar. Vielleicht kamen ihre Vorfahren oder kam sie selbst aus einem südlich gelegenen Land. Wegen ihres fremdländischen Äußeren und wegen ihrer Einsamkeit nannte ich sie für mich die Fremde.
Zuweilen glaubte ich, aus der Richtung des Mädchens ein hastiges, unverständliches Flüstern zu hören. Ich hätte sie gern angesprochen: Guten Tag, wer sind Sie und warum sind Sie so allein. Aber ich wagte es nicht. Die ungewisse Befürchtung, eine Grenze zu überschreiten oder ein heimliches Gesetz zu verletzen, hielt mich zurück. Auch keiner der übrigen Gäste durchbrach die Einsamkeit der Fremden, und es gelang mir nicht herauszufinden, ob die Fremde ihr Alleinsein wünschte oder ob sie dazu verurteilt war.
Einmal träumte ich von ihr. Wir saßen in einem Lokal, das einem Supermarkt ähnelte und in dessen Mitte sich ein Schwimmbecken befand. Die Fremde und ich saßen einander gegenüber und lächelten uns zu. Ich möchte auch einen Kaffee, sagte die Fremde. Als der Ober kam und den Kaffee brachte, war sie verschwunden. Ich entdeckte sie im Schwimmbecken, wo sie, immer noch lächelnd, einen Kreis schwamm. Danach kam sie an den Tisch zurück. Wieder saßen wir stumm einander gegenüber, bis ich fragte: Wie heißt du. Die Fremde lächelte nervös. Ach ja, sagte sie, stand auf und ging fast schwebend auf das Schwimmbecken zu. Noch zweimal ging sie und kam zurück. Sobald ich ein Gespräch mit ihr beginnen wollte, erhob sie sich still und verschwand in dem grünen Wasser. Nach dem dritten Mal kam sie nicht wieder. Ich suchte sie zwischen den Tischen und zwischen den Schwimmern. Sie blieb verschwunden.
Nach dem Traum beschloss ich, sie anzusprechen. Ich fürchtete, der Traum könnte eine Bedeutung haben und die Fremde könnte sich eines Tages in Erinnerung auflösen wie der Traum, und ich würde nie erfahren, wer sie war und warum ich mich ihr so verwandt fühlte.
Am Abend setzte ich mich an ihren Tisch, ohne vorher gefragt zu haben, ob es ihr recht sei.
Guten Abend, sagte ich.
Guten Abend, sagte sie, ohne mich anzusehen.
Ich heiße Rosalind.
Die Fremde hob den Kopf. Ich kenne Sie nicht, sagte sie.
Ich habe von Ihnen geträumt, sagte ich.
Sie betrachtete mich neugierig. Es ist schön, dass ich Sie nicht kenne. Ich kenne die meisten hier.
Warum sind Sie dann immer allein.
Sie musterte mich, als müsste sie erst entscheiden, ob sie eine so wichtige Auskunft erteilen wollte. Dabei zog sie mit dem rechten Zeigefinger die Linien in ihrem linken Handteller nach.
Ich sprech nicht mehr gern, sagte sie und dehnte das letzte Wort so, dass die Unvollständigkeit des Satzes erkennbar wurde.
Warum nicht, fragte ich.