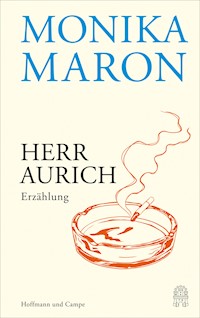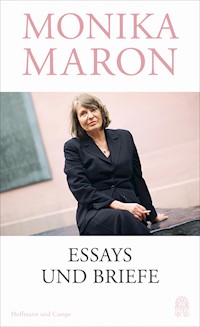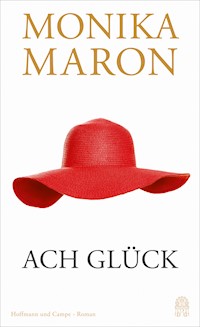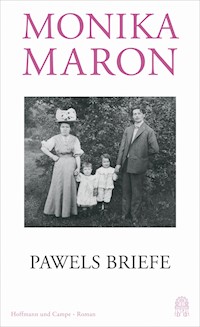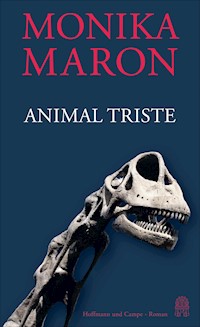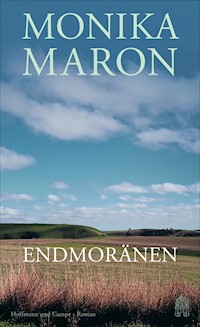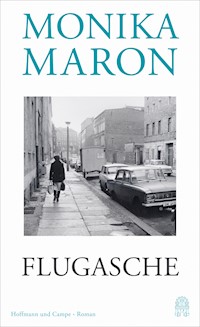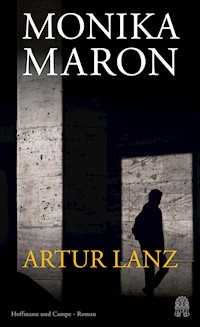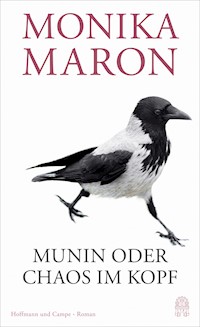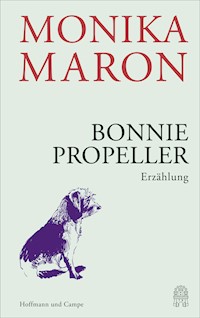10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Am Tag von Olgas Beerdigung verschwimmt die Welt vor Ruths Augen zu einem impressionistischen Gemälde, sie verfährt sich auf dem Weg zum Friedhof und strandet stattdessen in einem abgelegenen Park. Ruth, die einmal für eine kurze Zeit Olgas Schwiegertochter war und die durch eine alte Schuld belastet ist, erscheinen an diesem seltsamen Ort die Toten und die Lebenden. Während die Wirklichkeit zunehmend verschwimmt, erlebt Ruth mit Olga an ihrer Seite einen Tag, an dem Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Ähnliche
Monika Maron
Zwischenspiel
Roman
Hoffmann und Campe
Für Antje †
und für Wilhelm
Obwohl ich mich an den Traum nicht erinnern konnte, hinterließ er in mir ein bedrückendes Gefühl, das jeden Gedanken oder auch nur einen ziellosen Blick aus dem Fenster verdunkelte, ohne dass ich einen Zusammenhang herstellen konnte zwischen Traum und Wachsein. Jeder Versuch, mich dem Traumgeschehen zu nähern und ihm wenigstens einen Erinnerungsfetzen zu entreißen, verjagte es erst recht in hoffnungslose Ferne. Nur ein dumpfes Unbehagen blieb, das irgendein unaufklärbares nächtliches Geschehen in mir hinterlassen hatte.
Vielleicht war der Traum ja nur ein Vorgriff auf den Tag gewesen, den ich zwar im Kalender schwarz eingerahmt, dem Gedanken daran aber keine konkrete Gestalt gegönnt hatte. Nur die Blumen hatte ich rechtzeitig bestellt, weiße Rosen mit einer kleinen weißen Schleife: In Liebe, Ruth.
Der Regen der Nacht dampfte über dem Straßenpflaster, und ein gelblich grauer Himmel warf sein Licht wie einen Schleier über Häuser und Bäume.
Wetter.de versprach einen trockenen Tag und Temperaturen um die zwanzig Grad. Ich suchte nach passender Kleidung, entschied mich für einen leichten dunkelgrauen Anzug und flache Schuhe. Zu Beerdigungen ging ich nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ oder wenn ich glaubte, den Toten müsse meine Abwesenheit kränken. Auch wenn ich nicht an ein Leben nach dem Tod glaubte, stellte ich mir dann vor, der oder die Gestorbene sei auf geheimnisvolle Weise anwesend, suche Kinder, Enkelkinder und Freunde, finde mich nicht unter ihnen und müsse nachträglich an meiner Zuneigung zweifeln. Ich hatte lange überlegt, ob ich zu Olgas Beerdigung gehen solle, und letztlich war es dieser kleine Rest von lächerlicher Unsicherheit, der meine Entscheidung bestimmt hatte.
In der letzten Zeit hatten wir nur noch miteinander telefoniert, Olga und ich. Am Dienstag nach Ostern hatte ich sie endlich besuchen wollen, aber dann rief Olga an und sagte, sie fühle sich nicht wohl und dass wir unser Treffen lieber verschieben sollten. Und nun war Olga tot.
Ich suchte bei Google Maps die Fahrtroute zum Friedhof am östlichen Stadtrand und las noch einmal den Text der Traueranzeige; Gott sei Dank haben sie nicht geschrieben »plötzlich und unerwartet …«, dachte ich. Niemand stirbt unerwartet, wenn er fast neunzig ist. Zwar auch nicht erwartet, immerhin hatten wir uns für den Dienstag nach Ostern verabredet, aber Olga fühlte sich nicht wohl. Und wenn man sich mit neunzig nicht wohlfühlt, kann das schon den Tod bedeuten. Das hätte ich bedenken sollen.
Beim Frühstück las ich die Zeitung von gestern. Ich las immer die Zeitung von gestern, weil ich für gewöhnlich frühstückte, bevor ich duschte und mich ankleidete, und nicht im Bademantel aus der vierten Etage zu den Briefkästen ins Erdgeschoss fahren wollte und wieder hinauf und weil ich die neuesten Nachrichten ohnehin nicht aus der Zeitung erfuhr, sondern aus dem Radio oder dem Fernsehen und weil es darum egal war, ob ich die Zeitung von gestern oder heute las. Früher hatte ich vom Aufstehen bis zum Verlassen des Hauses anderthalb Stunden gebraucht, inzwischen waren es zweieinhalb. Wenn ich wie üblich um neun Uhr in meinem Büro im Museum sein wollte, musste ich um sechs Uhr aufstehen. Olgas Beerdigung war um elf Uhr angesetzt. Ich war trotzdem wie jeden Morgen um sechs Uhr erwacht, noch ehe der Wecker klingelte, direkt aus meinem Traum. Der Traum. Für einen kurzen Augenblick war er plötzlich zum Greifen nah, nur ein Gefühl, kein Bild, und dann wieder nichts. Vielleicht hatte ich vom Tod geträumt, dachte ich, so ein dunkles Nichts kann nur der Tod sein.
Ich überflog die Überschriften auf der Seite für Vermischtes: Vorbeatmung gestoppt, las ich und überlegte, was Vorbeatmung sein könnte, las noch einmal: Verbeamtung gestoppt, gut. Und jemand hatte sein Baby aus dem Fenster geworfen, das war kein Lesefehler. Im Feuilleton fand ich einen ausführlichen Bericht über einen spektakulären Kunstfälscherprozess, gab die Lektüre aber schon nach dem ersten Absatz auf, weil mir die Schrift vor den Augen verschwamm, als würden die Buchstaben Schatten werfen. Ich putzte die Brille, setzte mich dichter ans Fenster, es half nichts, ein mir bis dahin unbekannter Defekt meiner Augen machte das Lesen so anstrengend, dass mir davon schwindlig wurde. Vielleicht der Kreislauf, dachte ich, riss die Seite raus und hob sie auf für später. Ich war nervös. Außer Olga hatte ich seit fast zwanzig Jahren niemanden von der Familie mehr gesehen, auch Bernhard nicht, vor allem Bernhard nicht.
Als Fanny mir vor fünf oder sechs Jahren zum ersten Mal von ihrem Besuch bei Bernhard erzählte, hatte ich, ohne nachzudenken, gefragt: Was wolltest du denn da? Fanny zog die Augenbrauen hoch, reckte kampfbereit ihren schmalen Hals und sagte: Er ist mein Vater. Danach hatte ich meine Tochter nicht mehr nach Bernhard gefragt. Ich nahm es hin, dass für Fanny der Vater wichtiger war als sein Verrat. Es ging mich nichts an. Natürlich ging es mich etwas an, denn ich allein hatte Bernhard zu Fannys Vater werden lassen. Aber das war in einem anderen Leben passiert, an das ich mich kaum erinnern konnte. Nur Olga und Fanny hatte ich aus diesem Leben mitgenommen. Bernhards Mutter und Bernhards Tochter, aber Bernhard selbst hatte ich vergessen. Ich wusste, dass ich drei Jahre mit ihm gelebt hatte, an unsere Wohnung erinnerte ich mich genau, zwei große sonnige Zimmer in einem heruntergekommenen Haus in der Wörther Straße, ich wusste, wie Bernhard aussah, damals, und dass er Gitarre spielte; viel mehr nicht. Er lag in meinem Gedächtnis irgendwo archiviert, vergraben unter Späterem, das auch vergraben war unter noch Späterem, eine Erinnerungsleiche, farblos, geruchlos, kalt. Dass er der Vater meines einzigen Kindes war, sah ich als eine emotionsfreie Tatsache an, der ich nur für den Fall einer eines Tages vielleicht notwendigen Knochenmark- oder Organspende für meine Tochter Bedeutung zumaß. Ich hatte von Bernhard niemals Geld oder Verantwortung für Fanny verlangt, nachdem ich ihn verlassen hatte. Wenn ich mit dem Kind ohne seinen Vater leben wollte, musste ich auch allein dafür sorgen. So jedenfalls erklärte ich mir und anderen damals meinen Verzicht.
Seit einer Woche, seit ich wusste, dass ich Bernhard an Olgas Grab treffen würde, rumorte es in den Verliesen meiner verbannten Erinnerungen. Ungebeten tauchten Bilder auf, Andy mit einem Verband um den kleinen Kopf, mit dem er vom Fahrrad gegen die Kühlerhaube eines Lastwagens gestürzt war und sich dabei den Schädel aufgeschlagen hatte. Frontalhirnsyndrom, eine Schädigung des vorderen Stirnhirns. Mit blindem Blick lag er in seinem Bett, eine Nadel in dem weichen Handrücken, durch die eine Nährlösung in den kleinen Körper floss.
Andy war Bernhards Sohn, den er kurz nach dem Abitur mit einer drei Jahre älteren Kellnerin, die außerdem Gedichte schrieb, gezeugt hatte. Das Kind lebte bei seiner Mutter, an den Wochenenden brachte sie es oft zu Bernhard, der noch bei seinen Eltern wohnte. Für Olga war Andy wie ein dritter, nicht mehr erwarteter Sohn. Madeleine, so hieß die Mutter, ließ ihn immer öfter auch während der Woche bei Olga, bis sie ihn eines Tages überhaupt nicht abholte und tagelang nicht erreichbar war. Nach einer Woche rief sie an, sie sei in Westberlin, mehr könne sie nicht sagen, es tue ihr alles furchtbar leid, aber Andy sei bei Olga und Bernhard bestimmt besser aufgehoben. Andy blieb bei Olga, auch als Bernhard eine eigene Wohnung bekam. Später, als Bernhard und ich zusammenzogen, wollte Andy bei seinen Großeltern bleiben. Damals lebte Hermann noch.
Nach Andys Unfall zog Olga zu ihm ins Krankenhaus, fütterte ihn, wusch ihn, las ihm Geschichten vor. Als er aus dem Koma erwachte, brachte sie ihm wieder das Laufen und Sprechen bei, sie massierte seine verkrampften Hände, ließ sich von der Physiotherapeutin einweisen, turnte mit ihm. Vier Monate lang half sie ihrem Enkelsohn zurück ins Leben. Als sie mit ihm wieder nach Hause kam, war sie mager und entkräftet.
Fanny war noch nicht einmal ein halbes Jahr alt, als Bernhard erklärte, Andy werde künftig bei uns leben, er werde nie wieder sein wie vor dem Unfall, seine Mutter schaffe das nicht mehr. Auf dem Wohnungsamt, wo wir eine größere Wohnung beantragten, sagte man uns, dass unverheiratete Paare keinen Anspruch auf eine gemeinsame Wohnung hätten. Beim Standesamt bekamen wir einen Termin in vier Wochen. Zwei Wochen vor der Hochzeit nahm jemand mich mit zu einer Haschischparty. Ein Typ aus Westberlin hatte Stoff für zehn Personen über die Grenze geschmuggelt und gab einen Einführungskurs in die Kunst des Haschischrauchens. Er zeigte uns, wie man die Zigarette richtig halten musste, und hatte die passende Musik mitgebracht, ich wusste nicht mehr, welche. Wir lagen nebeneinander auf Kissen und Decken und überließen uns erwartungsvoll dem Rausch. Allmählich versanken das Zimmer, die Menschen, nur die Musik schloss einen Raum um uns, und ich sah in der Ferne eine Lawine von gewaltiger Größe, ein weißes, von Schneestaub umnebeltes Monster, das lautlos auf mich zuraste, bis es mächtig und gefräßig über mir hing und mich im nächsten Augenblick verschlingen würde. Noch ehe das Licht wieder eingeschaltet und das Experiment für beendet erklärt wurde, wusste ich, dass ich gerade gesehen hatte, was ich seit Wochen fühlte und nicht einmal mir selbst einzugestehen wagte: Etwas raste auf mich zu, das mich unter sich begraben würde, das ich fürchtete, wovor ich davonlaufen musste, so schnell ich konnte.
Bernhard war auf einer Dienstreise in Sachsen oder Thüringen. Ich rief am nächsten Morgen beim Standesamt an und sagte die Hochzeit ab. Aufgeschoben oder aufgehoben?, fragte die Frau. Aufgehoben, sagte ich.
Als ich mit Fanny auszog, war die Narbe über Andys Stirn schon wieder von Haaren verdeckt. Aber in meiner Erinnerung hockte er schweigend im Krankenbett, um den zerbrochenen Schädel den dicken Verband, der nur Augen, Nase und Mund frei ließ, ein sechsjähriger Junge, vor dem ich geflohen war.
An Olgas Grab würde ich wahrscheinlich auch Andy treffen, er war jetzt einundvierzig, sechs Jahre älter als Fanny. Zum letzten Mal hatte ich ihn bei Olgas fünfundsechzigstem Geburtstag gesehen. Er saß die ganze Zeit neben Olga mit seitlich hängendem Kopf, als könne der die Mitte nicht finden, sprach wenig, nur wenn er noch ein Stück Kuchen verlangte, meldete er sich energisch und schien sich sonst für das Geschehen ringsum kaum zu interessieren. Aber immer, wenn ich an ihn denken musste, was selten vorkam, saß er stumm und mit weißem Mull umwickeltem Kopf in meinem Erinnerungskeller.
Damals war ich mir monströs vorgekommen, herzlos, gemein, niederträchtig. Den Mann mit seinem kranken Kind verlassen; einfach abhauen mit dem gemeinsamen Kind; das Schicksal hochmütig verweigern, das war nicht erlaubt. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich Bernhard die abgesagte Hochzeit erklärt hatte, wie ich ihm überhaupt mitgeteilt hatte, dass ich nicht zuständig sein konnte für seinen Sohn, der mehr Pflege brauchte als Fanny, ich aber Fannys Mutter war, nur Fannys Mutter, und dass ich ihn, Bernhard, nicht genug liebte, um auch die Mutter seines Sohnes zu sein. Irgendwie muss ich es ihm gesagt haben. Es fiel mir schwer, mir diese Szene als ICH vorzustellen. Ich will dieses Leben nicht, das mir plötzlich angetragen wird. Ich habe andere Pläne mit mir und meinem Kind. Ich gehe und dreh mich nicht um. So muss es ja gewesen sein. Das hatte ich getan, obwohl es mir vorkam, als sei nicht ich es gewesen, sondern eine Ruth, die es nicht mehr gab und deren Schuld mit ihrem Verschwinden getilgt war und der ich nachträglich dankbar sein musste für ihre tapfere Herzlosigkeit.
Im vergangenen Jahr war ich sechzig geworden. Von meinen engen Freunden war noch niemand gestorben, aber im weiteren Bekanntenkreis mehrten sich die Todesfälle. Eigentlich hatte ich nicht das Gefühl, dass es schon Zeit sei für ein Lebensresümee, aber an Tagen wie diesem drängten sich diese sinnlosen Fragen nach dem Woher und Warum ungebeten in meine ziellosen, noch immer von dem unheilvollen Traum befangenen Gedanken. Was ist so ein Ich eigentlich, dachte ich, wenn dem alten Ich das junge so fremd ist, als gehöre es gar nicht zu ihm. Wo bleiben die ganzen Ichs überhaupt, die man in seinem Leben war und denen man das letzte immerhin verdankt? Das Problem ist, dass man nicht als der Mensch die Welt verlässt, als der man auf die Welt gekommen ist, dachte ich, verwarf den Gedanken aber gleich wieder, weil ich mich fragte, ob nicht vielleicht das Kind, das ich einmal war, mir von allen bisherigen Ichs am vertrautesten geblieben war. An das Kind konnte ich mich gut erinnern, besser als an alle folgenden Ichs, obwohl es zeitlich am weitesten entfernt war. Die Angst vor dem dunklen Treppenhaus, wenn das Licht nicht funktionierte, das Glück, als ich zum ersten Mal im Zirkus war, der Kummer wegen der untreuen Freundin, die Gerüche aus den Fenstern im Hof, das Fell eines kleinen Hundes unter der Hand, das waren warme Erinnerungen. Das Kind ist unser Urwesen, so wie der Urmensch der Ursprung des Menschen ist, unser unverwüstlicher Kern im Stammhirn, im Hypothalamus und im limbischen System. Den Steinzeit- und Bronzemenschen haben wir vergessen, über die Antike und Renaissance wissen wir nur, was wir gelesen haben, aber den Urmenschen können wir nie vergessen, er lebt in uns. So wie das Kind. Der Gedanke gefiel mir. Es wäre ja auch möglich, dass wir das eine Ich vergessen müssen, wenn wir ein anderes geworden sind, dass wir es als kalte Daten und Fakten bewahren, alles andere aber vergessen, weil wir sonst verrückt würden. Vielleicht sind die seltsamen Geschichten über multiple Persönlichkeiten, von denen es in amerikanischen Filmen vor einigen Jahren nur so wimmelte, vielleicht sind das alles nur Geschichten über Leute, die sich von ihren Ichs nicht trennen konnten und in denen dann alle möglichen Stimmen durcheinanderredeten. Sogar für die einfache Schizophrenie wäre die Überlegung, ob es sich dabei um eine missglückte zwanghafte Ich-Bewahrung handeln könne, möglicherweise sinnvoll.
Das Telefon unterbrach mich in meinen anthropologischen Mutmaßungen. Fanny wollte wissen, ob wir gemeinsam zum Friedhof fahren sollten.
Ich hätte hinterher einen wichtigen Termin und brauchte mein Auto, sagte ich.
Wir verabredeten uns vor dem Friedhof. Ich hatte keinen Termin, wollte aber von Fanny, die sicher nach dem Begräbnis mit der Familie zum Essen oder Kaffeetrinken gehen würde, nicht abhängig sein.
Auch als Mutter hat man wenigstens zwei Ichs, dachte ich, wahrscheinlich sogar drei oder vier, das vierte kannte ich noch nicht. Am Anfang war das Wunder, wenn auch das gewöhnlichste Wunder der Welt, an dem jede Maus, jede Katze, eben jedes Säugetier, vorausgesetzt, es war weiblich, teilhaben konnte. In mir war auf eine biologisch erklärbare und trotzdem nicht zu begreifende Weise etwas gewachsen, das an einem Tag noch ganz zu mir gehörte, in meinem ungeheuren Bauch, und am anderen Tag ein eigener Mensch war. Darüber zu sprechen war müßig, weil es an jedem Tag weltweit viel zu oft passierte, und das schon seit Tausenden von Jahren. Trotzdem blieb es ein Wunder, jedenfalls für jede, der es widerfuhr. Das erste Mutter-Ich lebt im Zustand des reinen Glücks, das mit jedem Tag vollkommener wird, denn das Objekt seiner Liebe erhebt es mit wachsender Bewusstheit ins Göttliche, zur Quelle allen Glücks. Und wer das unersetzbare Glück eines anderen ist, vergisst die Fragen nach dem Sinn seines Daseins; er, in diesem Fall sie, hat ihn gefunden, wenigstens für zehn, vielleicht elf Jahre, bis das Kind zu ahnen beginnt, dass die Mutter nur über den allerkleinsten Teil des Glücks in der Welt verfügt, dass sie manchem Glück sogar im Wege steht. Vielleicht denkt das Kind auch hin und wieder, mit einer anderen Mutter wäre es ihm besser ergangen. Ganz allmählich schuf es sich einen mutterfreien Raum. Zum Glück der Kinder flüchten die meisten der entthronten Mütter in ein Doppelleben. Ihr erstes Mutter-Ich leben sie in der Erinnerung fort und nähren daraus ihre Kraft, die Zurückweisungen, Kränkungen und Schuldsprüche der folgenden Jahrzehnte zu ertragen. Viele schaffen sich Hunde an.
Vielleicht ergeht es den Vätern ähnlich, aber von Vätern verstand ich nichts, ich hatte keinen, jedenfalls nicht lange. Mein Vater war gestorben, als ich vier Jahre alt war. Er kam mit einer durchlöcherten Lunge aus russischer Gefangenschaft, zeugte mit letzter Kraft ein Kind, saß dann noch fünf Jahre in dem grünen Sessel am Fenster im Wohnzimmer und kämpfte mit jedem Atemzug um sein Leben. Ich erinnerte mich an den röchelnden Mann im Sessel wie an einen Fremden, Unberührbaren, nichts sonst, kein Lächeln, kein Spiel, kein Lied. Er war doch schon viel zu schwach, hatte meine Mutter gesagt. Nach dem Tod des Vaters blieben wir fünf Jahre allein, die Mutter und ich. Das war die Zeit, in der ich mich in der Erinnerung als ein unbeschwertes, lachendes Kind sah: die Ausflüge mit den Freundinnen der Mutter und deren Kindern oder die Abende, wenn die Mutter mir vorlas, selbst als ich schon lesen konnte, oder wenn wir beim Abwaschen alberne Lieder sangen, »wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Heinrich, lieber Heinrich«. Dass der Mutter dieses vollkommene Glück nicht ausreichte, sondern dass sie einen fremden Mann in unser beider Leben holen musste, um selbst glücklich zu sein, kam für mich damals der Vertreibung aus dem Paradies gleich. Ich war zehn Jahre alt, als der Genosse Keller mit ein paar Umzugskisten und zwei klobigen Ledersesseln bei uns einzog, und achtzehn Jahre und zehn Tage, als ich selbst mit zwei Koffern und meinem Bettzeug auszog.
Meine Mutter war dem natürlichen Ende des reinen Glücks zuvorgekommen. Nur dass es ausgerechnet der Genosse Keller sein musste, blieb in dem Verhältnis zwischen Mutter und Tochter eine nicht heilende Wunde, auch wenn wir am Ende nicht mehr darüber sprachen. Selbst wenn die Mutter anderen anwesenden Personen Episoden aus ihrem Leben erzählte und die Erwähnung des Genossen Keller sich dabei nicht vermeiden ließ, nannte sie seinen Namen so nebenher, als hoffte sie, ihre Tochter würde ihn überhören.
Ich war schon über vierzig, als ich es mir endgültig versagte, meine Mutter mit den immer gleichen Fragen zu quälen. Ich erinnerte mich an einen Sonntagnachmittag, wahrscheinlich war es Winter. Durch die Fenster drang die letzte Dämmerung. Das Licht der Stehlampe neben der Couch fiel auf das in sich gekehrte Gesicht meiner Mutter. Nach dem Essen am Sonntag legte der Genosse Keller sich für gewöhnlich hin und schlief zwei, manchmal auch drei Stunden. Das war die Zeit für uns beide, seit ich ausgezogen war. Auch Fanny war endlich eingeschlafen. Wir tranken Kaffee, dazu zwei oder drei Gläser Kognak, sprachen über Alltägliches, ich erzählte von der Chagall-Ausstellung, die ich gerade vorbereitete, die Mutter von ihrem Dauerzwist mit Doro, ihrer Chefin in der Presseagentur. Wie sie unter dieser zwei Zentner schweren Stalinistin überhaupt arbeiten könne, fragte ich, worauf die Mutter sagte, dass Doros zwei Zentner nichts zu tun hätten mit ihrer politischen Überzeugung, die sich übrigens von ihrer eigenen nicht grundsätzlich unterscheide, und dass Doro auch keine Stalinistin sei, sondern eine Kommunistin, die Schweres durchgemacht habe, was auch ihre gelegentliche Unberechenbarkeit entschuldige.
Ich war davon überzeugt, dass meine Mutter, liebte sie nicht aus unbegreiflichen Gründen ausgerechnet Eduard Keller, diesen Sekretär in höheren Diensten, es unter Doro keine vier Wochen ausgehalten hätte, dass sie vermutlich überhaupt nicht in dieser Presseagentur gelandet wäre, sondern eher in der Zeitschrift »Der Hund« oder in einem Kochbuchverlag, wo sie ihren eigentlich gut funktionierenden Verstand hätte behalten dürfen.