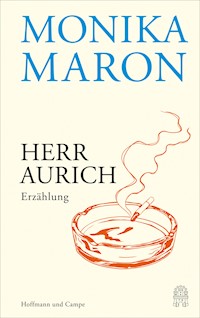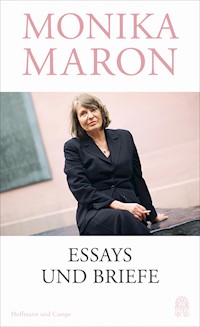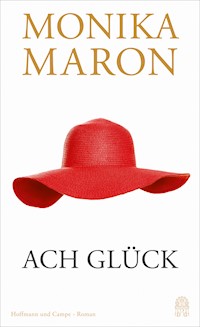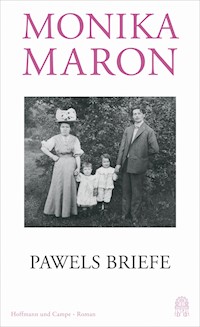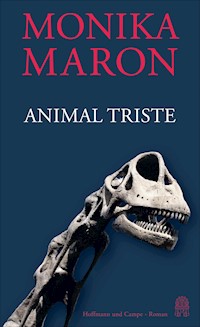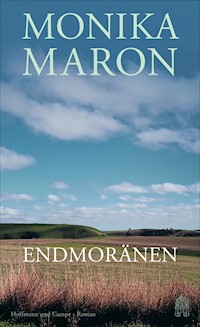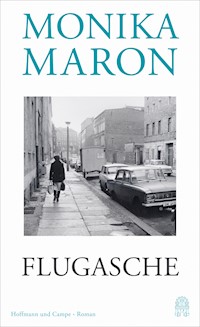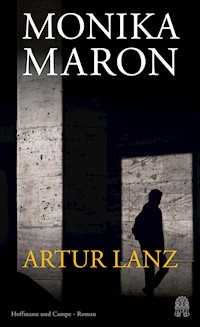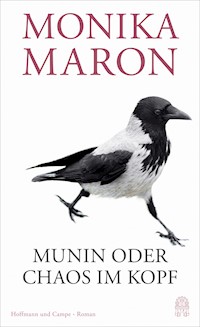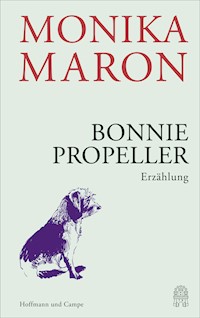19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der neue Roman von Monika Maron! Katharina, Tierärztin im Ruhestand, erbt ein abgelegenes Gutshaus nordöstlich von Berlin. Schnell ist die Idee geboren, dort eine Kommune mit Freunden einzurichten, um den steigenden Mietpreisen in Berlin zu entfliehen und im Alter nicht allein zu sein. Bei Eva, Katharinas Freundin, sträubt sich zunächst alles gegen die Vorstellung, mit Menschen jenseits der Sechzig zusammenzuziehen. Doch dann lässt sie sich notgedrungen auf das Experiment ein und akzeptiert einen Neuanfang. Das Haus ist ein ebenso ergreifender wie weiser Gesellschaftsroman, in dem Monika Maron universelle Themen des Lebens, der Liebe und des Alters neu verhandelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Ähnliche
Monika Maron
Das Haus
Roman
Hoffmann und Campe
Für Ursula
1
Ich wollte in das Haus nicht einziehen. Schon im Winter hatte Katharina mir von ihrer unverhofften Erbschaft erzählt, ein großes, komplett renoviertes Gutshaus hundert Kilometer nördlich von Berlin, das ihr Vetter Edwin ihr aus nur zu vermutenden Gründen hinterlassen hatte und damit zugleich die schwierige Frage, was sie mit dieser Erbschaft anfangen sollte.
Ich riet ihr, das Haus zu verkaufen, aber Katharina meinte, in dieser gottverlassenen Gegend bekäme man höchstens ein Zehntel dessen, was der Vetter in das Haus schon investiert hätte. Sie erwog, eine Pension für Fahrradtouristen zu eröffnen oder, was ihr Vetter geplant hatte, einen Aufenthaltsort für Künstler, wofür er das Haus eigens umgestaltet hatte mit Bädern an jedem Zimmer oder Apartment und einer großen Küche mit mehreren Kochstellen. Aber weder verspürte sie die Neigung, eine Fahrradpension zu führen, noch ein Künstlerparadies, und so blieb dieses Thema wochenlang Gespräch im Freundeskreis, was aber immer wieder nur zu den gleichen Vorschlägen führte, weil die Möglichkeiten auch an drei Fingern abzuzählen waren und die vierte, Katharina könnte allein in dieses Haus mit zehn oder fünfzehn Zimmern ziehen, absurd war.
Katharina kannte ich, seit ich mir vor zwanzig Jahren meinen ersten Hund angeschafft hatte. Sie arbeitete in der Tierarztpraxis in meiner Nähe, der Hund war infolge einer Borreliose oft krank, und mir gefiel, wie Katharina mit ihm umging, entschlossen, aber niemals grob, wie sie sich freuen konnte an den Eigenarten eines Hundes, auch wenn sie ihr die Arbeit erschwerten. Es sei furchtbar für sie, sagte sie einmal, dass alle Tiere sich vor ihr fürchteten, obwohl sie die Hunde wie die Katzen, sogar die Meerschweinchen liebe und ihnen ja auch nur Gutes tue. Ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, dass wir uns befreundeten. Wir gingen manchmal miteinander ins Kino, einmal reisten wir gemeinsam nach Sizilien, weil wir herausgefunden hatten, dass wir beide Sizilien liebten. Inzwischen fiel Katharina mir immer als Erste ein, wenn ich etwas Erfreuliches oder Unerfreuliches zu erzählen hatte, sogar noch vor Sylvie, die ich viel länger kannte.
Es war Anfang Februar bei Sylvies achtundsechzigstem Geburtstag, als morgens zwischen drei und vier wieder einmal die Rede auf Katharinas grandiose Immobilie kam. Wir waren nur noch zu fünft oder sechst, der engste Kreis eben, als Sylvie meinte, wir könnten doch alle zusammen da einziehen. Ich rief gleich: um Gottes willen, aber Sylvie war von ihrem Vorschlag so entzückt, dass sie uns mit vom Alkohol befeuerter Begeisterung ein gemeinsames Leben in einem Schloss auszumalen begann, was mich umso mehr abschreckte. Katharina sah ernst von einer zur anderen und sagte dann mit einem Blick zu mir, den ich als Frage verstand, daran hätte sie auch schon gedacht. Eigentlich sei das sogar ein alter Traum von ihr, für den sie irgendwann nur der Mut verlassen hätte.
Ich beteuerte noch einmal, dass für mich so eine späte, wenn auch luxuriöse Wohngemeinschaft nicht infrage käme, Sylvie jubelte, in dem Gesicht von Michael Jahnke, dessen Freund vor einem Jahr an einem Aneurysma gestorben war, glaubte ich etwas zu erkennen, das Neugier, vielleicht sogar Hoffnung hätte sein können, und Katharinas Gesicht sah ich an, dass in ihr schon die ersten Pläne keimten.
Von diesem Tag an arbeiteten Sylvie und Katharina an dem großen Vorhaben Bossin und fuhren fast an jedem Wochenende mit ausgewählten Kandidaten über Land. Offenbar gestaltete sich das Zusammenfügen einer Gemeinschaft, die sowohl erwünscht als auch willig war, schwieriger als erhofft, was weder Sylvies noch Katharinas Enthusiasmus bremste. Sylvie hatte einen Traum und Katharina einen Plan. Und wenn Katharina einen Plan hatte, entfaltete auch der sinnvollste Zweifel an seiner Realisierung die gegenteilige Wirkung, indem er Katharina nur animierte, nach neuen Wegen und Umwegen zu suchen, um ans Ziel zu gelangen. Wie die Geschichte mit der alten Dogge, deren Besitzer nach einem Unfall und einer misslungenen Operation für unbestimmte Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen war und den Hund nicht behalten konnte. Katharina versprach ihm, einen geeigneten Nachfolger zu finden, bei dem die Dogge die zwei oder drei Jahre, die sie noch zu leben hatte, glücklich sein würde. Aber es fand sich niemand, der dieses riesige Tier aufnehmen wollte oder konnte. Am Ende beschloss Katharina, die den Hund schon als Welpen gekannt hat und der es unmöglich war, ihr Versprechen zu brechen, den Hund selbst zu behalten. Sie nahm ihn mit in die Praxis, wo er in einem hinteren Raum ein komfortables Bett bekam, stellte einen Studenten an, der zweimal am Tag den Hund, der schon an leichter Inkontinenz litt, zum Ausgang in der Praxis abholte, ging morgens und abends selbst mit ihm spazieren, bis er nach zwei Jahren starb. Sie gab zu, dass es eine Strapaze war, aber sie hatte sich nun einmal vorgenommen, den armen Hund zu retten.
Noch im Mai standen nur Katharina, Sylvie und Michael Jahnke als zukünftige Bewohner des Hauses fest. Manche Interessenten hatten sich wieder zurückgezogen, andere waren von der Idee begeistert, besaßen aber selbst Anwesen auf dem Land oder ererbte Villen in Berlin, die sie einem Zimmer in einer Kommune vorzogen.
Katharina beschloss, den Kreis der Kandidaten zu erweitern und lud zur Besichtigung des Hauses eine größere Gesellschaft ein, zu der auch Personen gehörten, die man nur mit gutem Willen als erweiterten Freundeskreis bezeichnen konnte. Diesmal fuhr ich mit, um wenigstens einmal gesehen zu haben, wovon Sylvie und Katharina träumten.
Das Haus war schöner, als ich es mir nach den Fotos vorgestellt hatte, ein lang gezogener Bau mit schmucklosen Säulen links und rechts der Treppe, die zu dem überdachten Eingang führten, die in der oberen Etage symmetrisch angeordneten Fenster ließen auf ausreichende Zimmer schließen, darüber drei Gaubenfenster, die wie schläfrige Augen aus dem Dach in die Landschaft blickten.
Nach der Besichtigung des Hauses lud Katharina zu einem kleinen Umtrunk im Garten ein. Wir standen im gleißenden Sonnenschein auf der großen Wiese vor dem Haus, der Wind wehte den süßlichen Duft des Flieders herüber, an der Eingangstür hatte jemand, wahrscheinlich Sylvie, einen Strauß bunter Luftballons angebracht, wie vor Geschäften, die neu eröffneten oder für eine Sonderaktion warben.
Ich konnte mir durchaus vorstellen, mein großstädtisches Leben gegen ein Leben in diesem Prachtbau zu tauschen, vorausgesetzt, ich hätte darin eine eigene Wohnung mit wenigstens drei Zimmern für mich allein und außer mir wohnten darin höchstens noch Katharina und Sylvie.
Ich kannte kaum jemanden von den Leuten, die das Haus und den Garten inspizierten, darunter auch ein jüngeres Paar, das Hand in Hand herumspazierte, an dem eigentlichen Anlass des Treffens aber kaum Interesse zeigte. Hin und wieder winkten sie den beiden Kindern, die kreischend und juchzend über die Wiese tobten. Eltern und Kinder waren hell und anmutig gekleidet wie für ein Sommerfest und sahen nicht aus, als träumten sie von einem Leben auf dem Dorf.
Um Katharina hatte sich eine kleine Gruppe möglicher Interessenten versammelt, von denen ich nur das Ehepaar Müller kannte, sie pensionierte Lehrerin für Deutsch und Geschichte, er emeritierter Althistoriker. Amadeus Müller war ein renommierter Wissenschaftler, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass er eine Landkommune für sich ernsthaft in Erwägung zog. Allerdings erzählte man sich, er hätte vor einiger Zeit einen Schlaganfall erlitten, was auch erklärte, warum er sich auf einen eleganten ebenholzfarbenen Stock mit Silberknauf stützte. Und wer wusste, welche Schäden er sonst noch davongetragen hatte. Jedenfalls schienen die Müllers sich ernsthaft nach den Räumlichkeiten zu erkundigen, denn Katharina wies ein paarmal in Richtung der rechten Ecke des Hauses, wo im Erdgeschoss eine kleine, komfortable Wohnung lag, die der Vetter wohl für sich selbst vorgesehen hatte. Katharina hatte nach kurzem Überlegen darauf verzichtet, weil sie sich in der künftigen Gemeinschaft keine privilegierte Position anmaßen wollte, nur weil ihr das Haus gehörte. Das würde von Anfang an alles in eine Schieflage bringen, sagte sie.
Ich goss mir noch etwas von dem Chardonnay ein, den Katharina in einer großen Kühltasche auf dem Eingangsportal abgestellt hatte, setzte mich auf die oberste Stufe und versuchte herauszufinden, wer von den geladenen Personen Katharinas Einladung annehmen könnte. Sylvie lief mit einer Weinflasche zwischen den Gästen herum und füllte die Gläser nach. Hinter mir hüpften die Kinder und versuchten, sich ein paar Luftballons aus dem Bündel zu erobern. Marianne Jansen half ihnen dabei, setzte sich dann neben mich, zündete sich eine Zigarette an, nahm einen tiefen Zug und atmete dann mit einer Entschlossenheit aus, die offenbar dem Satz galt, den sie mir mitteilen wollte:
Ich glaube, ich mache das.
Was?
Ich ziehe hier ein. Und du?
Du kennst mich doch, natürlich nicht.
Marianne, von ihren Freunden Mary genannt, hatte eine kleine Buchhandlung, fünf Minuten von meiner Wohnung entfernt, wo ich seit jeher meine Bücher kaufte. Dreißig Jahre hatte sie das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann betrieben, bis Martin vor drei Jahren plötzlich gestorben war. Er hatte sie am Nachmittag im Laden ablösen sollen, weil sie einen Zahnarzttermin hatte, und als er nicht kam, auch nicht ans Telefon ging, schloss sie den Laden ab und ging nach Hause. Da fand sie ihn auf dem Fußboden vor dem Bett, tot.
Zwei Wochen danach öffnete sie die Buchhandlung wieder, stellte bald eine junge Frau ein, das Geschäft lief weiter wie zuvor, die Stammkundschaft blieb ihr treu, und trotzdem war für jeden spürbar, dass die zuweilen manische Leidenschaft, mit der Mary ihren Kunden die Bücher nahelegte, von denen sie überzeugt war, dass gerade dieser Mann oder diese Frau oder dieses Kind sie unbedingt lesen müssten, mit Martin entschwunden war.
Dabei war Mary berühmt für ihre magische Fähigkeit, an Mimik, Gestik, Stimme und Kleidung zu erkennen, welches Buch für welchen Menschen das richtige war. Und wenn sie fand, dieser Mensch hätte sich für ein Buch entschieden, das sie für das nicht gemäße hielt, fragte sie manchmal: Ach, wollen Sie das verschenken? Und gerade diese außergewöhnliche Fähigkeit, die ihr die größte Lust an ihrem Beruf bereitet hatte, war ihr verloren gegangen. Ohne Martin bin ich nur noch halb, sagte sie. Ihr magisches Talent hat wohl zur verlorenen Hälfte gehört.
Und was machst du mit dem Laden, fragte ich.
Den würde Nele übernehmen, die Neue, du weißt. Ich überlege ja schon lange, ob ich den Laden verkaufen soll. Es macht keine Freude mehr ohne Martin. Dreißig Jahre, von Anfang an, war das unser Leben. Ich sehe ihn immer noch auf der Leiter stehen und Bücher ins Regal sortieren und will ihn immer noch fragen, welche Titel wir auf den Tresen legen sollen. Er fehlt jeden Tag, es ist nicht mehr dasselbe. Und hier ist alles neu, sagte sie, zog an der Zigarette, lachte kurz, es klang rau. Den ganzen Tag von anderen Menschen umgeben sein bin ich ja gewöhnt, besser als ganz allein.
Sie saß, den rechten Arm um ihre Knie geschlungen, in der linken Hand die Zigarette, neben mir auf den Stufen, klein und dünn wie ein Mädchen, und sah ziellos über die Wiese in die maigrünen Kronen der Bäume, als suchte sie da ihre Zukunft.
Ich kannte Mary seit fast dreißig Jahren, zuerst nur, weil ich meine Bücher bei ihr kaufte. Eines Tages bekam ich den Auftrag, ein Feature über Buchhandlungen zu machen und interviewte dafür auch Mary und Martin. Die beiden müssen Anfang dreißig gewesen sein. Ich versuchte mich zu erinnern, wie Mary damals ausgesehen hat, aber ihr junges Gesicht war überlagert von allen ihren Gesichtern danach. Genau so erging es mir sogar mit meinem eigenen Gesicht, wenn ich unter meinem Spiegelbild nach den vergangenen Gesichtern suchte. Die fand ich nur auf Fotos, von denen sie mich freundlich oder trotzig ansahen wie eine mir sehr vertraute Person, die aber nicht ich war, obwohl ich natürlich wusste, dass sie ich war, jedenfalls gewesen war. Auch wenn ich versuchte zu ergründen, warum ich vor dreißig oder vierzig Jahren etwas getan, gedacht und entschieden habe, fand ich nicht mehr heraus, ob es nicht längst meine Bearbeitung der Ereignisse in den dazwischenliegenden Jahren war, ob ich die Erinnerungen nicht meinem veränderten Verständnis der Menschen und der Welt im Allgemeinen und meines Lebens im Besonderen angepasst hatte. Aber schließlich waren wir im Leben da gelandet, wo wir heute waren, und Mary wollte in das Haus einziehen und ich nicht.
Mary legte ihre Hand auf meine Schulter, aber nur, um sich beim Aufstehen darauf zu stützen. Sie winkte Katharina und hob dabei den Zeigefinger wie jemand, der etwas melden wollte. Die beiden liefen aufeinander zu, und kurz darauf umarmten sie sich lachend. Und die Müllers schüttelten Katharina beim Abschied so lange die Hand, dass es nach einem Vertragsabschluss aussah. Auch das junge Paar mit den Kindern, offenbar die Müller’sche Familie, verabschiedete sich auffallend herzlich und machte einen zufriedenen Eindruck.
Ich fuhr mit Katharina wieder nach Berlin. Wir sprachen über das Haus, Katharina schwärmte von der kargen, aber doch reizvollen Landschaft, dem traumhaften Himmel und dem schönen Park.
Siehst du, es wird doch, sagte sie, die Buchhändlerin hat fest zugesagt und Amadeus Müller so gut wie. Er ist reizend und bestimmt ein intellektueller Gewinn. Ich glaube, es kann großartig werden.
Na ja, sagte ich.
Was hätte ich ihr auch sonst sagen können. Dass ihr Haus nur eine Verlockung war für Menschen, die sich vor dem einsamen Alter fürchteten wie Mary? Oder für Menschen mit Schlaganfall wie Amadeus Müller, dessen Frau rechtzeitig dafür sorgte, dass nicht sie allein die Last tragen musste? Und dass ich genau darum nicht in das Haus einziehen wollte?
Na ja, sagte ich noch einmal.
2
Elf Monate später zog ich in das Haus ein, und das nicht, weil ich ein kollektives Hinleben auf Siechtum und Tod inzwischen verlockend fand, sondern weil unausweichliche Umstände mich zwangen, meine Wohnung aufzugeben. Unser Hausbesitzer war schon vor einiger Zeit gestorben, inzwischen hatten die Erben das Haus verkauft, Eigentümer und Wohnungsverwaltung wechselten und präsentierten sofort eine Mieterhöhung und die Ankündigung von Modernisierungsmaßnahmen einschließlich eines Ausbaus des Dachbodens zu komfortablem Wohnraum. Ich wohnte in der vierten Etage. Im Februar begann über mir an jedem Morgen um acht ein wuchtiges Hämmern und Krachen, dass ich dachte, jeden Augenblick müsste die Decke einstürzen. Nach den ersten groben Abrissarbeiten wurde es etwas ruhiger, dafür stand eines Tages meine Küche unter Wasser, weil wohl jemand ein funktionierendes Rohr für ein stillgelegtes gehalten hatte. Der Ausbau würde vermutlich zwei Jahre dauern, wurde uns mitgeteilt. Zwei Jahre, dazu eine Miete, die schon jetzt höher war, als ich mir eigentlich leisten konnte. Ich wollte raus aus dieser Hölle, so schnell wie möglich. Eine in Preis und Zustand annehmbare Wohnung zu finden würde schwer werden, dazu die Kündigungsfrist von drei Monaten. Ich rief Katharina an, zwei Zimmer waren noch zu vergeben, ich brauchte nur eins. Ich kündigte die Wohnung, mietete einen Speicherraum für Hausrat und Möbel und zog mit Bett, Schreibtisch, zwei Sesseln, einem kleinen Couchtisch und drei Bücherkisten in das Haus. Natürlich nur vorübergehend, sagte ich zu Katharina, bis ich was Passendes gefunden habe.
Eine Woche vor meinem Umzug hatte Katharina mir eine Mail geschrieben:
Liebe Eva,
Du glaubst nicht, wie ich mich auf Dich freue. Erinnerst Du Dich an unsere Fahrt von Bossin nach Berlin am Tag meiner Hauspräsentation? Ich habe Dir von unserer Zukunft in Bossin vorgeschwärmt, und Du hast mir mit Deinem unvergesslichen Na ja geantwortet. Daran habe ich oft gedacht, denn wir mussten uns alle erst an die neuen Umstände, vor allem aber aneinander gewöhnen. Es ist eben ein Unterschied, ob man sich besucht oder miteinander lebt, auch wenn jeder seine eigene kleine Wohnung hat. Sylvie hat sich unser Leben hier wahrscheinlich aufregender vorgestellt, vermutlich hat sie an ihre studentische Wohngemeinschaft gedacht, als sie sich ein gemeinsames Leben in diesem Haus vorstellte. Mary und Michael, die beide der Tod ihrer Partner verbindet, unternehmen viel miteinander. Sylvie ist im Winter ziemlich oft nach Berlin gefahren, wahrscheinlich hat sie Dich auch besucht und Dir selbst schon berichtet. Seit zwei Monaten haben wir einen Neuzugang, Johannes Bertram. Ich weiß nicht, ob Du Dich an ihn erinnerst. Er ist ein alter Freund von mir noch aus meiner Dresdener Zeit, dessen zwanzig Jahre jüngere Frau in Liebe zu einem wiederum einige Jahre jüngeren bulgarischen Arzt verfallen ist. Nun wohnt er erst einmal hier und hofft, dass die Sache sich irgendwie erledigt und er in sein gewohntes Leben zurückkehren kann.
Ich habe noch viel zu tun, um unsere Angelegenheiten hier zu organisieren. Wir mussten lange suchen, um eine Putzfrau für das große Haus zu finden. Am Ende habe ich in der Zeitung inseriert, worauf sich drei polnische Frauen gemeldet haben, Polen ist ja nur zehn Kilometer entfernt. Jetzt teilen sich zwei die Arbeit, und wir sind sehr zufrieden. Unser Kontakt zu den Einheimischen ist noch nicht weit gediehen. Gott sei Dank ist es Frühling, man sieht die Leute wieder öfter in ihren Gärten, und wir lernen uns allmählich besser kennen. Das alles schreibe ich Dir, damit Du weißt, was Dich erwartet. Illusionen machst Du Dir sowieso nicht, das weiß ich. Aber glaub mir, das Leben fernab der städtischen Aufgeregtheit ist ein Gewinn. Der große Himmel, das Blühen und Vergehen, selbst der bösartige Wind verändern den Blick auf fast alles, auch auf sich selbst. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass wir dieses Abenteuer gewagt haben.
Bis nächste Woche also!
In freudiger Erwartung
Deine Katharina
Bis auf die Ankunft des Neulings, an den ich mich, falls ich ihn schon einmal kennengelernt haben sollte, nicht erinnerte, enthielt Katharinas Nachricht für mich nichts Überraschendes. Schlimmer als die Torturen, denen ich in meiner Wohnung ausgesetzt war, konnte es sowieso nicht werden. Im April ließ ich mich also samt meinem spärlichen Mobiliar von dem hilfsbereiten Sohn eines Freundes in einem geliehenen Transporter nach Bossin chauffieren. Katharina und Sylvie standen schon auf den Stufen vor dem Haus, als wir vorfuhren. Sylvie hatte ihre Vorliebe für extravagante Mode offenbar der neuen Umgebung angepasst und sah aus, als hätte sie ihre Garderobe in einem Katalog für englische Landhausmode bestellt: eine doppelreihig geknöpfte karierte Weste über einem farblich passenden Rollkragenpullover, dazu dunkelbraune Hosen, die kurz über den eleganten Schnürstiefelchen endeten. Auch ihre blonden Locken umrahmten wie immer ein bisschen wild, aber perfekt frisiert ihr Katzengesicht.
Katharina hatte einen jungen Mann aus der dörflichen Nachbarschaft organisiert, der beim Entladen der Möbel half. Nachdem mein Zimmer, das einen schönen Ausblick auf den Park bot, notdürftig eingerichtet und sogar das Bett bezogen war, bestanden Sylvie und Katharina auf einem Rundgang durch das Haus und die Gärten, die sie schon im vorigen Sommer angelegt hätten. Die anderen Bewohner seien gerade unterwegs, die Müllers hätten sich zur Nachmittagsruhe zurückgezogen, die würde ich erst am Abend treffen, sodass wir nur die Gemeinschaftsräume besichtigen könnten. Die Bibliothek war der größte Raum mit vier Sitzecken. Sessel, Sofas und Lampen zeugten von unterschiedlichem Geschmack. Drei Bauhausklassiker in schwarzem Leder und Chrom und ein samtbezogener und kordelverzierter Ohrensessel standen dicht nebeneinander und verbreiteten einen sehr gemütlichen Eindruck.
Sieht ein bisschen bunt aus, sagte Sylvie, was eben jeder so übrig hatte.
Nur mit der Anordnung der Bücher hätten sie ein Problem gehabt und sich am Ende dafür entschieden, dass jeder sein eigenes Regal bekommt. Natürlich könne jeder bei jedem ausleihen und müsse das nur in ein Heft eintragen. Amadeus Müller hätte seine Fachliteratur allerdings in seiner eigenen Wohnung untergebracht.
Durch eine schlichte zweiflügelige Tür mit der Bibliothek verbunden, schloss sich der Speiseraum an, in dessen Mitte ein langer, sehr eleganter Tisch aus glänzendem Nussbaum mit schwarz lackierten Beinen stand, dazu zehn passende Stühle mit hellem Bezug. An der Stirnseite des Raums prangte eine dekorative Anrichte, darauf eine Espressomaschine und die dazugehörigen Tassen.
Diese luxuriöse Ausstattung verdanken wir den Müllers, erklärte Katharina, bis auf die Espressomaschine, die war unsere erste gemeinsame Anschaffung.
Ich stellte mir vor, wie ich hier jeden Morgen mit Sylvie, Mary, Michael Jahnke, Katharinas Dresdener Freund und vielleicht sogar mit den Müllers frühstücken würde. Kollektive Lebensmodelle überforderten mich, selbst meine Ehen waren an meinen Kompatibilitätsdefiziten gescheitert. Aber ich hatte schon in Berlin beschlossen, mich angesichts meiner Notlage derartigen Aversionen und Vorurteilen keinesfalls hinzugeben, sondern was immer mich hier erwartete, mit Gefallen zu betrachten, und falls mir das nicht gelingen sollte, dann wenigstens mit Interesse.
Und kocht ihr gemeinsam, fragte ich.
Geht nicht, sagte Sylvie, Müllers sind Vegetarier, er wohl nicht ganz freiwillig, und Michael Jahnke hat eine Fischallergie wegen der Parmaluine.
Parvalbumine, korrigierte Katharina, die sitzen im weißen Muskelfleisch von Fischen. Thunfisch könnte er essen, aber den gibt es hier nicht, außerdem ist er zu teuer. Meistens kochen Sylvie und ich zusammen, und manchmal laden wir noch jemanden ein, wie es gerade passt.
Ich hätte das Haus lieber selbst erkundet, ohne mich zu der gelungenen oder weniger gelungenen Einrichtung äußern zu müssen, und nutzte darum unser Gespräch über die Essgewohnheiten, um bescheiden darauf hinzuweisen, dass ich seit dem Frühstück nichts gegessen hätte und außerdem unbedingt eine Zigarette rauchen müsse.
Sylvie bot an, die Linsensuppe von gestern für mich zu wärmen, und Katharina führte mich in ein abgelegenes, aber geräumiges Zimmer mit Fenstern nach zwei Seiten, das für verschiedene Zwecke möbliert war. Zwei Sofas, ein Schreibtisch, zwei kleine Tische, an denen man auch essen konnte, ein Schrank mit Gläsern aller Art.
Unser Rauchersalon, sagte Katharina, im eigenen Zimmer kann man natürlich auch rauchen. Aber eigentlich gibt es nur mit Gerlinde ein Problem.
Gerlinde?
Gerlinde Müller, sagte Katharina in einem Ton, der vermuten ließ, dass es mit Gerlinde noch andere Probleme gab.
Außer der Linsensuppe brachte Sylvie eine Flasche Rotwein, wir verschoben die Besichtigung des Gartens auf den nächsten Tag und freuten uns über das Wiedersehen, redeten viel durcheinander über gemeinsame Freunde, irgendeinen Film, den wir alle gesehen hatten, über Sylvies schicke Schnürstiefelchen oder erregten uns wieder einmal über die neuesten Spracherfindungen, denen man wehrlos ausgesetzt war. Eigentlich war es wie immer, und trotzdem kamen mir meine Freundinnen auf schwer zu beschreibende Weise verändert vor. Vielleicht lag es nur daran, dass ich sie lange nicht gesehen hatte oder an Sylvies britischem Landkostüm. Auch Katharina in Jeans und Lederjacke war ein eher ungewohntes Bild. Aber es war mehr als das, sie kamen mir zugleich jünger und älter vor, jedenfalls hatte ich ein jüngeres Bild von ihnen im Kopf, als es die erbarmungslose Nachmittagssonne, die durch die westlichen Fenster fiel, nun zeichnete. Die zahllosen Fältchen um Mund und Augen, die wie eine Schraffur auch schon die Wangen durchzogen. Zugleich aber erschienen sie mir verjüngt in ihrer Art, sich zu bewegen und zu sprechen; beweglicher, bedenkenloser, mir fiel kein passendes Wort dafür ein. Vielleicht bildete ich mir das auch ein, und es lag nur daran, dass sie ihr Leben in eine andere Landschaft verpflanzt hatten und darin eben ein ungewohntes Bild abgaben, was in Zukunft dann auch für mich gelten könnte. Aber nach den Strapazen, die der Umzug und die Wohnungsauflösung mir abverlangt hatten, war ich froh, endlich hier zu sein, den Frühling zu genießen und diese himmelhohe Stille, durch die nur hin und wieder ein fernes Geräusch drang.
Wir waren schon bei der zweiten Flasche Wein, als Sylvie plötzlich aufsprang, gegen das Fenster klopfte und mit heftigen Gesten jemandem bedeutete, zu uns zu stoßen.
Johannes kommt gerade von seiner Radtour, sagte sie.
Als Johannes Bertram den Raum betrat, erinnerte ich mich gleich an ihn. Auf einem von Katharinas Festen hatte ich sogar lange mit ihm gesprochen, ich wusste nicht mehr worüber, und seinen Namen hatte ich vergessen, aber seine melancholische Freundlichkeit, die ihm ins Gesicht geschrieben war, hatte bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er war ein hochgewachsener Mann, wobei er Schultern und Kopf beim Gehen leicht gebeugt hielt, wie ich es schon oft bei großen Menschen beobachtet hatte. Entweder war ihre Größe ihnen peinlich oder es hatte sich zur Körperhaltung fixiert, dass sie sich ihren Gesprächspartnern meistens von oben nach unten zuneigen mussten. Johannes schüttelte mir lange die Hand. Er freue sich, dass ich nun zu ihrer Gemeinschaft gestoßen sei, wenn auch die Umstände, die dazu geführt hätten, natürlich weniger erfreulich seien.
Es blieb unklar, ob er damit auch seine eigenen Umstände meinte. Ich versicherte ihm, dass die Freude ganz meinerseits sei, was auch der Wahrheit entsprach, nicht nur, weil ich mir von ihm eine interessante Gesellschaft versprach, sondern auch, weil er die männliche Fraktion im Haus verstärkte, die ohne ihn nur aus Michael Jahnke und einem lädierten Althistoriker bestanden hätte.
Johannes Bertram fuhr sich durch das vom Wind zerzauste Haar, das zwar fast weiß, aber für sein Alter ungewöhnlich üppig war.
Es ist eben doch ein Unterschied, sagte er, ob ich zu Hause auf meinem Hometrainer vor mich hin radele oder hier durch die Frühlingslandschaft. Erinnerungen an fast vergessene Gefühle steigen da in einem auf.
Ein leichter Anklang des sächsischen Dialekts gab seiner Sprache etwas Weiches, Verbindliches, das, wie ich fand, seine ganze Erscheinung, die gebeugten Schultern und den etwas melancholischen Gesichtsausdruck zu bestätigen schien.
Erinnerung an Gefühle, das ist schön, sagte Katharina, so geht es mir hier auch, ich erinnere mich an Gefühle, unabhängig von den Ereignissen. Wenn ich durch die Landschaft laufe, diese endlosen Felder, rundum alles so grenzenlos, dann fühle ich mich manchmal, wie ich glaube, dass ich mich sehr viel früher mal gefühlt habe.
Also, du meinst, du fühlst dich jung, fragte ich, verwundert über Katharinas Schwärmerei.
Natürlich nicht, es ist wie eine emotionale Fata Morgana, herübergeweht aus einer anderen Zeit, nur die Erinnerung an ein Gefühl eben.
Sylvie sah von Katharina zu Johannes, schüttelte den Kopf, für sie klinge das eher wie eine Nahtod-Erfahrung.
Es muss ja nicht gleich der Tod sein, sagte Katharina, aber Gefühle verändern sich im Laufe des Lebens, wie sich auch die Vorstellungen von Glück verändern. In der Jugend zielt alles in die Unendlichkeit, und jedes Gefühl ist mit Hoffnung verbunden: die Hoffnung auf die große Liebe, Erfolg im Beruf, auf Kinder, Wohlstand, alles gilt absolut, und alles scheint erreichbar. Und dann endet die große Liebe, die Ehe wird vielleicht geschieden, das Kind pendelt zwischen Vater und Mutter, und der Erfolg im Beruf erweist sich als endlich. In unserem Alter hat das Wort unendlich sowieso nur noch eine fatale Bedeutung. Ich muss, wenn ich an die Zukunft denke, doch etwas anderes fühlen als vor vierzig Jahren.
Ich habe schon immer verwundert oder auch neidvoll zugehört, wenn andere von ihrer Jugend sprachen. Ich erinnerte mich an meine Jugend nicht gern, und woran ich mich überhaupt erinnerte, gefiel mir nicht, ich selbst gefiel mir nicht. Ich hielt es auch nicht für erstrebenswert, meine jugendlichen Gefühle zu beleben.
Was fühlt ihr denn, wenn ihr euch an vergessene Gefühle erinnert, fragte ich.
Johannes Bertram senkte den Kopf und sah aus, als wollte er sein Geheimnis für sich behalten. Katharina suchte die Antwort mit ratlosen Blicken nach links und rechts und himmelwärts, spreizte die Finger und schloss sie wieder, aber die Antwort, die sie suchte, ließ sich weder blicken noch greifen.
Nein, das wäre peinlich.
Sie schüttelte den Kopf und lachte. Alles, was mir einfällt, klingt nur kitschig. Aber es ist trotzdem so. Eva, sag du doch mal, was du fühlst, wenn du liebst. Na?
Kommt darauf an, wen oder was, sagte ich.
Na gut, ich mach es einfach, du hast deinen Hund geliebt. Was hast du dabei gefühlt?
Liebe, ich habe Liebe gefühlt, sagte ich.
Aber Katharina bestand darauf, dass ich mein Gefühl beschreibe, nicht nur benenne, schließlich hätte ich das von ihr auch verlangt.
Johannes Bertram hob sein Glas und zitierte: Wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.
Sylvie protestierte. Das ist doch Quatsch, natürlich kann man über Liebe reden. Alle Menschen reden ihr halbes Leben lang über Liebe. Zuerst über ihr himmelhohes Glück, bis es sich früher oder später in Unglück oder Langeweile verwandelt hat.
Aber wie, fragte Johannes Bertram leise, wie sprechen sie über Glück? Nach seiner Erfahrung sprächen die Menschen über ihr Unglück viel konkreter, wütend oder gekränkt oder verzweifelt. Das Glück würden die meisten doch nur benennen. Ich bin glücklich, sagen sie und setzen voraus, dass der andere weiß, was sie jetzt fühlen. Unglück sei individueller und konkreter, Schuld und Schuldige seien anzuklagen, Rachegelüste kämen auf. Selbst unbeholfenen Rednern könne so eine dramatische Erzählung gelingen. Hingegen bedürfe es doch eines erheblichen sprachlichen Talents, ohne Peinlichkeit über Glück zu sprechen.
Das habe ich doch gesagt, unterbrach ihn Katharina, es wäre peinlich. Ich bin Tierärztin und kein Dichter. Ich könnte auch nur sagen: Es ist die Erinnerung an Glück. Und ihr könnt euch dann denken, was ihr wollt.
Da ich die Diskussion, die unversehens ernst geworden war, eher scherzhaft vom Zaun gebrochen hatte, wollte ich etwas zur Beruhigung beitragen und rezitierte die berühmten vier Zeilen von Eichendorff:
Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.
Das, sagte ich, sei für mich eine gelungene Beschreibung von glücklichem Erleben, eines Augenblicks von Glück, aber auch von Liebe. Und eigentlich ginge es mir nicht anders als Katharina, mir fiele auch nur Unaussprechliches ein, wenn ich Glück beschreiben sollte.
Ja, sagte Katharina, die Seele, die weit ihre Flügel ausspannt, ist ein wunderbares Bild. Genau das ist das Gefühl, an das ich mich erinnere.
Und jetzt kannst du nicht mehr so fühlen, fragte Sylvie mit sanftem Mitleid in der Stimme.
Katharina lachte. Die unverwüstliche Sylvie. Nein, die Flügel meiner Seele sind inzwischen gestutzt, fliegen kann sie nicht mehr, nur noch flattern.
Johannes Bertram lächelte und sah dabei aus dem Fenster, als suchte er eine Flugbahn für seine Seele. Und ich versuchte mich zu erinnern, wann ich zum letzten Mal etwas verspürt hatte, das der Eichendorff’schen Beschreibung würdig gewesen wäre. In der näheren zeitlichen Umgebung fiel mir nichts ein. Vielleicht hatte es Sekunden gegeben, ein überwältigendes Himmelsbild oder das unverhoffte Lächeln eines fremden Menschen, in dem man sich für einen Augenblick aufgehoben fühlen konnte. Nur die Begegnung mit dem alten Mann hatte einen bleibenden Eindruck hinterlassen, die lag aber schon Jahre zurück. Es war ein sonniger Tag im Frühsommer gewesen, ich lief mit meinem Hund durch die Pariser Straße, und wir müssen einen sehr einigen, glücklichen Anblick geboten haben. Ein zartes Männlein mit einem dünnen Kinnbart und leuchtenden blauen Augen kam uns entgegen, bedachte uns schon aus der Entfernung mit einem wohlwollenden Lächeln, blieb dann vor uns stehen und sagte: Gott beschütze Sie. Seine ganze Erscheinung schien einem Märchen entsprungen zu sein, und seine Stimme klang, als sei der Mann berufen, solche Sätze zu sagen, und als sei er nur wegen uns, meines Hundes und mir, gerade in dieser Minute über die sonst menschenleere Pariser Straße gekommen, um uns Gottes Schutz zu empfehlen. Und obwohl ich nicht an Gott glaubte, brannte sich mir diese Begegnung als ein Glücksmoment ein, als etwas, das mich auf eine unerklärliche Weise wirklich beschützen würde.
Es sei schade, sagte ich, dass wir uns alle nicht kannten, als wir jung waren.