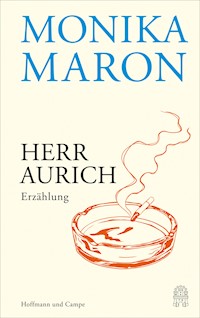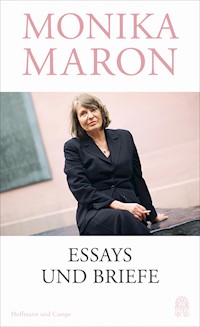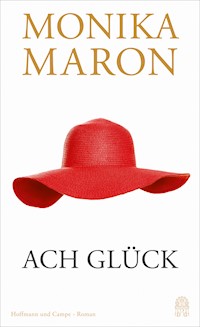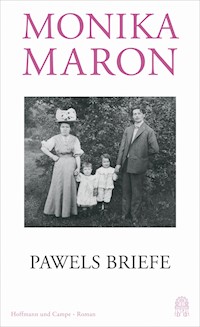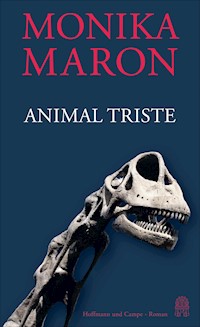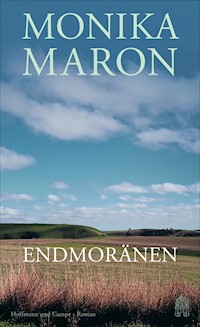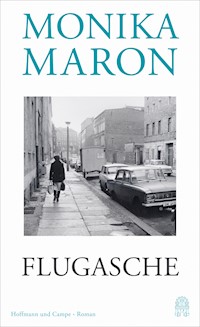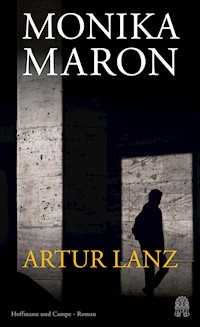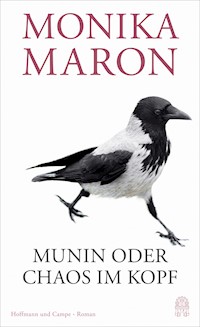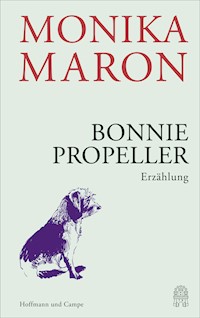17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Zum 80. Geburtstag von Monika Maron am 3. Juni 2021: Ausgewählte Essays aus vier Jahrzehnten von einer großen Schriftstellerin, die immer schon zu aktuellen Debatten und gesellschaftspolitischen Themen Stellung bezog und die sich nie vereinnahmen ließ. Poetisch, elegant, humorvoll und unerschrocken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Monika Maron
Was ist eigentlich los?
Ausgewählte Essays aus vier Jahrzehnten
Essays
Hoffmann und Campe
Vorwort
von Jürgen Kaube
I
Monika Marons Eingriffe begleiten uns seit mehr als dreißig Jahren. Wie viele im Westen Deutschlands las ich von der Schriftstellerin zum ersten Mal etwas im Juli 1987. Da hatte sie schon zwei Romane, darunter den berühmten Flugasche, und einen Erzählungsband veröffentlicht. Viel bekannter aber wurde sie damals durch ihren öffentlichen Briefwechsel mit dem Autor Joseph von Westphalen. Maron war sechsundvierzig Jahre alt und lebte seit 1951 in Ost-Berlin. Sie war die Stieftochter eines ehemaligen Innenministers der DDR, zunächst Journalistin von Beruf, von 1976 an dann freie Schriftstellerin, deren Werke im Osten aber nicht gedruckt wurden. Und nun tauschte sie Briefe mit einem westdeutschen Publizisten aus, die wöchentlich im Magazin der Zeit abgedruckt wurden. Das war schon als Vorgang ungewöhnlich. Am Ende des Briefwechsels hatte die DDR als Staat noch anderthalb Jahre, doch das wusste niemand.
Nach wenigen der Briefe war klar, wie viele Missverständnisse den deutsch-deutschen Gedankenaustausch erschwerten. Zumeist waren es einseitige Missverständnisse, sie beruhten auf Unkenntnis und auf zu umstandslosem Hinschreiben. Unvergesslich bleibt, wie Westphalen den Spruch »Schwerter zu Bierdosen!« aufnahm, eine damalige Persiflage auf das friedensbewegte »Schwerter zu Pflugscharen!«, um Monika Maron zu fragen, ob der »pfiffige« Aufruf womöglich aus der DDR stamme. Maron: In der DDR gebe es gar kein Dosenbier. Und kein Verwaltungsrecht, das einem im Umgang mit dem Staat womöglich nützlicher sei als Pfiffigkeit. Man dürfe sich beschweren, könne aber nicht klagen. Maron störten außerdem die Projektionen. In der DDR nenne niemand, den sie kenne, sein Freizeithäuschen »Datscha«, das sei ein Ausdruck von Westdeutschen. »Und waren Sie auch in Wohnungen?«, fragt sie noch 2019 diejenigen, die ihr Urteil über die DDR in Gaststätten und bei Stadtrundgängen bildeten. Mehr aber noch als über Ahnungslosigkeiten war Maron früh darüber verärgert, wie schematisch das Verhältnis gedeutet wurde: »Warum können Sie es eigentlich nicht lassen, jeden Unterschied zwischen Ihnen und mir zum Unterschied zwischen Ost und West zu erklären!«
Dieser reizbare Überdruss an undurchdachtem Reden, Fühlen und Verhalten findet sich auch in vielen der hier versammelten Stücke von Monika Maron dokumentiert. Die Adresse ihrer Wortmeldungen ist nicht, wie bei manchen Intellektuellen, in erster Linie die Politik. Sie reflektiert zumeist nicht oder protestiert gar gegen staatliche, juristische oder wirtschaftliche Entscheidungen. Der Gestus des »Ich verstehe zwar wenig davon, aber ich sage trotzdem mal etwas sehr Entschiedenes dazu«, den manche intellektuelle Einlassungen zur Gegenwart pflegen, ist ihr fremd. Kaum ein Aufsatz aus ihrer Hand, in dem die Mitteilungen über gesellschaftliche Vorkommnisse nicht durch die erläuternde Mitteilung privater Erfahrungen unterstützt würden. Wäre es nicht paradox, so könnte man sagen, der Gegenstand wie die Adresse ihrer Schriften sind deutsche Mentalitäten. Aber es ist paradox, denn Mentalitäten haben gar keine Adresse. »An alle, die es angeht«, lautet ihr Motto.
Im Jahr 1992 wendet sich Monika Maron beispielsweise gegen den Glauben vieler ihrer ostdeutschen Landsleute, die Wiedervereinigung habe ihnen die Würde genommen. So viel Würde sei aber, so sagt sie, zuvor gar nicht dagewesen, wie jetzt angeblich abhandengekommen sein sollte. Tatsächlich vermissten viele nur die Gleichheit und rechneten in ihre Ungleichheitsbilanz weder die eigene Treuherzigkeit bei Wahlen ein, noch die geringen Mieten im Osten oder die Lage anderer postkommunistischer Länder wie Polen, Ungarn, Russland. Unerwachsene Haltungen also regen Maron auf, die sich verbreitende Bereitschaft etwa, Opferrollen einzunehmen und betroffen Klage darüber zu führen, wenn Erwartetes nicht eintritt, der »dauerpubertäre« ziellos trotzige Protest mittels Beleidigtsein. Sie hat diese Einstellungen, die sich heute überall finden, früh an ostdeutschen Reaktionen nach der Wende registriert.
Ihnen stellt sie, der Erfahrung von 1989 entnommen, entgegen, »woran es diesem Land bis zur Psychose mangelt: die Lust zu leben«. Woran es diesem Land mangelt. Nicht »den Ostdeutschen«, auch wenn es an jener Stelle um sie ging. Dass uns die Lust zu leben fehlt, ist ein sehr hartes Urteil, aber ist es abzuweisen? Gut siebzig Jahre zuvor hatte der französische Intellektuelle Jacques Rivière in seinem Buch L’Allemande ein ähnliches Urteil über die Deutschen gefällt, wie er sie in vierjähriger Kriegsgefangenschaft von 1914 bis 1918 erlebt hatte. Die Deutschen, hieß es dort, führten alles, was man ihnen vorgebe, mit großer Akribie und Sachlichkeit aus, »fromm und stark«, aber sie wüssten selbst nicht, was sie wollten. Es fehle ihnen die Leidenschaft, ein Gefühl dafür, wofür sie sich auf jeden Fall entscheiden und dafür, was sie auf keinen Fall tun würden.
Zu solcher Indifferenz hat Marons Biographie das »antifaschistische Kind«, das sie war, nicht disponiert. Wer Geschichte im Sinne des Durchlebthabens von dramatischen Umbrüchen wesentlich nur aus dem Schulunterricht, dem Studium und den Medien kennt, der hat in bestimmter Weise Glück gehabt. Viele Umbrüche sind keine guten und niemandem zu wünschen. In anderer Hinsicht verschiebt sich dadurch aber die Gelegenheit zur Willensbildung und zum Selbstbewusstsein davon, was es heißt, unter extremen Umständen nicht den Verstand zu verlieren. Gar keine Umbrüche verführt zum Verdämmern des Freiheitsgefühls. Monika Marons jüdisch-polnischer-sozialistisch-bürgerlicher-ost-westdeutscher Lebenslauf ist darum sehr eindrücklich. In ihren Essays wie in ihren Romanen zeichnet sie nach, wie Geschichte in Familien und Paarbeziehungen nicht nur vorkommt, sondern auf sie durchschlägt, weil sie dort zu Handlungen aufruft. Fast niemand ist Innenminister der DDR, aber alle müssen ihre private Geschichte mit der des Weltlaufs auf irgendeine Art verbinden. Marons Stück über Lebensentwürfe und Zeitenbrüche in diesem Band ist der Entwurf eines ganzen Forschungsbereichs über Biographien.
Sobald es zu Umbrüchen kommt, kann sich ihnen niemand entziehen, ohne durch den Entzug Schaden zu nehmen. Die Geschichte der zwei Brüder, die Maron im Jahr 1995 erzählt hat und die sich wie die Essenz eines ganzen Romans liest, ist ein Sinnbild dafür. Denn auch die Indifferenz gegen Geschichte, das bloße Sicheinrichten oder das Streben nach unbeschadetem Durchkommen, hat Kosten und wird von ihnen oft eingeholt. Was privat die verbreitete Wahl ist, das Ausweichen und die Versuche, sich stumm zu arrangieren, lässt gesellschaftlich ein Land hinter seinen Möglichkeiten zurück. Hier liegt die intellektuelle Aufgabe, die Monika Maron in vielen ihrer Texte sich stellt: zum Bewusstsein solcher besseren, wenngleich nicht ohne Verzichte ergreifbaren Möglichkeiten aufzurufen.
Im Jahr des Mauerfalls schreibt sie so, »das Volk in der DDR« sollte niemandem gestatten, sich dieses Augenblicks zu bemächtigen, weder Kalten Kriegern noch denen, die nun mehr oder weniger verdruckst über das Ende der sozialistischen Utopie klagten. Weder das Bewusstsein der Schande des jahrzehntelang gebeugten Rückens noch das Gefühl, ihn jetzt endlich gestreckt zu haben, sollten vergessen werden. Im Osten Deutschlands, heißt es Jahre später in derselben Richtung, sei das demokratische System installiert worden, aber der demokratische Geist lasse sich nicht installieren. Denn der demokratische Geist, so darf man das zusammenziehen, ist genau jener, dem erinnerlich und gegenwärtig bleibt, wogegen er erkämpft wurde.
II
Die Umstände schriftstellerischer Intellektualität haben sich seit den Tagen Heinrich Heines geändert. Medial beispielsweise. So waren die Gebildeten, die ohne politischen Auftrag ihre Stimme geltend machen, seit jeher an Journale und an die Tagespresse gebunden. Heine spricht von »wilden, in Druckpapier gewickelten Sonnenstrahlen«, als er auf Helgoland von der Pariser Julirevolution erfährt. Was Intellektuelle sagen, steht seitdem in der Zeitung. Und selbst die späte, an ihrer Zeitungslektüre fast verzweifelnde Monika Maron kommt nicht darum herum, dieses Missvergnügen in Form eines Essays mitzuteilen, der in einer Zeitung abgedruckt wird.
Seit den sechziger Jahren jedoch und bis in die jüngste Gegenwart hinein wurde das Fernsehen für die Bildung einer massendemokratischen Öffentlichkeit viel entscheidender. Die Wiedervereinigung etwa war ein Ereignis, das sich über Sendungen mitteilte: Sendungen von Demonstrationen, Berichte über besetzte Botschaften und Pressekonferenzen. Man denke nur an Günter Schabowskis zögerndes »unverzüglich« und seine gewaltigen, grenzöffnenden Folgen.
Heute wiederum sind längst die digitalen Stürme und Wellen hinzugekommen, die das Profil von Stimmen einzelner Personen und also auch das von Intellektuellen schwächen. Es gibt inzwischen sehr viele Urteile, an denen nicht gearbeitet worden ist, sondern die der Subjektivität momentaner Mitteilungsbedürfnisse entspringen und zugleich anonym mitgeteilt werden. Manche halten diesen Trend zu unredigierten Texten, die selbst nur als Teil von größeren Textmengen Wirkung entfalten, für einen demokratischen Fortschritt. Endlich können alle publizieren. Doch selbst wenn das unter manchen Gesichtspunkten auch ein Rückschritt sein sollte, ist es einer, mit dem wir alle und mithin auch die Intellektuellen leben müssen.
Die Stimme der Intellektuellen wirkte sich außerdem früh in einem Meinungskampf um Mehrheiten aus. Der französische Streit um die angebliche Schuld des Hauptmann Dreyfus, die Geburtsstunde der Figur der Intellektuellen, war insofern bezeichnend. Es war ein Kampf darum, die Öffentlichkeit auf eine Seite zu ziehen und dadurch die Politik zu verpflichten. Intellektuelle sind insofern selbst dort der Idee demokratischer Verfahren verpflichtet, wo sie solche Verfahren nicht verwirklicht vorfinden, sondern nur an sie appellieren können. Wenn es auf ihren Beitrag ankommt, dann nur im Licht öffentlicher Debatten, die etwas bewirken. Dass Monika Maron in einem ihrer jüngeren Texte sogar ausbreitet, welche Parteien für sie noch wählbar sind, und dann dabei landet, am liebsten in Österreich wählen zu wollen, unterstreicht den Sprung, der heute zwischen Intellektualität und politischer Parteinahme liegt.
Eine letzte Bedingung der Intellektuellenrolle im Beruf der Literatur selbst. Als Heinrich Heine schrieb, gab es für Einwirkungen auf die lesende Öffentlichkeit noch kaum andere Kandidaten als Schriftsteller. Als Émile Zola seine Anklage gegen die Verfolger von Dreyfus formulierte, waren die Fächer der politischen Wissenschaft, der Soziologie oder gar der Vorurteilsforschung längst noch nicht institutionalisiert. Auch Staatsrechtler hätten sich damals nicht leicht hervorgewagt. Heute hingegen würde man wohl nicht als Erstes einen Romancier anrufen, um ein Urteil über einen Justizskandal zu bekommen. In dieser Situation steht die schriftstellerische Intellektualität stets in der Gefahr, nur gut formulierten Small Talk anbieten zu können, weil sie sich weder forschend noch professionell zu ihrem politischen Gegenstand verhält. Das bloße Meinen kommt deshalb nicht oder nur unehrlich um die Frage herum, wie für seine Meinungen denn auch Mehrheiten gewonnen werden können.
Was bleibt also für die Intellektuellen? Die Besonderheit vieler Interventionen von Monika Maron liegt darin, dass sie sich dieses Ungleichgewichts zwischen ihrer Stimme und der Masse der Meinungen bewusst ist. Sie verzichtet in ihren Texten nie auf das »Ich«, weil sie der Schlüsselgewalt persönlicher Erfahrung vertraut, auf den Bericht aus dem Alltag, auf die Anekdote. Die ernst genommene Erfahrung der Literatur hat hier intellektuelle Folgen, die denen der wissenschaftlichen Expertise im öffentlichen Diskurs ähneln. Dort werden, wenn es gut geht, Argumente auf ihre Darstellbarkeit geprüft. Literatur prüft Individualität auf Darstellbarkeit. Dass wir die im frühen neunzehnten Jahrhundert aufgeschriebene Geschichte über das Schicksal eines Pferdehändlers im sechzehnten Jahrhundert auch im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht nur historisch verstehen, hat darum Konsequenzen für die Gegenwart. Monika Maron spricht von »intuitiver Erkenntnis« als ihrem literarischen Antrieb. Das gilt auch für ihre Aufforderungen, ernsthaft öffentlich zu streiten.
Verstehen und streiten heißt dabei, eines nicht zu akzeptieren: die Verachtung des Verstehens und des Streitens selbst, den unzugänglichen Dogmatismus einer ganz handgreiflichen Polemik gegen die Prämissen der Verständigung. Es ist lautstark und kurz angebunden über Monika Marons Kritik der fundamentalistischen Zurückweisungen solcher Prämissen geurteilt worden. Islamophob wurde sie gescholten, als handele es sich um eine Krankheit, die gleichwohl selbstverschuldet sei, und als gelte ihre Kritik den Muslimen als solchen und nicht denjenigen, die ihre Religion politisch in Stellung gegen Prinzipien wie die Gleichheit der Geschlechter, die Freiheit der Partnerwahl oder den religionsneutralen Gerichtssaal in Stellung bringen. Panikmache wurde ihr vorgeworfen, als existierten die am Ende von Verzicht auf Argumentation stehenden Gewalttaten – von Paris über Nizza und den Breitscheidplatz bis nach Hamburg-Barmbeck und Conflans-Saint-Honorine –, gar nicht oder als gingen sie nur aus schwierigen sozialen Lagen hervor, nicht auch aus religiösen Gesinnungen.
Maron fordert hier »die Solidarität der Aufgeklärten«, die Intoleranz gegen Intoleranz, den Primat der Freiheit gegenüber der Einfühlung in Kulturen. Sie verbindet diese Forderung mit ihren Erfahrungen aus der Zeit um 1989. Damals waren viele im Westen blind gegen die DDR als Diktatur, weil sie nach wie vor an irgendwelchen von 1968 hergebrachten Utopien hingen und dafür eine Leinwand brauchten. Die oben bezeichnete Unkenntnis kam passenderweise hinzu. Existierende Konflikte zur Projektionsfläche eigener, damit gar nicht zusammenhängender Absichten zu machen, geht Monika Maron besonders gegen den Strich. Was hat die Beurteilung der DDR mit verblassten Akademikerphantasien im Westen zu tun, was die Diskussion über den fundamentalistischen Teil des Islam mit dem Unbehagen westlicher Autoren an ihrer eigenen religiösen Existenz? Dass Maron dieses Gebot, von Projektionen Abstand zu nehmen, in jedem ihrer eigenen Texte auf gleiche Weise durchgehalten hat, ist unwahrscheinlich. Aber wir können nicht beides haben, den zugespitzten Streit und jene Empfindlichkeit, die von sich derart überzeugt ist, dass sie Dissens im Grunde für unzumutbar hält.
Wir wollen trinken und dann ein bisschen weinen
Die Stadtmitte der Hauptstadt ist ihr westlicher Außenbezirk. Die Mitte ist die Grenze; das Nichtüberschreitbare ist die Mitte, auch des Denkens. Da, mitten in die Mitte hinein führt eine Tür, ein eisernes, braun angestrichenes Tor, durch das die von draußen kommen, von drüben, aus dem Westen, wie immer einer das nennt. Die Tür hat nur auf einer Seite eine Klinke, auf der anderen. Die Rede ist vom Bahnhof Friedrichstraße, dem symbolträchtigen Schauplatz von Stadtgeschichte, nationaler Geschichte, von unzähligen Familien- und Liebesgeschichten. Ein Ort voll stumpfer Dramatik.
Vor dieser Tür im Mittelbau des Bahnhofs stehe zuweilen auch ich und erwarte meine Gäste. Ich stehe im gleißenden, von den gelb gekachelten Wänden feindselig reflektierten Neonlicht inmitten anderer Wartender, glotze wie sie auf diese Tür, die alle paar Sekunden ein Menschlein ausspuckt, manchmal auch mehrere zugleich, ins Schloss fällt, sich öffnet, spuckt, wieder zufällt. Ich weiß, gleich neben der Tür hängt ein Schild: Halt! Weitergehen verboten; ich weiß es, aber ich sehe es nicht, ich sehe nur auf die Tür, wie die Blicke aller Umstehenden magisch auf die Tür gerichtet sind. Einziger Zeitvertreib: die Personenbestimmung der Ankömmlinge, Ostmensch oder Westmensch. Die meisten sind Rentner, Ostmenschen also. Sie schleppen schwere Taschen und Beutel, wenn sie vom Einkaufen am Zoo oder in der Neuköllner Karl-Marx-Straße kommen, große Koffer, wenn sie Verwandte in Westdeutschland besucht haben. Einmal habe ich hier einen Gepäckträger gesehen, ebenso alt und auch so gebrechlich wie die Frau, deren Koffer er trug.
Bernauer Straße, 1992
Haben die schwer Beladenen sich samt ihrem Gepäck endlich durch den schmalen Spalt in der Tür bugsiert, retten sie sich zunächst an das eiserne Geländer, das ein zimmergroßes Areal vor dem Tor begrenzt. Da stellen sie ihr Gepäck ab, sortieren die Papiere, die sie in den nervösen, schweißfeuchten Händen halten, suchen unter den Wartenden jenseits der Absperrung nach einem, der ihretwegen da steht. Finden sie keinen, greifen sie seufzend oder entschlossen nach ihren Koffern und Taschen, schleppen sie und sich an den Taxistand vor dem Bahnhof, um sich ergeben in eine Schlange von 30 oder mehr Leuten einzureihen. Andere bleiben keuchend hinter der Tür stehen, bleich, öffnen einen Kragenknopf, tupfen sich mit einem Tuch den Schweiß von Stirn und Schläfen, während ihre Kinder oder Enkelkinder auf sie zustürzen und sie zu einer der beiden Bänke mit insgesamt acht Sitzplätzen führen, die in dieser Wartehalle den Bedürftigen zugedacht sind. Der Weg vom Zug bis hierher war zu schwer, es gibt keine Rolltreppen, keine Gepäckwagen, die Wartezeiten an der Passkontrolle sind oft lang, Sitzgelegenheiten nicht vorhanden, die Luft ist schlecht. Dazu vielleicht die Angst wegen einem bisschen Schmuggel, Bücher oder Kassetten für die Enkel, wer weiß. Sie schaffen es bis hinter die Tür, gerade so.
An den Abenden finden sich auch jüngere Leute unter den einreisenden Ostmenschen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dringenden Familienangelegenheiten, mehr Frauen als Männer, wie mir schien. Die Kinder und der zurückgebliebene Elternteil stehen gespannt am Geländer, bis eines der Kinder einen Blick durch den Türspalt wirft und schreit: »Mama kommt.« Der Mann freut sich, weil die Frau wieder da ist, die Kinder mustern gierig Koffer und Tüten, die Frau, von den Geheimnissen des heimkehrenden Reisenden umgeben, strahlt eine leichte Überlegenheit aus – ein fast normales Bild.
Schönhauser Allee Ecke Sredzkistraße, Prenzlauerberg
Es kommt vor, dass ein Angehöriger des Grenzorgans durch die Tür tritt und sich einen Weg durch die Wartenden bahnt. Ich habe selten erlebt, dass einer von ihnen bittet, er wartet, bis man ihm aus dem Wege geht. Bittet er doch, murmelt er etwas Unverständliches durch den fast geschlossenen Mund. Auf keinen Fall lächelt er.
Zuweilen frage ich mich, was wohl ein Westmensch – in dem elektrisch erleuchteten Anzeigenkasten über der braunen Tür als Bürger der BRD, Bürger Berlin (West) oder Bürger anderer Staaten bezeichnet –, was die Sinne eines solchen Westmenschen wohl wahrnehmen, wenn sich das Eisentor zum ersten Mal in seinem Rücken schließt: unsere ihn gleichgültig und erbarmungslos taxierenden Blicke, die sieben Schilder, auf denen in schwarz-weiß-roter Bildersprache das Rauchen untersagt wird, der Gestank, der von den Toiletten aufsteigt, in die zwei der Eisentür gegenüberliegende Treppen führen, der graue schmutzige Fußboden … Kein Ort in der Stadtmitte wirkt trostloser, ungeschminkter. Was die Plakate an den Litfaßsäulen verheißen: Berlin – weltoffene Metropole, beginnt erst einige Hundert Meter entfernt vom Sicherheitstrakt Bahnhof Friedrichstraße.
Vor 20 Jahren, als ich noch in unmittelbarer Nähe studierte, habe ich dem Schauspiel zwischen der Schinkel’schen Neuen Wache und der Knobelsdorff’schen Staatsoper zum letzten Mal zugesehen. Seitdem war diese leibhaftige Demonstration preußischer Geschichte eher ein Grund, die Stadt am Mittwoch zwischen zwei und drei zu meiden, wenn für eine halbe Stunde der Verkehr zwischen Friedrichstraße und Palast der Republik gesperrt, der Platz vor der Neuen Wache – heute Mahnmal für die Opfer des Faschismus und des Militarismus – von der Polizei mit Seilen eingezäunt wird. In mein Bild vom Stadtbezirk Mitte aber gehört die allwöchentliche Wachablösung ebenso wie die Straße, in der sie zu bestaunen ist: das architektonische Prunkstück preußischer Königsmacht Unter den Linden.
Also begebe ich mich an einem Mittwoch im September, eine Stunde vor Beginn des Spektakels, an den beschriebenen Ort. Vor einem klaren blauen Himmel strahlt in der herbstlichen Sonne weithin das frisch vergoldete Kreuz des Domes. Kaiserwetter sagen alte Leute heute noch zu solchem Tag. Als ich um halb zwei vor der Wache ankomme, befestigen zwei Polizisten gerade die Seile, mit denen später der Bürgersteig abgesperrt wird, jetzt liegen sie noch schlapp auf den Steinen. Die ersten Zuschauer finden sich ein – an ihrem Dialekt identifiziere ich sie als Bewohner südlicher Regionen dieses Landes –, sie stellen sich auf einen Platz, den sie für den besten halten, offenbar bereit, ihn für die nächste Stunde nicht zu verlassen.
Auf der Promenade zwischen den beiden Fahrbahnen reitet in philosophisch nachdenklicher Pose Eff Zwo. Kurz nach dem Krieg hatte man das Denkmal von Christian Daniel Rauch als Sinnbild militaristischer Preußenherrschaft nach Potsdam verbannt und vor sechs Jahren, nachdem die ältere deutsche Geschichte weniger emotional betrachtet, dafür auf ihre praktische Verwendbarkeit untersucht wurde, hierher, auf seinen seit 1851 angestammten Platz, zurückgebracht.
Der Platz vor dem Ehrenmal füllt sich; Schülergruppen, Touristen, drei Busse mit französischen Soldaten, ein Bus mit englischen und ein Bus mit amerikanischen Soldaten. Berlin – weltoffene Metropole.
Eine ungewohnte Stille beherrscht die Straße, der Verkehr ist umgeleitet. Bauarbeiter, die die Staatsoper für die 750-Jahr-Feier Berlins herrichten, stehen mit verschränkten Armen auf der Balustrade und sehen auf uns herab. Nur ein einzelner Zimmermann drischt rhythmisch auf das Dach der Oper ein, und ich, der Suggestion des Wartens erliegend, halte sein Hämmern für die Pauke des nahenden Musikcorps.
Dann, fünf Minuten vor halb drei, kommen sie wirklich. Mit Tschingderassabum und Tambourmajor biegen sie im preußischen Stechschritt aus der Universitätsstraße in die Linden ein. Die Augen unter den Stahlhelmen starr nach vorn gerichtet, marschieren sie an dem ihnen leicht zugeneigten Alten Fritz und an den Zuschauern vorbei.
Ich stehe inmitten einer französischen Reisegruppe, Frauen und Männer verschiedenen Alters, die dem Geschehen mit belustigten oder befremdeten Blicken folgen. Einige lachen. Der Zug ist vor dem Ehrenmal angekommen; es wird kommandiert, präsentiert, salutiert, marschiert.
Hinter mir fragt eine Frau ihren um einen Kopf größeren Mann, was die da vorne machen. »Faxen«, sagt der Mann.
Die Kapelle spielt »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit«.
Es war ein Jahr nach dem Krieg, als meine Mutter mich zum ersten Mal zu einer Maidemonstration mitnahm. Wir marschierten hierher, zum ehemaligen Lustgarten am östlichen Ende der Linden. Es gibt ein Foto, auf dem sind sie und ich zu sehen zwischen vielen anderen Leuten, mager und fröhlich wie wir, Überlebende des Krieges, der Konzentrationslager, der Emigration, der Illegalität, die alle eines wussten: Nie wieder Krieg!
Auch damals sangen wir das Lied »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit«. Keinem von denen, die auf dem Bild zu sehen sind, wäre es eingefallen, sein Bekenntnis zum Frieden durch ein preußisches Militärzeremoniell zu bestärken.
Ein älterer Franzose vor mir singt einige Takte mit, bricht, als der Rhythmus in einen forcierten Marsch wechselt, ab. Dann ist alles vorbei, Tambourmajor, Kapelle, Soldaten marschieren durch die Universitätsstraße zurück in die Kaserne am Weidendamm. Die Seile werden eingerollt, die Linden für den Verkehr wieder freigegeben, bis zum nächsten Mittwoch.
Eine Gruppe westdeutscher Mädchen unterhält sich noch verwundert über die sportliche Leistung der Wachsoldaten, die reglos wie Wachsfiguren links und rechts vom Eingang des Ehrenmals stehen.
»Ist alles Disziplin und Training«, sagt ein Mädchen. Ein anderes verweist auf die Guards vor dem Buckingham-Palast, die schließlich Ähnliches zu vollbringen hätten.
»Die fallen aber auch um wie die Fliegen«, sagt die Erste. Sie wirft noch einen mitleidigen Blick auf die Wachen, seufzt: »Die tun mir leid«, wendet sich dann entschlossen ab. »So«, sagt sie, »jetzt müssen wir noch zum Brandenburger Tor.«
Ehe wir sitzen, sind wir dreimal freundlich belehrt worden, und hätten wir es nicht ohnehin gewusst, wüssten wir es jetzt: Das »Roti d’Or« – was so viel heißt wie »Goldener Braten« – im Palasthotel ist ein Valutarestaurant, von den Bewohnern der Hauptstadt »Restaurant für Weiße« genannt, wobei sie selbst die Schwarzen sind, denn in der Währung, die sie verdienen, darf hier nicht gezahlt werden.
Aus der Straßenbahn, Alte Schönhauser Straße, Mitte, 1998
Es ist Freitag, 18 Uhr, wir, das sind ein Historiker, eine Fotografin, ein Naturwissenschaftler und ich, sind die einzigen Gäste. Drei junge Kellner, alle nach 61 geboren, umwerben uns mit ungewohnter Aufmerksamkeit, preisen uns die exotischen Speisen und Getränke so lässig an, als hätte man sie im Säuglingsalter schon mit Kiwi-Mus gefüttert. Wir verzichten auf einen Kir Royal, der uns als eine Spezialität des Hauses offeriert wird, und bestellen trockenen Sherry, bis auf den Naturwissenschaftler, einen fanatischen Biertrinker, der seine Trinkgewohnheiten auch der angestrengten Noblesse des Etablissements nicht unterwerfen will.
Durch das braun getönte Fensterglas sehen wir über die Spree auf den Dom und den Palast der Republik, Domizil der gesetzgebenden Körperschaft der DDR, der Volkskammer. Dem Hotel gegenüber steht das neue Marx-Engels-Denkmal, umgeben von weiteren bildkünstlerischen Dokumenten des Klassenkampfes, über deren Dualität wir uns gerade streiten, als der Ober die Krabbensuppe serviert.