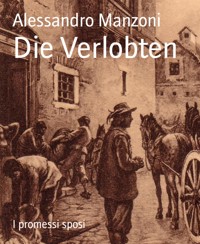
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lucia und Renzo, das Liebespaar aus dem mittelalterlichen Italien kommt und kommt nicht zusammen. Schurken, Banditen, ein ängstlicher Pfarrer und am Schluss die Pest verhindern die Vermählung. - Dennoch, ganz am Schluss wendet sich dank eines selbstlosen Paters die Geschichte einem glücklichen Ende zu! Ein Sittengemälde epischen Ausmasses!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Die Verlobten
I promessi sposi
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEinleitung
Alessandro Manzoni
Die Verlobten
I promessi sposi
Einleitung
Quel cielo di Lombardia, così bello quand' è bello, così splendido, così in pace. (Dieser lombardische Himmel, so schön, wenn er freundlich ist, so glanz-geschmückt, so friedlich-sanft.)
Manzoni, Die Verlobten, T. I, Kap. 17.
Wem es jemals vergönnt war, die Sonne des also gefeierten lombardischen Himmels zu fühlen, wer je die Wunder der oberitalienischen Seen, das Wunder des Mailänder Domes erlebt hat, wird die Landschaft, in der die mailändische Geschichte von den »Verlobten« spielt, niemals wieder vergessen. Sie bleibt die ewige Sehnsucht des Nordländers, der nach einem reineren Himmel, nach hellerer Klarheit und wärmerer Sonne verlangt; sie war aber in gleicher Weise das Land, das auch der Südländer von jeher mit besonderer Liebe umfing. Aus sehnsüchtiger Erinnerung heraus fragte Plinius d. J. in einem Briefe an Caninius Rufus: »Was macht Como, deine und meine Wonne? Was das reizende Landhaus? Was die Säulenhalle mit dem ewigen Frühling? Was der schattige Platanenhain? Was die grüne, kristallklare Flut? Was das sonnenbestrahlte Bad?«
Dieses Bild könnte auch heute noch ein moderner Italienfahrer im Gedächtnis haben, wenn er an Como und seinen See denkt: das ist ganz das Abbild des einen, südwestlichen Armes des dreizipfligen Sees mit seiner Perlenschnur von weißen Villen, die am Ufer entlang in das dunkle Grün der Gärten eingebettet liegen. Manzonis Werk nimmt seinen Ausgang aber vom Winkel des südöstlichen Armes, in dem die Seidenspinnerstadt Lecco liegt und die Adda aus dem See austritt. Dieser Teil, einsamer und weniger besucht von Fremden, aber darum nicht minder reich an landschaftlichen Schönheiten, trägt ein anderes Gepräge. Wer aus dem Comoarm kommend das Paradies von Bellaggio umfahren hat und in den See von Lecco kommt, ist überrascht von der Grelle dieser Gegensätze: eben noch anmutige Hügel, immergrünende Gärten in lieblicher Landschaft, jetzt eine ragende Bergwelt mit schroffen und kahlen Felswänden, die romantische Gebirgsszenerie einer Dolomitenkette, die nur schlichte Dörfer und Weiler am schmalen Seeufer duldet. Die künstliche Welt der Villen und Parks hat aufgehört, eine herbere, einfachere, aber in der Großartigkeit der Bergeinfassung um so eindrucksvollere beginnt. Dort, wo am Südende bei Lecco und Malgrate die Berge mehr zurücktreten und größeren Raum für die Olivenhaine und Weingärten der Dörfer lassen, lebt die Lieblichkeit des westlichen Armes noch einmal auf, aber sozusagen unvermischt, ohne die künstliche Zugabe prunkvoller Villen und Zierparks, in ihrer ganzen natürlichen Schönheit. Dort, in jener »lieblichen Mannigfaltigkeit«, die von der schroffen, sägenartig gezackten Felswand des Monte Resegone durch grünende Fluren an das helle Ufer des Leccosees, der Adda, des Sees von Pescarenico führt, dort sind die Gestalten Manzonis zu Hause.
Das Leben Manzonis entbehrt größerer äußerer Begebenheiten. 1805 bis 1807 weilte er in Paris und geriet dort ganz ins klassizistische Fahrwasser. Die Jahre 1809/12 sind von entscheidender Bedeutung für Manzonis inneres Leben. Nach seiner Rückkehr aus Paris heiratete er die kalvinistische Schweizerin Henriette Blondel nach protestantischem Ritus; beide aber traten im Mai 1810 wieder zum katholischen Glauben über. In dieselbe Zeit fällt auch die Bekehrung Manzonis zur Romantik. Er schrieb die Inni sacri (Heilige Hymnen, 1812 begonnen, Gesamtausgabe 1823), die zu den herrlichsten Liedschöpfungen zum Preise des Katholizismus gehören, dazu gleichsam die erste lyrische Manifestation der Romantik in Italien sind; er verfaßte die ersten romantischen Dramen (1816/22), die sich über die klassischen Einheiten hinwegsetzen, aber heute, weil in ihnen die Geschichte die Poesie überwuchert, vergessen sind. Sein berühmtestes, noch heute lesenswertes Gedicht ist »Der fünfte Mai« (1821), eine Ode auf den Tod Napoleons, die von Goethe mit Recht gerühmt wird.
Sein Haupt- und Lebenswerk ist jedoch I promessi sposi, »Die Verlobten«, an dem er immer wieder arbeitete und verbesserte. Die erste Ausgabe in drei Bänden 1825/27 ist stark mit Lombardismen durchsetzt; nach einem Aufenthalt in Florenz machte er sich an die Ausmerzung derselben (1840) und schenkte damit seinem Volke ein Beispiel für reine Prosa, die von der Akademie der Crusca für vorbildlich erklärt wurde.
Den Rest seines Lebens verbrachte Manzoni, hochgeehrt von seinen Landsleuten, zum Teil in seinem vornehmen Hause in Mailand, zum Teil auf seinem Landgut Brusuglio in der Brianza. Wir hielten es für notwendig, die Leser umständlicher in die Landschaft des Romans einzuführen. Denn diese Landschaft ist der belebende Atem, der durch das ganze Werk weht. Klarheit, Lieblichkeit und einfache Größe, sie geben seinem Geschehen und seinen Personen das Gepräge. Daher ist das Werk echte Heimatkunst im besten Sinne des Wortes. Selten vielleicht stehen Landschaft und Dichtung in so engem Zusammenhange wie hier. Sie bedingen einander so sehr, daß sogar nachträglich Landschaft und Örtlichkeit nach dem Roman gedeutet wurden. Die eigentliche Handlung nämlich, die Geschichte der Verlobten Renzo und Lucia, deren Vereinigung ein gewalttätiger Machthaber Don Rodrigo zu hindern sucht, ist vom Dichter frei erfunden, aber das lesende Volk, das seine Welt in dem Werke wiederfindet, seine Örtlichkeiten und sein Denken und Fühlen mit solcher Meisterschaft und Naturwahrheit geschildert sieht, glaubt an die wirkliche Existenz der erfundenen Personen. Hier mußte Don Rodrigo in seinem Raubneste gehaust haben, dort standen die Hütten der unglücklichen Liebenden, hier mußten die Bravi dem furchtsamen Don Abbondio aufgelauert haben, dort mußten die flüchtigen Verlobten über die Adda gesetzt sein: So wird noch jetzt dem wissensdurstigen Reisenden berichtet.
Aber Manzonis Werk ist nicht nur Heimatkunst, es ist mehr als das. Echte Dichtung kann vielleicht nur in dem fruchtbaren Boden des – in weitestem Sinne – heimischen Volkstums keimen, aber sie muß darüber hinaus in allgemein menschliche Bezirke wachsen. Viele lieben mit uns diese so trefflich geschilderte Landschaft, übervölkische Bedeutung jedoch als ein Roman der Weltliteratur erhält es erst durch die Wahrheit der Empfindung und die Tiefe des Gefühls, die jeden Empfänglichen ergreifen, und durch die künstlerische Vollkommenheit, mit der sie in Sprache und Charakterschilderung zur Darstellung gebracht werden.
Daß diese Eigenschaften in schönster Harmonie unseren Roman schmücken, wird nicht nur durch seine Volkstümlichkeit in ganz Italien bewiesen, wo er eine Art Weltbibel, geistiger Besitz von fast jedermann ist, sondern vor allem durch die Wertschätzung, deren er sich in ganz Europa erfreut. Er ist sehr oft und in alle Kultursprachen übersetzt worden, er wird von vielen für ein schlechthin vollkommenes Buch gehalten, das den übrigen Romanen der Weltliteratur in nichts nachsteht und viele übertrifft.
Als Kronzeugen für die Weltgeltung des Werkes müssen wir zunächst Goethe anführen. Er erhielt den Roman gleich nach Erscheinen im Jahre 1827 mit einer eigenhändigen Widmung vom Verfasser zugesandt. Seine Begeisterung nach der ersten Lektüre gibt Eckermann in seinen »Gesprächen mit Goethe« unter dem 18. Juli 1827 wieder: »Ich habe Ihnen zu verkündigen, war heute Goethes erstes Wort bei Tisch, daß Manzonis Roman alles überflügelt, was wir in dieser Art kennen. Ich brauche Ihnen nichts weiter zu sagen, als daß das Innere, alles, was aus der Seele des Dichters kommt, durchaus vollkommen ist, und daß das Äußere, alle Zeichnung von Lokalitäten und dergleichen gegen die großen inneren Eigenschaften um nichts zurücksteht. Das will etwas heißen. Der Eindruck beim Lesen ist derart, daß man immer von der Rührung in die Bewunderung fällt und von der Bewunderung in die Rührung, so daß man aus einer von diesen beiden großen Wirkungen gar nicht herauskommt.«
Etwas später, nach Beendigung der Lektüre, schwächt Goethe sein Lob in etwas ab. Er meint, daß die allzu breite und allzu genaue Darstellung der historischen Ereignisse der poetischen Wirkung Schaden tue; darüber berichtet Eckermann unter dem 23. Juli 1827: »Ich sagte neulich, daß unserem Dichter in diesem Roman der Historiker zugute käme, jetzt aber im dritten Bande finde ich, daß der Historiker dem Poeten einen bösen Streich spielt, indem Herr Manzoni mit einemmal den Rock des Poeten auszieht und eine ganze Weile als nackter Historiker dasteht. Und zwar geschieht dieses bei einer Beschreibung vom Krieg, Hungersnot und Pestilenz, welche Dinge schon an sich widerwärtiger Art sind und die nun durch das umständliche Detail einer trockenen chronikenhaften Schilderung unerträglich werden ... Hätte Manzoni einen ratgebenden Freund zur Seite gehabt, er hätte diesen Fehler sehr leicht vermeiden können. Aber er hatte als Historiker zu großen Respekt vor der Realität ... Doch sobald die Personen des Romans wieder auftreten, steht der Poet in voller Glorie wieder da und nötigt uns wieder zu der gewohnten Bewunderung.«
Ohne Zweifel liegt in diesem Tadel, abgesehen natürlich von der Abneigung des Klassikers Goethe gegen die Darstellung des Häßlichen, eine gewisse Berechtigung. Die Verbindung der romanhaften Teile mit der Schilderung der historischen Ereignisse namentlich in unserem zweiten Teile ist oft recht lose. Dieser Fehler in der Komposition ist indessen fast Allgemeingut des romantischen historischen Romans. Über dessen Entstehung und Sinngebung ist bereits in dieser Reihe von Werken der Weltliteratur anläßlich von Victor Hugos »Notre-Dame von Paris« gehandelt worden, und dort wurde auch Manzonis Werk bereits in die historische Entwicklung eingefügt; es sei dafür also auf jene Ausführungen verwiesen. Jedenfalls zeigt Manzonis Roman eine ähnliche Kompositionsart wie der Victor Hugos: Eine frei erfundene romanhafte Handlung wird in einen historischen Hintergrund gestellt.
Unser Roman führt den Untertitel »Eine Mailänder Geschichte aus dem siebzehnten Jahrhundert«. Italien stand in jener Zeit zum größten Teil unter spanischer Herrschaft. Karl der V., deutscher Kaiser und König von Spanien, hatte seinen Nebenbuhler um die Weltherrschaft, König Franz I. von Frankreich, 1525 bei Pavia geschlagen, gefangen genommen und zum Verzicht auf seine Ansprüche in Italien gezwungen. 1527 sprengte er durch die denkwürdige Erstürmung Roms die »Heilige Liga« zur Vertreibung der Fremden aus Italien und befestigte so seine Herrschaft in Neapel, Sizilien und Mailand, die er seinem Sohne, dem düsteren Philipp II., überließ. Fremdes Recht, fremde Soldaten, fremde Sprache herrschten fortan in diesem größten Teil von Italien und lasteten auf der Bevölkerung. Die kulturelle Entwicklung, im sechzehnten Jahrhundert zur höchsten Blüte gebracht, sank unter dem Drucke der spanischen Fremdherrschaft und der orthodoxen Hierarchie der Kirche immer tiefer und zehrte im siebzehnten Jahrhundert nur von dem geistigen Kapital der Vergangenheit. Dazu ließen dauernde kriegerische Verwicklungen das Land nicht zur Ruhe kommen und minderten den materiellen Wohlstand. Der alte Widersacher der spanischen Macht, Frankreich, schürte öffentlich und heimlich vor allem in Norditalien gegen den Madrider Hof. Manzoni greift aus dieser Zeit die Jahre 1628-1631 heraus und schildert die wachsende Teuerung, die drohende und ausbrechende Hungersnot, die Volksrevolution in Mailand und als Folge des allgemeinen Elends die Pest.
Gewiß geht Manzoni bei der Erzählung dieser historischen Umwelt, vor allem in der Schilderung der Pest, allzusehr in die Breite; aber andererseits birgt dieser Teil der Erzählung für Liebhaber historischer Darstellung große Reize und ist mit vollendeter Kunst gestaltet worden. In prächtiger Steigerung erweitert sich die kleine Welt des Dorfes bei Lecco zum Staatsgeschehen, die Dorfgeschichte wird zur Weltgeschichte, und die kleinen Bedrängnisse der uns lieb gewordenen Personen münden in dem großen Leiden jenes entsetzlichen Sterbens, das einen ganzen Staat heimgesucht hat. »Alles einzelne ist mit einer solchen Genauigkeit und mit so plastischer Geisteskraft gezeichnet, daß wir uns in ferner Zeit und in dem fremden Lande mit einemmal heimisch fühlen und an den Leiden und Freuden dieser Menschen einen so lebhaften Anteil nehmen, als ob das Erzählte sich vor unsern Augen zutrüge.«
Wenn Manzoni uns Fremden so ans Herz greift und unser Mitleid weckt, wie mußte er erst an die Seele seiner eigenen Landsleute rühren! Und das beabsichtigte er vielleicht nicht ohne Grund. Indem er ihnen die Heimat unter dem Joche spanischer Fremdherrschaft seufzend zeichnete, mußten sie notgedrungen an ihre eigene Zeit denken, die wieder ein anderes fremdes Land, Österreich, über die Lombardei und Venezien herrschen sah. Manzoni war ein guter, aber auch ein bedächtiger Patriot; er forderte seine Landsleute mit diesem Werke nicht zu gewalttätiger Erhebung auf, sondern ermahnte sie, indem er ihnen ein Beispiel der Geduld und Ergebung gab, das politische Elend zu ertragen im Vertrauen auf den endlichen Sieg der gerechten und guten Sache. Fanatischen Freiheitskämpfern von damals war das freilich nicht genug; sie sahen in solcher Ergebung mehr den Verzicht auf politische Freiheit als die Hoffnung auf zukünftige Besserung. Settembrini meint z. B., ein solcher Ratschlag in solcher Zeit bedeute die Unterwerfung in die Knechtschaft und die Preisgabe des geeinten Italiens.
Offenbar wird diese Auslegung der Absicht Manzonis nicht gerecht. Dem Dichter geht es hier allerdings nicht um aktuelle politische Ziele, aber um etwas anderes, das vielleicht damals wichtiger war: den Geist zu bereiten, das Volk mit wahrem Gefühl und echter Vaterlandsliebe zu erfüllen und so seinen Teil an der Zukunft des Volkes zu wirken.
Von den Einzelpersonen des Romans sind nur wenige wirklich geschichtlich. Zu ihnen gehört der Kardinal Federigo Borromeo, diese wunderbare Mischung aus Heiligem und Weltmann, der neben feinstem Herzenstakt und eindringender Menschenkenntnis die überzeugende Kraft des reinen und guten Kirchenfürsten besitzt. Der Chronist Ripamonti, aus dem der Dichter viele Züge geschöpft hat, berichtet von dem großen »Ungenannten«, einem Visconti, der von dem Kardinal bewogen wurde, sein bisheriges Räuberleben aufzugeben. In derselben Quelle fand Manzoni auch die Gestalt Gertrudens, der »Dame von Monza«, einer gewissen Marianna de Leyva aus gräflicher Familie, die als Nonne im Margaritenkloster zu Monza mit einem lasterhaften Schurken in Beziehungen trat. Fra Cristoforo endlich, jener ideale Held der Nächstenliebe, der dennoch voll männlichen Mutes ist, eine der schönsten Gestalten des Romans, ist scheinbar nach einem Bruder Christophorus aus Cremona geformt, von dem berichtet wird, daß er auf die Kunde von der Pest nach Mailand eilte und dort als Krankenpfleger im Dienste seiner Nächsten starb.
Manzoni ist der größte Charakterdarsteller in der italienischen Literatur. So reich diese auch an Werken mit fruchtbarer Erfindung ist, so arm ist sie an psychologisch wahr gezeichneten, eindringlich beobachteten Gestalten. Hier erstand ihr zum ersten Male ein Dichter, der seine Personen von innen heraus entwickelte und sie mit einfachem Griffel, aber sicher und natürlich zeichnete. Gerade die Reihe seiner frei erfundenen Personen stellt diese Gabe ins hellste Licht. Lucia ist vielleicht der liebenswerteste, aber auch der am wenigsten lebenswahre Charakter von ihnen. Sanft und schamhaft, rein und offen, aber zugleich von einer kaum glaublichen Passivität, ist sie eine Heldin des Leidens. Sie ist mit zu großer typischer Erhabenheit umkleidet, die sie uns fernhält wie eine Madonna, sie hat zuviel von einer Heiligen und zu wenig von der Art eines wirklichen, lebendigen Weibes an sich, die uns eine Julia oder ein Gretchen lieben lassen (De Sanctis). Ihrem Madonnenwesen steht der frische, volkstümliche Charakter ihres Verlobten Renzo gegenüber; seine impulsive Natur drängt zum Handeln und führt ihn gerade dadurch in die schlimmsten Lagen.
Man erlasse es uns, auf alle diese Gestalten im einzelnen hinzuweisen; sie sprechen für sich; sie stehen da, bewegen sich und fühlen wie wirkliche Menschen – und das ist vielleicht das Größte, was ein Dichter erreichen kann. Dabei zeichnet Manzoni sie nur mit wenigen Strichen und hält sich nicht mit überflüssigen Einzelheiten auf.
Seine Gestalten an Höhepunkten des Romans sind unvergeßlich: Die Begegnung Fra Cristoforos mit Don Rodrigo, Don Rodrigo auf dem Krankenbett, Ferrer in der empörten Menschenmenge Mailands, Renzo an der Adda, der Kardinal Borromeo und der Ungenannte im Gespräch, der Wagen, der die an der Pest Verstorbenen wegträgt, jene Mutter, die ihr totes Töchterchen selbst auf den Wagen legt und den Monatti sagt, sie möchten am Abend kommen, sie ebenfalls mit ihrer anderen Tochter zu holen – das sind Schöpfungen einer wunderbaren Kunst. Und hinter diesen seinen Schöpfungen taucht zuweilen der Dichter auf, der sie wie ein Vater kennt, sie liebt, sie leitet, sie handeln läßt – und väterlich lächelt über diese seine kleine Welt. »Dieses Lächeln ist echt italienisch, ist Einsicht und Vernunft, ist Güte und innerer Frieden der Seele, ist das Lächeln christlicher Erbarmung.« Aus ihm ist die Figur des Don Abbondio geboren, jenes hasenfüßigen Pfarrers, der wohl die populärste Figur der italienischen Literatur ist und eine der besten humoristischen Gestalten der Weltliteratur überhaupt, würdig, dem Don Quijote an die Seite gestellt zu werden. Gegenüber Don Rodrigo, dem Vertreter der Gewalt, ist er die Verkörperung der Furcht. Er wäre vielleicht sogar ein braver Mensch, ein Egoist vielleicht, aber ein Egoist friedsamer Ruhe, wenn ihm nicht immer die Angst im Nacken säße und ihm den ersehnten Frieden störte. Die Pflicht gebietet ihm zu handeln, die Angst verbietet es ihm: dieser Widerstreit ist eine Quelle unaufhörlichen Lachens.
Durch die ganze Handlung des Romans, durch die Schilderungen von Natur, geschichtlichen Ereignissen und sozialen Zuständen, durch die Zeichnung der Charaktere und durch den eigentümlichen Humor Manzonis zieht sich, verbindend und erhöhend, jenes echte, mitschwingende Gefühl hindurch, das dem Werke die warme Tönung gibt. Verstand und Phantasie verbinden sich mit Liebe zu den Menschen und ihrer Welt. Jene Liebe, sich offenbarend in Mitgefühl und Mitleid, mündet bei Manzoni ganz in der religiösen Sphäre, genauer und bestimmter gesagt: in der christlich-katholischen Religion. Aber sein Glaube ist nicht einseitig und orthodox, sondern, auf dem Grunde des Katholizismus fußend, allgemein und menschlich weit, so daß er über seine örtlichen und zeitlichen Bindungen zu höherer Geltung emporwächst. Er ist solcher Art, daß jeder Mensch, gleich von welchem Glaubensbekenntnis er sei, davon ergriffen werden muß, wenn er nur irgendein religiöses Gefühl besitzt.
Als Quintessenz des Romans soll die Erfahrung der beiden Verlobten gelten, die sie am Schluß aussprechen und die wohl aus Manzonis eigenem Glauben geboren ist: »Das Unglück stellt sich oft ein, weil der Mensch ihm die Gelegenheit gibt; aber auch das vorsichtigste und unschuldigste Benehmen genügt nicht immer, es fernzuhalten; die Leiden mögen indessen mit oder ohne Schuld uns treffen, das Vertrauen in Gott mildert sie und macht sie für ein besseres Leben nutzbringend. Diese Folgerung, wenn auch nur von ungebildeten Leuten gefunden, dünkte uns so passend, daß wir sogleich bedacht waren, sie als den Kern unserer ganzen Geschichte hierherzusetzen.«
Das Vorbild des Italieners Manzoni waren die historischen Romane Walter Scotts. Es schwebte ihm vor, für seine Heimat das zu schaffen, was der große Schotte für sein nordisches Land erstrebt hat: die Verherrlichung der heimatlichen Geschichte (und Sage) im volkstümlichen Roman. Manzoni hat sein Vorbild erreicht, das ist sicher; er hat in mancher Beziehung, weil er langsam und gründlich arbeitete, sogar den Vielschreiber Walter Scott übertroffen. Bei solcher Gleichartigkeit der Ziele und Gleichwertigkeit des dichterischen Gehalts im ganzen ist es reizvoll und aufschlußreich zugleich, zu fragen, inwiefern sich beide Dichter unterscheiden. Die Antwort liegt in den Verschiedenheiten der Landschaft und des Volkes begründet. Der italienische Literaturhistoriker Luigi Settembrini findet dafür einen treffenden, wundervollen Vergleich. Er sieht, wenn er an Manzonis Roman denkt, im Geiste ein Dorfkirchlein von reiner italienischer Bauart vor sich, neu, sauber und leuchtend im blendenden Weiß, mit Kirchengerät von feinster Arbeit, mit den zwei prächtigen Gemälden von der Hungersnot und von der Pest darin; rüstige Fratres walten in dem Kirchlein ihres Amtes, singen und predigen und veranstalten Prozessionen, und bedeuten alles im Ort, und die Dorfbewohner verehren sie; und wer ihnen bei der Messe behilflich sein darf, dünkt sich Wunder was zu sein; auch ein paar Edelherren lassen sich dort sehen, aber nur Sonntags, um ihre Andacht zu halten. Die Romane Walter Scotts dagegen erinnern an den großen gotischen Tempel von Westminster, wo die Gräber der Könige und Königinnen sind und viele andere Nationalheiligtümer, mit den langen Fenstern, geschmückt mit Glasmalerei, und den vielen zwar nicht schönen, aber alten, reichen und ehrfürchtig aufbewahrten Geräten; Bauern und Fremde kommen dahin und sehen die ganze Geschichte eines großen Volkes. Der Italiener hat religiöses Gefühl und schafft ein Werk in reinsten Ausmaßen, der Schotte hat Nationalgefühl und schafft ein vielseitiges Werk, das wohl in manchem ein wenig seltsam, aber immer bewunderungswürdig ist. Der Italiener hat mehr Verstand, der Schotte mehr Phantasie; der Italiener lächelt, der Schotte bricht bisweilen in ein grobes Lachen aus; der Italiener kennt besser das Menschenherz, der Schotte kennt besser die Welt: Beide sind wahre Künstler, jeder groß in seiner Art, und wer sagen wollte, der eine sei größer als der andere, würde gänzlich falsch urteilen, denn sie sind nicht vergleichbar, und die Kunst hat nicht nur eine Seite, zeigt nicht immer das gleiche Gesicht.
Wer empfänglich ist für eine Dichtung voll echten, einfachen, natürlichen Gefühls, wer noch nicht durch die Lektüre moderner, psychologisch verworrener Werke voreingenommen ist, der lese also dieses Buch: es gibt Erquickung und Labsal, wie die Sonne des Südens sie gibt. Ein Ausspruch Goethes über den Roman enthält vielleicht alles, was über ihn zu sagen ist und gesagt werden kann:
»Eine durchaus reife Frucht; und eine Klarheit in der Behandlung und Darstellung des einzelnen wie der italienische Himmel selber.«
Mit diesem Worte übergeben wir diese Neuausgabe der alten Übersetzung (vgl. dazu das Nachwort des Herausgebers) dem Leser. Möge das Werk in dieser Gestalt sich viele neue Freunde werben.
Hamburg, im Januar 1929.
Dr. Hermann Tiemann.
Das Nachwort des Herausgebers
Der vorliegenden Neuausgabe von Manzonis »Die Verlobten« liegt die erste deutsche Übersetzung des Werkes zugrunde, die kurz nach dem Erscheinen des Originals (vgl. die Einleitung, S. 6, Anmerkung) 1827 erschien. Sie stammt aus der Feder von Daniel Lessmann (1794 –1831), der, Historiker und Dichter, auch sonst in der deutschen Literatur als kenntnisreicher, talentvoller Schriftsteller bekannt ist.
Wir haben mit Bedacht diese älteste Übersetzung neueren deutschen vorgezogen. Sie scheint uns in ihrer Sprache dem Stil des Originals am nächsten zu kommen, was kaum wundernehmen kann, da sie ja fast in der gleichen Zeit wie dieses entstanden ist. Schon in dieser Gleichzeitigkeit liegt ein hoher Reiz, der noch dadurch erhöht wird, daß der Stil der Übersetzung von klassischem Gepräge ist. Es ist die Sprache der Zeit des alten Goethe, der den Roman so eingehend gelesen und so sehr bewundert hat (vgl. Einleitung, S. 8). Mag diese Sprache zunächst etwas breit und langatmig erscheinen, man wird sich bald darin eingelesen haben und ihre Schönheiten empfinden. Wir haben uns daher nicht für befugt gehalten, in ihr inneres Gefüge durch zu viele Modernisierungen störend einzugreifen.
Dagegen schien es uns nötig, die manchmal allzu weit auseinandergezogene Handlung etwas zu straffen, maßvoll zu kürzen, ohne dem Ganzen des Kunstwerkes Wesentliches zu nehmen. Von größeren Episoden sind z. B. gestrichen worden die Beschreibung der Hungersnot in Mailand, die der Pest vorangeht, die nähere Beleuchtung von Don Ferrantes und Dame Prassedes Charakteren, eine Lebensbeschreibung des Kardinals Federigo Borromeo und manche Einzelzüge aus der historischen Beschreibung der Pest (im Kapitel 12 des zweiten Teiles), zu deren Kürzung schon Goethe geraten hat. Im übrigen sind nur nebensächliche Züge gekürzt worden. Wir hoffen, daß dieses Verfahren Billigung bei allen findet, die das prachtvolle Werk einem modernen Leserkreis, und zwar dem deutschen, wieder nahebringen möchten.
Dr. H. T.
Erstes Kapitel
Der See von Como erstreckt sich mit dem einen seiner Zweige gegen Süden zwischen zwei Ketten von ununterbrochenen Bergen und bildet an ihrem Fuße eine Menge von Buchten und Busen. Nachdem diese vielfach hervorgetreten und sich wiederum zurückgezogen, verengt er sich plötzlich und nimmt zwischen einem Vorgebirge zur Rechten und einem weiten Gestade zur Linken den Lauf und die Gestalt eines Flusses an. Die Brücke, welche beide Ufer daselbst verbindet, scheint dem Auge diese Umgestaltung des Gewässers noch merkbarer zu machen und die Stelle zu bezeichnen, wo der See endet und die Adda beginnt. Weiterhin aber entfernen sich die beiden Ufer aufs neue voneinander, der Wasserspiegel wird wieder geräumiger und verläuft sich in neue Buchten und Busen; der Fluß ist wieder zum See geworden. Das Gestade, durch die Anschlemmung dreier großer Wassermassen gebildet, senkt sich allmählich und lehnt sich an zwei zusammenhängende Berge, von welchen der eine San Martino, der andere wegen seiner vielen, reihenweis emporragenden Hügelchen, die ihm wirklich Ähnlichkeit mit einer Säge geben, in lombardischer Mundart der Resegone, die große Säge, genannt wird; wer ihn daher unter einem rechten Winkel, wie etwa von Mailands Basteien aus, die gerade im Norden desselben liegen, erblickt, unterscheidet ihn in jener langen und weiten Gebirgsflur angeblich an diesem einfachen Kennzeichen von allen übrigen Bergen, deren Name weniger bekannt, deren Gestalt weniger ausgezeichnet ist.
Eine lange Strecke hindurch erhebt sich das Gestade in langsamer und gleichförmiger Neigung; dann aber steigt es in Hügeln und Tälern, in Anhöhen und Ebenen an, je nachdem die Felsenmasse der beiden Berge oder die Wirkung der Gewässer darauf Einfluß haben. Der äußerste Rand, von den Buchten des Gewässers durchschnitten, besteht fast gänzlich aus Kieselsand und großen Steinen; weiter hinaus erblickt man Felder und Weinfluren, mit Landgütern, Wohnhäusern und Dörfern bedeckt; hin und wieder auch Gebüsche, die sich ziemlich weit bis durchs Gebirge hinauf erstrecken. Lecco, die vorzüglichste Stadt in jener Gegend, welcher sie auch den Namen gibt, liegt am Ufer des Sees, wenig von der Brücke entfernt; bei hochgestiegenem Gewässer befindet sich der Ort sogar zum Teil im See selbst; in unseren Tagen ein ansehnlicher Flecken, welcher sich wahrscheinlich bald zur Stadt vergrößert haben wird. In den Zeiten dagegen, als die Begebenheiten, welche wir zu erzählen unternommen, sich ereigneten, war der ansehnliche Flecken zugleich eine Feste, genoß die Ehre, der Aufenthalt eines Befehlshabers zu sein, und hatte den Vorzug, eine stehende Besatzung von spanischen Soldaten zu beherbergen. Von einem Acker zum andern, von den Anhöhen zum Gestade, von Hügel zu Hügel liefen und laufen noch heute Wege und Fußsteige, bald steil und abschüssig, bald eben und tief, zwischen zwei Mauern verborgen, wo der erhobene Blick nur einen schmalen Streifen der Himmelsdecke oder irgendeine Bergspitze entdeckt; zuweilen ziehen sie sich über offene Hochebenen hin, und von hier aus streift das Auge durch mehr oder weniger umfangreiche Landschaften, die aber, immer mannigfaltig, immer eine neue Aussicht gewähren, je nachdem die verschiedenen Gesichtspunkte einen größeren oder kleineren Teil der Gegend umfassen; je nachdem dieser oder jener Bezirk wechselweise hervortritt oder sich verbirgt, sich eröffnet oder schließt.
Überall der lieblichste Wechsel der Mannigfaltigkeit. Hier erscheint der weite farbenschillernde Spiegel des Wassers in langer Ausdehnung; dort schließt sich der See in blauer Ferne oder verliert sich vielmehr in einer Winkelkluft des Gebirges, in einem tiefen Irrgange der Höhen; allmählich aber gewinnt er wieder Raum zwischen andern Bergen, die sich einer nach dem andern den Blicken entfalten und in umgekehrtem Bilde mit den kleinen Dorfschaften des Gestades vom Wasser abgespiegelt werden; auf jener Seite zeigt sich ein Arm des Flusses, dann ein See, dann aufs neue ein Fluß, in leuchtender Schlangenwindung sich zwischen den Felsen verlierend, welche ihn begleiten und, stufenweis sich senkend, gleichfalls im Nebeldunste des Horizontes sich verlieren. Der Standpunkt, von welchem aus der Wanderer diese mannigfaltigen Schauspiele betrachtet, gewährt selbst auf jeder Seite neue Ausblicke; der Berg, an dessen Abhang man soeben hingewandelt, wechselt bei jedem Schritte mit seinen Gipfeln und Schlünden; was vor wenigen Augenblicken ein einfacher Bergrücken schien, wendet sich unvermutet und spaltet sich in gesonderte Ketten; was kurz zuvor sich an der Seite der Anhöhe darstellte, überrascht plötzlich auf ihrem Gipfel. Dabei mildert das liebliche wirtliche Gepräge dieser Abhänge auf gar anmutige Weise den Ausdruck des Wilden und schmückt um so herrlicher die Pracht der übrigen Aussichten.
Auf einem dieser schmalen Fußwege kehrte am 7. November des Jahres 1628 Don Abbondio, Pfarrer in einer der oben bezeichneten Ortschaften, langsamen Schrittes von seinem Spaziergange am Abend nach Hause; indessen findet sich weder hier noch weiterhin so wenig der Name der Ortschaft wie der Geschlechtsname des Mannes in unserer Handschrift. Er betete ruhig das Brevier und schloß bisweilen zwischen einem Psalm und dem andern das Gebetbuch, indem er als Merkzeichen den Zeigefinger der rechten Hand dazwischenlegte; dann aber hielt er beide Hände auf dem Rücken ineinander, setzte seinen Weg fort, blickte zur Erde und entfernte die Steine, die im Wege als ein Hindernis lagen, mit dem Fuße gegen die Mauer hin. Bald erhob er das Gesicht, ließ die Blicke gemächlich umherschweifen und heftete sie endlich auf den Rücken eines Gebirges, woselbst das Licht der schon verschwundenen Sonne, durch die Spalten des gegenüberliegenden Berges hindurchschießend, in weiten mannigfachen Purpurstreifen sich auf den hervortretenden Massen malerisch lagerte. Nachdem er von neuem das Brevier geöffnet und ein anderes Stück hergebetet, kam er an eine Wendung des Pfades, bei welcher er jedesmal die Augen vom Buche emporzuheben und vor sich hin zu schauen pflegte. So tat er auch diesmal. Nach jener Wendung lief die Straße etwa sechzig Schritte in gerader Richtung fort und teilte sich dann, nach Art eines Ypsilons, in zwei schmale Gassen. Die Gasse zur Rechten zog sich gegen den Berg hinauf und war der Weg, der zur Pfarrei führte; links ging es ins Tal hinab bis zu einem wilden Bache, und hier reichten die Mauern nur bis an die Hüften des Wanderers. Die inneren Mauern der beiden Pfade liefen nicht in einen Winkel zusammen, sondern endigten mit einer kleinen Kapelle, an welcher verschiedene lange, geschlängelte, spitz auslaufende Figuren gemalt erschienen. Der Pfarrer drehte sich seitwärts und wandte, wie er gewöhnlich tat, den Blick nach der Kapelle; da sah er etwas, das er nicht erwartet hatte, etwas, das er nicht hätte sehen mögen. Zwei Männer standen beim Zusammenfluß der beiden Fußpfade, wenn ich so sagen darf, einander gegenüber; der eine saß, als wär' er zu Pferde, auf der niedrigen Mauer, während das Bein nach außen hin in der Luft schwebte und der andere Fuß auf dem Boden des Weges ruhte; sein Gefährte stand aufrecht, an die Mauer gelehnt, die Arme vor der Brust übereinander geschlagen. Die Kleidung, die Gestalt, und was sich sonst von der Stelle aus, wo der Pfarrer stehen blieb, in ihrem Äußern erkennen ließ, verbannte jeden Zweifel über ihren Stand. Beide trugen um den Kopf ein grünes Netz, welches vorn an der Stirne einen gewaltigen Haarbüschel hervorquellen ließ und auf die linke Schulter, in eine große Quaste endigend, herabhing; zwei lange Schnauzbärte, bis zur äußersten Spitze gekräuselt; der Saum des Wamses durch einen Gurt von glänzendem Leder geschlossen, und zwei Pistolen an Haken daran hängend; ein kleines volles Pulverhorn, gleich einem Halsbande vor der Brust schwebend; rechts an den weiten bauschigen Beinkleidern eine Tasche, aus welcher der Griff eines großen Messers hervorblickte; zur Linken ein Degen, dessen großes Gefäß mit glatten und leuchtenden Messingblättchen, zu einem Namenszuge aneinander gefügt, durchbrochen war; – beim ersten Blick ließ sich ein Paar von der Zunft der Bravi erkennen.
Diese Zunft, jetzt gänzlich verschwunden, erfreute sich damals in der Lombardei ihrer glänzendsten Blüte und stammte aus alten Zeiten her. Wer keinen Begriff von ihr hat, dem mögen einige authentische Mitteilungen über ihre vorzüglichsten Kennzeichen, über die Anstrengungen, welche bei ihrer Unterdrückung erforderlich waren, und über ihre widerstrebende üppige Lebenskraft hinreichende Auskunft geben.
Schon am 8. April des Jahres 1583 hatte der erlauchte Don Carlos von Aragonien, Großadmiral und Konnetabel von Sizilien, Statthalter von Mailand und Generalkapitän Seiner katholischen Majestät in Italien, »vollkommen von dem unerträglichen Elend überzeugt, in welchem die Stadt Mailand wegen der Bravi und der Vagabunden gelebt hat und lebt,« eine öffentliche Achterklärung gegen sie erlassen. »Er bestimmt und erklärt, daß in dieser Achterklärung begriffen, als Bravi und Vagabunden angehalten werden sollen alle diejenigen, welche, Ausländer oder Einheimische, kein Gewerbe haben oder, wenn sie eins haben, es nicht treiben; welche kein Gehalt beziehen oder mittelst desselben sich an einen Ritter angeschlossen, an einen Edelmann, einen Beamten oder Kaufmann, dem sie ihre Dienste leisten, oder für welchen sie wirklich, wie es sich vermuten läßt, andern nach dem Leben stellen.« Allen diesen gebot er, binnen sechs Tagen das Land zu räumen, drohte den Widerspenstigen mit der Galeere und erlaubte allen Dienern der Gerechtigkeit, zur Vollziehung seines Befehles, außerordentlich umfassende und unbegrenzte Gewaltmittel. Aber im folgenden Jahre gewahrte er, »daß die Stadt dessenungeachtet voll von Bravi, welche, ohne ihre Weise geändert oder an Zahl abgenommen zu haben, ganz auf dieselbe Art leben, wie sie früher zu leben gewohnt waren,« und so erließ er am 12. April ein zweites Gebot, nachdrücklicher und bestimmter als das erste, worin unter den übrigen Befehlen verordnet ward:
»Daß jedweder, Bürger oder Fremder, von welchem es durch zwei Zeugen erwiesen, daß er als ein Bravo besoldet wird und allgemein dafür gilt, auch wenn er keines bereits begangenen Verbrechens überführt worden ist, vermöge dieses bloßen Rufs eines Bravo, ohne weitere Anzeigen, von jedem der bestallten Richter nach eingereichtem Bericht des Prozesses zum Marterseil und zur Folter bestimmt werden könne; daß er ohne Geständnis eines Verbrechens, bloß weil er ein Bravo heißt und dafür gilt, auf drei Jahre zum Galeerendienste geschickt werde.« Alles dies und manches andere, das hier weggelassen wird, »weil Seine Herrlichkeit in jedem Falle von jedem Gehorsam fordert«.
Beim Widerhall dieser entschlossenen und nachdrucksvollen Worte, von einem so mächtigen Herrn gesprochen und durch solche Drohungen verstärkt, wären alle Bravi, sollte man glauben, für immer verschwunden. Doch das Zeugnis eines nicht weniger glaubwürdigen Herrn von berühmtem Namen überzeugt uns vom Gegenteil. Juan Fernandez de Velasco, Statthalter des mailändischen Staates, ebenso hinlänglich unterrichtet, »welch ein Verderben und Unheil die Bravi und Vagabunden sind, wie diese Gattung von Menschen so höchst nachteilig dem allgemeinen Wohl zuwider wirkt und die Gerechtigkeit hintergeht«, gebot ihnen am 5. Juni des Jahres 1593 unter Wiederholung derselben Befehle und Drohungen gleichfalls, binnen sechs Tagen das Landesgebiet zu räumen. Aber am 23. Mai des Jahres 1598 sah er sich genötigt, wie bei hartnäckigen Krankheiten, die Heilmittel zu schärfen, und »da man bei Tage und bei Nacht von den Bravi nichts weiter höre als vorsätzliche Verwundungen, Raub, Mord und Missetaten aller Art«, sollten die furchtbarsten Hilfsquellen einer strengen Gerechtigkeitsliebe in Tätigkeit gesetzt werden.
Aber die verderbliche Brut der Bravi gedieh und vermehrte sich trotzdem ununterdrückt von Jahr zu Jahr. An ihre Ausrottung dachte endlich Don Juan de Mendoza, gleichfalls Statthalter von Mailand, in vollem Ernste. In dieser Absicht schickte er den königlichen Druckern Pandolfo und Marco Tullio Malatesti die herkömmliche Verordnung, verbessert und erweitert, zu, damit sie dieselbe zur Vertilgung der Bravi öffentlich bekannt machten. Dessenungeachtet lebten diese Bösewichter unausrottbar fort, um im Jahre 1618 das herbere Drohwort des Herzogs von Feria, Don Gomez Suarez de Figueroa, zu hören. Da sie jedoch dadurch ebensowenig wie durch alle früheren Vorkehrungen in ihrem Gewerbe sich hindern ließen, sah sich Don Gonzalo Fernandez de Cordova, unter dessen Regiment jene Heimkehr des Don Abbondio sich ereignete, bewogen, den gewöhnlichen Aufruf gegen die Bravi noch einmal ergehen zu lassen. Dieser erschien am 5. Oktober des Jahres 1627, also etwa dreizehn Monate vor dem Ereignis, dessen Merkwürdigkeit dem Leser bald sich entfalten soll.
Daß die beiden Männer, welche wir oben beschrieben haben, in Erwartung eines Menschen dort standen, begriff sich auf der Stelle; was aber unsrem Don Abbondio gar sehr mißfiel, war, daß verschiedene Gebärden ihm zu verstehen gaben, der Erwartete sei er selbst. Denn bei seinem Erscheinen hatten beide einander angesehen und den Kopf mit einer Bewegung erhoben, aus welcher sich schließen ließ, daß beide zugleich: Er ist es! gesagt hatten. Der eine, der rittlings auf der Mauer saß, hatte sich erhoben und das Bein nach der Straße hingezogen; währenddessen hatte der andere sich von der Mauer entfernt, und beide gingen auf ihn zu. Der Pfarrer hielt das Gebetbuch immer offen vor sich, als wenn er läse, blickte aber dessenungeachtet verstohlen in die Höhe, um die Bewegungen der beiden Kerle zu beobachten, und da er sie geradeswegs auf sich loskommen sah, ergriffen ihn plötzlich tausend verschiedene Gedanken. In aller Eile fragte er sich selbst, ob sich zwischen ihm und den Bravi die Straße zur Rechten oder zur Linken durch einen Ausweg öffne; aber ebenso schnell fiel ihm ein, daß ein solcher nicht vorhanden war. Zugleich stellte er eine schnelle Untersuchung an, ob er vielleicht gegen irgendeinen Gewaltigen, gegen irgendeinen rachsüchtigen Menschen sich ein Vergehen habe zuschulden kommen lassen; bei diesem ängstlichen Nachsinnen beruhigte ihn jedoch das tröstliche Zeugnis seines Gewissens. Die Bravi aber kamen immer näher auf ihn zu und ließen ihn nicht aus den Augen. Don Abbondio legte Zeige- und Mittelfinger der linken Hand in den Kragen seines geistlichen Gewandes, als wollte er ihn wieder in Ordnung setzen; und indem er beide Finger um den Hals herum bewegte, wandte er das Gesicht zurück und sah mit verstohlen blickendem Auge, so weit er konnte, ob von hinten her vielleicht jemand des Weges käme; aber keiner war zu sehen. Er blickte über die niedrige Mauer hinweg, in die Felder – keiner zu finden; und auch auf dem Fußpfade, der vor ihm lag, war außer den Bravi kein menschliches Wesen anzutreffen. Was sollte er tun? Umkehren, dazu war keine Zeit, und sich auf die Beine machen, hieß geradezu die beiden Kerle zum Nachsetzen auffordern. Da er also der Gefahr nicht aus dem Wege gehen konnte, lief er ihr entgegen; die Augenblicke der Ungewißheit hatten so viel Peinliches für ihn, daß er jetzt nichts sehnlicher wünschte, als sie abzukürzen. Er verdoppelte seine Schritte, sagte einen Vers mit lauterer Stimme her, suchte, soviel er konnte, seinem Gesichte den Anstrich der Ruhe und der Fröhlichkeit zu geben, und strengte sich an, ein trauliches Lächeln auf seinen Wangen erscheinen zu lassen. Als er sich darauf dem stattlichen Paare gegenüber befand, sagte er in Gedanken: Da sind wir, und blieb stehen.
»Herr Pfarrer!« sagte einer der beiden, indem er ihm mit starrem Blick ins Gesicht sah.
»Wer will etwas von mir?« fragte Don Abbondio schnell, hob die Augen vom Buche empor und hielt es geöffnet mit beiden Händen vor sich.
»Sie gehen damit um,« begann der andere, mit dem drohenden und entrüsteten Ausdruck eines Mannes, der seinen Untergebenen auf einer Schurkerei ertappt; »Sie gehen damit um, Renzo Tramaglino und Lucia Mondella morgen zu vermählen!«
»So ist's,« antwortete Don Abbondio mit zitternder Stimme, »so ist's.«
»Gut,« antwortete der Bravo mit gedämpfter Stimme, aber im Ton eines Befehles; »diese Vermählung darf nicht vor sich gehen, weder morgen noch jemals sonst.«
»Aber, meine Herren,« nahm Don Abbondio das Wort, mit der sanften und höflichen Stimme eines Menschen, welcher einen Ungeduldigen zu überreden sich bemüht, »belieben Sie sich nur einmal an meine Stelle zu setzen. Wenn die Sache von mir abhinge ... Sie sehen wohl, daß mir nichts daran liegt.«
»Ei was,« unterbrach ihn der Bravo, »wenn die Sache durch Wortgekram ausgemacht werden müßte, so würden Sie uns bald in Grund und Boden schwatzen. Wir wissen nichts davon und wollen auch nichts davon wissen. Ein Mensch, dem man einen Fingerzeig gegeben hat – Sie verstehen uns.«
»Aber die Herren sind viel zu gerecht, viel zu vernünftig –«
»Genug,« fiel ihm hier der andere Gefährte, der bisher kaum eine Silbe gesprochen hatte, ins Wort; »genug, die Vermählung geschieht nicht, oder« – hier stieg ein tüchtiger Fluch in die Höhe – »oder wer sie betreibt, soll sie eben nicht bereuen, weil er keine Zeit dazu haben wird, und« – ein zweiter Fluch –
»Ruhig, ruhig!« rief der erste Redner, »der Herr Pfarrer weiß, wie es in der Welt zugeht; wir aber sind Leute von Ehre, die ihm nichts Böses antun wollen, sobald er sich wie ein vernünftiger Mann benimmt. Herr Pfarrer, Don Rodrigo, unser erlauchter Herr, hält Sie gar hoch in Ehren.«
Der Name wirkte in Don Abbondios Seele wie mitten in einem nächtlichen Sturmgewitter ein Blitzstrahl, welcher plötzlich mit zuckender Helle die Gegenstände beleuchtet und den Schrecken erhöht. Unwillkürlich machte er eine tiefe Verneigung und sagte: »Wenn Sie mir an die Hand zu geben wüßten –«
»Ihnen an die Hand geben, einem Manne, der Latein versteht!« unterbrach ihn der Bravo mit einem Lächeln, in welchem Grobheit und Wildheit sich paarten. »Auf Sie kommt's an. Vor allem aber lassen Sie sich über den Wink, den wir Ihnen zu Ihrem eigenen Besten gegeben haben, nicht einen einzigen Laut entschlüpfen; sonst – es wär' ebenso schlimm, wie die Vermählung vollziehen. Nun, was sollen wir in Ihrem Namen dem erlauchten Herrn Don Rodrigo melden?«
»Meine Achtung.«
»Man erkläre sich, Herr Pfarrer!«
»Jederzeit – werde ihm jederzeit gehorsam sein!« Und indem er diese Worte aussprach, wußte er eigentlich selbst nicht, ob er ein Versprechen von sich gab oder bloß eine alltägliche Redensart der Höflichkeit hinwarf. Die Bravi nahmen sie in einem ernsteren Sinne, oder zeigten ihm wenigstens, daß sie sie so nahmen.
»Sehr schön,« sagte der eine, indem er mit seinem Gefährten sich auf den Weg machte; »gute Nacht, Herr Pfarrer!«
Don Abbondio, welcher wenige Minuten vorher ein Auge seines Kopfes drum gegeben hätte, ihnen aus dem Wurf zu kommen, würde jetzt das Gespräch und die Unterhandlung gar gern weiter fortgesetzt haben. – »Meine Herren!« rief er, indem er das Gebetbuch mit beiden Händen schloß – das Paar aber hörte nicht weiter auf ihn, es nahm die Straße, daher er gekommen war, und entfernte sich, indem es ein Lied sang, das wir eben nicht mitteilen möchten. Der arme Pfarrer blieb einen Augenblick wie bezaubert mit offenem Munde stehen, dann machte auch er sich auf den Weg und schlug die Straße ein, die nach seinem Hause führte. Als wären seine Füße vom Krampfe gelähmt, zog er den einen mit Anstrengung dem andern nach; in welcher Gemütsstimmung er sich aber befand, wird der Leser leichter einsehen, sobald er von der Sinnesart des Mannes und von den Zeitumständen, darin er lebte, ein Näheres erfahren hat.
Don Abbondio – der Leser wird es wohl selbst bereits gemerkt haben – hatte keineswegs das Herz eines Löwen mit auf die Welt gebracht. Seit seinen frühesten Jahren aber mußte es ihm einleuchten, daß in jenen Zeiten ein Geschöpf ohne Krallen und Hauer, welches bei alledem keine Neigung, sich verschlingen zu lassen, verspürte, sich in der verfänglichsten Lage befand. Einen ruhigen harmlosen Menschen, der andern Furcht einzujagen sonst keine Mittel hatte, schirmte die Kraft der Gesetze in keiner Hinsicht. Es fehlte nicht eben gegen gewalttätige Schritte einzelner Bürger an Gesetzen und Strafen, haufenweise vielmehr wurden die Verordnungen erlassen; die Verbrechen waren aufgezählt und mit der kleinlichsten Weitschweifigkeit voneinander gesondert; die töricht übertriebenen Strafen konnten bei jedem einzelnen Falle nach Gutbefinden des Gesetzgebers und seiner hundert Vollstrecker geschärft werden; um das gerichtliche Verfahren bekümmerte man sich nur insofern, als es den Richter beim Ausspruch eines verdammenden Urteils von jedem Hindernis befreite; die Probestellen, welche wir von den Verordnungen gegen die Bravi mitgeteilt haben, liefern ein kleines, aber treues Beispiel. Nichtsdestoweniger, und zum Teil gerade aus dieser Ursache, hatten jene wiederholten und verstärkten Verordnungen der verschiedenen Statthalter keinen andern Nutzen, als die Ohnmacht der Befehlshaber in ihrer traurigsten Blöße zu enthüllen. Die Straflosigkeit hatte sich vollkommen ausgebildet; die Wurzeln ihres Wachstums berührte kein Befehl, konnte kein Befehl ausrotten. Wer, bevor er eine Missetat beging, seine Maßregeln getroffen hatte, um zur rechten Zeit sich in ein Kloster, in einen Palast zu flüchten, wohin kein Häscher jemals den Fuß zu setzen gewagt hätte; wer, ohne alle weiteren Schutzmittel, eine Livree trug, um derentwillen die Eitelkeit und der Vorteil einer mächtigen Familie, eines ganzen Geschlechtes seine Verteidigung auf sich nehmen zu müssen glaubten, der war bei allen seinen Handlungen frei und durfte über das Geschrei der öffentlichen Verordnungen sich lustig machen. Von denjenigen, welche sich erlaubten, solche Schandtaten verüben zu lassen, gehörten einige durch ihre Geburt zu den bevorrechteten Ständen, andere hingen durch Schutzverhältnis mit ihnen zusammen; diese wie jene hielten durch Erziehung, Eigennutz, Gewohnheit und Nachahmung die einmal angenommenen Grundsätze fest und hüteten sich gar sehr, sie eines Stück Papieres wegen, das an den Straßenecken angeheftet hing, zu verletzen. Wenn nun auch die Menschen, welche die unmittelbare Ausführung auf sich nahmen, unternehmend wie Helden, gehorsam wie Mönche und ergeben wie Märtyrer gewesen wären, so hätten sie dennoch eigentlich nichts durchsetzen können; sie waren der Zahl, mit welcher sie ihren Kampf begannen, nicht gewachsen und mußten oft gewärtig sein, von den eigenen Herren, die ihnen ihre Schritte vorgeschrieben, verlassen und selbst aufgeopfert zu werden.
Wer zu beleidigen gedenkt oder jeden Augenblick beleidigt zu werden fürchtet, beide sehen sich begreiflicherweise nach Verbündeten und Gehilfen um. Daher in jenen Zeiten das Bestreben der einzelnen, in Ständen sich verbrüdert zu halten, aufs höchste gestiegen war; man trat zu neuen Verbrüderungen zusammen, und derjenigen, welcher er angehörte, suchte jeder die ausgedehnteste Macht zu verschaffen. Mit wachsamer Sorgfalt verteidigte und erweiterte die Geistlichkeit ihre Steuerfreiheit, der Adel seine Vorrechte, der Kriegerstand die Ausnahmen, die ihm in der allgemeinen Pflichtleistung gestattet waren. Kaufleute und Handwerker waren in Zünfte und Brüderschaften eingeschrieben, die Rechtsgelehrten bildeten einen Bund, selbst die Ärzte hielten sich in eigener Gesellschaft zusammen. Jede dieser kleinen Oligarchien besaß ihre besonderen Kräfte; in einer jeden fand der einzelne seinen Vorteil darin, nach Verhältnis seines Ansehens und seiner Gewandtheit die Kräfte vieler zu seinem Besten in Tätigkeit zu setzen. Die Redlichen bedienten sich dieses Vorteils zu ihrer Verteidigung; die Schlauen und Ruchlosen benutzten ihn zur Vollführung schurkenhafter Streiche, zu welchen ihre persönlichen Mittel allein nicht hingereicht hätten, und stellten sich zugleich gegen jede Bestrafung sicher. Indessen fand in den Kräften dieser verschiedenen Genossenschaften eine bedeutende Ungleichheit statt; auf dem offenen Lande besonders umgab sich der reiche und gewaltsüchtige Edelmann mit einer Schar von Bravi, mit Landleuten, welche durch verjährte Herkömmlichkeit, durch Eigennutz oder Zwang sich als die Untergebenen und die Streiter des Herrn betrachteten; und so übte er eine Gewalt, welcher keine jener andern Brüderschaften so leicht Widerstand zu leisten vermochte.
Unser Abbondio, weder adlig noch reich oder mutig, kam sich also, bei seinem Austritt aus den Kinderjahren schon, unter jenem Menschengeschlechte wie ein Gefäß von gebrannter Erde vor, welches mit vielen andern eisernen Gefäßen gleichen Schritt halten soll. Daher hatte er sich seinen Eltern, die ihn zum Priester machen wollten, recht gern gehorsam erwiesen. Die Wahrheit zu gestehen, hatte er über die Pflichten und die edlen Zwecke des Amtes, welchem er sich widmete, nicht eben allzu reiflich nachgedacht; sich ein ziemlich behagliches Leben zu sichern, in einen ehrwürdigen und begründeten Stand sich zu erheben, das waren ein paar Gründe, welche in seinen Augen solch eine Wahl mehr als hinlänglich rechtfertigten. Aber jeder Stand sorgt für den einzelnen und sichert ihn bis zu einem gewissen Punkte nur; keiner überhebt ihn des Geschäftes, sich seinen eigenen Lebensplan zu entwerfen. Don Abbondio, fortwährend nur mit dem Gedanken an die Sicherstellung seines Daseins beschäftigt, kümmerte sich wenig um jene Vorteile, deren Erlangung es nötig macht, daß der Mensch sich rüstig anstrenge oder ein wenig zu Gelde zu kommen suche. Allen Zwist zu vermeiden und, wenn er ihn nicht vermeiden konnte, bescheiden nachzugeben, darin bestand vorzüglich das System des Pfarrers. In allen Kämpfen, die um ihn her losbrachen, suchte er eine unbewaffnete Neutralität zu behaupten; es mochten Feindseligkeiten sein, wie sie damals zwischen der Geistlichkeit und den weltlichen Gewalten gar häufig stattfanden, es mochten Fehden der Beamten mit dem Adel, des Adels mit der Obrigkeit, der Bravi mit den Soldaten oder Händel zweier Bauern sich ereignen, durch ein Wort entstanden, durch die Faust oder das Messer entschieden. Mußte er notwendigerweise zwischen zwei Widersachern Partei ergreifen, so hielt er sich auf der Seite des Stärkeren, wiewohl jedesmal im Hintertreffen, und gab sich Mühe, dem andern begreiflich zu machen, daß er keineswegs aus freien Stücken sein Gegner sei; es war, als wenn er ihm sagte: Aber warum habt Ihr es nicht verstanden, der Stärkere zu sein? Ich stände unfehlbar auf Eurer Seite jetzt. – Von den Übermächtigen hielt er sich weit entfernt; er schien die Beleidigungen ihrer vorübergehenden Launen nicht zu bemerken, nahm diejenigen, die ihm mit ernster besonnener Absicht angetan wurden, mit Unterwürfigkeit auf, nötigte durch Bücklinge und gefällige Ehrfurcht selbst den zornsüchtigen Gesellen und den Murrköpfen, wenn sie ihm unterwegs begegneten, ein Lächeln ab; und so war der arme Mensch, ohne gewaltsame Stürme, glücklich über die Sechzig hinausgeschifft.
Zwar hatte auch er sein Teil Galle an der Leber hängen; diese beständige Übung im Dulden, diese Selbstverleugnung, mit welcher er andern jederzeit recht gab, so viele bittere hinuntergeschluckte Bissen, ohne sich zu äußern, hatten selbst sein sanftes Gemüt zur Heftigkeit gereizt, und seine Gesundheit würde gewiß darunter gelitten haben, wenn er nicht hin und wieder eine Gelegenheit, seinem Herzen Luft zu machen, festgehalten hätte. Gab es doch auf Erden und in seiner eigenen Umgebung Leute, von deren Unfähigkeit, Böses zu stiften, er überzeugt war; gegen diese durfte er bisweilen der bösen, lange angehäuften Laune eine Ergießung gestatten, durfte seinerseits auch einmal den Grillenfänger spielen und ohne Ursache schreien. Dabei war er ein strenger Tadler der Leute, die nicht nach seinen Ansichten lebten; doch mußte sich der Tadel ohne die entfernteste Gefahr aussprechen lassen. Wer Schläge bekommen, war in seinen Augen wenigstens ein Unkluger; und ein Gemordeter hatte sich im Leben immer als ein unruhiger Tollkopf benommen. Jedem, welcher sein Recht gegen einen Mächtigen behauptete und mit wundem Kopf aus dem Handel gekommen war, wußte Don Abbondio beständig ein Unrecht zu finden; und das war nicht schwer, denn Recht und Unrecht sind nie durch einen so glatten Schnitt gesondert, daß jeder Teil sich durchaus nur im Besitz des einen befände. Vorzüglich aber predigte er gegen diejenigen unter seinen Amtsbrüdern, welche mit eigener Gefahr einen schwachen Unterdrückten wider einen mächtigen Bedränger in Schutz zu nehmen suchten. Das heißt, pflegte er zu sagen, für bares Geld sich Händel kaufen und den Dachshunden die Beine gerade drehen wollen; ja er behauptete ernstlich, das sei eine Teilnahme an weltlichen Dingen, worunter die Würde des heiligen Amtes leide.
Mögen sich demnach meine paar Leser einmal vorstellen, welchen Eindruck das Ereignis, das eben erzählt worden, auf das Gemüt des armen Mannes machen mußte. Das Schreckliche, das aus jenen unheimlichen Gesichtern, aus jenen grausenvollen Worten sprach, die Drohung eines Herrn, der nicht vergebens zu drohen pflegte, das System eines ruhigen Lebens, welches so viele Jahre hindurch mit Fleiß und Geduld erkauft worden, in einem Augenblick zerrüttet; ein enger Weg, durch welchen nur mit gefährlicher Beschwerde zu kommen war, ein Weg, dessen Ende das Auge nicht sah, alle diese Gedanken trieben sich summend in Don Abbondios gesenktem Kopfe umher. – »Wenn Renzo sich durch ein glattes Nein ruhig abspeisen ließe, gut; aber er wird Gründe wissen wollen, und was, um Himmels willen, kann ich ihm antworten? Ei, auch der hat einen Kopf; ein Lamm, wenn keiner ihn anpackt, aber wenn einer ihm zu widersprechen meint... Und dann, und dann in diese Lucia vergafft, verliebt wie... Junge Burschen, die sich verlieben, weil sie nicht wissen, was sie sonst anzufangen haben; wollen sich verheiraten und denken an nichts weiter, scheren sich wenig um die Not, die sie einem armen ehrlichen Manne auf die Schultern packen...« Hier aber ward er inne, daß solche Gedanken keine Spur einer frommen Gesinnung an sich trügen, und so wandte er seine ganze Entrüstung gegen jenen andern, welcher ihn soeben um seinen Frieden gebracht hatte. Nur dem Ansehen und dem Namen nach kannte er Don Rodrigo; noch hatte er nie etwas mit ihm zu schaffen gehabt, als daß er die wenigen Male, da er ihm auf der Straße begegnet war, das Kinn mit der Brust und die Spitze seines Hutes mit der Erde sich berühren ließ. Bei mehr als einer Gelegenheit hatte er gegen verschiedene Leute, die mit leiser Stimme, seufzend und die Augen zum Himmel erhoben, irgendeine Handlung jenes Herrn verwünschten, seinen Ehrenruf verteidigt und ihn wohl hundertmal einen achtungswerten Edelmann genannt. Jetzt aber gab er ihm im Herzen alle jene Titel, welche er aus dem Munde der andern niemals hatte hören können, ohne mit einem hastigen: Warum nicht gar! dazwischenzufahren.
Nachdem er im Gewirre dieser Gedanken an die Türe seines Hauses gekommen war, welches am Ende des Dörfchens stand, steckte er den Schlüssel, den er schon in der Hand hatte, eilig ins Schloß, öffnete, trat hinein und schloß sorgsam wieder hinter sich zu. Voller Sehnsucht, eine treue Seele um sich zu wissen, rief er augenblicklich: »Perpetua! Perpetua!« und begab sich nach dem kleinen Saale, wo sie unfehlbar sich eben aufhalten mußte, um den Tisch fürs Abendessen zu decken. Perpetua war, wie jeder merkt, die Haushälterin unseres Pfarrers, eine treue anhängliche Dienerin, welche je nach den Umständen zu gehorchen und zu befehlen verstand, die Murrköpfigkeit und die Grillenfängerei ihres Herrn zur rechten Zeit ertrug und ihn dahin gebracht hatte, daß er seinerseits auch ihre Launen sich gefallen ließ. Diese nahmen allerdings von Tag zu Tag an Zahl zu; denn sie hatte das hochmündige Alter von vierzig Jahren durchlebt und sich dabei in ehelosem Stande gehalten, weil sie alle Vorschläge, die ihr gemacht worden, wie sie behauptete, zurückgewiesen, oder weil kein Hund, wie ihre Freundinnen sagten, auf den Einfall geraten, sich um ihre Hand zu bewerben.
»Ich komme!« sagte Perpetua, indem sie Don Abbondios kleine geliebte Weinflasche auf den Tisch an ihren herkömmlichen Platz stellte und sich langsam in Bewegung setzte. Sie hatte aber die Schwelle des kleinen Saales noch nicht berührt, als er schon mit so wildem Schritte hineintrat, mit einem so finsteren Blicke und einem so verwirrten Gesichte, daß es nicht einmal der geprüften Augen seiner Perpetua bedurfte, um beim ersten Zusammentreffen schon die Entdeckung zu machen, ihm sei etwas ganz Außerordentliches begegnet.
»Barmherziger Himmel! Was fehlt Ihnen, lieber Herr?«
»Nichts, gar nichts,« erwiderte Don Abbondio und warf sich, schwer Atem holend, in seinen großen Lehnstuhl.
»Wie, nichts? Und das wollen Sie mir einreden? Was das für eine Unfreundlichkeit ist! Irgendein großes Ereignis ist vorgefallen.«
»Um Himmels willen! Wenn ich sage, nichts, so ist es nichts, oder etwas, das ich nicht sagen kann!«
»Das Sie auch mir nicht einmal sagen können?« fragte Perpetua. »Wer wird sich denn sonst um Ihr Bestes kümmern? Wer soll Ihnen einen guten Rat geben?«
»Weh mir! Schweig und mache mir nichts weiter zurecht; nur einen Becher von meinem Wein gib mir.«
»Und Sie wollen mir einreden, daß Ihnen nichts fehlt!« sagte Perpetua, füllte den Becher und hielt ihn dann in der Hand, als sollte er der Lohn der vertraulichen Eröffnung sein, die sie so sehnlich erwartete.
»Gib her, gib her!« rief Don Abbondio, nahm den Becher mit halbzitternder Hand und leerte ihn rasch.
»Sie wollen mich also wirklich so weit bringen,« nahm die Haushälterin das Wort, »daß ich hier und dort herumfragen muß, was für ein Zufall meinem Herrn in den Weg gekommen sei?«
»Um Himmels willen,« rief der Pfarrer, »mach mir kein Geklatsch, mach mir kein Geschrei; es steht ... es steht das Leben auf dem Spiel.«
»Das Leben?«
»Das Leben,« antwortete Don Abbondio.
»Sie wissen recht gut,« meinte die Dienerin, »sooft Sie mir noch etwas aufrichtig im Vertrauen mitgeteilt haben, ist's nimmermehr« – »Ei freilich,« unterbrach sie ihr Herr; »zum Beispiel als« –
Perpetua fühlte, daß sie eine falsche Saite angeschlagen hatte. Sie änderte also rasch den Ton und sagte mit einer bewegten Stimme, die zugleich bewegen sollte: »Herr Pfarrer, ich bin Ihnen seit Menschengedenken von Herzen ergeben gewesen, und wenn ich jetzt gern etwas erfahren möchte, so geschieht's aus Eifer, weil ich Ihnen zu Hilfe kommen, Ihnen einen guten Rat geben, Ihren Mut wieder aufrichten will.«
Gewiß ist's, daß Don Abbondio fast ebenso große Neigung verspürte, sich seines plagenden Geheimnisses zu entledigen, wie Perpetua, es in Empfang zu nehmen; nachdem er also immer schwächer ihre neuen gesteigerten Angriffe zurückgeschlagen, nachdem er sie mehr als einmal hatte schwören lassen, daß sie nicht einen Laut davon in die Welt flüstern würde, erzählte er ihr endlich das traurige Ereignis. Jeden Augenblick gab es eine Unterbrechung, war ein »Weh mir!« zu hören. Als man darauf beim schrecklichen Namen des Herrn stand, welcher den Auftrag gegeben, mußte sich Perpetua durch einen neuen, weit feierlicheren Eid zur Verschwiegenheit verpflichten, und da er den Namen ausgesprochen, wandte sich Don Abbondio nach der Lehne seines Sessels zurück, hob die Hände, als gelte es zugleich einen Befehl und eine Bitte, und rief: »Um des Himmels willen, Perpetua!««
»Jesus Maria!« rief diese. »O, was für ein Schurke! Was für ein listiger Betrüger! Ein Mensch ohne alle Gottesfurcht!«
»Willst du dein Maul halten,« fiel ihr der Pfarrer in die Rede, »oder willst du mich ganz und gar zugrunde richten?«
»Ei, wir sind hier allein, keine Seele hört uns. Aber wie werden Sie es nun mit der Sache halten, armer guter Herr?«
»O, da seh' einer,« sagte Don Abbondio mit einer Stimme, die ziemlich nach Grimm klang, »da seh' einer den schönen Rat, den mir die Person zu geben weiß! Sie fragt mich, was ich tun werde, was ich tun werde; gerade als steckte sie in der Klemme, und ich hätte es auf mich genommen, sie wieder herauszuarbeiten.«
»Aber,« bemerkte Perpetua, »ich hätte wohl auch meinen geringen Rat Ihnen an die Hand zu geben, aber dann –«
»Aber dann? Laß hören.«
»Mein Rat wäre,« lautete Perpetuas Eröffnung, »sintemal alle Leute sagen, daß unser Erzbischof ein heiliger Mann ist und ein Herr, der das Herz an der rechten Stelle hat und der sich vor greulichen Gesichtern nicht fürchtet, so wird's ihm auch eine Freude machen, wenn er einen Pfarrer gegen solche Unheilbringer unter seine Flügel nehmen kann; mein Rat wäre also. Sie schrieben ihm einen hübschen Brief und setzten ihm darin auseinander, wie –«
»Wirst du schweigen? Wirst du schweigen? Ist das ein Rat, den man einem armen Manne gibt? Wenn ich eine Flintenkugel in das Rückgrat bekäme, Gott steh' mir bei, würde sie mir der Erzbischof wieder herausschaffen?«
»Eh, die Flintenkugeln werden nicht mir nichts, dir nichts verschenkt wie gebrannte Mandeln, und weh der Welt, wenn diese Hunde sooft bissen, wie sie bellten! Ich habe immer gesehen, daß ein Mensch, der die Zähne zu weisen versteht, sich in Achtung setzt. Und gerade weil Sie nie Ihre Gründe angeben mögen, ist es so weit mit uns gekommen, daß alle uns auf den Hals laufen, mit einer Keckheit –«
»Willst du schweigen?«
»Den Augenblick. So viel aber ist gewiß, daß, wenn die Welt einen sieht, der immer und bei jedem Zusammentreffen sich duckt und die Segel –«
»Willst du schweigen?« rief Don Abbondio. »Es ist gerade jetzt Zeit zu solchen Lumpereien!«
»Genug, Sie werden die Nacht darüber nachdenken. Unterdessen aber tun Sie sich nicht selber weh und bringen Sie sich nicht um die Gesundheit. Essen Sie einen Bissen.«
»Ich werde darüber nachdenken,« entgegnete der Pfarrer mürrisch, »ich werde darüber nachdenken, ich habe darüber nachzudenken. – Ich genieße nichts,« sagte er, indem er aufstand, »nichts; der Kopf steht mir nicht danach. Ich weiß selbst, daß ich darüber nachzudenken habe. Aber mir, mir mußte das passieren!«
»Nehmen Sie wenigstens hier das Schlückchen noch,« sagte Perpetua und kredenzte ihm ein zweites Glas. »Sie wissen, das bringt Ihnen immer den Magen wieder in Ordnung.«
»Ei, ich brauch' ein anderes Pflaster, ein ganz anderes Pflaster!«
Bei diesen Worten nahm er das Licht und brummte fortwährend vor sich hin. »Eine lumpige Kleinigkeit! Einem ehrlichen Manne wie mir! Und wie wird's morgen gehen?« Unter diesen und ähnlichen Klagen zog er sich in seine Schlafkammer zurück. An der Schwelle stand er einen Augenblick still, wandte sich nach der Haushälterin um, legte den Zeigefinger an die Lippe und sagte mit langsamer, feierlicher Stimme: »Um Himmels willen, Perpetua!« So ging er schlafen.
Zweites Kapitel
Der Prinz von Condé ruhte, wie erzählt wird, während der Nacht, welche dem Tage von Rocroy vorherging, in tiefem Schlafe; indessen war er teils durch Anstrengungen sehr ermüdet, teils hatte er bereits alle nötigen Vorkehrungen getroffen und ausführlich angegeben, was am nächsten Morgen geschehen sollte. Unser Don Abbondio dagegen wußte für jetzt noch nichts weiter, als daß morgen ein Tag der Schlacht sein werde, und so war's kein Wunder, wenn ein großer Teil der Nacht in ängstlichen Beratschlagungen zugebracht wurde. Sich weder um die schurkenhafte Zumutung noch um die Drohungen zu kümmern und die Vermählung zu vollziehen, war ein Ausweg, welchen er nicht einmal in Erwägung ziehen mochte. Das Ereignis dem Renzo vertrauen und mit ihm vereinigt nach irgendeinem Mittel sich umsehen – der Himmel steh' uns bei! »Lassen Sie sich keine Silbe entschlüpfen, sonst –!« hatte der eine der beiden Bravi gesagt, und während dem guten Don Abbondio dieses schauerliche Sonst im Kopfe nachsummte, scheute er nicht bloß, solch eine Vorschrift zu überschreiten, sondern bereute auch schon, mit Perpetua nur davon geplaudert zu haben. Fliehen? Wohin? Und hernach? Wie viele Verwicklungen! Wieviel Rechenschaft zu geben!





























