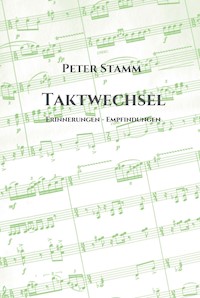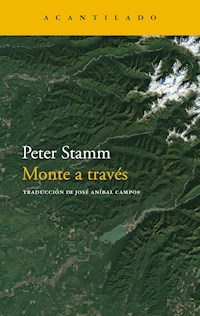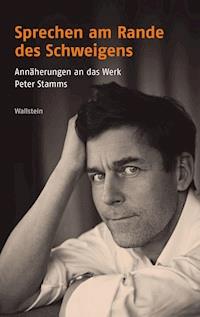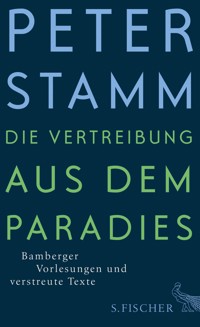
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Peter Stamm über das eigene Schreiben Im Sommer 2014 hält Peter Stamm die Bamberger Poetikvorlesungen. Zum ersten Mal erzählt er vom Erzählen, versucht eine Antwort zu finden auf die Frage, was er da eigentlich tut. Diese Frage führt ihn zurück in das Paradies seiner Kindheit und Jugend, zurück an die Anfänge seines Schreibens und zu den Fragen nach dem Leben überhaupt, den Fragen, die so fruchtbar sind für die Literatur: »Der Text ist (…) oft der Weg«, schreibt er, »den man beim vergeblichen Suchen nach der Antwort zurücklegt.« Stamm gibt uns Einblicke in sein Denken und Schreiben, als wäre eine Poetikvorlesung eine Geschichte, die erzählt werden will. Zahlreiche bisher nur verstreut veröffentlichte poetologische, journalistische und essayistische Texte ergänzen den Band.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Peter Stamm
Die Vertreibung aus dem Paradies
Bamberger Vorlesungen und verstreute Texte
Über dieses Buch
Peter Stamm über das eigene Schreiben
Im Sommer 2014 hält Peter Stamm die Bamberger Poetikvorlesungen. Zum ersten Mal erzählt er vom Erzählen, versucht eine Antwort zu finden auf die Frage, was er da eigentlich tut. Diese Frage führt ihn zurück in das Paradies seiner Kindheit und Jugend, zurück an die Anfänge seines Schreibens und zu den Fragen nach dem Leben überhaupt, den Fragen, die so fruchtbar sind für die Literatur: »Der Text ist (…) oft der Weg«, schreibt er, »den man beim vergeblichen Suchen nach der Antwort zurücklegt.« Stamm gibt uns Einblicke in sein Denken und Schreiben, als wäre eine Poetikvorlesung eine Geschichte, die erzählt werden will.
Zahlreiche bisher nur verstreut veröffentlichte poetologische, journalistische und essayistische Texte ergänzen den Band.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
© Peter Stamm
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Christoph Eberle/plainpicture
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403053-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Bamberger Poetikvorlesungen 2014
I – Die Vertreibung aus dem Paradies
II – Das wiedergewonnene Paradies
III – Lehr- und Wanderjahre
IV – »Work in Progress«
Verstreute Texte
Journalistische Texte
Ich setze also meine Studien fort
Nur die Vergessenen sind wirklich tot
Nachtzüge
»Man hat es nun mal und muss damit fertig werden«
Taxi zum Eismeer
Ist es ein Mensch? Ist es ein Tier? Ist es ein Ding?
»Die Sensationen dieser Welt«
Eine Geschichte der Dunkelheit
»... und niemand, niemand weiß, was einem jeden bevorsteht ...«
Endstation Zürich
Lesen und schreiben
In fremden Gärten
Mein Stil
Fenster in andere Welten
Eine Todesanzeige
»Sandras Verhalten ist mir schleierhaft.«
Von Schweinen und Menschen
Die schlimmstmögliche Wendung einer Geschichte
»I’ll hum it for you ...«
Das Theater der Lebenden
Man nehme ...
»Ankleben verboten!« –
Kunst und Künstler
Für immer
Der erinnerte Besuch
Nie ist die Nacht so dunkel wie in der Kindheit
Eine Erzählung aus Fleisch
Gedanken und Reisen
Wie ich die Armee abschaffte
Deutschland. Ein Wintermärchen
»Ich kann nicht lieben, weil ich will«
Ein kurzer Bericht von einer weiten Reise
Das Land ohne Eigenschaften
Wie hoch sind die Berge?
Das Loch in der Wand der Stube
Die vergessenen Opfer des Bergbaus
Pilger und Kreuzfahrer
Mein Winterthur
Krauts
»Ein Dorf brauchst du«
Nur etwas stiller
Quellennachweis
In den Vorlesungen zitierte Texte
Journalistische Texte
Lesen und schreiben
Kunst und Künstler
Gedanken und Reisen
Bamberger Poetikvorlesungen 2014
I – Die Vertreibung aus dem Paradies
15.5.2014
Dieser Ort könnte aus einem – vermutlich nicht sehr guten – Roman stammen: ein altes, geschmackvoll renoviertes Bauernhaus in den Hügeln der Toskana, eine Stunde östlich von Florenz. Die Wände des Hauses sind von blühendem Jasmin und von Lupinen überwuchert. Hinter der hohen Mauer, die das Grundstück umgibt, liegt der weitläufige Garten, eine Wiese, auf der Rosenbüsche und Olivenbäume wachsen, begrenzt von einem steil abfallenden Bambushain, durch den eine Steintreppe hinunter zum Pool führt. Etwas abseits steht ein alter, ausgebauter Wachtturm, in dessen erstem Stock sich meine Zimmer befinden. Morgens um neun, während ich dabei bin, in der großen dunklen Küche, im Erdgeschoss des Turms, Kaffee zu kochen, bringt Nadia, die rumänische Putzfrau, frisches Brot. Das Mittagessen um zwei wird bei diesem heißen Wetter wohl wieder auf der überdachten Terrasse neben dem Schwimmbecken eingenommen. Bis dahin wird niemand mich stören. Den ganzen Vormittag lang sitze ich unter einer Laube vor dem Turm, der Blick geht über bewaldete Hügel und kleine Dörfer in der Ferne. Dann und wann huscht eine Eidechse vorüber oder einer der vier Hunde trottet vorbei und wirft mir aus den Augenwinkeln einen scheelen Blick zu. In der Ferne ruft ein Kuckuck, Bienen erfüllen die Luft mit einem stetigen Summen.
Ich befinde mich seit einer Woche in Santa Maddalena, dem Heim von Gregor von Rezzori, einem Schriftsteller aus der Bukowina, der dieses Anwesen zusammen mit seiner Frau, der Contessa Beatrice Monti della Corte, in den sechziger Jahren kaufte. Beatrice hatte zuvor eine einflussreiche Galerie in Milano geführt, kannte Alberto Giacometti, Marcel Duchamp, Henri Cartier-Bresson. Sie stellte als Erste in Italien die jungen Künstler jener Zeit aus, mit denen sie auch befreundet war, Francis Bacon, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Mark Rothko. Berühmte Schriftsteller und Künstler gingen im Haus ein und aus. Nach dem Tod ihres Mannes 1998 gründete Beatrice eine Stiftung und fuhr fort, Autorinnen und Autoren einzuladen, damit sie in Ruhe schreiben konnten und ihr bei den Mahlzeiten Gesellschaft leisteten. Die meisten Gäste stammen aus angelsächsischen Ländern.
Man kann sich nicht um einen Aufenthalt in Santa Maddalena bewerben, man bekommt irgendwann eine E-Mail von Beatrice, in der sie schreibt, sie habe einige Bücher von einem gelesen und Gefallen daran gefunden, ob man einen Monat bei ihr, mit ihr, in der Toskana verbringen wolle. Einem Ort, wo – wie der Pulitzerpreisträger Michael, einer der anderen Gäste, sagt – privilegierte Autoren noch mehr privilegiert werden. Außer uns beiden ist Alba hier, Tochter eines berühmten jüdischen Malers, die vor kurzem ein Buch über ihre Kindheit in Paris veröffentlicht hat, Javier, ein junger spanischer Autor und eine Art Assistent von Beatrice, und Emma, eine noch jüngere Amerikanerin aus guter Familie, die früher für Beatrice gearbeitet hat und jetzt zu Besuch da ist. Zu den Mahlzeiten kommen oft Nachbarn oder Freunde des Hauses vorbei, Bernardo Bertolucci gehört dazu und Isabella Rossellini. Am Wochenende, bei einer großen Gartenparty, war neben der Florentiner Hautevolee auch Volker Schlöndorff hier, dem früher das Nachbarhaus gehörte.
Während meiner ersten Tage in Santa Maddalena korrigierte ich die Fahnen meines neuen Romans, eine leichte Arbeit, die mehr Konzentration als Kreativität erforderte. Nachdem ich die letzten Änderungen an den Verlag geschickt hatte, begann jene seltsame Zeit zwischen zwei Projekten, während der alles offen ist. Woran arbeite ich als Nächstes? Stelle ich eine Erzählsammlung zusammen? Schreibe ich einen Roman? Wovon wird er handeln? Manche Autoren fürchten diese Zeit, ich liebe sie. Die Kunst besteht darin, im richtigen Moment mit der Arbeit zu beginnen. Entscheidet man sich zu schnell und unüberlegt, kann es passieren, dass man nach einigen Monaten, nach einem Jahr, die Reise abbrechen muss, weil sie zu keinem Ziel führt. Entscheidet man sich zu spät, kommt man leicht ins Zaudern, und plötzlich scheint jede Idee gleich tauglich, und man kann sich für keine mehr entscheiden. Oder man hat so lange an einem Projekt herumgedacht, dass eine weitere Beschäftigung damit nichts Überraschendes mehr verspricht und einen langweilt. Ich beschließe, diese Poetikvorlesung zu schreiben, auch wenn ich sie erst in einem Jahr halten werde. Ich arbeite nicht gern unter Druck, und ich möchte mein nächstes Prosaprojekt nicht unterbrechen müssen, wenn die Zeit plötzlich knapp wird. Außerdem finde ich es angemessen, eine Vorlesung, die ich im Frühling halten werde, auch im Frühling zu schreiben.
Ich beginne mit einem Ort. Ich habe über die Jahre gelernt, dass jeder Text einen ganz konkreten Ort haben muss, selbst wenn dieser im Text keine große Rolle spielt. Der Ort bildet die gesättigte Lösung, in der sich der Kristall des Textes bildet. Jetzt brauche ich nur noch einen Kristallisationskern, an dem sich die Moleküle anlagern können.
»Wer erzählt, hat eine Frage«, sagte Judith Kuckart vor einigen Jahren in ihrer Essener Poetikvorlesung. Am Anfang meiner Texte steht oft eine Frage. Jene, die am Anfang von »Sieben Jahre«, meinem vierten Roman, stand, war: »Hat jemand Macht über mich, der mich liebt, auch wenn ich ihn nicht liebe?« Eine der Fragen hinter meinem letzten Roman, »Nacht ist der Tag«, lautete: »Welche Beziehung besteht zwischen meiner Persönlichkeit und meinem Äußeren?« Ich habe mir diese Frage immer wieder gestellt. Den ersten Text, der auf ihr beruht, schrieb ich vor zwanzig Jahren, ein gescheiterter Roman mit dem Arbeitstitel »Akt«. Weniger komplexe Fragen ergeben Erzählungen:
Wie würde ich reagieren, wenn Andrej, ein russischer Freund, dessen Frau an Krebs erkrankt ist, mich um Geld für ihre Behandlung bitten würde? (»Wie ein Kind, wie ein Engel«)
Warum lebte eine junge Frau, von der ich in der Zeitung las, vier Jahre lang allein im Wald, während sie jeden Tag die Schule besuchte? (»Im Wald«)
Was geschieht, wenn ich eines Abends vergesse, mein Kind von der Krippe abzuholen? (»Wir fliegen«)
Was tut ein Pfarrer, der mit einer jungfräulichen Empfängnis konfrontiert wird, auf der sein ganzer Glauben basiert, aber mit der er nie gerechnet hat? (»Kinder Gottes«)
Was empfindet eine alte Frau, die nach dem Tod ihres Mannes Briefe seiner Geliebten findet, von der sie nicht gewusst hat? (»Der Brief«)
Die Frage, mit der ich diese Vorlesung beginnen will, stammt von einem anderen Autor. Bruce Chatwin, der Reiseschriftsteller, war ein enger Freund von Beatrice und Gregor und Stammgast in Santa Maddalena. Vielleicht hat er sich hier an diesem Granittisch unter der Laube jene Frage gestellt, die den Titel seines wohl bekanntesten Buches bildet: »What am I doing here?« Was tue ich hier? Die Frage ist komplexer, als sie zunächst erscheinen mag. Die einfachste Antwort: Ich schreibe eine Poetikvorlesung für Bamberg, ich schwimme im Pool, esse und trinke und rauche zu viel, gehe spät ins Bett und stehe spät auf. Ich unterhalte mich mit Kolleginnen und Kollegen über Literatur, über Musik, über Autorinnen und Autoren, die wir mögen, die wir nicht mögen, die wir verachten oder verehren. Die Welt der Literatur ist kleiner, als man denken könnte, sie ist wie ein Park, durch den Menschen spazieren. Man begegnet sich, spricht ein paar Worte, geht weiter, sieht sich wieder in einer Woche oder in einem Jahr, man mag sich, teilt ein Stück des Weges, arbeitet vielleicht sogar zusammen, verstreitet sich, geht sich aus dem Weg, und kann doch nicht vermeiden, sich wieder zu begegnen.
Aber die Frage »Was tue ich hier?« ist damit nicht erschöpfend beantwortet. Sie führt letztlich zu den Fragen nach dem Schreiben, nach dem Leben überhaupt, die nicht zu beantworten sind und gerade deshalb so fruchtbar für die Literatur. Solche Fragen sind wie Katalysatoren, die den Denkprozess anregen, ohne dabei verbraucht zu werden. Der Text ist der Weg, den man beim Suchen nach der Antwort zurücklegt. Und ob das Ende ein glückliches oder ein unglückliches wird, hängt vielleicht davon ab, ob man sich mit dem Scheitern abfindet oder ob man sich dagegen auflehnt.
Was tue ich hier? Ich will die Frage einschränken, will sie verstehen als: Warum tue ich das, was ich tue, und nicht etwas anderes? Eine Frage, die mich in meine Kindheit und Jugend zurückführt. Ich gehöre nicht zu den Autoren, die schon immer schreiben wollten und mit acht oder zehn oder zwölf ihren ersten Roman verfassten. Meine Berufswünsche waren so disparat wie meine Interessen: Schiffbauer, Professor (ohne ein bestimmtes Fachgebiet), Koch, Werbefachmann, Fotograf, später Physiker und Kriminologe. Was sie mit meinem jetzigen Beruf, dem Schreiben, verbindet, ist vielleicht ihre Gegensätzlichkeit. Sie sind nur in der Phantasie unter einen Hut zu kriegen, als nicht realisierte Möglichkeiten. Ich kann mir in einem Leben vorstellen, ein Koch zu sein, ein Schiffsbauer, ein Fotograf oder ein Polarforscher. Entscheide ich mich für eine dieser Möglichkeiten, muss ich die anderen aufgeben.
Schriftsteller zu werden hat weniger mit dem Schreiben zu tun, als man denken könnte. Wer in der Schule gute Aufsätze schrieb, hat kaum bessere Chancen in diesem Beruf als jede und jeder andere auch. Schreiben lernt (fast) jeder in der Schule, Schreiben kann man auch später noch lernen. Erzähler kann man auch sein, wenn man nicht schreiben kann. Am Anfang des Erzählens steht nicht die Geschichte, sondern die Frage.
Wenn ich versuche, an die Wurzeln meines Schreibens zu gelangen, fallen mir keine frühen Lese- oder Schreiberlebnisse ein. Zugegeben, ich war schon als Kind ein begeisterter Leser, aber meine ersten Schreibversuche hatten nichts mit den Büchern zu tun, die ich gelesen hatte. Sie scheiterten daran, dass mir die Fragen und damit der Antrieb fehlten. Ich lese Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus einem nicht viel längeren Tagebuch vor, das ich als Achtjähriger in den Sommerferien führte:
3. Juli 1971
Erste Fahrt nach Mathon mit dem neuen Auto. Wir essen in Buchs. Ankunft um 4 Uhr.
4. Juli 1971
Meine Tante kam auf besuch. wir gingen an den Libisee. Am 12. Hochzeitstag asen wir Kuchen.
5. Juli 1971
Am Morgen waren wir am Bach nachher im Wald u.s.w
6. Juli 1971
Wir gingen nach Wergenstein. Es war schön. u.s.w
und schließlich, einer der letzten Einträge:
19. Juli 1971
u.s.w
Ein wenig erinnert mich dieser Text an einen, den wir wohl ungefähr in der gleichen Zeit in der Schule schreiben mussten, um die Uhr zu lernen:
Mein Tag
Um 7 Uhr stehe ich auf. Um 8 Uhr beginnt die Schule. Um 9 Uhr schreiben wir. Um 10 Uhr beginnt die Pause. Um 11 Uhr turnen wir. Um 12 Uhr essen wir die Suppe. Um 13 Uhr helfe ich der Mutter. Um 14 Uhr beginnt die Schule wieder. Um 15 Uhr arbeiten wir mit dem Lehrer. Um 16 Uhr gehen wir heim. Um 17 Uhr schreibe ich die Aufgaben. Um 18 Uhr steht das Nachtessen bereit. Um 19 Uhr darf ich spielen.
Ich habe gesagt, dass mir bei meinen ersten Texten die Fragen fehlten. Das ist nicht ganz richtig. Die Fragen waren da, aber ich hatte noch nicht gelernt, sie zu erkennen, sie mir zu stellen und fruchtbar zu machen. Während ich versuchte, mein eintöniges Leben zu dokumentieren, hatte ich in gewissem Sinn mein Thema schon gefunden. Ich lese Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus »An einem Tag wie diesem« vor, einem Buch, das ich fünfunddreißig Jahre später schrieb.
Andreas, ein Deutschlehrer an einem Pariser Gymnasium, befürchtet, an Krebs erkrankt zu sein. Statt die Resultate der medizinischen Untersuchungen abzuwarten, entschließt er sich, sein Leben zu ändern. Er kündigt seine Stelle, bricht mit seinen Freunden, verkauft seine Wohnung, seine Möbel und reist mit Delphine, die seit kurzem seine Geliebte ist, in sein Heimatdorf in die Schweiz, um dort eine Jugendliebe wiederzusehen und eine Geschichte abzuschließen, die für ihn nie ganz zu Ende war. Während der Fahrt steckt Delphine eine von Andreas’ Kassetten in das Abspielgerät. Es ist ein Deutschkurs, in dem die Reflexivpronomen behandelt werden. Erst spricht eine Frau ein paar Sätze, dann ist eine sympathische Männerstimme zu hören:
»Mein Tagesablauf. Morgens stehe ich um halb sechs auf. Ich stehe immer so früh auf, denn ich muss um acht Uhr in der Firma sein. Nur samstags und sonntags kann ich länger schlafen. Nach dem Aufstehen gehe ich ins Bad, putze mir die Zähne und dusche mich, zuerst warm und zum Schluss kalt. Danach bin ich richtig wach und fühle mich wohl. Dann ziehe ich mich an und kämme mich. Anschließend gehe ich in die Küche und frühstücke. Ich koche mir einen Kaffee, esse ein Brot mit Marmelade oder mit Wurst oder Käse …«
Die Stimme des Mannes hatte etwas Heiteres. Es klang, als habe er sich ganz dem Lauf der Tage und der Jahre ergeben, seinem Schicksal ohne Nebensätze.
»Ich mich, du dich«, sagte Delphine und dann noch ein paarmal, ich mich, bis es wie ein Wort klang.
»Du bist der Ichmich«, sagte sie.
»Ich dich«, sagte Andreas. Er nahm die Kassette aus dem Gerät, und das Radioprogramm war wieder zu hören. Er fragte, ob sie den Text verstanden habe. Das meiste, sagte sie, es wundere sie nicht, dass niemand mehr Deutsch lernen wolle, wenn sie mit solchen Lehrmitteln arbeiteten. Wurst zum Frühstück.
Gegen Ende des Buches – die Begegnung mit der Jugendliebe war ein Desaster, Delphine hat Andreas verlassen – fährt er an die Atlantikküste, auf der Suche nach ihr. Er hört Radio, aber er erträgt das nervöse Geplapper der Moderatoren nicht:
Andreas schob die Kassette ein, die im Gerät steckte. Es war der Sprachkurs, den er und Delphine auf dem Hinweg gehört hatten, der sympathische Mann, der erzählte, wie er Wurst und Käse frühstückte und mit dem Bus zur Arbeit fuhr, wie er mittags in der Kantine aß, wo er die Wahl zwischen drei schmackhaften Gerichten hatte, und wie er nach der Arbeit wieder nach Hause fuhr.
»Nach dem Abendessen setze ich mich vor den Fernseher und schaue mir noch die Nachrichten an. Das Abendprogramm interessiert mich nicht sehr, und die interessanten Sendungen kommen für mich meistens zu spät. Ich gehe früh zu Bett. Die Nacht ist schnell vorbei. Und wenn morgens der Wecker klingelt, habe ich nicht immer ausgeschlafen. Der nächste Tag wiederholt sich auf die gleiche Weise.«
Andreas hatte bei einem Rastplatz angehalten. Er saß im Auto und hörte zu, wie der Mann sein Leben erzählte. Bei den letzten Sätzen krampfte sich sein Körper zusammen, und er begann zu zittern, als hätte er Schüttelfrost. Es würgte ihn, und dann begann er zu schluchzen, trocken und stoßweise. Als endlich die Tränen kamen, ließ das Zittern nach, und er wurde ruhiger. Er legte den Kopf auf das Lenkrad und weinte lange, ohne recht zu wissen, weshalb. (…)
Er nahm die Kassette aus dem Gerät. Er stieg aus und ging zum kleinen Toilettenhäuschen, um sich das Gesicht zu waschen. Die Kassette warf er in eine Mülltonne, auf der in vier Sprachen »Danke« stand.
Andreas weiß nicht, weshalb er weint. Manche Kritiker und Leserinnen glaubten, weil er in der Lebensbeschreibung dieses fiktiven Mannes die Eintönigkeit und die Tristesse seines eigenen Lebens erkannt hat. Ich glaube eher, dass er um dieses Leben trauert, das er durch die Krankheit bedroht sieht. Er fürchtet, aus der Gleichmäßigkeit und Ordnung seiner Tage gerissen zu werden, die ihm so teuer ist. Immerhin lautet schon der erste Satz des Buches:
Andreas liebte die Leere des Morgens, wenn er am Fenster stand, eine Tasse Kaffee in der einen, eine Zigarette in der anderen Hand, und auf den Hof hinausschaute, den kleinen, aufgeräumten Hinterhof, und an nichts dachte als an das, was er sah.
Die »Mülltonne, auf der in vier Sprachen ›Danke‹ stand« taucht übrigens in dreien meiner Texte auf. Auch sie ist Teil eines geordneten Lebens, in dem ein Tag dem anderen gleicht, ein endloses »und so weiter« wie im Tagebuch meiner Sommerferien. Sie ist Teil einer perfekten Welt, in der jedes Ding und jeder Mensch seinen Platz hat. Ich widerstehe der Versuchung, diese Welt »Schweiz« zu nennen. Genauso gut könnte sie »Norwegen« heißen, wie in meinem zweiten Roman »Ungefähre Landschaft«, dessen letzten Abschnitt ich Ihnen vorlesen möchte:
Kathrine ging zur Arbeit. Sie fuhr mit dem Auto. Sie setzte Randy bei der Schule ab. Er wurde krank und wieder gesund. Er bekam eine Brille. Er wuchs. Kathrine verdiente Geld und kaufte sich Dinge. Sie gebar ein zweites Kind, ein Mädchen, Solveig. Dann stand sie mit Morten in der Küche. Sie belegten Brote, um das Geld für das Mittagessen zu sparen. Später kauften sie eine Wohnung, dann ein Haus. Sie wohnten in Tromsø, in Molde, in Oslo. Randy fuhr in die Ferien zur Großmutter ins Dorf. Er kam zurück. Es wurde Herbst und Winter. Es wurde Sommer. Es wurde dunkel, und es wurde hell.
Der letzte Satz mag Ihnen bekannt vorkommen. Ich habe ihn gestohlen von einem größeren Autor, von Moses oder dem, den wir so nennen. Der Satz wurde vermutlich in der Bronzezeit geschrieben und beschreibt die Erschaffung einer perfekten Welt, des Paradieses.
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen: der erste Tag.
Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich besuchte als Kind die Sonntagsschule und bekam von mehr oder weniger begabten Lehrern und Lehrerinnen die biblischen Geschichten erzählt. Sie hatten für mich von Anfang an keine religiöse Bedeutung, sondern ausschließlich eine literarische. Trotzdem – oder gerade deshalb – schienen sie mir eine Wahrheit zu enthalten, die tiefer ging als das, was sie erzählen. Es mag sein, dass dies mein eigenes Schreiben prägte. Dass es mir deshalb nie genügte, einfach eine möglichst ausgefallene Geschichte zu erzählen. Bis heute misstraue ich originellen Büchern, deren Handlung sich in wenigen Sätzen, wenigen Stichworten zusammenfassen lässt und die oft schon auf die Verfilmung hin geschrieben zu sein scheinen. Wer etwas lesen will, was er noch nicht weiß, der kauft sich die Zeitung. Literatur lesen wir, um die Welt, in der wir leben, um uns selbst zu erkennen. Literatur lesen wir, um in einer chaotischen und unverständlichen Welt Formen zu erkennen und vielleicht einen Sinn.
Aber zurück zum Paradies. Es wäre eine Übertreibung zu behaupten, meine Kindheit sei paradiesisch gewesen, und doch ist es nicht ganz falsch. Ich lebte die ersten neunzehn Jahre meines Lebens im selben Ort mit etwas mehr als neuntausend Einwohnern. Wir zogen nur einmal, ich war ungefähr acht, von einer Wohnung in ein Haus auf der anderen Seite des Dorfes. Meine Kindheit erscheint mir im Rückblick zeitlos, ich habe Mühe, meine Erinnerungen chronologisch zu ordnen. Meine Wahrnehmung von damals scheint jener von religiösen Gesellschaften zu gleichen, wie sie Mircea Eliade in seinem Buch »Das Heilige und das Profane« beschreibt. Die »heilige Zeit«, heißt es dort, biete: den paradoxen Aspekt einer zirkulären, umkehrbaren, wiedererreichbaren Zeit (…) und eine Art mythische ewige Gegenwart. Sie könne »in gewisser Hinsicht der Ewigkeit gleichgesetzt werden«.
Ich habe nie viel über meine Kindheit geschrieben, aber sie ist in allen meinen Werken präsent als verlorenes Paradies, wobei ich unter dem Paradies nicht einen Garten der Glückseligkeit verstehe. Die vielen Paradiese, die in meinen Texten vorkommen, können genauso gut Orte des Schreckens sein. Was sie alle auszeichnet, ist das Stillstehen der Zeit und dadurch ein intensives Gefühl der Gegenwärtigkeit.
Schon einer meiner frühen literarischen Texte, mein erstes Hörspiel, das ich 1990 schrieb, handelt vom Ende der Zeit. Das Stück, dem man den Einfluss von Friedrich Dürrenmatt und Oskar Panizza etwas zu deutlich anmerkt, beginnt damit, dass die Erde aufgehört hat sich zu drehen und alle Menschen in riesigen Aufzügen in den Himmel gefahren werden, um dort dem Jüngsten Gericht vorgeführt zu werden. Oben tut sich eine Gruppe von Leuten zusammen, deren Namen alle mit Z beginnen und die gemerkt haben, dass sie unendlich lange auf ihr Urteil warten müssten, da die Verfahren in alphabetischer Reihenfolge stattfinden. Zudem macht das Gerücht die Runde, Gott sei verschwunden. Während Petrus Dolmetscher für die Steinzeitmenschen sucht und Merkblätter für die Angehörigen nichtchristlicher Religionen verteilen lässt, schmuggelt sich die Gruppe in einen der Aufzüge, mit denen Müll auf die Erde gebracht wird, und fährt zurück, um von vorn zu beginnen. Ganz am Schluss merken sie, dass der Aufzugsführer, der mit ihnen vor dem Gericht geflohen ist, Gott war. Das Hörspiel, das zum Teil in Versen abgefasst war, wurde – zum Glück muss ich wohl sagen – nie produziert.
Ebenfalls auf der Suche nach einem Neuanfang ist Gillian in meinem letzten Roman »Nacht ist der Tag«. Nach einem schweren Autounfall, in dem ihr Gesicht entstellt wird und ihr Mann stirbt, findet sie in einem Clubhotel in den Bergen Zuflucht und eine Arbeitsstelle. Das einfache Leben im Robinson-Club wird für sie zu einer Art Paradies inklusive nackter Menschen und Vollpension, eine Ironie, die vor allem manche Schweizer Kritiker nicht verstanden haben. Vielleicht, weil unser Land manchmal selbst wie die Parodie des Paradieses wirkt. In einer frühen Version des Textes vergleicht Gillian das Hotel gleich selbst mit den Paradiesbildern in religiösen Magazinen:
Jill war ans Fenster ihres Büros getreten und schaute hinaus in den Park hinter dem Hotel. Es war ein strahlend schöner Tag, fast alle Liegestühle waren besetzt, Kinder spielten auf der Wiese, und im Hintergrund, im Schatten einiger mächtiger Bäume, die am Flussufer standen, saß ein Dutzend Gäste im Kreis. Die meisten waren barfuß, einige trugen nur Shorts und ein T-Shirt. Sie hatten Zeichenblöcke auf den Knien und schauten aufmerksam zu Hubert, der in ihrer Mitte stand und redete. Neben ihm saß auf einem Korbstuhl eine nackte junge Frau. Hubert machte ausladende Handbewegungen, es sah aus, als zeichne er ein Bild in die Luft, dann trat er aus dem Kreis, und die Gäste fingen an zu zeichnen. Die Szene erinnerte Jill an die bunten Bilder in den Traktätchen der Zeugen Jehovas, die idyllische Gebirgslandschaften zeigten, in denen sich alte und junge Menschen, Raub- und Beutetiere in friedlicher Eintracht begegneten.
Auch Anja in der Erzählung »Im Wald« zieht sich in eine Art Paradies zurück: sie lebt drei Jahre lang allein im Wald und empfindet dort ebenjene Zeitlosigkeit, von der ich schon gesprochen habe und die im Text durch Einschübe im Präsens markiert wird:
Etwas hat sich verändert. Es kommt Anja vor, als nähme sie den Wald zum ersten Mal bewusst wahr, als wendete der Wald sich ihr zu. Ihre Gedanken scheinen stillzustehen und mit ihnen die Zeit, und alles verbindet sich mit ihr, wird zu einem einzigen, wunderschönen Gefühl, das Licht, die Gerüche, die vereinzelten Geräusche, die die plötzliche Stille noch intensiver machen. Sie steht da und beobachtet das Spiel des Lichts, das durch die Baumkronen dringt. Sie berührt den Stamm einer Buche, ihre kühle silberne Rinde. Später ruft sie sich diesen Moment immer wieder in Erinnerung, wenn sie versucht ist, aufzugeben und zurückzukehren in die Wohnung der Eltern. Und dann steht die Zeit wieder still, und alles wird gleichgültig, und sie hält die Nacht durch, die Woche, das Jahr.
Aber auch für Anja gibt es kein Verweilen im Paradies. Ein Jäger taucht auf, eine Figur, die durchaus psychoanalytisch gedeutet werden darf. Anja verliert zwar nicht ihre Unschuld, aber ihre Präsenz, ihre Gegenwart. Erst durch einen Tagtraum, in dem der Jäger sie erschießt, findet sie, wenigstens für den Moment, zurück in ihr Paradies.
Da sieht sie den Jäger. Er ist aus einer der Gassen getreten und steht ebenfalls still. Langsam nimmt er das Gewehr von der Schulter, kniet nieder und legt an. Sein Gesicht ist starr vor Konzentration, sein Blick leer. Obwohl sie mindestens zwanzig Meter voneinander entfernt sind, sieht Anja den Finger am Abzug, der sich langsam krümmt, und dann das Mündungsfeuer, und spürt im selben Moment einen heftigen, köstlichen Schmerz in der Brust und die Wärme ihres Blutes, als stiege sie in ein heißes Bad. Dann liegt sie am Boden, und der Jäger kniet an ihrer Seite. Er streicht ihr das Haar aus der Stirn. In seinen Augen sind Tränen. Er will etwas sagen, aber sie schüttelt nur lächelnd den Kopf. Es ist gut.
Schließlich möchte ich Ihnen den Anfang meines Hörspiels »Das Schweigen der Blumen« von 2005 vorspielen, in dem Reinhard – ebenfalls durch einen Schuss, der zugleich den Anfang und das Ende des Hörspiels markiert und die Zirkularität der Zeit andeutet – ganz wörtlich im Paradies landet:
Sophie und Reinhard befinden sich im Garten. Ein Schuss ertönt.
REINHARD
Wo sind wir hier?
SOPHIE
Im Paradies.
REINHARD
Man könnte es meinen. Wie still die Blumen sind.
SOPHIE
Mein Herz ist in diesem Garten. Nichts wächst hier, was mich nicht liebt und von mir nicht zärtlich geliebt wird.
REINHARD
Wer sind Sie? Die Gärtnerin? Die Jägerin?
SOPHIE
Sie können mich Sophie nennen, wenn Sie wollen.
REINHARD
Und was machen Sie hier? Sophie.
SOPHIE
Ich bin immer hier. Ich bin hier geboren und gewachsen.
REINHARD
Ich habe gemeint, hier wohnt keiner.
SOPHIE
Ich habe mich versteckt, damit Sie mich finden.
REINHARD
Jetzt habe ich Sie gefunden … aber ich weiß nicht mehr, wo wir sind.
SOPHIE
Am Anfang oder am Ende. Ich verwechsle das immer. Aus welcher Richtung sind Sie gekommen?
REINHARD
Ich bin Ihnen gefolgt. Sie leben hier?
SOPHIE
Es ist mein Garten. Wenn hier Tag ist, ist anderswo Nacht.
REINHARD
Das wollen wir doch hoffen. Ich würde den Weg zurück nicht mehr finden.
SOPHIE
Es gibt keinen Weg zurück.
REINHARD
Ich war noch nie im Osten.
SOPHIE
Wenn Sie immer weiter nach Westen gehen, kommen Sie auch in den Osten.
REINHARD
Das ist wahr. Aber ich war auch nie wirklich im Westen.
SOPHIE
Spüren Sie, wie die Erde sich dreht? Mir wird ganz schwindlig.
REINHARD
Ich glaube nicht.
SOPHIE
Morgen um dieselbe Zeit sind wir wieder hier.
REINHARD
Ich bin Wissenschaftler … Student.
SOPHIE
Die Lebenden träumen vom Tod, und die Toten träumen vom Leben.
REINHARD
Sie bringen mich ganz durcheinander.
SOPHIE
Lieben Sie mich?
REINHARD
Wir haben uns ja eben erst getroffen.
SOPHIE
Wie viel Zeit brauchen Sie denn, um mich zu lieben? Eine Stunde, einen Tag, ein Jahr? Ich habe Sie gleich geliebt. Ich liebe Sie schon lange. Wollen wir vögeln? Heute ist unser Hochzeitstag.
Aber zurück zum Paradies meiner Kindheit in der ungefähren Landschaft des Thurgaus, die weder flach noch gebirgig, weder bäurisch noch urban ist. Ich hatte drei Geschwister, hatte Freunde, mit denen ich mich in der Freizeit traf, nahm Musikunterricht und war Mitglied der Rettungsschwimmgesellschaft und später eines Badmintonclubs. Aber vor allem verbrachte ich viel Zeit allein, trieb mich im Wald herum, kletterte auf Bäume, machte Fahrradtouren oder versank in Tagträumen. In der zweiten Klasse machte ich auf dem Schulweg einen Umweg, um meinem besten Freund nicht zu begegnen. Als mich meine Mutter fragte, weshalb ich das tue, soll ich gesagt haben, ich bräuchte Zeit zum Denken.
Sowohl die verbotenen Früchte wie der strafende Vater fehlten in meinem Paradies. Mein Vater war ein sanfter und verständnisvoller Mensch. Meine Eltern ließen uns viele Freiheiten und begründeten jede der wenigen Regeln, die sie aufstellten. Auch meine Lehrer – es waren die siebziger Jahre – waren wenig autoritär. Waren sie es doch, konnte ich mir als guter Schüler leisten, sie nicht ganz ernst zu nehmen. Einzig im Sportunterricht, meinem schlechtesten Fach, litt ich. Mein Turnlehrer in der Sekundarschule war klein, sein Gesicht war immer gerötet, vielleicht trank er zu viel, vermutlich hatte er einen zu hohen Blutdruck, der dann auch zu seinem frühen Tod führte. Er musste spüren, dass ich ihn nicht respektierte, und er rächte sich an mir, indem er mich bloßstellte. Meine Entscheidung, nicht ins Gymnasium zu gehen, sondern eine kaufmännische Lehre zu machen, hatte – so absurd es klingen mag – vor allem mit diesem Lehrer zu tun, der mir meine letzten drei Schuljahre gründlich verdarb. Er ist das Vorbild für mindestens drei unsympathische Turnlehrer in meinen Büchern.
Auch mein Lehrmeister war keine Autoritätsperson, sondern ein väterlicher Chef, der mir viele Freiheiten ließ. Er besaß ein Stück Wald, und an den Samstagen half ich ihm oft beim Bäumefällen und hörte ihm beim Philosophieren zu. Da sowohl die Berufsschule als auch mein Lehrbetrieb nur wenige hundert Meter vom Haus meiner Eltern entfernt waren, wohnte ich, bis ich neunzehn Jahre alt war, zu Hause. Irgendwann während der Lehre muss ich angefangen haben, meine ersten literarischen Texte zu schreiben. Mein bisheriges Leben war so ereignislos und formlos gewesen, dass ich dabei – und bis heute – nicht auf die Idee kam, meine Biographie als Material zu verwenden.
Noch bevor ich meine Lehre abgeschlossen hatte, hatte ich mich entschieden, die Matura nachzuholen, und suchte schon während der Rekrutenschule, der Grundausbildung in der Schweizer Armee, eine Stelle, um mich in der Zeit der Abendschule über Wasser zu halten. Ich bewarb mich bei der Schweizerischen Verkehrszentrale, einer Organisation, deren Aufgabe es ist, die Schweiz im Ausland als Tourismusdestination zu vermarkten. Zum Bewerbungsgespräch reiste ich in Uniform. Als man mich fragte, ob ich daran interessiert wäre, in einem der Auslandbüros zu arbeiten, sagte ich, eher nicht. Kurz darauf wurde ich in der Kaserne ans Telefon gerufen. Der Personalchef der Verkehrszentrale war am Apparat. Er sagte, der Buchhalter der Pariser Filiale sei tödlich verunglückt, sie bräuchten dringend einen Ersatz. (Der Buchhalter war – dies nur nebenbei – bei einer Übung der Schweizer Pfadfinder in Paris von einer Seilbrücke gestürzt und kurz darauf an inneren Verletzungen gestorben. Diesen Unfall habe ich in meinem ersten Roman »Agnes« verwendet, wo ein Mädchen ebendiesen Tod stirbt.) Ich überlegte nicht lange und nahm die Stelle an.
Ich lese Ihnen Auszüge vor aus einem Text, den ich vor fünf Jahren für die Reihe »Die Reise meines Lebens« der Zeit schrieb. Er handelt von einem prägenden Jahr in Paris:
Im Dezember 1982, einen Monat nach dem Ende meiner Rekrutenschule, reiste ich nach Paris. Eigentlich war ich mit neunzehn zu alt, um von den Eltern zum Bahnhof gebracht zu werden, aber diese Reise war eine besondere: Ich hatte keine Rückfahrkarte gelöst, die Abfahrt nach Paris war zugleich mein Auszug aus dem Elternhaus.
Der Zug nach Zürich war voller Jugendlicher, die in die nahe Stadt fuhren zu einem Kino- oder Diskothekenbesuch. Mein Koffer war so seltsam fehl am Platz wie die Eltern, die auf dem Bahnsteig standen und versuchten, dem Moment die angemessene Würde zu verleihen. Aber für mehr als ein kurzes Winken reichte der Aufenthalt nicht, und der Zug fuhr ab. Ich stelle mir vor, dass meine Eltern noch ein paar Schritte mitgingen und sich dann auf den Nachhauseweg machten durch den kalten Dezemberabend. Für sie ging etwas zu Ende, für mich fing etwas Neues an.
Ich erreichte Paris spät abends. Es regnete, und obwohl das Hotel nur zehn Minuten von der Gare de l’Est entfernt war, entschloss ich mich, ein Taxi zu nehmen. Der Fahrer hatte noch nie von einem Hôtel de la Nouvelle France gehört, im Bahnhofsviertel wimmelte es von solchen kleinen Häusern mit hochtrabenden Namen und schäbigen Zimmern. Er brachte mich zu einer Gendarmeriekaserne desselben Namens, und der wachhabende Gendarm erklärte mir den Weg zum Hotel, das ganz in der Nähe lag in einer düsteren Seitenstraße. Die Rezeption war um diese Zeit nicht mehr besetzt, der Hotel- und der Zimmerschlüssel lagen in einem Umschlag unter der Fußmatte. Ich schleppte meinen Koffer die vier Stockwerke hoch und fand mein Zimmer ganz am Ende eines schmalen Flurs, keine acht Quadratmeter groß. Aber ich fühlte mich sofort wohl hier, geborgen in der Enge und durch die Aussicht über eine Dächerlandschaft doch mit der Stadt verbunden. In den ersten Monaten meines Aufenthalts schaute ich mich nach einer Wohnung um, aber schließlich gab ich die Suche auf und blieb das ganze Jahr über in meinem kleinen Zimmer wohnen.
Ich weiß nicht mehr, wie ich meinen ersten Tag in Paris verbrachte, vermutlich spazierte ich ziellos im Regen herum und kochte mir Tee mit meinem Tauchsieder, den ich noch heute besitze. Ich war schon zweimal in Paris gewesen und hatte geglaubt, die Stadt einigermaßen zu kennen, hatte den Eiffelturm bestiegen und im Louvre die Mona Lisa gesehen. Aber die Übersichtlichkeit der Pariser Innenstadt hatte mich darüber hinweggetäuscht, dass es sich um einen riesigen Ballungsraum handelte, in dem tausendmal so viele Menschen lebten wie im Dorf, aus dem ich kam. In der Schweiz war ich zu Fuß ins Büro gegangen und hatte die Hälfte der Menschen gekannt, die mir auf der Straße begegneten. In Paris stand ich eingequetscht in einer Metro, in der Nase den Geruch von ungewaschenen Haaren und billigen Parfums. An meinem ersten Arbeitstag hatte ich einen vollen Zug vorbeifahren lassen, aber der nächste und der übernächste waren genauso voll, das Reservoir von Menschen schien unerschöpflich zu sein. Und während es in meinem Dorf erst zwei, dann gar kein Kino mehr gegeben hatte, gab es in Paris vierhundert Säle oder mehr, zwischen denen man sich entscheiden konnte. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit man unterwegs war, nie war man allein, nie fand man Ruhe.
Die ersten Monate dachte ich oft daran, meine Stelle aufzugeben und nach Hause zurückzukehren. Aber ich war zu stolz dazu. Von Woche zu Woche lebte ich mich besser ein und gewöhnte mich an den schnellen und zugleich langsamen Rhythmus der Stadt, an den Alltag. Ich fing an, Paris zu erforschen mit der Neugier und der Unvoreingenommenheit des Dorfjungen. Es waren weniger die Monumente, die mich anzogen, als die Menschen. Ich entdeckte die dunkleren Orte der Lichterstadt, die ärmlichen, schmutzigen Viertel im Norden, die selbst meine französischen Arbeitskollegen mieden, die nach Feierabend so schnell wie möglich in ihre Vororte verschwanden. Oft kam ich erst spät in der Nacht von meinen Streifzügen zurück. Meine Stammkneipe, das »Cordial«, wurde von Paco, einem Algerier, geführt, der im Hinterzimmer auch manchmal verdächtig billige Lederjacken oder Musikkassetten verkaufte, von denen nicht ganz klar war, woher sie stammten. Wenn unter den dicken Vorhängen noch ein Streifen Licht zu sehen war, konnte man lange nach der Polizeistunde an die Scheibe klopfen. Dann äugte der Wirt misstrauisch durch einen Spalt im Vorhang, und kurz darauf wurde die Tür entriegelt und man wurde hereingewinkt. Dort saßen meist auch meine Freunde, die Söhne der Gendarmen und ein paar Schweizer Angestellte, die wie ich im Hotel lebten, und wir redeten und tranken, bis der Morgen graute.
Im Büro war nicht sehr viel zu tun. Mein Vorgänger schien einen beträchtlichen Teil seiner Zeit damit verbracht zu haben, das Büromaterial zu zählen. Auf jeder Schachtel mit Bleistiften oder mit Schreibblocks standen der Anfangsbestand und die datierten Entnahmen. Die Heiligenbilder, mit denen er das Büro dekoriert hatte, hatte ich längst abgehängt und durch Tourismusplakate der Schweiz ersetzt, Schneelandschaften, Berge und Seen, die Natur, die ich in Paris schmerzlich vermisste.
Dafür fand ich hier vieles, was mir zu Hause gefehlt hatte. Ich ging in jenem Jahr achtzigmal ins Kino, sah all die Klassiker, die es nie in unser kleines Dorfkino geschafft hatten, »Spiel mir das Lied vom Tod«, »Blade Runner«, »A Clockwork Orange«, aber auch billige Actionfilme in Doppelvorstellungen zu ermäßigtem Preis. Wenn ich aus dem Kino trat und mit schnellen Schritten die Grands Boulevards entlangging, fühlte ich mich wie die Helden der Filme, einsame Männer in dunklen Städten, die zugleich Jäger und Gejagte waren.
Ein Arbeitskollege erschloss mir die Welt des Jazz, indem er mich immer wieder ins New Morning schleppte, einem kleinen Jazzlokal in der Rue des Petites Ecuries, in dem Jazzgrößen auftraten, die sonst nur im berühmten Olympia zu sehen waren. Es kam vor, dass er in der Pause eines Konzerts zu mir ins Hotel kam und mich, wenn ich schon im Bett lag, herausklopfte und nötigte mitzukommen, um wenigstens den zweiten Teil eines genialen Abends nicht zu verpassen. Dank ihm hörte ich Lionel Hampton und George Adams, Niels-Henning Ørsted Pedersen und Chet Baker, der kurz darauf verstarb. Dieses Konzert habe ich in meinen Roman »An einem Tag wie diesem« beschrieben:
»Als ich ziemlich neu war in Paris, habe ich Chet Baker im New Morning gesehen«, erzählte Andreas. »Er war unglaublich dünn und hatte eingefallene Wangen. Er saß zusammengesunken auf einem Barhocker, die Trompete zwischen die Beine geklemmt. Dann fing er an zu singen, ganz leise und mit brüchiger Stimme. An das Stück kann ich mich nicht erinnern, ›The Touch of Your Lips‹ oder ›She Was Too Good to Me‹, aber ich höre heute noch seine Stimme. Nach ein paar Takten bricht er plötzlich ab und macht eine unzufriedene Handbewegung, und die Musiker fangen noch einmal von vorne an. Es war wie das Echo eines Echos. Bald darauf ist er gestorben.«
Ich aß während eines Ausflugs in die Normandie zum ersten Mal in meinem Leben Meeresfrüchte, fing an zu rauchen, kaufte mein erstes Aftershave, »Jules«, einen zimtigen Duft, den ich bis heute in der Nase habe. Mit meinen Freunden trieb ich mich im Rotlichtviertel der Rue du Faubourg Saint-Denis herum. Wir hörten den Verhandlungen zwischen den Prostituierten und den Freiern zu und beobachteten, wie die Männer in den Hauseingängen verschwanden und wie schnell sie wieder herauskamen. Und wenn eine der Frauen uns um Feuer bat oder uns am Arm fasste und fragte, »Tu montes?«, »Kommst du mit rauf?«, fühlten wir uns sehr erwachsen und gingen schnell weiter.
Mein Paris wurde mit jedem Tag größer, meine Wanderungen führten mich immer weiter in die Außenviertel. Ich entdeckte den Parc des Buttes-Chaumont, eine wunderbare kleine Märchenlandschaft im 19. Arrondissement, die Pariser Kanäle, die Fernfahrerkneipen am Autobahnring, wo man wunderbares Käseraclette bekam. Auf dem großen Flohmarkt an der Porte de Clignancourt erstand ich einen englischen Militärregenmantel, den ich auf fast allen Bildern aus jener Zeit trage.
In den Sommerferien besuchten wir unsere französischen Freunde am Atlantik auf einem Zeltplatz nur für Gendarmen und ihre Angehörige, aßen mittags Austern am Strand und tanzten am Abend in einer improvisierten Disco. Auch dieser Ort hat es in »An einem Tag wie diesem« geschafft.
Und schließlich gab es da auch noch ein Mädchen, eine Österreicherin, die erst in unserem Hotel ein Zimmer hatte und dann ein kleines Studio ganz in der Nähe. Aber das ist eine andere Geschichte.
An der Gare de l’Est, von der ich in diesem Jahr ein paarmal in die Schweiz fuhr, gab es ein Plakat, »Melde dich zur Fremdenlegion«. Ich dachte nie ernsthaft daran, Legionär zu werden, aber irgendwann bestellte ich bei der angegebenen Adresse die Unterlagen. Sie waren wie ein Versprechen, dass die Welt noch größer war, dass es nicht nur den Weg zurück in die Heimat gab, sondern auch Wege, die weiter führten, nach Süden, in die arabische, die afrikanische Welt.
Paris hat mich erwachsen gemacht. Ich lernte, dass Menschen, wie Hugo Lötscher sagte, keine Wurzeln haben, sondern Beine. Und dass man in dieser großen Stadt verschwinden konnte in der Einsamkeit eines winzigen Zimmers oder einer Menschenmasse. Vermutlich hat das mein Schreiben mehr geprägt als alle Bücher, die ich las. In dieser riesigen Stadt, in der ich oft einsam war, verwirrt und unglücklich, wurde Literatur zum Überlebensmittel.
Eines Abends, zu Besuch bei Freunden, trat ich in einen schachtartigen Innenhof, in dem vollkommene Stille herrschte. Nach Monaten des Lärms und der Aufregung war diese plötzliche Stille wie ein Schock, wie ein plötzliches Erwachen. Ich hatte mich an Paris gewöhnt, aber die Stadt war eine dauernde Überforderung geblieben. Von nun an ging ich nicht mehr so oft aus und fing an, meine Freunde zu meiden und statt im Restaurant in meinem Zimmer zu essen. Ich saß am Fenster und schaute stundenlang in die Hinterhöfe, las wieder mehr, spazierte alleine durch die Quartiere. Mein Bedürfnis, all das Erlebte und Gesehene in eine Form zu bringen, wurde immer stärker, und ich fing an, erste Texte zu schreiben auf der alten Hermes-Schreibmaschine im Büro, auf der ich sonst die Kontenblätter nachführte. Manche dieser Texte waren nur ein paar Zeilen lang, kleine Szenen, Stimmungen und allerlei altkluge Gedanken. Fast alles ist verloren, aber ein paar Fragmente, ein paar Erinnerungen haben es in einen ersten Roman geschafft, den ich kurz nach meiner Rückkehr in die Schweiz begann.
Damals war ich glücklich. (…) Auf dem kleinen Ruderboot im Bois de Boulogne in Paris, mit einem guten Freund und dieser Schweizerin, die ich ja eigentlich gar nicht gemocht habe, aber die so lebendig und sonnenverbrannt war wie der Sommer im Park, mit ihrem kurzen, weißen Rock und den braunen Armen und Beinen.
Der Roman, den ich vermutlich 1984 begann, hieß nach einem Zitat von Charles Baudelaire »Ein Traum von Stein«.
Schön bin ich, Sterbliche, ein Traum von Stein.
Der Roman erzählte die Geschichte von Andreas Bastian Zaffius, einem Koch, der aus einem Dorf in den Bergen stammt, das leicht als Soglio im Bergell zu erkennen ist, vielleicht das schönste Dorf der Schweiz.
Ich tippte den Text damals auf einer Art elektrischen Schreibmaschine mit Diskettenlaufwerk und kleinem Bildschirm, er existiert nur noch als Ausdruck, der bei mir zu Hause in einem Ordner liegt. Das Buch beginnt und endet in einem Zug, der von der Schweiz nach Paris fährt. Die Geschichte, die erzählt wird, ist eine lange Rückblende, die Erinnerung von Andreas an seine Rückkehr ins Dorf seiner Kindheit. Ein Pfarrer spielt eine wichtige Rolle im Buch. Er und Andreas streiten sich über Religion und um ein Mädchen.
Ich durchforstete für diese Vorlesung meine Festplatte nach Spuren dieses ersten Romans und finde ein Fragment, das ich irgendwann einmal abtippte aus Gründen, die nichts zur Sache tun:
Ich hatte früh gelernt, dass man niemandem helfen kann. Eine Wespe, die im Schwimmbecken um ihr Leben zappelte, bewegte mich, als sei es ein Mensch, der neben mir ertrinke, und auf Spaziergängen ärgerte ich meine Eltern oft, indem ich zurückblieb, um einem Insekt in Not beizustehen. Ich schaute zu, wie es langsam starb, wagte nicht, es selbst zu töten, aber blieb bei ihm und litt mit ihm, litt doppelt, da ich ihm nicht helfen konnte. Sobald das Tier tot war, erhob ich mich ohne Erinnerung und ohne Trauer.
Eine ähnliche – vom Pathos befreite, dafür genauer beobachtete – Szene findet sich in der Erzählung »Männer und Knaben« aus dem Band »Wir fliegen«, die ich viele Jahre später schrieb:
Er legte sich am Rand des Schwimmbeckens auf die rauen Zementplatten. Auf dem Wasser trieben Blätter, die das Gewitter von den Bäumen geschlagen hatte, dazwischen zappelte eine Wespe. Lukas streckte die Hand aus, er wollte das Insekt retten, aber er hatte Angst, gestochen zu werden. Seine Hand verharrte über dem Tier, als wolle er es beschützen. Langsam trieb es ab und entfernte sich immer weiter vom Beckenrand.
Der Höhepunkt meines ersten Romans ist eine Rettungsaktion. Der Dorfpfarrer hat mit einigen Jugendlichen eine Bergtour gemacht und ist kurz vor dem Gipfel verunglückt. Die Jugendlichen lassen den Pfarrer zurück und steigen ab, um Hilfe zu holen. Während ein Schneesturm aufzieht, macht Andreas sich auf, seinen Widersacher zu retten. Als er den Pfarrer erreicht, liegt dieser schon im Sterben. Andreas bleibt bei ihm, wie bei einem sterbenden Insekt, aber er kann nichts für den Verletzten tun. Nachdem der Pfarrer gestorben ist, steigt Andreas auf den Gipfel. Im Morgengrauen kehrt er zurück ins Dorf. Er bekommt das Mädchen, und die beiden verlassen das Tal und fahren nach Paris.
Ich machte beim Schreiben dieses ersten langen Textes ein paar entscheidende Fehler. Zum einen war der Roman von Anfang bis Ende durchgeplant. Ich wusste im Voraus, wie viele Kapitel er haben würde und was in jedem von ihnen passieren sollte. Das führte dazu, dass mir beim Schreiben jede Spannung fehlte und dass meine Figuren keine Chance hatten, sich zu entwickeln und eigene Entscheidungen zu fällen, eigene Wege zu gehen.
Das Dorf, in dem der Roman spielte, war mir nur von Ferienaufenthalten bekannt. Ich betrieb in der Bibliothek ausführliche Recherchen, las unter anderem eine Dissertation über den Inzest in Soglio, statt dass ich mich in das Dorf begeben hätte, um wenigstens eine Zeitlang dort zu leben.
Aber mein schlimmster Fehler war wohl, dass ich die berüchtigte Frage: »Was will der Autor uns sagen?« sehr gut hätte beantworten können. Andreas, meine Hauptfigur, war mein Sprachrohr. Statt einer Frage hatte ich eine Antwort.
Ich schickte das Typoskript an einige Verlage, die alle mit Standardbriefen absagten. Ein schlechter Text von Tausenden, die jedes Jahr in den Lektoraten landen.
Noch war beinahe nichts passiert. Ich war dabei, die Matura nachzuholen, arbeitete nebenbei in der Betriebsbuchhaltung von Swissair, hatte eine Freundin und ein Motorrad. Ich hätte es dabei bewenden lassen können. Wenige Leute wussten, dass ich schrieb. Hätte ich aufgehört, kein Mensch hätte sich gewundert. Aber ich machte weiter.
Das Mittagessen hier in Santa Maddalena wird heute, wie erwartet, unten am Pool eingenommen. Wir reden über John Cage und über schalltote Räume. Michael erzählt von der Stille, die nach dem Drehen von Filmszenen aufgenommen wird, weil jedem Raum die Stille eigen ist. Eine Szene, die ich in meinem letzten Roman beschrieben habe.
Am Nachmittag ziehen Gewitterwolken auf, und aus der Ferne ist Donner zu hören, aber der ersehnte Regen kommt nicht. Ich lese die Zeitung, schwimme ein wenig im Pool, um mich abzukühlen, schreibe dann weiter an dieser ersten Vorlesung, die mir etwas aus dem Ruder zu laufen scheint.
Inzwischen ist es Abend geworden. Im Park riecht es betäubend nach Jasmin, und es herrscht jene eigentümliche Stille wie oft vor Gewittern, die ich so sehr liebe und in meinen Büchern immer wieder beschrieben habe. Nur Vogelgezwitscher ist zu hören. Wir fahren alle zusammen in ein nahe gelegenes Hotel, ein ehemaliges Herrenhaus, von dem aus man wunderschön über die Hügel sehen kann, trinken einen Aperitif. Nach dem Abendessen sitzen wir lange vor dem Haus, reden über Literatur und trinken Rotwein. Ich mache mich unbeliebt mit einer gewagten These über die mangelnde Originalität der angelsächsischen Literatur, keine sehr diplomatische Bemerkung, wenn man von englischsprachigen Autoren umgeben ist. Aber es ist zu friedlich hier für Streit und wir wechseln das Thema, reden über den Unterschied von Schauspielern und movie stars und über Emmas bevorstehende Heirat im Oktober. Auf dem Weg durch die Dunkelheit zurück zum Turm sehe ich zum ersten Mal seit vielen Jahren Glühwürmchen.
II – Das wiedergewonnene Paradies
22.5.2014
Heute ist in Santa Maddalena der Tag der Abreisen. (Sie erinnern sich, wir befinden uns in der Toskana, im Haus von Beatrice Monti della Corte, wohin ich für einige Wochen zum Schreiben eingeladen wurde.) Als ich nach dem Frühstück ins Haupthaus komme, ist Emma, die junge Amerikanerin, schon weg. Ihr Flug zurück in die USA ging früh am Morgen.
Emma war ein paar Sommer lang Beatrices Assistentin. Jetzt arbeitet sie an ihrer Abschlussarbeit über den russischen Film der zwanziger Jahre. Im Herbst wird sie Jim heiraten, eine gute Partie, wie mir die anderen versichern. Emma ist groß, gebildet, gut erzogen und von fast klassischer Schönheit. Riccardo, ein Fotograf und Nachbar von Beatrice, der uns kürzlich zu einer Party in sein Haus eingeladen hat, hat gemeint, sie habe ein Renaissance-Gesicht. Er hat ihr einen Turban aufgesetzt und sie in seinem Garten porträtiert. Für mich ist Emma der Idealtypus der höheren amerikanischen Tochter aus gutem Haus. Alle mögen sie, und es ist schwer vorstellbar, dass sie etwas Geschmackloses oder Gemeines täte. Sie hat sich unsere abgeklärten Gespräche über Beziehungen angehört, scheinbar ohne sich dadurch verunsichern zu lassen, mit der Ruhe und dem Selbstvertrauen junger Menschen, die fest daran glauben, alles anders, alles besser zu machen als die Generation vor ihnen. Es ist mit dem Leben wie mit Texten, es fällt viel leichter, die der anderen zu deuten und zu beurteilen als die eigenen. Ich hätte Emma gern alles Gute gewünscht für ihre Hochzeit mit Jim, für ihr weiteres Leben.