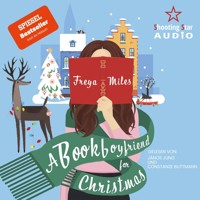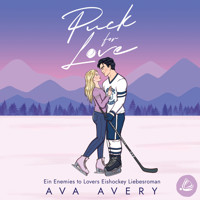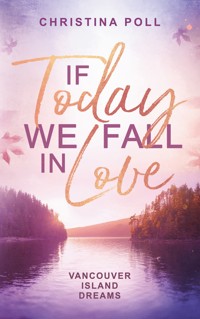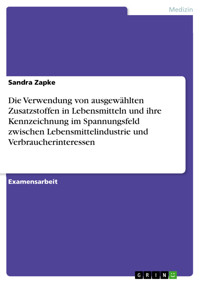
Die Verwendung von ausgewählten Zusatzstoffen in Lebensmitteln und ihre Kennzeichnung im Spannungsfeld zwischen Lebensmittelindustrie und Verbraucherinteressen E-Book
Sandra Zapke
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Gesundheit - Ernährungswissenschaft, Note: 2,3, Technische Universität Berlin (Arbeitslehre Haushalt), Sprache: Deutsch, Abstract: 1. Einleitung „Von Fälscherei und Beschiß Betrüger sind und Fälscher viel, [...] Man läßt den Wein nicht rein mehr bleiben: Viel Fälschung tut man mit ihm treiben, Salpeter, Schwefel, Totenbein, Pottasche, Senf, Milch, Kraut unrein Stößt man durchs Spundloch in das Faß. [...] Mausdreck man unter den Pfeffer rollt, [...] Die faulen Heringe man mischt Und sie als frische dann auftischt.“ Dieser Ausschnitt aus Sebastian Brants Narrenschiff aus dem Jahr 1494 lässt erahnen, dass bereits im Mittelalter die Lebensmittel bei der Herstellung verunreinigt und gestreckt wurden. Aber auch heute ist das Thema „Fälscherei und Beschiß“ [sic] ganz aktuell. Zusatzstoffe werden mit verstärktem Aufleben der Fast-Food-Gesellschaft, dem „Convenience Food“, dem schnellen Lebenswandel und der starken Verwendung durch die Lebensmittelindustrie immer relevanter, gerade in Bezug auf den Schutz des Verbrauchers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Thema:Die Verwendung von ausgewählten Zusatzstoffen in
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung
Vorgelegt von: Sandra Zapke
Berlin, den
Page 3
1. Einleitung
Dieser Ausschnitt aus Sebastian Brants Narrenschiff aus dem Jahr 1494 lässt erahnen, dass bereits im Mittelalter die Lebensmittel bei der Herstellung verunreinigt und gestreckt wurden. Aber auch heute ist das Thema „Fälscherei und Beschiß“ [sic] ganz aktuell. Zusatzstoffe werden mit verstärktem Aufleben der Fast-Food-Gesellschaft, dem „Convenience Food“, dem schnellen Lebenswandel und der starken Verwendung durch die Lebensmittelindustrie immer relevanter, gerade in Bezug auf den Schutz des Verbrauchers. Meine Motivation zu diesem Thema liegt vor allem darin, dass ich junge Mutter bin und während der Schwangerschaft, der Stillzeit aber auch nach der Stillzeit meine Ernährung so gesund, abwechslungsreich und risikoarm gestalten möchte. Auch als zukünftige Lehrerin der Arbeitslehre ist es mein Wunsch, den Schülern Lebensmittel präsentieren zu können, die gar nicht oder möglichst schonend verarbeitet wurden. Um das Wissen darüber zu erhalten, bedarf es einer genauen Auseinandersetzung mit den zugelassenen und verwendeten Zusatzstoffen in Lebensmitteln und ihrer Wirkung. Aber auch die Interessen der Lebensmittelindustrie und die der Verbraucher sollen in dieser Arbeit betrachtet werden. Sie unterscheiden sich in großem Maße und liegen, wenn überhaupt, nur selten beisammen. Zudem sind die Begriffsspanne und das Verständnis von Zusatzstoffen sehr weitläufig. Der Gesetzgeber erkennt nur die mit E-Nummern versehenen Zusätze als wirkliche Zusatzstoffe an, wohingegen der Verbraucher alle Zusatzstoffe, die dem Lebensmittel zugesetzt werden, als Zusatzstoffe ansieht. Dazu zählen unter anderem auch Aromen, Gelatine und Stärke. Sie sollen in
1Brant 1494: Kapitel 102
Page 4
dieser Arbeit näher beleuchtet werden und letztendlich soll auch auf die Gefahren, die von Zusatzstoffen ausgehen, eingegangen werden.
2. Das Lebensmittelrecht
Das Lebensmittelrecht, welches grundlegend zum Schutz des Verbrauchers existiert, ist in der Europäischen Union weitestgehend vereinheitlicht. Das ist wichtig, da innerhalb der EU die Grenzen geöffnet sind und Lebensmittel aus anderen EU-Ländern auch in Deutschland vertrieben werden können. Grundlage zur Vereinheitlichung bildet die im Januar 2002 vom Europäischen Parlament und Rat verabschiedete EG-Basis-Verordnung zum Lebensmittelrecht Nr. 178/2002. Diese Verordnung wird nach und nach in deutsches Lebensmittelrecht umgewandelt. Das deutsche Lebensmittelrecht basiert auf drei Säulen. Den Rahmen bildet das neue Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), welches im Jahr 2005 aus dem bisherigen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG) entstanden ist. Es legt wesentliche Grundlagen fest. Was ist ein Lebensmittel? Wer ist für die Überwachung zuständig? Was ist erlaubt? Was ist grundlegend verboten und welche Strafen sind vorgesehen? Das LFGB umfasst den ganzen Weg der Lebensmittelkette, sozusagen vom Acker bis zum Teller. Alle Beteiligten, von der Herstellung bis zum Verkauf, müssen dafür Sorge tragen, dass die Beschaffenheit und die Bezeichnung eines Lebensmittels den gesetzlichen Bedingungen entsprechen. Das Lebensmittelrecht basiert auf drei grundlegenden Prinzipien zum Schutz des Verbrauchers: Schutzvor Gesundheitsschäden, Schutzvor Täuschung, undsachgerechte Information.
In der Umsetzung versteht man darunter, dass gesundheitsschädliche Lebensmittel, auch Lebensmittel deren Gehalt an unerwünschten Stoffen die gesetzlich festgelegten Höchstmengen überschreiten, nicht in den Handel kommen dürfen. Die Kennzeichnung, Aufmachung und Packungsgröße eines Lebensmittels darf den Verbraucher nicht über den Inhalt der Packung täuschen. Die Informationen über das Lebensmittel müssen eindeutig und richtig sein.2Durch die Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung findet die Umsetzung und Kontrolle der Einhaltung zur Lebensmittelkennzeichnung statt.
2Vgl. aid infodienst 2005: 6f.
Page 5
Darüber hinaus gibt es für bestimmte Lebensmittel und Lebensmittelgruppen wie Käse, Fleisch, Eier, Obst und Gemüse extra Kennzeichnungsvorschriften.
2.1.Die Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung
Die Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung (LMKennzVO) ist von besonderer Bedeutung für den Verbraucher, da sie in seinem Interesse handelt und für fast alle Lebensmittel, soweit sie in Packungen oder Behältnissen an den Verbraucher abgegeben werden, Kennzeichnungspflichten, insbesondere zur Kennzeichnung des Herstellers, des Inhalts nach der handelsüblichen Bezeichnung und der Menge, aber auch der Zeit der Herstellung oder der Haltbarkeitsdauer enthält. Die Hersteller verpflichten sich auf allen Packungen oder Behältnissen von Lebensmitteln sechs Angaben zu leisten:Die Verkehrsbezeichnung (der Name des Lebensmittels),Die Zutatenliste, wobei die Zutaten in absteigender Reihenfolge nach Gewicht aufgelistet sind,
Das Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum,Die Füllmenge,
Der Name oder die Firma und die Anschrift des Herstellers, Verpackers oder eines europäischen Verkäufersund die Los-/Chargen-Nummer.
Die Angaben müssen leicht verständlich, deutlich lesbar, in deutscher Sprache und unverwischbar sein. Ausgenommen von dieser Kennzeichnungspflicht sind Aromen, Weinerzeugnisse, zubereitete und verzehrfertige Speisen sowie Dauerbackwaren und Süßwaren, die am Verkaufsort verpackt werden.3
Wenn unverpackte Lebensmittel Zusatzstoffe enthalten, müssen sie kenntlich gemacht werden, wobei der Anbieter sich zwischen zwei Kennzeichnungsvarianten entscheiden kann, der Kennzeichnung in Kurzform oder der vollständigen Angabe in einem Verzeichnis. Entscheidet sich der Anbieter für die Kurzform, muss er direkt neben der Ware mit einem Schild nur auf ganz bestimmte Zusatzstoffe hinweisen. (in der folgenden Tabelle ersichtlich)
3Vgl. aid infodienst 2005: 10f.
Page 6
Page 7
Andere Zusatzstoffe und Zutaten müssen nicht genannt werden. Wählt der Verkäufer die vollständige Auflistung aller Zutaten in Form eines Heftes, Aushangs etc., dann muss nahe dem Lebensmittel auf dieses Verzeichnis hingewiesen werden. In Gaststätten, Kantinen und anderen Einrichtungen reicht es aus, die Zusatzstoffe in Form von Fußnoten auf der Speisekarte anzugeben. Beispiel: „Matjes satt*) mit Bratkartoffeln“ *) konserviert mit Sorbinsäure
Da die Lebensmittelindustrie jedoch gerne in Bezug auf das Gewicht, die Beschaffenheit, den Wert und die Haltbarkeit des Lebensmittels täuscht, ist mit der Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung ein Weg geebnet, dem Käufer einen raschen Überblick über den Inhalt nach Art und Menge zu verschaffen.4Die Kennzeichnung von verpackten Lebensmitteln soll der Irreführung des Käufers vorbeugen, da er in der Regel nicht in der Lage ist, sich an Ort und Stelle vom Inhalt der Packung zu überzeugen. Bis Oktober 2005 waren bestimmte Stoffe mit allergenem Potenzial wie Milch, Eier oder Nüsse nicht kennzeichnungspflichtig. Seit November 2005 müssen sie jedoch gekennzeichnet werden, egal ob es sich um unwirksame Restmengen von Zusatzstoffen handelt oder um Trägerstoffe für Aromen.
Seit Januar 2009 gibt es eine zusätzliche Erweiterung in Bezug auf die Deklaration von Lebensmittelzusatzstoffen, die besagt, dass ab 20. Juli 2010 Lebensmittel, die bestimmte Farbstoffe enthalten, besser gekennzeichnet werden. Dabei handelt es sich um die Azo-Farbstoffe mit den E-Nummern E 110 (Gelborange S), E 104 (Chinolingelb), E 122 (Azorubin), E 129 (Allurarot AC), E 102 (Tartrazin) und E 124 (Conchenillerot A). Lebensmittel, die diese Farbstoffe enthalten, müssen künftig die
4Vgl. Holthöfer/ Nüse/ Franck 1971: 1
Page 8
entsprechende E-Nummer und den Hinweis „kann sich nachhaltig auf die Aktivität und Konzentration von Kindern auswirken“ tragen.5Mit diesem Beschluss setzt das Europäische Parlament den vorbeugenden Verbraucherschutz durch, da es ausreichende Vermutungen auf Gesundheitsschädigungen gibt. Jedoch nicht jeder Zusatzstoff und jede Substanz muss deklariert werden.
2.1.1. Zutaten, die nicht deklariert werden müssen
Es gibt gewisse Ausnahmen in Bezug auf die Deklaration von Lebensmitteln, denn wenn einem Lebensmittel ein anderes, behandeltes Lebensmittel (z.B. Früchte im Joghurt) zugesetzt wird, dann müssen die verwendeten Zusatzstoffe deklariert werden, es sei denn, dass durch die Vermischung ihre Konzentration im Endprodukt zu gering ist, um noch eine Wirkung (z.B. Konservierung) auszuüben.
„Man gibt ein Zusatzmittel in ein Fett hinein, ein Antioxydans, damit es nicht oxydiert, nicht ranzig wird. Nun wird dieses Fett als Ausgangsfett für Margarine mit anderen Fetten gemischt, die keine Zusätze enthalten. Dabei wird der Antioxydans-Gehalt schon stark verringert. Nun nehmen Sie die aus diesen Fetten hergestellte Margarine mit reduziertem Antioxydans-Gehalt und backen damit einen Kuchen. Dann wird der Antioxydans-Gehalt darin wiederum so verdünnt, daß [sic] es unsinnig wäre, zu deklarieren: ‚Das ist ein Kuchen mit Antioxydans.’“6
Das gilt zum Beispiel für Enzyme, die einen Brotteig funktionell besser aufgehen lassen, oder Milchsäurebakterien, die bei der Käseherstellung zum Reifeprozess beitragen. Lösungs- und Trägermittel von Zusatzstoffen oder Aromen sowie Extraktionslösungsmittel müssen auch nicht gekennzeichnet werden, da sie nur verwendet werden, um einen Lebensmittelzusatzstoff oder ein Aroma zu lösen, zu verdünnen, zu dispergieren oder auf andere Weise physikalisch zu modifizieren. Sie verändern weder seine Funktion noch üben sie technologische Wirkung aus. Die Mittel erleichtern nur die Handhabung, Verwendung oder den Einsatz. Bestandteile wie Wasser oder Aromen, die einem Lebensmittel entzogen und dann wieder hinzugefügt wurden, ohne dass sich deren Anteil im Lebensmittel verändert, wie zum Beispiel bei Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat müssen auch nicht gekennzeichnet werden.
5Vgl. Europäisches Parlament: „Neue EU-Gesetzgebung zu Lebensmittelzusatzstoffen“. URL: http://www.europarl.de/presse/pressemitteilungen/quartal2008_3/PM_080708_1e [Stand 15.Juni 2009]
6Spiegel: „Gift in der Nahrung?“. URL:
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?top=Ref&dokname=COCQEINZEL-SP19581105-C0502353&suchbegriff=vw+bank&titel=Gift+in+der+Nahrung%3A+Titel-