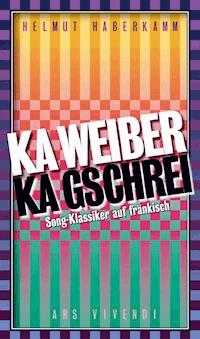Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
"Eine Stunde hat viele Gesichter, und ein einziger Tag unglaublich viele Jahre." - Helmut Haberkamm ruft Erinnerungen an vergangene Zeiten wach, an alte, beinahe in Vergessenheit geratene Redewendungen und Wörter, auch, "mit langen, staubbraunen Schatten, mit Wärme und Licht". Ebenso einfühlsam wie kritisch erzählt er von den Wunden, die das letzte Jahrhundert in den Familien und in der Gesellschaft hinterlassen hat. Die Geschichten seiner Figuren handeln von Schicksalsschlägen und Ausgrenzung, aber auch von den hellen Momenten, die das Leben immer wieder bereithält. Und wenn Haberkamms Erzählungen in Franken angesiedelt sind und seine Sprache auf unvergleichbare Art vom Mündlichen, dem Fränkischen, gefärbt ist, so wird doch klar, dass er auf kleinem Raum von der ganzen Welt spricht - und von dem, was uns als Menschen ausmacht. Ein echtes Lese-Highlight!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Haberkamm
Die warme Stube der Kindheit
Erzählungen
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage April 2019)
© 2019 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Druck: CPI books GmbH, Leck
Gedruckt auf holzfreiem Werkdruckpapier
der Papierfabrik Arctic Paper
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
ISBN 978-3-7472-0053-7
Inhalt
Der Stern von Bethlehem
Ein Tag mit so vielen Jahren
Das Gewicht eines Zettels
Die warme Stube der Kindheit
Stiftengeher
Kleine Geschichte im Grunde
Das Dorf der einsilbigen Menschen
Bruderherz
Helgaland, so nah am Wasser
33 – 45 – 78
Gringo, Goggo und Jerry
Hohe Nacht der klaren Sterne
Der Autor
Quellennachweise
Der Stern von Bethlehem
»Hast du schon die Sauerei im Schaufenster gesehn?«, fragte eine Kundin in der Bäckerei Rost ihre Freundin hinter der Theke. Auch im Kindergarten und Getränkemarkt, am Bankschalter und an der Tankstelle hörte man die Frage. Manche Gesichter wirkten dabei ernst und empört, manche Leute grinsten und machten anzügliche Bemerkungen, andere schüttelten ihren Kopf oder fuchtelten mit dem Finger. Kein Zweifel: Diese Weihnachtskrippe war in aller Munde.
Den Ort des Geschehens musste keiner mehr erfragen, jeder kannte nun das barocke Sandsteingebäude in der Spitalgasse, zwischen dem Drogeriemarkt und dem Tattoo- und Piercing-Studio. Im schön geschwungenen Bogenfenster war eines der zwanzig Kunstwerke dieser Adventsaktion des Heimatvereins und des Verbands der Einzelhändler am Tag vorher feierlich enthüllt worden. Seitdem konnte man Passanten dort stehen sehen, meist waren sie zu zweit, zu dritt am Reden und Gestikulieren, zogen damit weitere Schaulustige an, die sich in die Gespräche einmischten oder dem Geschehen rasch den Rücken zukehrten und forteilten. Jugendliche fanden sich in Grüppchen dort ein, feixten und lachten. Mütter zogen ihre neugierigen Kinder schnell weiter, wenn diese wissen wollten, was es dort zu sehen gäbe.
Wer in das festlich umrahmte Adventsfenster hineinblickte, sah eine Frau am Boden sitzen, die Füße aufgestellt, Arme nach hinten gestützt, den Kopf mit den verschwitzten, strähnigen Haaren tief gebeugt, sodass man ihr Gesicht nicht erkennen konnte. Nur wenn man sich bückte, sah man ihren vor Anstrengung geöffneten Mund, ihr abgekämpftes Antlitz. Sie trug ein graues, grobes Hemd, das teilweise geöffnet und nach oben gerutscht war, sodass ihr Oberkörper, die Bauchfalten und Brüste zu sehen waren. Ihre nackten Beine hatte sie gespreizt, der blutige Kopf des Kindes schaute aus ihrem geöffneten, haarigen Schoß, mit geschlossenen Augen und dem Gesicht nach oben. Alles an der Frau wirkte aschgrau, fahl und trübe, nur der Säugling glänzte wässrig rot, und am rauen Stoff überm Herzen der Mutter prangte ein knallgelber Davidstern. »Der Stern von Bethlehem« stand als Titel auf einem Kärtchen im Vordergrund, dazu der Name des Künstlers: Eberhard Bodenschatz.
Am Abend vorher war die kolorierte Tonplastik mit einer Rede von Dr. Thürauf, dem Künstlerbeauftragten der Kirche, feierlich enthüllt worden. Etwa fünfundzwanzig Personen hatten sich vor dem Adventsfenster eingefunden, darunter Freunde und Kollegen des Künstlers, Mitglieder des Heimatvereins und Einzelhandels, des Rathauses, zwei Stadtratsmitglieder, ein Mitarbeiter der Lokalzeitung, der fotografierte und eifrig Notizen machte. Sekt und Glühwein wurden getrunken, man grüßte, scherzte, plauderte. Auf dem Gehsteig vor dem Fenster brannten Kerzen und Laternen, innen wurde ein dunkler Vorhang entfernt und alle betrachteten der Reihe nach die stuhlhohe Skulptur im schlichten Lichtstrahl. Ernst und aufmerksam wurde sie begutachtet, auf Einzelheiten hingewiesen und anerkennend genickt. Vorbeieilende, die noch letzte Einkäufe erledigten, blieben neugierig stehen, um einen Blick ins Schaufenster zu werfen, etliche wurden aus dem Kreis der Versammelten auch herbeigewunken und freudig begrüßt. »Geselligkeit und Kunstgenuss gaben sich ein stimmungsvolles Stelldichein«, würde es anderntags im Lokalteil heißen.
»Das ist kein gewöhnliches Kunstwerk«, begann Dr. Thürauf seine Rede. »Das ist keine gewöhnliche Geburt, keine x-beliebige Frau. Nein, das ist keine klassische Darstellung von Weihnachten. Das ist unsere große Chance, um genauer hinzusehen, darüber nachzudenken und unser Mitgefühl wachzurufen. Als Betrachter sind wir hautnah beim Geburtsvorgang dabei. Jeder von uns ist Augenzeuge, wie ein Kind das Licht der Welt erblickt. Zur Hälfte steckt es noch im Mutterschoß, aber sein Kopf hängt schon in der Luft, in der Schwebe zwischen Geborgenheit und Gefahr. Man möchte geradezu die Hände ausstrecken und seinen Kopf halten und stützen, gewissermaßen zum Geburtshelfer werden. Die Erschöpfung ist dieser gebärenden Frau ins Gesicht geschrieben. Man spürt sie atmen beim Pressen, verschnaufen, schwitzen. Mit Schmerzen sehnt sie sich danach, dass es vorübergeht. Sie kann nicht mehr, das Ganze geht über ihre Kräfte. Aber sie muss alles ertragen, die Wehen, die Furcht, die Schmerzen, um ihrem Kind das Leben schenken zu können. Dabei ist sie mutterseelenallein ihrem Schicksal ausgeliefert. Niemand steht ihr bei.
Wir merken sofort: Das ist keine gewöhnliche Weihnachtskrippe. Zwar geht es um die Ankunft des Neugeborenen, das Wunder der Geburt, dem wir staunend beiwohnen. Aber hier haben wir auch eine Passionsgeschichte vor uns. Wir nehmen teil am Leid einer gebärenden Frau. Alles verweist auf Maria im Stall von Bethlehem, aber wir sehen sie nicht im Glanz der Gottesgebärerin, erfüllt vom Glück einer gesegneten Mutter. Wir sehen sie leiden als erbarmungswürdige, schmerzgebeugte Kreatur, als kreißende Wöchnerin bei der Niederkunft. Schmerzhaft wird uns die emotionale Wucht der Botschaft bewusst: Das Göttliche kommt hernieder und wird Mensch, das Wort wird Fleisch und Blut.
Der Titel des Kunstwerks verweist aber auch auf die Jüdin Maria, die ihren Sohn Jesus gebar, der als Jude zur Welt kam und als Jude starb. Der unschuldige gelbe Stern wirkt so ehrwürdig und lebensfroh in all dem Grau, aber er erzählt von brutalster Ausgrenzung und Verfolgung. Und so prallen hier Geburt und Tod, Liebe und Hass, Gewalt und Friede auf Erden zusammen. Mit diesem Stern von Bethlehem sind wir bis heute wie mit einer blutigen Nabelschnur unauflöslich verbunden.
Die Muttergottes und Himmelskönigin als KZ-Gefangene bei der heimlichen Geburt im Lager? So haben wir das Weihnachtsgeschehen gewiss noch nie gesehen. Aber genau aus diesem Grund brauchen wir solche Kunstwerke und Künstler: um uns die Augen und Herzen zu öffnen, neue Blickwinkel und Denkmöglichkeiten zu eröffnen. Danke, lieber Eberhard Bodenschatz, für diese Wegweisung und Offenbarung. Mit dieser atemberaubenden Maria zeigen Sie, dass Sie den Albrecht-Dürer-Preis, den höchsten fränkischen Kunstpreis, den Sie vor einigen Jahren in Empfang nehmen durften, mit Fug und Recht verdient haben.«
Die Zuhörer klatschten und stießen mit Gläsern an, man suchte das Gespräch mit Bodenschatz, der neben seiner vor Stolz strahlenden Frau stand und verlegen lächelte, dann aber erleichtert Glückwünsche und Eindrücke zur Kenntnis nahm und leutselig kommentierte. Nun wirkte er nicht mehr so angespannt und wortkarg wie zuvor. Er, der eher zurückhaltende, reichlich mit sich selbst und seinen Ideen und Projekten beschäftigte Künstler, genoss nun mit sichtlicher Genugtuung die Aufmerksamkeit und Anerkennung der Anwesenden. Mit Sekt und Glühwein wurde die Mühsal der vergangenen Wochen und Monate, alle Zweifel und Bedenken hinweggespült. Zwar hatte ihm Veronika, seine Frau, zu Hause im Atelier bereits versichert, dass seine »KZ-Maria«, wie sie das Werk nannte, »absolut realistisch« war, »total eindrucksvoll«. Sie musste es ja wissen, als Krankenschwester kannte sie die Einzelheiten des menschlichen Körpers zur Genüge und sah sie Tag für Tag auf der Intensivstation der Klinik.
Linda, ihre Freundin, die als Hebamme auch ihre Meinung beisteuern und wichtige Hinweise über alle Arten von Geburten geben konnte, äußerte sich ebenfalls begeistert: »Dafür, dass du keine Kinder hast und nie dabei warst, wenn so ein Erdenwurm auf die Welt kommt, hast du es echt wirklichkeitsnah hingekriegt«, meinte Linda, als sie bei ihnen im liebevoll restaurierten alten Bauernhaus draußen in Güthleinsberg war, um das fertige Produkt als Erste kritisch in Augenschein zu nehmen. »Die Idee mit der Maria mit dem Judenstern ist schon genial. Ehrlich gesagt hab ich stillschweigend auch immer gedacht, sie wär eine Christin gewesen.« Eberhard Bodenschatz lächelte und seine Augen strahlten. Als Albrecht-Dürer-Preisträger, so hoffte er, müsste das Werk an ein angesehenes Museum zu verkaufen sein, vielleicht auch an eine Kirche oder ein Bistum. Jetzt war er überzeugt und guter Dinge.
Am Vormittag nach der Eröffnung klingelte sein Telefon. »Hier ist der Bürgermeister!«, hörte Bodenschatz eine kraftvolle, aufgeladene Männerstimme loslegen. »Sagen Sie, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Freiheit der Kunst schön und gut, aber das ist doch keine Kunst, das ist eine Provokation! Wissen Sie, was Sie damit angerichtet haben? Hier im Rathaus steht das Telefon nicht mehr still. Am laufenden Band kriegen wir hier die Protestanrufe rein. Wir kommen gar nicht mehr zum Arbeiten. Hören Sie, Bodenschatz, das Ding muss weg, und zwar sofort und auf der Stelle! Wenn Sie’s nicht selber wegschaffen, dann lass ich es entfernen, bloß dass das klar ist. Alles was recht ist, aber so geht’s nicht, da hört sich ja alles auf!«
»Also ich weiß überhaupt nicht … Haben Sie die Skulptur denn überhaupt schon gesehen?«
»Natürlich! Was glauben Sie denn? Meinen Sie, ich wäre so aufgebracht, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte? Ich hab Sie immer für einen freundlichen, vernünftigen Menschen gehalten, Bodenschatz, aber das ist ein Schlag ins Gesicht! So was ist doch keinem Menschen in unserer Stadt zuzumuten, noch dazu jetzt in der Weihnachtszeit! So eine Zumutung stört doch den ganzen Weihnachtsfrieden! Das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses!«
»Das ist doch nur ein Kunstwerk, und zur Freiheit der Kunst gehört …«
»Jede Freiheit muss ihre Grenze haben, sonst gibt’s Chaos! Wo kämen wir denn da hin? Sie können doch nicht die religiösen Gefühle rechtschaffener Bürger mit Füßen treten!«
»Wo hab ich denn hier …?«
»Da fragen Sie noch? Eine nackte Frau, wo man untenherum alles sieht, in einem Schaufenster, wo jede Mutter, jedes Schulkind beim Einkaufen vorbeilaufen und reinschauen muss? Das will doch keiner sehen! Wer braucht denn so was? Meine Frau hat es auch gesehn und sie war genauso empört wie ich. ›Das verletzt ihre Würde als Frau‹, sagt sie. Da hat sie recht, da stimm ich ihr voll und ganz zu.«
»Aber Herr Döderlein, gestern waren vierzig Leute bei der Eröffnung des Adventsfensters und kein Einziger hat …«
»Ach was! Das ist doch kein Adventsfenster! Wo ist denn da der Frieden, die Liebe, die frohe Botschaft?«
»Grad weil das alles fehlt, zeigt es doch das Entscheidende, dazu noch der gelbe Stern …«
»Das ist sowieso der Hammer! Was haben denn die Nazis und die Juden mit dem Stall von Bethlehem zu tun? Das ist doch eine gewollte Provokation, weiter nichts! Dass das viele Mitbürger jetzt als Gotteslästerung empfinden, kann ich absolut nachempfinden. Am Ende hetzen Sie uns damit auch noch die jüdischen Gemeinden und die Medien auf den Hals, dann haben wir den Salat, dann Gnade uns Gott! Sie können uns doch nicht mitten in unsere schöne, ruhige Stadt so ein Machwerk reinsetzen! Noch dazu als Weihnachtskrippe! Nein, nein, das muss sofort weg, Bodenschatz, auf der Stelle, haben Sie mich verstanden?«
»Aber das ist doch ein Kunstwerk, und als solches bleibt es dort stehen. Wenn es Diskussionen und Reaktionen auslöst, umso besser, genau das ist ja auch die Funktion von Kunst …«
»Papperlapapp, Funktion von Kunst! Hier bei uns im Rathaus beschweren sich die Leute und schimpfen und drohen. Das müssen Sie doch zur Kenntnis nehmen und entsprechende Schritte einleiten.«
»Wie wär’s denn mit einer öffentlichen Podiumsdiskussion dazu?«
»Sind Sie verrückt? Dass es noch der Allerletzte mitbekommt und auf die Barrikaden geht? Das bleibt doch alles an mir hängen! Ich weiß doch, wie so was läuft. Dann kommt irgend so ein Klugscheißer aus der Stadt und sagt uns, was das hier für ein tolles Kunstwerk ist und wie provinziell wir sind, und am Ende sind wir verklemmte Kunstbanausen und ewiggestrige Antisemiten. Das will ich hier nicht haben, basta! Das muss weg und zwar auf der Stelle, haben Sie gehört?«
»Tut mir leid, Herr Döderlein, aber so kann man mit einem Kunstwerk nicht umgehen. Der Heimatverein hat mich gebeten, ein Adventsfenster zu gestalten …«
»Das ist aber kein Adventsfenster! Das ist ein Stein des Anstoßes, weiter nichts! Ein öffentliches Ärgernis! Da muss ich als Stadt reagieren.«
»Mit welcher Handhabe?«
»Das werden Sie schon sehn. Sie weigern sich also, trotz meiner Einwände und der allgemeinen Proteste, den Schandfleck zu entfernen?«
»Natürlich. Wie käme ich dazu, bloß weil einige …?«
»Na schön, wenn Sie es nicht anders wollen. Aber ich warne Sie! Das kann für Sie sehr böse enden. Ich werde mich mit den beiden Pfarrern beraten und dann die notwendigen Schritte einleiten. Sie haben mich zutiefst enttäuscht, Bodenschatz. Wir waren stolz auf Sie als einen Sohn unserer Stadt, aber wenn Sie keine Vernunft annehmen und einlenken, zeigen Sie Ihre wahrhafte Gesinnung, und das lässt tief blicken, sehr tief! Mehr hab ich dazu im Moment nicht zu sagen.«
Damit hatte Bürgermeister Döderlein das Gespräch beendet, grußlos und abrupt. Eberhard Bodenschatz starrte einige Minuten fassungslos vor sich hin, hörte sein Herz rasen und das Echo der polternden Worte im Ohr. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Seine Händen fuhren unruhig hin und her und er spürte ein flaues Gefühl im Magen. Dann wählte er die Nummer des Schwesternzimmers der Intensivstation, um mit seiner Frau zu reden. Sie war jedoch im Operationssaal und unabkömmlich. Schlagartig kam er sich verloren und vollkommen unverstanden vor.
Kaum hatte Bodenschatz die Kaffeetasse weggeräumt und abgespült, klingelte erneut das Telefon. Es war Herr Reitenspieß von der Lokalredaktion der Zeitung, der am Abend vorher die Eröffnung des Adventsfensters mit dokumentiert hatte. Er berichtete Bodenschatz lang und breit von verschiedenen Anrufen und Nachrichten, von Gesprächen mit dem Bürgermeister und dem Pfarrer, von eingegangenen E-Mails und heftigen Reaktionen. Dann kündigte er für die Ausgabe am folgenden Tag »eine umfassende, ausgewogene Darstellung an, auch gleich mit Leserbriefen, soviel der Platz eben hergibt«.
»Was wir aber auf jeden Fall wollen, das ist eine Stellungnahme von Ihnen als Auslöser sozusagen, was Sie zu der Kritik zu sagen haben und wie Sie die ganzen Anschuldigungen von allen Seiten so sehen.«
»Was heißt denn das: von allen Seiten? Ich kenne bisher nur die Meinung von Bürgermeister Döderlein.«
»Na ja, also wir haben hier schon haufenweise E-Mails reingekriegt. Mit dem Pfarrer hab ich geredet, dem Vorsitzenden des Heimatvereins, einigen Stadträten. Da kommt schon eine ganze Menge zusammen.«
»Und was sind das für Anschuldigungen, wenn ich fragen darf?«
»Na ja, im Grunde ist es dreierlei. Also erstens, dass Ihr Kunstwerk geschmacklos sei, schamlos, unmoralisch. Das sind so die Ausdrücke. Einige benutzen auch schärfere Munition: lasziv, exhibitionistisch, pervers. In der einen Zuschrift sind Sie mit Ihrem Sex-Fenster gleich zu einem Sittenstrolch geworden.«
Der Redakteur Reitenspieß ließ einen trockenen Lacher los nach diesem Satz.
»Das ist alles?«, wollte Bodenschatz wissen.
»Na ja, nein. Das geht schon noch weiter. Das ganze Arsenal schießen die hier ab: blasphemisch, pornografisch, sexistisch. Und dann natürlich noch antisemitisch. Dass Sie hier das unfassbare Leid in den Lagern verharmlosen zu Kindergeburt und Mutterschaft. Noch dazu, wo Sie der Jüdin Maria lange Haare dranlassen, wo sie in Wirklichkeit ja einen geschorenen Schädel haben müsste. Was sagen Sie dazu?«
»Oh mein Gott, was soll man denn da noch sagen?«
»Und wie sehen Sie die Sache?«
»Das Werk soll doch nicht provozieren und verletzen, sondern zum Mitfühlen und Nachdenken anregen!«
»Und wenn Leute sagen, das sei anstößig und beleidigend?«
»Etwas so Grundmenschliches wie eine Geburt kann gar nicht moralisch schlecht oder verwerflich sein. Die Kunstgeschichte ist voll von Werken, die zu ihrer Zeit als anstößig und schmutzig galten. Es ist höchste Zeit für eine ehrliche, realistische Darstellung der gebärenden Maria.«
»Na ja, und das mit dem gelben Stern auf dem Kittel?«
»Maria war Jüdin, Jesus war Jude, aus dem Stamme Davids. Sie wurden ausgegrenzt, angefeindet und verfolgt. Wir kennen doch die ganze verdammte Geschichte. Was liegt da näher, als das auch mit dem Stern Davids zu zeigen?«
»Alles klar, kein Thema.«
»Sie waren doch gestern Abend auch dabei und haben die Skulptur gesehen. Haben Sie das Werk als anstößig und beleidigend empfunden?«
»Nein, ganz und gar nicht. Ich find’s geil, total spannend.«
»Wenn es Anstoß erregen und Gefühle verletzen sollte, was mir leid täte, dann sollte es eine öffentliche Diskussion darüber geben. Am besten mit Kunstsachverständigen und Vertretern der Stadt und der Kirchen. Das ist doch die Aufgabe von Kunst, dass sie die geistige Auseinandersetzung fördert, Gespräche und Meinungsaustausch ermöglicht, um neue Sichtweisen zu gewinnen.«
»Alles klar. Super, perfekt. Das bringen wir so. Vielen Dank, Herr Bodenschatz.«
Er fühlte sich aufgewühlt und gleichzeitig niedergeschlagen. Die heftigen Reaktionen auf seine mit besten Absichten gefertigte Skulptur hatten Eberhard Bodenschatz vollkommen überrascht. Manche Zeitgenossen hätten ihn vielleicht einen kritischen, zuweilen auch unbequemen und widerspenstigen Menschen genannt, sogar seine Frau kannte ihn als durchaus schwierigen Partner, der lieber seinen eigenen Weg geht als auf den ausgetretenen Pfaden der breiten Masse nachzutrotten. Für ihn als freischaffenden Künstler, der von Anfang an das volle Risiko einer unsicheren Existenz eingegangen war, auch auf die Gefahr hin damit zu scheitern, gehörte eben dies zu echter, zeitgemäßer Kunst dazu: nicht den Publikumsgeschmack zu bedienen, nicht den Erwartungen zu entsprechen, nicht auf unterhaltsame Weise um gefälliges Lob zu buhlen. Nein, Kunst musste vor den Kopf stoßen, das Unerhörte und Neuartige wagen, das Ungeheuerliche zum Thema machen. Fragen aufwerfen, Anstoß erregen, ein Ärgernis sein. Darauf beruhte doch der Fortschritt der Kunst zu allen Zeiten. Gerade in einer Gegenwart, wo man ständig nur noch auf die Popularität und Vermarktung schielte, war es notwendig, dass die Kunst Widerstand bot, dass sie den Leuten unangenehme Sichtweisen vorzusetzen wagte.
Mitten hinein in Bodenschatz’ Überlegungen klingelte das Telefon. Am Apparat war Heinz Helmreich, der Vorsitzende des Heimatvereins.
»Menschenskind, Eberhard, da hast du ja eine schöne Bescherung angerichtet!«
»Wieso ich? Ich hab nur ein Kunstwerk geschaffen, wie von euch gewünscht.«
»Schon klar, kein Vorwurf, um Himmels willen! Ich steh voll und ganz zu deiner Maria. Ich hab’s ja gestern Abend auch klipp und klar gesagt: Kunst ist wichtig, aber schwierig – wie die Menschen. Da muss nicht jedem immer alles gleich gefallen. Umso wichtiger ist es. Deshalb auch die Freiheit der Kunst. Wird voll und ganz respektiert, was denn sonst? Genauso hab ich es auch dem Reitenspieß von der Zeitung vorhin gesagt.«
»Hat der dich auch angerufen?«
»Was glaubst denn du, was da jetzt los ist! Wenn das so weitergeht, haben wir bald das Fernsehen und die Bild-Zeitung hier im Städtchen. Das Käsblatt wird morgen eine ganze Seite bringen, mit Stellungnahmen vom Bürgermeister, Pfarrer, dazu Leserbriefe, Umfrage, Heimatverein, das volle Programm!«
»Mein Gott! Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich niemals mitgemacht.«
»Sag so was nicht, Eberhard! Wenn man alles im Voraus wüsste, käm gar nix Wichtiges zustande. Das kriegen wir schon. Ist doch eine super Werbung für unsere Kunstaktion! Und für unsere Stadt erst recht! Kunstsinnig, tolerant, offen für Neues, für Fremdes und Unbequemes. So muss man das verkaufen.«
»Was meinst du ganz persönlich denn zu meinem Stern von Bethlehem?«
»Das hab ich dir doch gestern schon gesagt. Ich find die Skulptur stark, aussagekräftig, zutiefst berührend. Vielleicht verstört sie einige Leute, aber mein Gott: Für die ist das Internet oder ein Psychothriller auch verstörend. Wenn man nach denen geht, kann man eh einpacken. Ich bin mir bloß nicht ganz sicher, ob es tatsächlich der richtige Ort für so was ist.«
»Wie meinst du das?«
»Na ja, ich weiß nicht so recht, ob diese gebärende KZ-Jüdin mit dem offen zur Schau gestellten Geschlecht die richtige Wahl ist für so ein Adventsfenster.«
»Kunst braucht aber den öffentlichen Raum, die Spannung, den Gegensatz, sonst wird sie zur Privatsache, zum Randphänomen, zur bloßen Dekoration.«
»Schon klar. Aber manche Leute sind halt schockiert, wenn sie so was aus heiterem Himmel sehn. Dein Kunstwerk ist so verdammt plastisch und direkt offensiv, das haut voll rein!«
»Bist du der Meinung, ich soll die Skulptur wieder rausnehmen?«
»Auf gar keinen Fall! Damit würden wir uns bloß lächerlich machen. Das ziehn wir jetzt knallhart durch. Der Heimatverein steht voll hinter dir, dafür leg ich meine Hand ins Feuer.«
»Hat dich der Döderlein angerufen?«
»Ja freilich, und wie! Der hat getobt und gedroht, kann ich dir sagen. Wie so ein Holzkopf bloß Bürgermeister werden kann! Unglaublich. Der will persönlich einschreiten, wenn wir nicht nachgeben, hat er gesagt.«
»Was will er denn machen?«
»Das Fenster anstreichen lassen, einen Lastwagen davor stellen, Mahnwachen, Streikposten, was weiß ich.«
»Schaufenster einschmeißen und alles zertrümmern? Hatten wir das nicht schon einmal hier?«
»Hör bloß auf und verschrei’s nicht! Der ist zu allem fähig in seiner Wut. Den katholischen und evangelischen Pfarrer hat er schon auf seine Seite gezogen. Bloß bei den Hausbesitzern und bei uns vom Heimatverein beißt er sich die Zähne aus.«
»Und bei mir.«
»Na ja, du spielst jetzt eigentlich gar nicht mehr die große Rolle. Jetzt geht’s ums Höhere und ums große Ganze. Sittenverfall, Verletzung der Würde der Frau, Beleidigung der Muttergottes, Verunglimpfung der Opfer des Holocaust.«
»Hast du Angst?«
»Ach wo! Höchstens dass das Ansehen des Heimatvereins Schaden nimmt. Das würde mich wirklich belasten.«
Eberhard Bodenschatz saß in der Küche und trank Rotwein, als seine Frau vom Krankenhaus nach Hause kam. Sie sah ziemlich mitgenommen aus. Nicht der Dienst hatte sie so strapaziert, sondern die Fragen und Bemerkungen ihrer Kollegen und Patienten hatten sie ermüdet und entnervt. Zwar hatte sie die Idee ihres Mannes von Anfang an gut gefunden, mutig und wichtig. Nach diesem langen Arbeitstag aber wollte sie von dem ganzen Thema nichts mehr hören und sehen. Kaum hatte sie die Haustür zugemacht, überhäufte sie ihr Mann mit Worten, Berichten und Fragen. All das, was sich über Stunden in ihm aufgestaut hatte. Veronika suchte Erholung und Entspannung nach einem kraftraubenden Tag, und er kam ihr mit der Aufregung über sein Werk und den Ansichten von irgendwelchen Leuten daher. Er wollte unbedingt ihre Meinung dazu hören, sich ihrer Unterstützung versichern, ihren Ratschlag einholen und beherzigen. Und gerade in diesem für ihn so wichtigen Moment zog sie sich erschöpft und geschafft zurück und wollte von ihm und seinen Problemen nichts mehr hören. Dafür hatte er kein Verständnis. Veronika musste doch spüren, wie ihm das alles unter die Haut ging, wie sehr er ihrer Zuwendung bedurfte. Sie wiederum konnte nicht begreifen, wie er so egozentrisch sein konnte, nur sich und seine Kunst zu sehen, ohne Rücksicht auf sie, die hart arbeitete, um das nötige Geld zu verdienen, ohne zu merken, wie sehr sie der ganze Rummel nervte und anödete. Jeden Tag sah sie in der Klinik Menschen leiden und sterben – ohne dass die Öffentlichkeit daran groß Anteil nehmen würde. Da konnte sie sich über fragwürdige Auffassungen über Kunst und Geschmack wahrlich nicht mehr aufregen. Es gibt schließlich Wichtigeres auf dieser Welt als die Empfindlichkeiten von Bürgern oder Künstlern. Wie sehr sie ihren Mann damit enttäuschte und kränkte, konnte sie nicht ahnen. Ihn erwartete eine schlaflose Nacht voller Misstrauen und Verzagtheit, Zweifel und Zorn.
Die Lokalzeitung brachte am nächsten Morgen eine ganze Seite über den »Kunst-Skandal«, mit allem Für und Wider. Was der Bürgermeister dazu meinte, wusste Bodenschatz. Beim katholischen Pfarrer reichte schon das bloße Überfliegen der Stellungnahme. »Sündig, frevelhaft, anrüchig, Verstoß gegen die guten Sitten« – all diese donnernden Vokabeln starrten ihm aus der Zeitung entgegen. Erwartungsvoll wendete er sich den Leserbriefen zu.
»Den künstlerischen Wert der Plastik streite ich ab, die religiöse Aussage ist reine Blasphemie«, hieß es gleich im ersten. »Dieses Pseudo-Meisterwerk ohne Scham und Geschmack ist eine Zumutung, eine Anmaßung, eine Unverschämtheit. Sollen Adventsfenster erfreuen oder schockieren? Dieses jedenfalls missachtet die christlichen Werte und verletzt die Empfindungen der Frau. So ein perverser Voyeurismus ist völlig deplaziert, zumal in der Advents- und Weihnachtszeit.«
Bodenschatz fing an zu schwitzen. Er spürte wieder das innere Zittern und Glühen in seinem Körper. Dennoch kam er nicht los davon, er musste einfach weiterlesen.
»Wie heißt es bei Schiller so treffend? Nichts Heiliges ist mehr, es lösen sich alle Bande frommer Scheu. Der Gute räumt den Platz dem Bösen und alle Laster walten frei. So ist es auch hier. Nicht ein Mindestmaß an Mutterwürde, Anstand und Takt ist in diesem Adventsfenster zu sehen. Ein Ärgernis!«
Bodenschatz traten Tränen in die Augen. Wut stieg in ihm auf, Trotz und Angst. Er sah nur noch Bruchstücke und Satzfetzen: »Schutz der Intimsphäre«, »schmutzige Zurschaustellung in der Öffentlichkeit«, »Entblößung«, »Niedrigkeit«. Er drückte seine Augen fest zusammen, und ein paar Tränen liefen über seine Wange. Fassungslos starrte er auf die Zeitungsseite. Dann fiel sein Blick auf einen Leserbrief, der ihn direkt anredete.