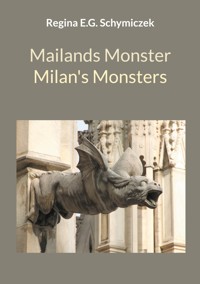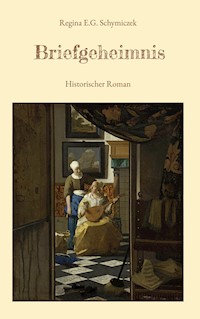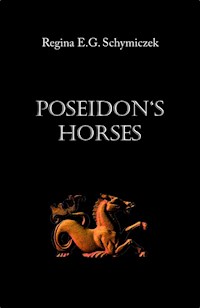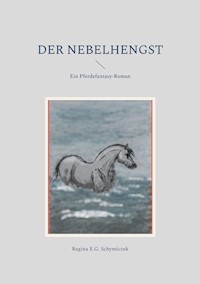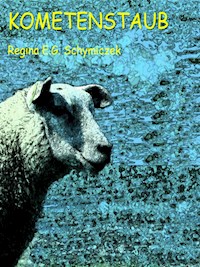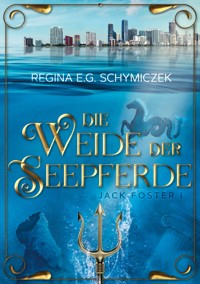
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Jack Foster
- Sprache: Deutsch
Jack Foster weiß, was die Katastrophe von Fukushima und die weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst hat. Er weiß auch, was antike Magie, Wassermänner und Meerjungfrauen damit zu tun haben. Doch dieses Wissen ist nicht ungefährlich... Als der Meeresarchäologe Dr. Jack Foster bei einer Schatzsuche vor der Golfküste Floridas auf eine unbekannte Stadt nach antikem Vorbild stößt, ist seine Freude zunächst groß, da er glaubt, das sagenhafte Atlantis gefunden zu haben. Tatsächlich ist er jedoch auf eine Ansiedlung von Verschwörern gestoßen, die das Ziel haben, die Weltherrschaft durch einen neuen Super-GAU zu erlangen. Schneller als ihm lieb ist, ist Jack in die Sache verwickelt und muss versuchen, den Kopf der Verschwörer auszuschalten. Das führt ihn nach Berlin, zum Mont-St-Michel, nach New York, Phoenix und Las Vegas. Begleitet wird er dabei von seinem besten Freund Tony, seiner Ex-Freundin Cat, der geheimnisvollen Amphitrite, dem deutschen Professor Otto von Greifentann und - was ihm nicht immer gefällt - von seiner Mutter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ingrid
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
FAKTEN UND FIKTION
ÜBER DIE AUTORIN
1
Rebecca biss sich auf die Unterlippe und war von ihrem Vorhaben auf einmal gar nicht mehr so überzeugt. Machte sie auch keinen Fehler? Reiß dich jetzt zusammen, dachte sie dann. Zögernd hob sie die Hand, holte noch einmal Luft und klopfte. Sie hörte, dass auf der anderen Seite der Tür gesprochen wurde. Als niemand antwortete, drehte sie den Türknauf und lugte in den Raum. Ein Mann stand mit dem Rücken zur Tür an seinem Schreibtisch, und telefonierte lautstark. Rebecca verstand nur, dass es um Zahlen und Fristen ging. Er gestikulierte wild mit seiner freien Hand und blickte dabei aus dem Fenster.
Er war ziemlich groß, hatte kurze braune Haare, trug Khaki-Shorts und ein dunkelblaues T-Shirt, auf dem in weißer Schrift Lazy Lobster stand. Wahrscheinlich war er so Anfang 30, gehörte aber zu den Leuten, die immer jünger aussahen, als es ihrem wahren Alter entsprach.
Offensichtlich hatte er weder ihr Klopfen gehört noch bemerkt, dass sie eingetreten war. Rebecca blieb in der Nähe der Tür stehen und ließ ihren Blick in dem kleinen Büro herumwandern. Es hingen einige ausgestopfte Fische an der Wand, dazwischen etliche gerahmte Fotos, die einen Mann – wahrscheinlich war es der, der am Schreibtisch stand – in Tauchausrüstung zeigte. Auf jedem Bild hielt er einen anderen Gegenstand in die Kamera, mal ein goldenes Kreuz, mal eine große Goldmünze.
Jack beendete das Telefonat, drehte sich um und knallte den Telefonhörer auf die Gabel des altmodischen Tischtelefons. Den ganzen Tag hatte er schon unschöne Gespräche mit Banken, Versicherungen und Reiseagenturen geführt, und jetzt machte auch noch der Vermieter Druck! Das kleine Büro in der ersten Etage über dem Restaurant Lazy Lobster, direkt am Ocean Drive, war ein Glücksfall gewesen. Die Miete war zwar ziemlich hoch, doch die Werbung, die das Restaurant für ihn machte, wog das in der Regel mehr als auf. Die letzten beiden Winter waren in Florida jedoch ungewöhnlich kalt gewesen. Das hatte sich stark auf den Tourismus und besonders auf die Buchungslage bei Tauchausflügen ausgewirkt. Außerdem war Jack nicht der Einzige, der sich die gescheiterten Versuche der spanischen Eroberer, Gold aus der Neuen Welt nach Europa zu schaffen, als Einnahmequelle zunutze machte. Angebote, zu den Wracks der Schiffe zu tauchen, gab es an der Küste Floridas so viele wie gesunkene Galeonen. Zu diesem Konkurrenzdruck war noch ein Motorschaden am Boot gekommen, der ein gewaltiges Loch in Jacks Firmenkasse gerissen hatte. Ärgerlich fuhr er sich mit den Händen durch die Haare und überlegte, wie er aus dieser Klemme kommen konnte.
Da fiel sein Blick auf das Mädchen, das gerade sein kleines Büro betreten hatte und nun vor seinem Schreibtisch stand. Sie starrte ihn mit ihren großen, wasserblauen Augen unverwandt an. Für Kinderkram hatte er jetzt wirklich keinen Nerv. Wahrscheinlich sammelte sie für irgendein Wohltätigkeitsprojekt ihrer Schule. Einer exklusiven Privatschule, der Kleidung nach. Sogar die blaue Schleife, die ihre langen dunkelblonden Haare zu einem ordentlichen Pferdeschwanz gebändigt hatte, sah teuer aus.
„Was willst du, Kleine? Hast du dich verlaufen?“
„Ich habe mich nicht verlaufen!“, antwortete das Mädchen mit großem Ernst. „Auf Ihrem Türschild steht: Foster & Campillo. Organisation von Tauchausflügen mit Wrackbesichtigungen, Bergungen, Schätzungen von Kunstwerken. Sie sind doch Dr. Jack R. Foster, oder? Das steht zumindest auf dem Schild auf Ihrem Schreibtisch. Dann will ich Sie genau dafür anheuern: Tauchen, Bergen, Schätzen!“
Jack warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Eigentlich wollte er gleich Feierabend machen. Er seufzte und ließ sich in den alten Ledersessel hinter seinem Schreibtisch fallen.
„Hör mal, Kleine –“
„Mein Name ist Rebecca Whithall-Meyers und nicht Kleine!“, unterbrach ihn das Mädchen mit einem leicht gereizten Unterton.
„Also schön, Rebecca, du hast also eine Schatzkarte gefunden und willst mich engagieren, um diesen Schatz zu finden, richtig? Weißt du, wie teuer das wird?“
„Ich sagte gerade, dass mein Name Whithall-Meyers ist!“, antwortete das Mädchen leicht ungeduldig.
Jack hatte schon den Mund geöffnet, um das Kind nun endgültig nach Hause zu schicken, als ihm plötzlich einfiel, was dieser Name bedeutete. Die Whithall-Meyers waren eine Dynastie von Schiffsbauern, die ihren Stammsitz in Florida hatten, deren Yachten aber weltweit vertrieben wurden. Wenn das Mädchen zu dieser Familie gehörte, konnte sie sich seine Dienste spielend leisten. Sein Gesicht hellte sich auf.
„Soso, Whithall-Meyers also… was sagen denn deine Eltern zu deiner Schatzsuche?“
„Meine Eltern sind schon lange tot. Ich kann mich gar nicht an sie erinnern. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. Sie ist vor vier Wochen auch gestorben. Mein Onkel ist jetzt mein Vormund, aber ich wohne nicht bei ihm. Ich habe eine Hauslehrerin, mit der ich in Großmutters Anwesen in St. Augustine lebe. Nach Grannys Tod habe ich tatsächlich eine Schatzkarte gefunden, nämlich diese hier.“ Rebecca öffnete ihre teure Designer-Tasche und holte ein vergilbtes Blatt hervor.
Jack war nun doch neugierig geworden und streckte die Hand aus. Rebecca gab ihm die Karte. Jack befühlte fachmännisch das Papier und hielt das Blatt gegen das Licht. Er runzelte die Stirn.
„Scheint tatsächlich alt zu sein“, murmelte er, mehr zu sich selbst. „Auf den ersten Blick zumindest.“
Dann sah er sich die gezeichnete Karte genauer an, auf der der südliche Teil Floridas dargestellt war. An der Nordspitze einer kleinen Inselgruppe, die sich oberhalb des Big Pine Keys befand, war ein kleines Kreuz mit einer seltsamen Zeichnung aufgemalt. Es sah ein bisschen aus wie ein Seepferdchen. Jack verzog den Mund. Die gesamte Inselgruppe stand unter Naturschutz und war nicht zugänglich. Er gab Rebecca, die es sich inzwischen in dem ebenfalls ziemlich abgewetzten Besuchersessel vor seinem Schreibtisch gemütlich gemacht hatte, die Karte zurück.
„Und was macht dich so sicher, dass das eine Schatzkarte ist? Nicht jedes Kreuz auf einer Landkarte bedeutet automatisch, dass dort eine Kiste mit Golddublonen versteckt ist, weißt du.“ War doch klar, dass dieser Kinderkram nichts bringt, dachte er dabei enttäuscht.
„Meine Großmutter hat mir gesagt, dass unsere Familie das Wissen um einen großen Schatz hütet, und dass sie mir zu gegebener Zeit davon erzählen würde“, sagte Rebecca, wobei sie ein Gesicht machte, als ob die Schatzkiste nur von der Post abgeholt werden müsste.
Jack stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch und vergrub sein Gesicht in den Händen. Dann sah er Rebecca an.
„Großmütter erzählen ihren Enkeln gern Geschichten. Dafür sind sie da. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte, Rebecca, aber eben nur eine Geschichte. Wahrscheinlich hat einer deiner Vorfahren dort mal ein Wrack gesichtet und sich die Stelle notiert, weil er vermutete, dass dort eine spanische Galeone untergegangen ist. Und da diese Schiffe meist wertvolle Fracht an Bord hatten, wollte er später danach tauchen. Die Karte ist dann aufgehoben worden und jede Generation hat etwas anderes dazu gedichtet – aber anscheinend hat niemand wirklich nachgesehen. Wenn du willst, kann ich die Karte für dich verkaufen, sie bringt wahrscheinlich ein paar hundert Dollar. An deiner Stelle würde ich sie aber aufheben – dann kannst du später deinen Kindern und Enkeln eine spannende Schatzgeschichte erzählen.“
Jack stand auf. Er war der Meinung, dass er sich jetzt lang genug mit dem Mädchen beschäftigt hatte. Rebecca blieb sitzen. Sie sah Jack schweigend an, dann griff sie wieder in ihre Tasche. Sie holte ein kleines Paket heraus und gab es ihm.
„Das war bei der Karte“, sagte sie. Jack nahm das Päckchen und setzte sich wieder hin.
Er entfernte das Papier und war erstaunt, als er ein goldenes Schmuckstück auswickelte. Es handelte sich um einen Anhänger, der ein Seepferdchen darstellte. Auf dem Kopf trug es eine Krone. Der Schwanz des Seepferdchens bog sich so weit über seinen Rücken nach oben, dass er an den anmutig geneigten Hals stieß. Dadurch entstand ein Ring, durch den ein Lederband gezogen war. Auf dem Körper des Tieres waren einige Zeichen eingraviert. Aufmerksam betrachtete Jack den goldenen Anhänger. Die starken Abriebspuren und stellenweise noch vorhandene Patina deuteten darauf hin, dass das Schmuckstück lange im Wasser gelegen hatte. Eine Datierung war aber schwierig, er hatte noch nichts gesehen, was dem Stil dieses Schmuckstückes gleichkam.
„Das war also bei der Karte? Kann ich die noch mal sehen?“
Rebecca schob ihm wortlos die Karte über den Tisch. Jack starrte darauf, seufzte und schüttelte dann den Kopf.
„Selbst wenn dort ein Schatz liegt – wir kommen nicht hin. Das gehört alles zum Naturschutzgebiet. Da ist jede Schatzsuche verboten. Sogar beim bloßen Betreten des Gebietes macht man sich schon strafbar.“
Dass er sich an diesem Ort schon mal großen Ärger mit den Behörden eingehandelt hatte, erwähnte Jack lieber nicht.
„Ich würde aber gut dafür bezahlen“, meinte Rebecca.
„Du guckst zu viele Krimis im Fernsehen. So einfach geht das nicht. Es gibt schließlich Gesetze und …“
„$5.000 als Vorschuss und 25 % von allem, was Sie finden.“
Jack lachte. „$5.000, ja? Und wo willst du die hernehmen? Du stammst vielleicht aus einer reichen Familie, aber so viel Taschengeld wirst du wohl auch nicht bekommen, oder? Wie alt bist du? 12 oder 13? Du bist ja noch nicht einmal geschäftsfähig! Wenn Onkel Bill dahinterkommt, schickt er dich ins Internat und mich ins Gefängnis, weil ich da mitgemacht habe!“
Wütend sah Rebecca ihn an, griff wieder in die Tasche und zog ein dickes Geldbündel heraus, das sie vor Jack auf den Tisch warf.
„Es lag Geld bei der Karte, zusammen mit einem Brief von meiner Großmutter. Darin schreibt sie, dass dieses Geld dafür bestimmt ist, den Schatz zu suchen. Außerdem bin ich schon 13 und mein Onkel heißt Cedric, nicht Bill!“
Jack ließ seinen Schreibtischstuhl nach hinten kippen und verschränkte die Arme im Nacken. Die ganze Sache war ja unglaublich! Cedric Whithall-Meyers … ging da nicht vor kurzem eine Geschichte durch die Medien?
„Und weiß Onkel Cedric von der Sache?“
Rebecca senkte den Blick und schüttelte den Kopf. „Wir verstehen uns nicht besonders gut. Er hat Granny einige Male nach der Schatzkarte gefragt, aber sie hat jedes Mal so getan, als wüsste sie nicht, wovon er redet. Dann hat sie mir gesagt, das wäre ein Geheimnis zwischen uns beiden. Darum habe ich ihm auch nicht erzählt, dass ich sie inzwischen gefunden habe.“
Jack brachte den Schreibtischstuhl wieder in eine aufrechte Position und rieb sich die Stirn. „Hör mal, Rebecca. Mir tut das alles sehr leid. Mit deinen Eltern, deiner Großmutter und auch, dass du dich mit deinem Onkel nicht verstehst. Aber ich kann dir nicht helfen. Das Gebiet, das auf der Karte markiert ist, ist gesperrt. Punkt.“
Rebecca sah ihn enttäuscht an.
„Und jetzt“, sagte Jack und stand wieder auf, „machst du, dass du auf dem schnellsten Weg nach Hause kommst. Wie bist du überhaupt hierhergekommen, das ist doch ein ganz schöner Weg von St. Augustine nach Miami Beach?“
„Bodenstein, Grannys Fahrer, hat mich hergebracht. Er wartet unten.“
Jack nickte. Warum hatte er nicht gleich daran gedacht? War ja klar, dass man in diesen Kreisen nur mit Fahrer unterwegs war. Er schob Rebecca das Geld hin.
„Pack’ das ein und geh’ nicht gleich zum nächsten Tauchlehrer damit. Es sind nicht alle so nett wie ich.“
Während Rebecca das Geld und die Karte einpackte, betrachtete Jack noch einmal das goldene Seepferdchen.
„Ein wirklich schönes Stück. Wenn du erwachsen bist, kannst du es als Schmuck tragen“, meinte er und gab es ihr dann. Rebecca blickte ihn noch einmal bittend an. Doch Jack schüttelte den Kopf und reichte ihr die Hand.
„Ich wünsche dir alles Gute, Rebecca.“
„Auf Wiedersehen, Dr. Foster“, sagte sie leise und ging zur Tür.
Als sie gegangen war, trat Jack ans Fenster und blickte auf die Straße. Es war noch zu früh für die Touristenströme, die sich auf dem Ocean Drive ein Restaurant für den Abend suchten. Auch der Autoverkehr war noch übersichtlich. Jack entdeckte eine wartende schwarze Limousine. Als das Mädchen aus dem Haus kam, stieg der Fahrer aus und öffnete den hinteren Schlag. Rebecca stieg ein und kurz darauf fädelte sich der Wagen in den abendlichen Verkehr ein. Jack blickte ihm noch nachdenklich nach, als es an der Tür klopfte.
„Komm rein, Rosalia“, rief Jack, ohne sich umzudrehen. Es war Feierabend und das konnte jetzt nur noch die Reinigungskraft sein.
Die Tür wurde geöffnet.
„Dr. Foster?“, fragte eine männliche Stimme.
Erstaunt drehte Jack sich um. Zwei Männer in teuren dunklen Anzügen mit Designer-Sonnenbrillen standen in seinem Büro. Einer von ihnen trug einen eleganten Aktenkoffer. Nicht die Sorte Leute, die gewöhnlich bei ihm eine Tauchexkursion zu einem Wrack buchten.
„Ja, das bin ich. Kann ich Ihnen helfen?“
Der eine Mann setzte sich in den Sessel, während der andere, der den Aktenkoffer trug, an der Tür stehend blieb. Jack beschlich das Gefühl, dass dieser Mann ihn am Verlassen des Büros hindern würde, falls er es versuchte. Waren das etwa die neuen Inkasso-Agenten seines Vermieters? Das Gespräch am Telefon eben hatte zwar nicht gerade freundlich geendet, bot aber seiner Meinung nach auch keinen Grund für eine solch drastische Maßnahme. Der Mann im Sessel sah Jack lächelnd an. Die entblößten Zähne erinnerten Jack aber eher an einen Hai.
„Bitte nehmen Sie Platz, Dr. Foster. Wir möchten Ihnen ein Geschäft vorschlagen.“
Verblüfft ließ Jack sich in seinen Schreibtischstuhl fallen. Was kam denn noch alles an diesem verdrehten Tag?
„Dr. Foster“, begann der Mann wieder, und Jacks Antipathie ihm gegenüber wuchs, „wir kommen im Auftrag von Mr. Cedric Whithall-Meyers.“
Jacks Augenbrauen schnellten in die Höhe.
Der Mann fuhr fort: „Wir wissen, dass Miss Whithall-Meyers soeben in Ihrem Büro war, um Sie für ein Unternehmen zu engagieren.“
Ach was, dachte Jack, da hat Onkel Cedric ja schnell reagiert! Laut sagte er: „Hören Sie, ich gehöre nicht zu den Leuten, die kleinen Mädchen Geld aus der Tasche ziehen. Ich habe natürlich abgelehnt, Miss Whithall-Meyers wieder nach Hause geschickt und …“
Der Mann im Sessel hob die Hand und unterbrach Jack. „Dr. Foster, Mr. Whithall-Meyers möchte, dass Sie diesen Auftrag annehmen.“
Verblüfft starrte Jack den Mann an. „Wie bitte?! Das kann ich gar nicht! Das Gebiet ist gesperrt! Da bekomme ich überhaupt keine Genehmigung für eine Schatzsuche!“
Der Mann im Sessel gab dem anderen an der Tür einen Wink. Dieser kam zum Schreibtisch, legte den Aktenkoffer darauf und öffnete ihn. Ungläubig starrte Jack auf viele ordentlich gebündelte 100-Dollar-Noten.
„Um das gesperrte Gebiet machen Sie sich keine Sorgen. Mr. Whithall-Meyers hat Freunde in den höchsten Kreisen, eine Genehmigung wird kein Problem sein. Hier sind $50.000 für Ihre Mühe. Mr. Whithall-Meyers bittet Sie allerdings, seine Nichte nicht wissen zu lassen, dass er eingeweiht ist. Sie soll davon ausgehen, dass sie dieses Unternehmen allein durchführt. Mr. Whithall-Meyers denkt, dass das sehr wichtig für das seelische Wohlbefinden seiner Nichte ist. Sie ist nach dem Tod ihrer Großmutter traumatisiert. Wir alle hoffen, dass ihr ein solches Abenteuer wieder neuen Lebensmut gibt. Für Sie hat das den Vorteil, dass Sie zweimal Geld kassieren – und das dürfte Ihnen bei Ihrer finanziellen Lage ja sehr entgegenkommen.“
Jack runzelte die Stirn. „Was meinen Sie damit?“
Der Mann im Sessel lächelte dünn. „Dr. Foster, wir haben natürlich recherchiert. Dieses Gebäude hier gehört der Miami Loft Inc., einem Unternehmen der Familie Whithall-Meyers. Sie sind schon zwei Monatsmieten im Rückstand.“
Jack starrte vor sich hin, dann sah er dem Mann in die Augen. „Es ist vermutlich auch kein Zufall, dass Rebecca zuerst zu mir gekommen ist, oder?“
„Langsam fangen Sie an zu begreifen, Dr. Foster. Es ist arrangiert worden, dass Miss Whithall-Meyers zur richtigen Zeit einen Werbeflyer von Ihnen vorfand.“
Der Mann stützte die Ellbogen auf die Sessellehnen und tippte die Fingerspitzen aneinander. „Nun, Dr. Foster, sind wir im Geschäft?“
Jack holte tief Luft. Er fand den Mann widerlich und seinen Boss ebenfalls. Ein hilfloses Waisenkind so zu hintergehen, widerstrebte ihm zutiefst. Andererseits – $55.000 waren eine Summe, die ihm nicht nur die Sorge abnehmen würde, wie er die nächsten Monate überleben würde, sondern sogar noch Investitionen in das Boot und eine bessere Tauchausrüstung möglich machen könnten. Das würde ihn wettbewerbsfähiger machen und –
Der Mann im Sessel riss ihn aus seinen Gedanken. „Dr. Foster?“
Jack rieb sich das Kinn. „Ich muss erst noch mit meinem Partner, Mr. Campillo, darüber sprechen.“
„Es tut mir leid, Dr. Foster. Mr. Whithall-Meyers erwartet sofort eine Antwort. Wir wissen außerdem, dass ausschließlich Sie für die Absprachen der Exkursionen verantwortlich sind.“
Mist! Da hat Onkel Cedric wirklich gut recherchiert, dachte Jack, räusperte sich und sagte: „Also, ich bekomme jetzt $50.000 von Ihnen, dann $5.000 von Rebecca und 25 % von allem, was wir finden?“
Der Mann im Sessel lachte herzlich. „Dr. Foster, ich dachte wirklich, Sie wären jemand, der hier die Touristen mit Wracktauchen abzockt. Dass Sie so naiv sind und tatsächlich an einen versunkenen Schatz glauben, hätte ich nicht erwartet!“
Jack starrte ihn ärgerlich an. „Ist das nun so oder nicht? Bekomme ich das schriftlich?“
Der Mann wurde wieder ernst. „Sie bekommen dieses Geld und das Geld, das Miss Whithall-Meyers Ihnen versprochen hat. Meinetwegen dürfen Sie auch gern eine Dublone behalten, wenn Sie eine finden sollten. Sie sehen also, niemand kommt zu Schaden, es geht nur darum, einem kleinen Mädchen ein Abenteuer zu ermöglichen, damit es wieder fröhlich wird. Dafür brauchen wir keine Verträge, dies ist ein Abkommen unter Ehrenmännern. Hier, über diese Telefonnummer können Sie Bodenstein, den Fahrer von Miss Whithall-Meyers, erreichen.“
*
Im Lazy Lobster war noch nicht viel los. Carl, der Barkeeper, plauderte mit der Kellnerin Suzie, die darauf wartete, dass endlich einer der Gäste sich als Mr. Right herausstellte und sie auf starken Armen auf eine millionenteure Yacht entführte. Zwei ältere Touristenpaare saßen an einem Tisch und lachten laut. Sie hatten Drinks mit Schirmchen vor sich stehen und gerade die Garnelen nach Art des Hauses bestellt, die es freitags für kleines Geld als All-You-Can-Eat-Angebot gab.
Als Tony das Restaurant betrat, steuerte er sofort auf seinen Freund und Partner Jack zu, der, wie immer, an ihrem Stammtisch in der Ecke saß. Als er näherkam, stutzte er.
„Wer bist du denn?“, fragte er verblüfft, ohne Jack zu begrüßen.
Bevor das Mädchen antworten konnte, sagte Jack: „Darf ich vorstellen – mein Partner, Mr. Antonio Campillo, Miss Rebecca Whithall-Meyers, unser Boss für den nächsten Auftrag!“
Während Rebecca artig „Sehr erfreut, Mr. Campillo“, sagte, stemmte Tony empört die Hände in die Hüften, zog die Augenbrauen hoch und wandte sich an Jack.
„Was soll das? Findest du das witzig?“
„Keineswegs. Beruhige dich und setz dich erst einmal hin. Suzie, bring doch mal eine Limonade und zwei Bier! Und dreimal Garnelen!“
Tony seufzte und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Er war im gleichen Alter wie Jack, legte im Gegensatz zu diesem aber viel Wert auf sein Äußeres und hatte sich für den Geschäftstermin extra umgezogen. Mit seinem blütenweißen Hemd, der beigefarbenen Leinenhose und den frisch gewaschenen schwarzen Haaren, die ihm immer wieder vorwitzig in die Stirn fielen, hatte er bereits die interessierten Blicke mehrerer Damen auf dem Ocean Drive auf sich gezogen.
Skeptisch wanderte sein Blick nun von Jack zu Rebecca und zurück. Alle schwiegen, bis Suzie die Getränke vor sie hingestellt hatte, was sie mit aufreizender Langsamkeit tat. Dabei ging ihr Blick ebenfalls fragend zwischen den beiden Männern und dem Mädchen hin und her. Jack und Tony hatten ja schon manchen seltsamen Auftraggeber mit in ihr Stammlokal geschleppt – aber was sie mit diesem Mädchen in den teuren Klamotten zu schaffen hatten...
Als sie endlich weg war, fasste Jack kurz zusammen, worum es bei dem Auftrag ging. Tony schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, sodass die Flaschen erzitterten.
„Madre de Dios, ich kann nicht glauben, was du mir da erzählst – wir sollen für ein kleines Mädchen arbeiten? Wegen einer angeblich alten Schatzkarte? In einem gesperrten Gebiet? Haben wir denn nicht gerade Probleme genug? Todos los Santos – bist du komplett übergeschnappt?!“
Rebecca straffte die Schultern und warf Tony einen vernichtenden Blick zu. Den hatte sie sich von ihrer Granny abgeschaut, die war mit dem Personal auch nicht zimperlich umgegangen. Dann wandte sie sich an Jack:
„Brauchen wir den überhaupt? Es reicht doch, wenn Sie tauchen!“
Tony schnaubte verächtlich und drehte die Augen zur Decke, während Jack sich verlegen räusperte und auf seine Hände starrte, die die Flasche mit mexikanischem Bier hin und herdrehten.
„Na ja, die Wahrheit ist – das Tauchen übernimmt Tony. Ich organisiere die Touren und schätze die Sachen hinterher. Aber – Tony ist der Taucher.“
„Aber auf den Fotos in Ihrem Büro – ich dachte … da sind Sie doch immer im Taucheranzug!“
„Das ist Marketing, das verstehst du noch nicht!“, meinte Tony und nahm einen langen Zug aus seiner Bierflasche.
Rebecca blitzte ihn wütend an. „Ich verstehe das sehr gut! Und ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Sie mich wie ein dummes kleines Mädchen behandeln!“
Als Tony den Mund aufmachte, um erneut seinen Protest zu äußern, hob Jack kurz die Hand und wandte sich an das Mädchen: „Rebecca, wenn du die Toilette suchst, die ist links hinter der Bar.“
„Aber…“, protestierte Rebecca, bis sie den eindringlichen Blick verstand, den Jack ihr zuwarf.
„Ja, danke, Dr. Foster“, sagte sie dann, stand auf und ging Richtung Bar.
Tony blickte ihr nach, bis sie hinter der Bar verschwunden war. Dann wandte er sich an Jack, der Suzie gerade ein Zeichen mit der leeren Bierflasche gab.
„Als du mir aufs Band gesprochen hast, dass wir einen Auftraggeber haben, hab ich gedacht, wir reden von einem Erwachsenen! Nicht von einem Kind!“
„Also, die Sache ist die: Wir verdienen $55.000 und ein kleines Mädchen bekommt wieder Spaß am Leben. Niemand kommt zu Schaden, alle gewinnen! Wir spielen nur ein bisschen Schatzsuche mit dem Mädchen.“
„Ich weiß nicht…“
„Mensch, Tony! $55.000! Und den Segen vom Onkel haben wir auch! Und denk bloß mal an das Gebiet, das wir dann – ganz legal – erforschen können!“
„Hmm… OK, da hast du natürlich einen Punkt.“ Tony wurde nachdenklich.
„Und außerdem…“, Jack holte aus seiner Hosentasche das kleine Päckchen, das Rebecca ihm kurz zuvor wieder gegeben hatte. Vorsichtig öffnete er es und beobachtete Tony, der seine Bewegungen interessiert verfolgte. „Davon gibt’s da unten vielleicht noch mehr!“
Tony starrte das goldene Seepferdchen an und nahm es vorsichtig in die Hand. „Santa Maria! Was ist das denn?“
„Das gehört irgendwie zu der Schatzkarte – sieh’ dir diese Gravuren an, das sieht wie eine Schrift aus. Ich habe so etwas noch nie gesehen! Alt ist es auf jeden Fall – Tony, weißt du, was das bedeuten kann?“
Tony lehnte sich zurück und sah seinen Freund skeptisch an. Dann verzog er etwas spöttisch den Mund.
„Jack, Jack – jetzt fang nicht wieder mit diesem Atlantis-Mist an! Ich weiß, ihr Meeresarchäologen träumt alle davon, den versunkenen Kontinent zu entdecken, aber so viel weiß ich auch: Es gibt nicht einen Beweis, dass er jemals existiert hat!“
Jack rieb sich die linke Augenbraue – was er immer tat, wenn er versuchte, ein Problem zu lösen. „Ich sage ja gar nicht, dass wir zwangsläufig auf Atlantis stoßen werden, aber dies könnte trotzdem die Entdeckung einer völlig neuen Zivilisation sein. Für eine solche Schrift ist mir keine Parallele bekannt – und auch sonst niemandem. Ich habe mich im Internet schon vorsichtig umgehört. Wir könnten bei diesem Auftrag auf eigene Faust forschen und dabei noch eine Menge Geld verdienen!“
„Hmm.“ Tony blickte träumerisch vor sich hin. Mehr als das Honorar oder das angebliche Atlantis reizte es ihn, in dem verbotenen Gebiet zu tauchen und womöglich einen Goldschatz zu entdecken.
Da kam Rebecca wieder zurück. „Haben Sie jetzt lang genug über mich geredet oder muss ich mir noch mal die Hände waschen gehen?“
Die beiden Männer grinsten. Tony stand auf, rückte Rebeccas Stuhl zurecht und sagte: „Señorita Whithall-Meyers, mein Partner hat mich überzeugt: Es wird mir ein Vergnügen sein, für Sie zu arbeiten!“
Rebecca setzte sich und strahlte die Männer an. Dieser Antonio konnte ja doch ganz nett sein. „Dann sind wir im Geschäft?“
„Wir sind im Geschäft!“, antwortete Jack.
In diesem Moment brachte Suzie zwei neue Flaschen mit mexikanischem Bier, aus deren Öffnungen vorwitzig Limonenspalten lugten, und die drei Portionen Garnelen, die einen köstlichen Duft verbreiteten. Als sie alles abgestellt hatte, hob Jack seine Flasche. „Lasst uns darauf anstoßen!“
Tony griff zu seinem Bier und Rebecca zu ihrer Limo. Tony rief: „Auf gutes Gelingen, Señorita Whithall-Meyers!“
Rebecca kicherte und meinte: „Ich heiße Rebecca.“
„Tony.“
„Jack.“
Dann stießen die drei an.
2
Die schwarze Limousine hielt direkt am Hafen. Es war noch früh am Morgen, Menschen waren noch nicht auf den Stegen zu sehen. Diese Zeit gehörte den Möwen, die kreischend über das Wasser flogen, das so glatt wie ein Spiegel war. Rebecca winkte dankend ab, als Bodenstein ihre Sporttasche zum Boot tragen wollte. Dies war schließlich der Beginn eines Abenteuers, da konnte sie sich doch nicht die Tasche tragen lassen! Sie ging den Steg entlang zum vereinbarten Treffpunkt. Das Boot war da und dümpelte sanft am Kai. Rebecca war jedoch ziemlich enttäuscht, als sie es sah – es war keineswegs die schnittige Yacht, die sie auf den Fotos in Jacks Büro gesehen hatte. Es hatte vielmehr Ähnlichkeit mit einem alten, umgebauten Fischkutter. Und so roch es auch. Nach altem Fisch und Diesel. Zumindest kam es Rebecca so vor.
Tony war gerade dabei, seine Tauchausrüstung an Bord zu schleppen, als er das Mädchen sah und bemerkte, dass sie das Boot kritisch musterte.
„Das ist …“
„… Marketing. Ich verstehe“, beendete Rebecca den Satz.
Tony grinste und verstaute sein Zeug. Jack tauchte aus der Kajüte auf und half Rebecca galant an Bord.
„Willkommen auf der Driftwood“, sagte er. „Such dir schon mal einen schönen Platz, wir können gleich auslaufen!“
Er nahm Rebeccas Tasche und stellte sie ab. Rebecca kletterte nach vorn zur Bugspitze und sah auf das glitzernde Wasser hinaus. Sie holte tief Luft. Es war schon lange her, seit sie sich so wohl gefühlt hatte. Jack warf den Motor an, während Tony die Taue löste. Dann sprang er an Bord und das Boot tuckerte langsam aus dem Hafen.
Rebecca starrte eine Weile auf die Bugwelle, die immer wieder weiße Schaumkrönchen produzierte, die dann vom Rumpf des Schiffes zermalmt wurden. Dann beschloss sie, ihre Kajüte in Besitz zu nehmen und kletterte nach achtern. Da die Schatzsuche mehrere Tage in Anspruch nehmen würde, war vereinbart worden, auf dem Boot zu übernachten. Ihrem Onkel hatte sie eine Nachricht hinterlassen, dass sie ein paar Tage bei ihrer Freundin Amy übernachten würde. Amy war natürlich eingeweiht und wäre nur zu gern mitgekommen.
Neugierig sah Rebecca sich um. Hier unten sah es besser aus, als man oben vermutete. Das Boot war recht geräumig. Es gab sechs Kajüten, sie konnte sich also eine aussuchen. Die erste Tür, die sie öffnete, führte sie in Jacks Kajüte. Das war ihr sofort klar, als sie die vielen Bücher in den Regalen an der Wand sah. Sie wusste ja inzwischen, dass Jack das Fachwissen hatte, während Tony für die Ausführung der Tauchgänge verantwortlich war. Rebecca grinste, als sie zwischen zwei dicken Bildbänden über antiken Schmuck einen kleinen Plüschhai sitzen sah, der ein Hawaiihemdchen trug.
Als nächstes öffnete sie die Tür der Kajüte direkt gegenüber. Hier musste Tony hausen. Überall lag Zeug herum und an der Wand hing das Foto eines Bikinimädchens in aufreizender Pose direkt neben einer bunten Plastikmadonna mit beleuchtbarem Weihwasserbecken.
Rebecca schleppte ihre Tasche in die dahinter liegende Kajüte. Die Schränke waren leer und sogar einigermaßen sauber. Schnell verstaute sie ihre Sachen. Aus einer Seitentasche zog sie zum Schluss die Schatzkarte, die sie noch einmal sorgfältig wasserfest verpackt hatte. Sie setzte sich auf ihr Bett und strich die Karte mit den Händen glatt. Da musste sie auf einmal an Granny denken und schluckte.
Jack, der den Kopf durch die Einstiegsluke gesteckt hatte, riss sie aus ihren Gedanken: „Wer mag ein Sandwich?“
Schnell steckte Rebecca die Karte wieder in ihre Tasche, die sie dann in den Schrank stellte.
„Ich!“, rief sie laut, denn sie verspürte plötzlich einen Riesenhunger.
Jack hatte an Deck einen kleinen Klapptisch aufgebaut, auf dem sich bereits ein Berg lecker aussehender Sandwiches türmte. Aus der Kombüse holte er gerade eine Thermoskanne mit Kaffee und eine Flasche mit kalter Milch.
„Na, Boss, hast du dich gut eingerichtet?“, grinste er Rebecca an. „Seeluft macht hungrig – greif zu!“
Rebecca strahlte ihn an und setzte sich an den Tisch. Tony, der jetzt das Schiff steuerte, angelte sich ein Sandwich und versuche es zu essen, während er gleichzeitig einen Becher voll heißem Kaffee balancierte. Rebecca biss herzhaft in ein Sandwich und fragte, während sie kaute: „Wann sind wir denn da?“
„Heute Abend. Wir werden ziemlich nahe am Ufer ankern. Wenn es dunkel wird, können wir Fische am Strand grillen. Was hältst du davon?“
Rebecca ließ ihr Sandwich sinken und sah Jack ernst an. „Du hast aber nicht vergessen, dass wir auf Schatzsuche sind, oder?“
„Rebeccita“, antwortete Tony an seiner Stelle, „naturalmente haben wir das nicht vergessen. Aber tauchen kann ich erst morgen. Was spricht also dagegen, das wir es uns heute Abend nett machen?“
Rebeccas Gesicht hellte sich wieder auf und sie nickte. „Also morgen wird getaucht?“
„Morgen wird getaucht!“
*
Am nächsten Morgen war Rebecca schon früh wach. Sie war viel zu aufgeregt, als dass sie lange hätte schlafen können. Sie zog sich an und suchte dann die Schatzkarte heraus. Im Boot war alles ruhig, nur das Glucksen des Wassers war zu hören. Ab und zu platschte es heftiger, als würde etwas auf die Wasseroberfläche aufschlagen. Das hatte sie gestern Nacht schon mal gehört, als sie sich hingelegt hatte. Als sie Jack nach der Ursache fragte, hatte er ihr erklärt, dass das wahrscheinlich spielende Delphine waren. Sie sah durch das Bullauge, konnte aber wieder nichts erkennen. Die beiden Männer schienen noch zu schlafen. Nachdem Rebecca sich überall umgesehen und niemanden gefunden hatte, beschloss sie, die beiden zu wecken.
Nachdem sie ein paar Mal energisch an Jacks Tür geklopft hatte, kam von drinnen ein Brummgeräusch als Antwort.
„Guten Morgen!“, trällerte Rebecca auf ihrer Seite der Tür.
Ein weiteres Brummen von der anderen Seite war die Antwort.
„Der Kaffee ist fertig!“, flunkerte sie dann. Das hatte immerhin den Erfolg, dass Jack nun in menschlicher Sprache antwortete. „Wie spät ist es denn?“, murmelte er.
„Fast schon halb sieben“, antwortete Rebecca fröhlich durch die geschlossene Tür..
Jack stöhnte. „OK, OK, ich steh’ ja schon auf…“
In diesem Moment drangen laut und deutlich die Geräusche eines Bootsmotors an ihre Ohren. Jack war plötzlich hellwach und riss die Tür auf. Er drängte Rebecca zur Seite und war mit zwei Sätzen an Deck. Auch Tonys Tür wurde aufgerissen. Er stürzte hinter seinem Freund nach oben.
„Du bleibst unten!“, rief er Rebecca noch zu. Beide waren durch frühere Erlebnisse geprägt – nicht selten versuchten sich die Wracktaucher und Schatzsucher gegenseitig aus ihren Jagdgründen zu vertreiben oder sich sogar ihre Funde abzujagen. Dabei konnte es ziemlich rau zugehen, denn niemand ließ sich gern ein lukratives Geschäft entgehen. Rebecca hielt den Atem an und lauschte. Sie hörte, wie das andere Boot längsseits kam und an der Driftwood festmachte.
„Jack Foster!“, hörte sie eine energische Frauenstimme sagen. „Also, das ist selbst für dich zu dreist! Letztes Mal bist du noch mit einer Verwarnung davongekommen, aber diesmal bist du fällig. Ich werde die Küstenwache verständigen!“
„Guten Morgen, Cat. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Möchtest du einen Kaffee?“, antwortete Jack gutgelaunt.
„Hör’ auf mich Cat zu nennen! Du weißt genau, dass ich diese Abkürzung hasse, ich heiße Catherine! Es wird dir sowieso nichts nutzen, ich…“
„Bevor du dich weiter aufregst, liebe Cat, ich habe eine GENEHMI-GUNG in diesen Gewässern zu tauchen. Wenn du mal schauen möchtest…“
Rebecca hatte sich auch der Treppe so weit nach oben geschlichen, dass sie das Deck beobachten konnte. Sie sah, wie Jack in das Steuerhäuschen griff und ein Schreiben hervorfischte. Das hielt er einer jungen Frau mit kurzen dunklen Haaren in Ranger-Uniform hin. Hinter der Frau stand ein weiterer Ranger, der Jack und Tony argwöhnisch im Auge behielt. Er war ein breiter Kerl, der lässig eine Hand auf seinem Waffenholster liegen hatte.
„Madre de Dios!“, mischte sich jetzt auch Tony ein, während die Frau auf das Blatt Papier starrte. „Das ist ja tatsächlich la bonita Señorita Beaulieu!“
Tony machte Anstalten, die Rangerin in die Arme zu nehmen, wurde aber von ihrem Kollegen daran gehindert, der sich schnell mit einem ärgerlichen „Hey!“ dazwischen stellte.
Die junge Frau, von der Rebecca nun wusste, dass sie Jack und Tony kannte, hatte inzwischen mit gerunzelter Stirn das Papier gelesen und sah Jack wieder an.
„Von Cedric B. Whithall-Meyers persönlich, also? Wie hast du das denn geschafft, Jack? Oder ist dies wieder eine gut gelungene Fälschung?“
„Fälschung? Also, hör mal, Cat!“, Jack wirkte ehrlich empört.
Rebecca hielt die Luft an, als der Name ihres Onkels fiel. Jack hatte zwar gesagt, er würde sich darum kümmern, dass sie irgendwie eine Genehmigung bekommen würden, in diesem Naturschutzgebiet zu tauchen – aber, dass er sie hintergehen und hinter ihrem Rücken ihren Onkel kontaktieren würde, nein, das hatte sie nicht gedacht. Verstimmt biss sie sich auf die Unterlippe.
„Also, die Sache muss ich erst einmal überprüfen. Mr. Campillo, Sie begleiten mich. Dann bin ich wenigstens sicher, dass hier keiner taucht, während ich das kläre“, meinte Cat und warf Jack einen herausfordernden Blick zu.
Sie wusste, dass sie ihn damit getroffen hatte, denn seine Angst vor dem Tauchen war ihm mehr als peinlich und er sprach nur ungern darüber. Jack wollte gerade etwas entgegnen, als Rebecca hinter ihm die Treppe heraufstieg.
„Die Genehmigung ist in Ordnung. Ich bin Rebecca Whithall-Meyers, die Nichte von Cedric. Ich habe die beiden beauftragt, für mich hier zu tauchen und mein Onkel hat die Genehmigung besorgt.“
Cat starrte das Mädchen ungläubig an. „Ein Kind, Jack? Was läuft denn hier? Ihr habt die Kleine doch nicht entführt?“
„Ach, komm schon, Cat, das glaubst du doch nicht wirklich!“, regte Jack sich auf.
Innerlich flehte er inständig, dass das Mädchen jetzt nicht aus Ärger darüber, dass er ihren Onkel doch informiert hatte, etwas anderes erzählte. Rebecca tat ihm den Gefallen und blieb bei ihrer Geschichte. Cat bestand jedoch darauf, die Sache in ihrer Station zu überprüfen und Tony mitzunehmen. Sie bot Rebecca an mitzukommen, doch das Mädchen lehnte ab.
„Ich würde mir gern den Strand ansehen, ist das OK?“, fragte sie.
„Klar!“, antwortete Cat, „mein Kollege Eric wird dich begleiten und kann dir viel über die Tiere und Pflanzen hier auf der Insel erzählen“, fügte sie hinzu. Eric schob sofort Jack zur Seite und machte sich an dem kleinen Schlauchboot zu schaffen, das für Landgänge an flachen Ufern bestimmt war.
Während Tony mit Cat auf deren Boot stieg und Eric das Schlauchboot zu Wasser ließ, überlegte Jack, wie er Rebecca die Geschichte erklären konnte.
„Rebecca...“, begann er. Doch sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu.
„Später, Dr. Foster!“, sagte sie und ließ sich von Eric in das Schlauchboot helfen.
Jack stützte sich auf die Reling und seufzte. Mit dem sich entfernenden Rangerboot und dem Schlauchboot, dass schon fast den Strand erreicht hatte, schwanden auch seine Hoffnungen, dieses merkwürdige Geschäft, das so simpel geklungen hatte, zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.
Am Strand angekommen, sprang Rebecca aus dem Schlauchboot und sagte zu Eric: „Ich möchte einfach nur allein am Strand entlanglaufen!“
Der Ranger war überrascht, hatte aber nichts dagegen, da es auf der Insel nichts Gefährliches gab. Er setzte sich auf ein dickes Grasbüschel und starrte zur Driftwood hinaus.
Von dort blickte Jack zum Strand und sah, dass Rebecca ein Stück allein an der Wasserlinie entlanglief und sich dann in den Sand setzte.
Vielleicht muss sie die Sache nur verdauen und dann können wir einfach weitermachen, hoffte er.
Rebecca bohrte ihre Zehen in den Sand und hob den Kopf. Der Wind strich angenehm warm über den Strand, und sie blickte hinaus auf das Meer. Sie saß mit angewinkelten Beinen und aufgestützten Armen dicht an der Wasserlinie, gerade so, dass die seicht heranplätschernden Wellen ihre nackten Füße nicht berühren konnten.
Sie hatte noch nie im Meer gebadet und fühlte dem Ozean gegenüber eine merkwürdige Mischung aus Angst und Faszination. Ihre Großmutter hatte ihr strengstens untersagt, Schwimmunterricht zu nehmen. Das wäre nicht gesund für sie, hatte sie immer behauptet. Noch nie war sie mit so wenig Aufsicht so nah am Meer gewesen.
Rebecca konnte erkennen, dass sich in einiger Entfernung vom Ufer mehrere Sandbänke gebildet hatten. Sie ließ den Blick an dem malerischen Strandabschnitt entlang gleiten und seufzte. Sie konnte nicht verstehen, was in ihr vorging. Noch nie hatte sie so empfunden. Sie fand das Meer absolut faszinierend und hätte sich am liebsten hineingestürzt, obwohl sie nicht schwimmen konnte. Doch irgendetwas hielt sie zurück – so sehr, dass sie sich sogar scheute, das Wasser an ihre Füße zu lassen.
Sie dachte an Jack und die Sache mit der Tauchgenehmigung. Vielleicht hatte er ja wirklich keine andere Möglichkeit gehabt und hatte sie nur schonen wollen. Genau, so musste es gewesen sein, darum hatte er ihr nicht erzählt, dass er mit Onkel Cedric gesprochen hatte! Sie war froh, dass sie einen Weg gefunden hatte, die trüben Gedanken zu verscheuchen. Jetzt konnte sie sich auch wieder auf die Schatzsuche freuen. Ob sie wohl tatsächlich etwas finden würden? Wenn Granny doch bloß mehr erzählt hätte! Welche Verbindung gab es zwischen ihrer Familie und dem Schatz?
Noch einmal ließ Rebecca den Blick auf das Meer hinaus wandern und wollte gerade aufstehen, um zu Eric zurückzulaufen, als sie auf einer der Sandbänke eine Gestalt bemerkte, die sich heftig bewegte. Ob das ein gestrandeter Delphin war? Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, etwas zu erkennen.
„Das kann doch wohl nicht wahr sein!", murmelte sie, als sie erkannte, um was es sich handelte. „Das ist ja ein Pferd!"
Angestrengt sah Rebecca noch einmal zur Sandbank hin und sprang schließlich auf. Es war tatsächlich ein schwarzes Pferd, das halb auf der Sandbank lag und sich wohl nicht aufrichten konnte. Sie konnte hören, wie es wieherte und sah, dass es immer wieder mit den Vorderbeinen in den Sand stampfte. Den Hinterleib konnte Rebecca nicht sehen, da das Tier frontal zum Strand hin ausgerichtet war. Sie schaute sich um, ob sie jemanden zu Hilfe holen konnte. Doch dafür sie hatte sich zu weit entfernt. Außerdem hatte sich Eric den Hut ins Gesicht gezogen und schien zu schlafen, Jack auf dem Boot war sowieso zu weit weg und war auch gar nicht an Deck zu sehen.
Bis sie da jemanden geholt hatte, war es für das arme Tier vielleicht zu spät. Sie war ganz allein. „Ich muss ihm doch helfen – vielleicht steckt es ja nur mit den Hinterbeinen fest, und ich kann es befreien", redete sie sich selbst Mut zu und holte tief Luft.
Sie machte die Augen zu und tat den ersten Schritt ins Wasser hinein. Es war ganz anders, als sie gedacht hatte. Noch nie hatte sie sich so wohl gefühlt, wie in dem Moment, als das sonnenwarme Meerwasser zuerst ihre Füße, dann ihre Waden umschloss. Mutiger geworden, ging Rebecca weiter auf die Sandbank zu.
*
Tony trommelte ungeduldig mit den Fingern auf der Reling, während Cats Rangerboot durch das Wasser pflügte.
„Madre de Dios! Geht das denn nicht schneller?!“
Cat warf ihm vom Steuer einen vernichtenden Blick durch ihre dunklen Sonnenbrillengläser zu. „Sie werden sich doch wohl die paar Minuten noch gedulden können, Mr. Campillo!“
„Die paar Minuten? Bis wir bei Jack sind, ist später Nachmittag, dann können wir nicht mehr tauchen. Wir haben einen kompletten Tag verloren – nur, weil Sie uns diese Schwierigkeiten machen! Das ist Geschäftsschädigung, wir werden Sie haftbar machen!“
Cat verzog das Gesicht. „Seien Sie froh, dass ich der Sache nicht noch gründlicher nachgehe. Diese Genehmigung steht doch auf sehr wackeligen Füßen!“
Ein Schwall spanischer Schimpfworte war die Antwort. Cat zuckte mit den Schultern und konzentrierte sich auf das Lenken des Bootes.
Endlich erreichten sie die Bucht und gingen längsseits der Driftwood.
„Holá, Jack! Wo steckst du, Muchacho?“, rief Tony und wunderte sich, Jack nicht an Deck zu sehen. Er musste das Motorengeräusch doch gehört haben! Noch bevor Cat ihr Boot an der Driftwood richtig festgemacht hatte, sprang Tony hinüber und war im Nu unter Deck verschwunden. Doch auch hier war seine Suche vergeblich, Jack war nicht zu finden.
Tony hetzte wieder nach oben. Cat stand am Bug ihres Schiffes und winkte dem Ranger Eric, der gerade mit dem Beiboot vom Strand abgelegt hatte und sich nun den beiden Booten näherte.
„Jack ist nicht an Bord!“, sagte Tony und seine Stimme klang besorgt.
„Was?“, fragte Cat abwesend. Auch ihr war nicht ganz wohl zumute. Sie konnte das Mädchen nirgendwo sehen und der sich rasch nähernde Eric sah ziemlich aufgeregt aus.
„Jack ist nicht an Bord!“, wiederholte Tony ungeduldig, erhielt aber keine Antwort von Cat, die dem schwitzenden Eric an Bord half.
„Catherine, das Mädchen ist verschwunden!“, keuchte Eric und wischte sich das vor Hitze und Aufregung rote Gesicht mit seinem Taschentuch ab.
„Verschwunden? Was soll das heißen – du solltest doch auf sie aufpassen!“, rief Cat und schob sich die Sonnenbrille auf den Kopf.
Verlegen spreizte Eric die Hände und antwortete: „Ich weiß, ich weiß – aber, sie wollte allein sein. Und es gibt ja nichts Gefährliches dort drüben. Ich hab‘ gedacht, ich behalte sie im Auge, aber dann – dann muss ich ein bisschen eingenickt sein …“, seine Stimme verebbte.
Cat schnaufte wütend und ihre Augen verengten sich zu Schlitzen. „Das darf doch nicht wahr sein! So eine schwierige Aufgabe war das doch nun wirklich nicht! Kannst du nicht einmal …!“
„Jack ist auch verschwunden!“, unterbrach Tony ihre Strafpredigt. „Vielleicht hängt das eine ja mit dem anderen zusammen. Es muss etwas passiert sein. Wir sollten lieber anfangen zu suchen, statt einen Schuldigen zu bestimmen!“
Dieser Vorschlag brachte Tony einen dankbaren Blick von Eric ein. Cat stimmte zu und die drei begannen noch einmal zusammen die Driftwood in allen Winkeln zu durchsuchen.
Nachdem das erfolglos blieb, fuhren sie zusammen zum Strand und suchten diesen ab. Sie konnten die Fußspuren des Mädchens bis zu der Stelle verfolgen, an der sie im Sand gesessen hatte.
„Sie scheint ins Wasser gegangen zu sein!“, rief Eric und deutete auf den Rest der Spuren, die von den Wellen noch nicht zerstört worden waren. Tony starrte aufs Wasser hinaus.
„Ich kann mir nur vorstellen, dass Rebecca Schwimmen wollte und irgendwie in Not geraten ist. Vielleicht hat sie einen Krampf bekommen, oder …“
„Ja, so etwas Ähnliches denke ich mir auch“, stimmte Cat zu und fuhr fort: „Jack muss das vom Boot aus gesehen haben und wollte ihr zu Hilfe kommen – aber was ist dann passiert?“
„Wir müssen tauchen!“, sagte Tony entschlossen, drehte sich um und ging Richtung Boot zurück. Cat holte ihn schnell ein und packte ihn am Arm.
„Die Sonne geht schon unter! Es ist zu spät, um heute noch zu tauchen! Wir sehen doch nichts mehr! Lassen Sie uns bis morgen früh warten!“
„Je länger wir warten, desto kleiner ist die Chance, dass wir sie noch lebend finden! Wir haben Unterwasser-Lampen an Bord, wir können auch nachts tauchen“, antwortete Tony. Cat sah die Verzweiflung in seinen Augen, ließ seinen Arm los und nickte.
„Also gut“, sagte sie. Sie wusste, dass auch Tony klar sein musste, dass die Chancen, die beiden lebend zu finden, sowieso bei null standen, sollten sie tatsächlich irgendwo unter Wasser sein. Aber sie verstand auch, dass er Gewissheit haben wollte, was mit seinem besten Freund passiert war.
Zurück auf der Driftwood legten Tony und Cat schnell die Taucherausrüstungen an. Jeder Handgriff saß, beide waren erfahrene Taucher. Zum Schluss half Eric ihnen die Sauerstoffflaschen anzulegen. Als die beiden im Wasser waren, reichte er ihnen die Unterwasser-Lampen und murmelte leise: „Viel Glück!“ Er schaute ihnen nach, bis auch das Licht der Lampen nicht mehr zu sehen war.
Tony und Cat waren sich einig, dass Jack von der Driftwood aus auf die Stelle zu geschwommen sein musste, an der sich Rebeccas Spur im Sand verlor. Am Kreuzungspunkt der beiden Linien musste etwas geschehen sein. Es war mühsam, sich im dunklen Wasser zu orientieren. Cat gab Tony ein Zeichen, dass sie auftauchen wollte.
Oben nahm sie das Mundstück heraus und japste: „Es hat keinen Zweck, Tony! Am Ende übersehen wir noch etwas, lass uns aufhören und morgen weitermachen.“
Tony registrierte erfreut, dass Cat ihn beim Vornamen nannte, wollte aber noch nicht aufgeben.
„Nur noch ein kleines Stück, dann kehren wir um!“, antwortete er, schob sich das Mundstück wieder hinein und tauchte unter, ohne Cats Antwort abzuwarten. Ihr blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen.
Cat orientierte sich am Schein von Tonys Lampe, um ihm zu folgen. Plötzlich bemerkte sie mehrere dunkle Schatten, die sich schnell näherten. Tony konnte sie nicht mehr sehen. Eine Bewegung hinter ihr ließ Cat herumfahren. Entsetzt stellte sie fest, dass die Schatten sie eingekreist hatten.
3
Ein paar Stunden zuvor war Rebecca durch das warme, blaugrüne Wasser gewatet. Schnell wurde es tiefer und benetzte bald ihre Shorts. Gerade, als sie dachte, dass es wohl kaum tiefer werden könnte, trat sie in ein Loch und wurde bis zum Oberkörper nass.
"Na, jetzt ist es auch egal", dachte sie und arbeitet sich weiter vor. Seltsamerweise hatte sie überhaupt keine Angst, dass das Wasser zum Laufen vielleicht zu tief werden könnte.
Das Pferd konnte sie jetzt deutlich erkennen. Es war kohlschwarz, hatte einen edlen kleinen Kopf und einen muskulösen Hals, der in der Sonne feucht glänzte. Die lange Mähne war trocken und flatterte im Wind. Immer wieder fiel sie ihm über die Augen. Es lag immer noch mit dem Bauch auf dem Sand und hatte die Vorderbeine aufgestemmt. Am Spiel der Muskeln ließ sich erkennen, wie es sich bemühte, von der Stelle zu kommen. Als es sah, dass Rebecca die Sandbank erreichte und aus dem Wasser stieg, wieherte es und legte misstrauisch die Ohren nach hinten.
Rebecca näherte sich langsam und versuchte, beruhigend auf das Tier einzureden. Pferde waren ihre heimliche Leidenschaft. Alle Bücher, die sie zum Thema Pferd bekommen konnte, hatte sie gierig verschlungen – doch leider hatte sie noch nicht die Gelegenheit gehabt, sich tatsächlich auf ein Pferd zu setzen. Auch das war ihr von ihrer Großmutter als zu gefährlich verboten worden. All ihr Wissen war also nur theoretisch.
Der Rappe hatte sich etwas beruhigt, als hätte er verstanden, dass ihm von dem Mädchen keine Gefahr drohte. Seine Ohren waren gespitzt und seine großen Augen folgten aufmerksam jeder ihrer Bewegungen. Rebecca wollte nun sehen, warum das Tier nicht aufstehen konnte. Langsam ging sie um das Pferd herum – und konnte einen Aufschrei nur mühsam unterdrücken.
Der Körper des Tieres endete in einer Art Delphinleib und statt der Hinterbeine hatte es eine große, quer stehende Schwanzflosse!
Rebecca hatte Mühe, dieses Bild zu verarbeiten. Während sie fassungslos dastand und auf das schier Unmögliche starrte, sah sie im Sand dicht neben dem Pferd etwas blinken. Sie bückte sich und hob ein goldenes Amulett auf, das an einem lederartigen Band befestigt war.
Es war die stilisierte Darstellung eines Seepferdes mit einem Krönchen – und glich haargenau dem Schmuckstück, das sie Jack gezeigt hatte! Das Lederband war sehr lang und Rebecca fand einige lange, schwarze Pferdehaare darin.
„Das muss um seinen Hals gehangen haben“, murmelte sie. Doch wer hatte dem Tier das Amulett wohl umgehängt?
Rebecca war noch ganz in die Betrachtung des Schmuckstücks versunken, als sie plötzlich vom stärker werdenden Rauschen der Brandung aufgeschreckt wurde. Der Wind hatte zugenommen und die Furt zwischen dem Strand und der Sandbank hatte sich schon erheblich verbreitert. Entsetzt sah Rebecca, dass ihr der Rückweg durch das tiefe Wasser versperrt war.
Da hörte sie das Pferd wieder wiehern. Es spürte, dass sich das Wasser bereits unter seinem Bauch zu sammeln begann und es bald wieder frei sein würde. Die mächtige Schwanzflosse klatschte schon auf das Wasser.
Entschlossen verkürzte Rebecca das Lederband durch einen Knoten und hängte sich das Amulett um den Hals. Dann ging sie wieder auf das Pferd zu. Vorsichtig streckte sie eine Hand aus und tätschelte den Hals des Tieres. Es ließ dies ruhig geschehen.
„Jetzt musst du mir helfen!", sagte sie zu dem Seepferd, das wieder mit der Schwanzflosse auf das steigende Wasser schlug. Rebecca dachte an all die schönen Pferdebücher, die sie gelesen hatte, nahm ihren ganzen Mut zusammen, fasste mit beiden Händen in die lange Mähne und zog sich auf den Rücken des Tieres. Kaum saß sie oben, umspülte das Wasser den Körper des Seepferdes – es drückte sich noch einmal mit den Vorderhufen vom Sand ab und war befreit.
Rebecca war hin- und her gerissen zwischen bodenloser Angst und einem nie gekannten Glücksgefühl. Gerade überlegte sie, wie sie den Rappen wohl dazu bringen könnte, Richtung Strand zu schwimmen, als dieser in einer einzigen fließenden Bewegung den Körper drehte, seinen Hals streckte, den Kopf senkte und in einem steilen Winkel nach unten tauchte.
Instinktiv klammerte Rebecca sich noch immer an der Mähne fest, hielt die Luft an und kniff die Augen zu, um sie vor dem Salzwasser zu schützen – dann schlugen die Wellen über ihrem Kopf zusammen.
*
Nachdem er gesehen hatte, dass das Mädchen am Strand sitzen geblieben war, war Jack nach unten gegangen und beschäftigte sich mit der Tauchausrüstung. Er musste irgendetwas tun, das bloße Rumsitzen ging ihm auf die Nerven. Doch auch damit war er schließlich fertig und kletterte wieder an Deck. Sein Blick suchte den Strand ab, wo er den schlafenden Ranger sah. Doch als seine Augen zu der Stelle wanderten, wo Rebecca gesessen hatte, konnte er sie nicht entdecken. Jack kniff die Augen zusammen, konnte die Umrisse des Mädchens aber nicht ausmachen. Dann nahm er im Augenwinkel eine Bewegung wahr, riss den Kopf herum und sah, wie Rebecca die Sandbank erreichte und auf ein liegendes Pferd zuging.
„Rebecca!!!“ Jack brüllte so laut er konnte, doch der Wind riss ihm die Laute aus dem Mund. Seine Finger umklammerten die Reling, als er beobachtete, wie die Flut die Sandbank schwinden ließ. Er wusste, das Mädchen würde das Ufer nur noch schwimmend erreichen können. Er sah noch einmal zu dem Ranger, der aber immer noch nichts mitbekommen hatte, kletterte schließlich über die Reling und sprang, so wie er war, mit Shorts und Hemd, ins Wasser. Sobald er wieder auftauchte, schwamm er mit kräftigen Zügen auf die Sandbank zu.
Er war nur noch wenige Meter von Rebecca und dem Pferd entfernt, als er zu seinem Entsetzen sah, dass sich das Mädchen auf den Rücken des Tieres zog und sie gemeinsam in den Fluten auf der anderen Seite der Sandbank abtauchten. Jack stolperte auf die nun schon knietief umspülte Sandbank und starrte fassungslos auf die große Schwanzflosse, die auf das Wasser schlug. Ohne weiter nachzudenken, stürzte er kopfüber hinterher.
Unter Wasser konnte er die Umrisse des Tieres nur schwach erkennen, die See war zu aufgewühlt. Jack bemerkte jedoch, dass das Pferd – oder was immer es war – auf dem direkten Weg nach unten schwamm. Seine Lungen schienen schon zu platzen, doch Jack wollte unbedingt das Mädchen von dem Rücken des Seepferdes holen. Er war sich jedoch darüber im Klaren, dass er nicht mehr lange aushalten konnte, bevor er zum Luftholen an die Oberfläche musste.
Plötzlich durchfuhr ein starker Schmerz seinen rechten Oberarm. Instinktiv griff er an die Stelle und ertastete einen dünnen Harpunenpfeil in seinem Arm. Reflexartig riss er den Mund auf, schluckte Wasser und strampelte wie wild, um nach oben zu kommen. Fast hatte er die hell schimmernde Wasseroberfläche schon erreicht, als eine dunkle Gestalt vor ihm auftauchte und ihm den Weg versperrte. Dann verlor Jack das Bewusstsein.
4
Der Sand unter seinen Händen fühlte sich weich und warm an, ein lauer Wind strich sanft über sein Gesicht. In der Ferne hörte er fröhliches Lachen und das Rauschen der Brandung. Jack streckte sich, ohne die Augen zu öffnen. Der Traum war so schön, er hatte keine Lust in die Realität zurückzukehren. Dann fielen ihm die letzten Ereignisse ein. Er riss die Augen auf und setzte sich ruckartig auf. Erstaunt sah er sich um.
Er befand in einem breiten Bett, das mit kühlen, seidenen Laken und einer Menge weicher Kissen ausgestattet war. Neben dem Bett stand ein kunstvoll geschmiedetes Tischchen, auf dem eine kostbare Glaskaraffe mit Wasser, ein dazu passender Pokal sowie eine silberne Schale mit köstlich duftenden Früchten standen. Der Raum hatte rosafarbene Marmorwände und einen ebensolchen Boden, die Decke war kassettiert.
Wie in einer römischen Villa, dachte Jack unwillkürlich. An der rechten Wand sah er zwei große, schmale Fenster. Glasscheiben waren nicht zu sehen, nur transparente Tücher, die bis auf den Boden reichten und sanft vom Wind bewegt wurden. Jetzt hörte er auch das Rauschen der Brandung und das Lachen wieder, beides gehörte nicht in seinen Traum, sondern war real.
Jack wurde schwindelig, und er ließ sich zurück in die Kissen sinken. Er schloss die Augen und rieb sich die Stirn. Die letzten Bilder, an die er sich erinnern konnte, bevor er das Bewusstsein verlor, tauchten wieder vor seinem geistigen Auge auf. Etwas hatte ihn verletzt – eine Harpune! Jack öffnete die Augen wieder und blickte auf seinen rechten Oberarm.
Da, tatsächlich, er hatte einen Verband! Erst jetzt fiel ihm auf, dass sein Oberkörper nackt war. Jack schlug das Laken zurück. Der Shorts, den er trug, war nicht sein eigener, passte aber gut. Vorsichtig stand er auf. Ihm war immer noch ein bisschen schwindelig.
Der Marmorboden fühlte sich unter seinen nackten Füßen angenehm glatt und kühl an. Langsam ging er zum Fenster und schob das Tuch zur Seite. Jack blinzelte. Er konnte kaum glauben, was er sah.
Nur etwa 100 m von seinem Fenster entfernt befand sich ein weißer Sandstrand, der im idealen Kontrast zu dem türkisfarbenen Wasser des Meeres stand. In der Ferne konnte er eine felsige Hügelkette erkennen. Am Strand war eine Gruppe von jungen Leuten mit einem Ballspiel beschäftigt. Was Jack jedoch an seiner Wahrnehmungsfähigkeit zweifeln ließ, war die Tatsache, dass die jungen Männer und Frauen in antike Gewänder gekleidet waren.
„Atlantis!“, murmelte er und ein freudiger Adrenalinstoß jagte durch seinen Körper. „Ich habe Atlantis gefunden!“ Unter all den Vermutungen über den Standort des sagenhaften Kontinents war auch die vielfach belächelte These aufgetaucht, dass er sich in der Nähe der USA befunden hätte. Sollte etwa doch …?
Nachdem er ein paar Minuten aus dem Fenster gestarrt hatte, ohne dass sich an dem Bild etwas änderte, beschloss er, der Sache auf den Grund zu gehen. Er ging zurück zum Bett, goss sich Wasser ein, das er in langen Zügen austrank, und ging dann zu den beiden Holztüren, die sich dem Bett gegenüber befanden.
Vorsichtig drückte Jack die Klinke der linken Tür hinunter. Sie war nicht verschlossen und ließ sich geräuschlos öffnen. Jack steckte seinen Kopf durch den Spalt und spähte hinaus.
Er blickte in das perfekte Atrium eines römischen Herrenhauses. Der kleine Innenhof war von allen Seiten von einem Säulengang umgeben. Weitere Türen ließen vermuten, dass es noch mehr Räume wie sein Zimmer gab. In der Mitte war ein rechteckiges Bassin, in dem sich einige bunte Fische tummelten. Ein reich verzierter Springbrunnen erzeugte ein beruhigendes Plätschern.
Er öffnete die Tür ganz und trat in den Säulengang. Eine der Türen musste auch nach draußen führen, da war er sich ganz sicher.
„Salve, Peregrinus!“, sagte da eine Stimme hinter ihm. Jack fuhr herum und stand einem jungen Mann in einer Tunika gegenüber, den er nicht hatte kommen hören.
Peregrinus war das lateinische Wort für Fremdling. Jacks Herz machte einen weiteren Freudensprung. Na klar, in Atlantis sprechen sie natürlich Griechisch oder Latein.
„Salve“, antwortete er und versuchte, sich an lateinische Vokabeln zu erinnern, die er jetzt einsetzen konnte.
„Ubi…“
„Wo du bist, möchtest du wissen?“, entgegnete der junge Mann in fließendem Englisch und lächelte.
„Das wird dir alles der Präfekt erklären. Mein Name ist Marcus und ich werde dich jetzt zur Präfektur bringen.“
Damit drehte er sich um, ging auf eine der Türen zu, öffnete sie und ging mit ausgreifenden Schritten hinaus. Jack beeilte sich, ihm zu folgen. Ihm war aufgefallen, dass sein Führer einen goldenen Anhänger als Schmuck an einem Lederband um den Hals trug – ein Seepferdchen, das dem glich, das Rebecca ihm gezeigt hatte.
Jack sah, dass es mehrere, ganz gleich gebaute Villen in der Nähe gab. Die Gebäude in der Ferne sahen aus, als gehörten sie zum alten Rom. Hin und wieder begegneten ihnen Menschen in antiker Kleidung, die Jack neugierig ansahen. Doch Marcus eilte weiter und Jack hatte keine Gelegenheit, stehen zu bleiben und Fragen zu stellen.