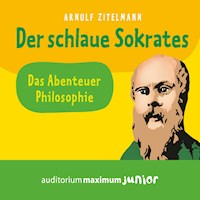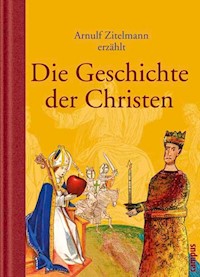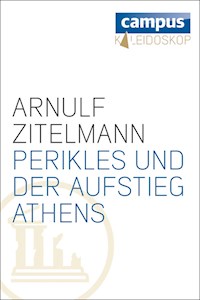Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
ab 10 Jahre Viel zu oft begegnet uns heutzutage Religion im Zusammenhang mit Konflikten und Gewalt. Doch was wissen wir wirklich über die Vielfalt, die Werte und Grundlagen der großen Weltreligionen? Arnulf Zitelmann lädt ein in die Welt von Taoismus, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam. Jenseits aller Mythen und Bilder stellt er die großen Religionsstifter wie Laotse, Buddha, Moses, Jesus und Mohammed vor allem als Menschen dar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
|7|Religion, ein erstes Wort
Religion ist ein schrecklich allgemeines Wort. Ich gebe es in die Suchmaschine ein, und auf dem Bildschirm erscheinen unsortiert Thai-Tempeltänzerinnen, Rosenkranzgebete, Ufos, Malcolm X und Martin Luther King, Selbstmordattentäter, die magischen Bildgalerien der Eiszeitjäger von Lascaux, Judenstern und Halbmond, St. Paul’s Cathedral, Sexismus, tibetanische Räucherstäbchen. Ich könnte nächtelang weitersurfen und käme an kein Ende. Unmöglich! So viel passt in kein einzelnes Wort. Doch ein besseres habe ich auch nicht.
Mir fällt die Begegnung mit einer Dame ein, der ich als Student aus meinem Studium erzählte, Philosophie und Theologie. Ich vergesse den Blick nicht, als sie mir sagte: »Sie sind doch ein vernünftiger junger Mann, wozu haben Sie Gott nötig?« Ich war verlegen, und meine Antwort weiß ich nicht mehr. In Europa und in der ganzen westlichen Welt sind Gott und Vernunft, Religion und Wissenschaft unüberbrückbare Gegensätze. Jahrhundertelang ist darüber im Abendland endlos gestritten worden. Was würde ich heute, nach all den Jahren, der Frau antworten? Ich brauche einen Rasierapparat, eine Zahnbürste und meine Pfeife, aber einen Gott brauche ich nicht.
Ich bin frommer Atheist. Atheisten nannte man im römischen Weltreich die Christen, weil sie an keine Gottesbilder glaubten. Das tue ich auch nicht. Gottesbilder sind ein Notbehelf, eher harmlos also. Klammert man sich daran, werden sie gefährlich. Deswegen bin ich Atheist, aber ein frommer. Ohne dieses Gefühl der Frömmigkeit möchte ich nicht leben, nicht einen Augenblick.
Beim Stichwort Religion höre ich hupende Hochzeitsautos, tibetanische Tempelmusik und Glockenspiele aus Holland, sehe Kardinalspurpur in Rom, im Iran die schwarzen Turbane der Mullahs, in das Kirchlein vor meinem Arbeitszimmerfenster tragen Eltern ihr Kind zur Taufe, buddhistische Mönche verbrennen sich in Vietnam, das Fernsehen überträgt einen Gottesdienst für Tiere, zeigt kirchliche Entwicklungshelfer, die in Eritrea Brunnen bohren. Religionen gibt es weltweit, sie kommen aber nicht miteinander aus. Sie schließen |8|Bündnisse mit der staatlichen Macht, zwischen Thron und Altar, eine brisante Mischung! Ich lese von mordenden Kreuzrittern, aber Franz von Assisi, der Vater der Franziskanermönche aus dem 13. Jahrhundert, predigte den Vögeln und wusch das faulende Fleisch von Leprakranken. All das ist Religion, auch das Lehrhaus des Konfuzius in China, die Kaaba in Mekka, die Klöster auf dem Berg Athos in Griechenland, die Stupas mit den Reliquien Buddhas, die Synagogen, der Kölner Dom. Ich rieche Papier, sehe Tinte fließen, Druckpressen arbeiten. Und dann fällt mir Hildegard von Bingen ein, die heilkundige Mystikerin des Mittelalters. Mystik ist Religion ohne Worte. So wie Hildegard dachten viele intelligente, weise Frauen. Aber Religion ist männerzentriert, weltweit, sei es im Buddhismus, Judentum, Christentum oder im Islam. Gott erbarme dich! Und dieses ganze Konglomerat von Ritualen, Institutionen, Rechtgläubigen und Ketzern heißt Religion. Was habe ich damit zu tun? Gar nichts. Oder doch? Wie auch immer, in mein Gefühl lasse ich mir von niemandem hineinreden.
Meine Mutter Helene betete abends mit mir am Kinderbett: »Will Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen: Dies Kind soll unverletzet sein.« Laut mitgebetet habe ich, und dieses Gefühl, das ich damals dabei empfand, ist mir nie abhanden gekommen: Die Gewissheit, im Letzten unverwundbar zu sein, angstfrei leben zu können.
Die Existenzialisten des vorigen Jahrhunderts machten die »Geworfenheit« als menschliche Situation aus. Albert Camus beschrieb sie in seinem »Mythos von Sisyphos« als »Verstoßensein ohne Ausweg«. Der Mensch ist einfach da und muss mit diesem Dasein fertig werden, so wie Sisyphos, der den Stein den Berg hinaufrollte, aber niemals oben ankam, weil der Stein immer wieder hinunterfiel und er von vorn anfangen musste. Ich habe eine schwierige Biografie, einen Katastrophenslalom sozusagen, doch die Einstellung von Camus teile ich nicht. Viel stärker empfinde ich die Tatsache, dass ich mich einer endlosen Reihe von glücklichen Zufällen verdanke. Jeder, der neben mir in der S-Bahn sitzt, kann sein Leben bis auf den Urknall zurückführen. Als vor 15 Milliarden Jahren in den ersten drei Minuten des kosmischen Prozesses jene atomaren Bausteine entstanden, die heute beim Schreiben meine Finger bewegen. Und wir verdanken uns der Evolutionskette, die auf unserem Planeten bis zum Menschen führte. Ein verschränktes Geschehen von Zufall und Gesetzmäßigkeiten. Von Mozart bis Madonna.
Dafür, dass ich da bin, mein Leben bis heute erhalte, weiß ich nicht nur meiner Mutter Dank, sondern ungezählten Menschen, Lebewesen, auch der |9|Mutter Erde, ihren Früchten, ihren Tieren, ihrer sauerstoffhaltigen Luft, ohne die wir nicht atmen können. Ich verdanke mich Menschen, deren Leben in meinem Leben Spuren hinterließen, der Musik, die ich hörte, den Büchern, die ich las. Nicht zu vergessen Kitti, unsere Katzenmamsell! Wo soll ich aufhören? Genauer gefragt, wo fange ich an? Ich weiß es nicht, aber schließlich bin ich doch da, einmalig, unverwechselbar.
Nie wieder wird es mich in den Milliarden Jahren der Zukunft noch einmal geben, wenigstens nicht genauso. Jede und jeder von uns ist einzigartig. Und auch darin verdanken wir uns. Wem? Oder was? Warum ist das große Los in der Gen-Lotterie ausgerechnet auf mich gefallen? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu mehreren Trillionen. Mich dürfte es gar nicht geben, rein statistisch gesehen. Trotzdem bin ich da. Unser Dasein beruht auf einem riesengroßen Zufall. Und die Religion verspricht, aus unserem Zufallsdasein einen Glücksfall zu machen, dem Zufall einen Sinn zu geben.
Das ist der gemeinsame Nenner der Philosophie von Laotse, Buddha, Moses, Jesus und Muhammad. Religion funktioniert wie eine Rückversicherung gegen das brutale Faktum des Zufalls. Die Frage nach dem Woher und Wohin werden sich vermutlich alle Menschen irgendwann einmal stellen. Und wahrscheinlich auch die Lebewesen von anderen Planeten irgendwo in der Galaxis. Falls es sie gibt, und falls die Außerirdischen wie wir die Zeit erfahren, nämlich als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Solche spekulativen Fragen möchte ich hier aber lieber nicht diskutieren.
Religion als die Bewältigung des Zufalls. Das klingt fast wie eine Umschreibung der Kritik von Sigmund Freud: »Der letzte Grund der Religion ist die infantile Hilflosigkeit des Menschen.« Ähnlich sah es Karl Marx, der aber auf die soziale Funktion der Religion abhob. Für ihn war sie ein Beruhigungsmittel, das »Opium des Volks«. Diese Funktion hat die Religion verloren. Heute benutzen wir als »Opium« Risikosport, Fitnesstraining, Rock- und Popmusik, Internetsurfen, Actionspiele, Erlebnisurlaub, eben alles, was einen aus dem Alltag herauskatapultiert, greifen vielleicht sogar zu richtigen Drogen, Ecstasy oder Alkohol. Hinein in die große Spaßgesellschaft, und die geht über Leichen. Daran würde Marx am Anfang unseres Jahrtausends die Kritik der ökonomischen Verhältnisse festmachen. Nicht mehr an der Religion.
Karl Marx entstammte einer alten jüdischen Familie, und unter seinen Vorfahren befanden sich mehrere Rabbiner, Schriftgelehrte, die Recht sprachen, Trauungen und Scheidungen vollzogen und die ihre Gemeinden nach außen vertraten. Der Religionskritiker kannte sich also in Sachen Religion gut aus. |10|Und er sprach ihr nicht rundweg jede Existenzberechtigung ab. In ihr vernahm er den »Seufzer der bedrängten Kreatur«, sah in ihr den ohnmächtigen Protest gegen die gesellschaftlichen Missstände, »in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Religionskritik des Österreichers Sigmund Freud, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Psychoanalyse begründete. In jeder Religion, befand Freud, steckt eine Portion Trotz, »versteckter Sohnestrotz« gegen einen übermächtigen Vater. Ich stimme zu. Religion ist mehr als ein Kuschelgefühl, mehr als liebes Eiapopeia. Alle großen Religionen begannen irgendwann als Protestbewegungen, alle Religionsgründer waren |11|zugleich Religionskritiker und mussten sich gegen zahllose Widerstände durchsetzen.
Moses, Buddha, Laotse, Jesus, Muhammad: Ihre Religion verspricht, dem Zufall einen Sinn zu geben.
|11|Laotse, der chinesische Weise, verließ seine angestammte Heimat: »Denn die Güte im Land war wieder einmal schwächlich, und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu.« So beschreibt Bert Brecht, der Poet, den legendären Auszug Laotses in seiner Ballade »Von der Entstehung des Buches Taoteking«. Buddha, eventuell des chinesischen Weisen Zeitgenosse, war das Ziel mörderischer Anschläge. Ein Vetter hetzte den wilden Elefanten Nalagiri auf den Erleuchteten. Auch gegen Moses intrigierten seine eigenen Verwandten. Aaron und Miriam wiegelten die Juden gegen ihren Anführer auf, und um ein Haar wäre Moses gesteinigt worden. Jesus wurde gekreuzigt, Muhammad, der Prophet, musste seine Heimatstadt Mekka fluchtartig verlassen.
Solche biografischen Übereinstimmungen sind kein Zufall. In jedem religiösen Genie steckt auch ein Religionskritiker. Unausweichlich, denn der ultimative Horizont der Dinge ist größer als unser Kopf. Egal wie die Menschen es nennen, das Tao des Laotse, das Nirwana von Buddha, der Jahwe-Gott Israels, der Allah des Koran oder der Jesus Christus des Neuen Testaments. Alles sind Annäherungen, keine letzten Wahrheiten. Darum muss die Religion gegenüber sich selbst kritisch sein und selbstkritisch bleiben.
Das ist ein weiterer Grund, warum mir das Wort »Religion« eigentlich so missfällt. Wir verbinden damit ihren Anspruch, im Besitz ewiger Wahrheit zu sein. Doch ewige Wahrheiten gibt es nicht. Schließlich ist alles unterwegs, noch im Werden. Nichts ist schon endgültig ausgemacht und entschieden. Und außerdem: Ewige Wahrheiten sind Killer. Sie leben vom Blut ihrer Opfer. Die Fernsehnachrichten dokumentieren täglich jene Grausamkeiten, die aufs Konto von totalitären Religionsansprüchen gehen. Die gut gemeinte Belehrung, ich dürfe über den Missbrauch von Religion ihr wahres Wesen nicht verkennen, hilft mir gar nichts. Im Gegenteil. Wer Religion doppelte Moral unterstellt, bringt sie vollends um allen Kredit.
»Es ist das Beste an Religion, dass sie Ketzer erzeugt«, oppositionelle Geister, Abweichler, Dissidenten, notierte der Philosoph Ernst Bloch im 20. Jahrhundert. Wer wollte das bestreiten? Alle großen Religionsstifter waren große Ketzer, Aufrührer in Wirklichkeit. »Neuerer« kennen die meisten religiösen Traditionen nur als Schimpfwort, doch was wären die Religionen ohne ihre Erneuerer! Und die gab es in jeder Religion, sonst wären sie längst alle vom Erdboden verschwunden. Es ist die Aufgabe der Theologen, die Balance zwischen Tradition und Reformation immer neu auszutarieren, und das gelingt |12|ihnen mehr oder weniger gut. Tatsache bleibt: Jede Religion schreibt ihre Geschichte ständig neu. Heute gilt das erst recht, weil der Globalisierungsprozess sich zusehends beschleunigt und keine Religion auf der Welt sich mehr von den übrigen abschotten kann. Der Dialog zwischen den Weltreligionen ist endlich in Gang gekommen. Mein Buch verstehe ich als Teil dieses Prozesses.
Dass ich es gerade jetzt schreibe, hat einen persönlichen Grund: die kürzliche Einweisung in eine Klinik. Ich lebte seit Jahrzehnten ärzte- und medikamentenfrei, doch jetzt lag ich plötzlich auf dem Operationstisch. Noch dazu unter Krebsverdacht.
Schläuche, Infusionsbeutel, Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte um mich herum. Ich konnte nicht fassen, wie mir geschah! Hier und heute, an meinem Schreibpult, blicke ich fast mit Wehmut auf jene Wochen zurück. Ohne Termine, keine Korrespondenz, ohne Computer, Telefon, keine Schreibarbeiten, keine Lese- und Vortragsreisen. Statt ständig unterwegs zu sein, lag ich im Bett und spürte, dass mein Leben endlich ist. Eine Woche später kam der erlösende Befund: kein Krebs. Doch ich hätte auch einen positiven Befund akzeptiert, ohne Bitterkeit, ohne die Frage: Warum gerade ich?
Während jener Zeit entstand dieses Buch. Als ich die Klinik verließ, hatte ich es im Kopf fertig geschrieben. Ein gutes halbes Jahr später stehe ich jetzt am Schreibpult und bringe den Text zu Papier. Als Dankeschön, ein Gefühl ohne bestimmte Adresse. Doch es schließt die Leserinnen und Leser mit ein. Sie sind mein Gegenüber, während ich schreibe. Jedenfalls, ich wollte mich bedanken, bei wem auch immer. Ich hatte Glück im Unglück gehabt, mal wieder.
Ich möchte mein Buch nicht abgehoben und abstrakt schreiben, sondern, wenn schon, auf der persönlichen Ebene, entlang meiner eigenen Biografie. Über Religion kann man nicht von außerhalb, nicht von oben herab schreiben. Jede Religion ist doch eine Art von Liebeserklärung. Anders gesagt, das religiöse Gefühl ist das Persönlichste, was ein Mensch besitzt. Ich wenigstens kann mich keinen Augenblick davon verabschieden.
Ein »Handbuch der Weltreligionen« kann und will mein Buch nicht sein. Davon gibt es genug, sehr gute und weniger gute. Ich werde die Welt von Laotse und Buddha, die Religion des Juden- und Christentums und die Botschaft Muhammads dem Leser so vorstellen, wie sie sich mir darstellt. Gewiss nicht, ohne dass ich mich rundum kundig gemacht hätte! Eine gewisse Unschärfe lässt sich trotzdem nicht vermeiden. Nicht mal seine eigene Religion kann ein einzelner Mensch ganz erfassen. Dazu ist jede Religion in sich zu reich, zu vielgestaltig. Religionen sind Kulturprodukte, an denen Hunderte von |13|Generationen gearbeitet haben. Auch deswegen ziehe ich eine subjektive, persönliche Sichtweise vor. Sie ist ehrlicher als ein Lehrbuch.
Meine Vorbehalte gegenüber dem Begriff von Religion habe ich mehrfach angesprochen. Dennoch muss ich von dem Wort Gebrauch machen, es lässt sich nicht vermeiden, obwohl manche Religionen das Wort überhaupt nicht kennen. Es stammt aus unserer westlichen, griechisch-lateinischen Kultur. Und die dominiert allein schon mit ihrer Zeitrechnung – vor oder nach Christus – innerhalb der Weltkulturen als Leitkultur. Nur innerhalb der westlichen Kultur kann ich meinen Begriff von Religion definieren. Ein Hindu beispielsweise, in dessen Sprache das Wort Religion nicht existiert, würde es ganz anders tun. Was also verstehe ich unter Religion?
Mir gefällt, was Thomas Mann in seinem Roman Joseph und seine Brüder dazu zu sagen hat:
»Gewissermaßen war Abraham Gottes Vater. Er hatte ihn erschaut und hervorgedacht, die mächtigen Eigenschaften, die er ihm zuschrieb, waren wohl Gottes ursprüngliches Eigentum, Abraham war nicht ihr Erzeuger. Aber war er es nicht dennoch in einem gewissen Sinne, indem er sie erkannte, lehrte und denkend verwirklichte? ... Darum blieb Gott aber doch ein gewaltig Ich sagendes Du außer Abraham und außer der Welt ... Gott aber hatte seine Fingerspitzen geküsst und zum heimlichen Ärger der Engel gerufen: ›Es ist unglaublich, wie weitgehend dieser Erdenkloß mich erkennt! Fange ich nicht an, mir durch ihn einen Namen zu machen? Wahrhaftig, ich will ihn salben!‹«
Den Text lasse ich so stehen. Die Leserinnen und Leser sollen ihn auf sich wirken lassen. Meine eigene Religionsauffassung veranschaulicht die Geschichte vom Paradies, mit der die Hebräische Bibel, das Alte Testament der Christen, beginnt. Bibelwissenschaftler datieren diesen Text in das 8. Jahrhundert vor unserer Zeit.
»Jahwe Gott« formte am Anfang den Menschen aus Staub von der Erde, hauchte ihm Lebensatem zu und versetzte ihn in eine Oase, die »Jahwe Gott« gepflanzt hatte, damit der Mensch sie hege und pflege. Und »Jahwe Gott« sprach: »Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei! Ich will ihm ein entsprechendes Gegenüber machen.« Noch ist der Mensch allein mit sich. Inmitten der pflanzlichen Kreatur erfährt er sein Fremd – und Anderssein. »Da bildete Jahwe Gott aus dem Erdboden jedes wildlebende Tier des Feldes und jedes fliegende Geschöpf der Himmel, und er begann, sie dem Menschen zu bringen, um zu sehen, wie er jedes nennen würde.« Aber es bleibt bei dem Fremd- und Anderssein, der Mensch ruft den Namen der Tiere, doch sie antworten |14|nicht in seiner Sprache. »Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen«, bildete aus des Menschen Gebein eine Menschenfrau und brachte sie dem Menschen. »Da sagte der Mensch: Endlich! Diese da ist Bein von meinem Gebein!« Das Fremd- und Anderssein war aufgehoben, Adams entsprechendes Gegenüber ward endlich gefunden!
Wir kennen den traurigen Fortgang der Geschichte! Adam und Eva essen von der verbotenen Frucht. Darüber gehen ihnen die Augen auf. Und ihnen wird bewusst, dass sie zum »Guten wie zum Bösen« fähig, durch die Existenz des Anderen gefährdet, verwundbar sind. »Da flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.« Das erlösende Gegenüber wird zur Bedrohung.
Jahrtausende später, zu unserer Zeit, schreibt der französische Philosoph Jean-Paul Sartre: Die Erfahrung des Angeblickt-Werdens wirft mich auf mich selbst zurück, der Blick des anderen ist mein Richter. »Mein eigentlicher Sündenfall ist die Existenz des anderen.« Seit ihnen die Augen aufgingen, ist jeder Mensch noch radikaler allein, verdammt zum ewigen Fremd- und Anderssein. Auch und gerade Gott kann Adam und Eva kein »entsprechendes Gegenüber« sein, denn als sie seine Stimme hörten, »versteckten sich der Mensch und seine Menschen-Frau vor dem Angesicht Jahwes inmitten der Bäume«.
»Er (der Mensch) weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rand des Universums hat, das für seine Musik taub ist, gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen«, so beschreibt der Biologe und Nobelpreisträger Jaques Monod die menschliche Situation. Der Mensch ist ein Geschöpf ohne ein Gegenüber, ein Tier, das in die Welt nicht hineinpasst. Ein Missgriff Gottes? Ein Irrläufer der Evolution? Die Wirklichkeit, so immens sich uns die Realität auch darstellt, ist jedenfalls eine Nummer zu klein für den Menschen. Er kann sich in ihr nicht wiederfinden. Blaise Pascal, ein Mathematiker und mystischer Philosoph des 17. Jahrhunderts, trieb diesen Gedanken auf die Spitze: »Begreife, der Mensch übersteigt unendlich den Menschen.« Er transzendiert sich, wie es in der philosophischen Fachsprache heißt, ist noch nirgends ganz angekommen und da, bleibt Projekt, ein Entwurf, entwickelt sich weiter und bleibt doch einsam. »Die Füchse haben Gruben, und die Vögel des Himmels haben Nester, der Sohn des Menschen hingegen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann«, sagt ein Jesuswort. Adams Sprösslinge sind unbehaust. Eine tragische Situation? Ja und Nein. Seiner Unangepasstheit verdankt der Mensch doch seine Kultur. Die Realität, immer und ewig eine Nummer zu klein, erweitert er um tausend virtuelle Welten. Anders könnten wir die Wirklichkeit |15|nicht ertragen. Neugier, Tanz und Musik, Sprach- und Liebesspiel, Erfindungsgeist, technische Kreativität, Traum und Vision: Was wären wir ohne sie? Kultur ist der ewige Versuch, in ihr zu finden, was uns als Naturwesen versagt ist, unsere Passung. Der taube Beethoven hörte seine Musik inwendig.
Die Religionen unseres Planeten gehören mit zu diesem produktiven Chaos. Sie bieten Orientierung an. Bei der abenteuerlichen Reise, bei der endlosen Suche nach Heimat in dieser befremdlichen Welt: Wir werden uns nie abfinden mit der Welt, wir werden uns nie ganz versöhnen mit uns selbst. Immer bleibt etwas von uns außen vor, ein schmerzlicher Rest. Vielleicht aber ist der Weg schon das Ziel? Darin jedenfalls besteht das Versprechen jeder Religion.
Eine Bemerkung zum Schluss, mit der Bitte um Pardon vorab! Beim Durchgang von mehreren tausend Jahren Kultur- und Religionsgeschichte werden dem Leser viele fremde, für unsere westlichen Ohren und Augen exotische Namen und Begriffe begegnen. Eigennamen wie Shi Huangdi und Tschuangtse in China beispielsweise, Siddharta in Indien, im muslimischen Ägypten Al-Hakim Bi-Amr Allah aus der Fatimiden-Dynastie, Shinran in Japan und so weiter. Und ganz ohne Fachterminologie komme ich auch nicht aus. Karma und Nirwana, gut, das haben wir schon einmal gehört, aber Dharma, Atman, Brahman, Sutra und Sunyatta, von denen die Buddhisten und Hindus sprechen, was ist denn das? Nicht einmal eine konsequente Rechtschreibung kann ich versprechen, sondern ich richte mich mal nach der englischen, mal nach der deutschen Schreibweise dieser Wörter, je nachdem, wie die Begriffe in der deutschen wissenschaftlichen Literatur auftauchen. Ärgerlich, gewiss, doch es gibt nun mal keine perfekte Umsetzung des Sanskrit oder Altindischen, des Chinesischen, Japanischen oder Arabischen in unsere westlichen Alphabete.
Ich verspreche, mein Bestes zu tun, muss aber doch gelegentlich die Augen der Leserinnen und Leser strapazieren. Die Geschichte spricht eben viele Sprachen. Und in einer Weltgesellschaft lernen wir jeden Tag ein paar Vokabeln dazu.
|16|Taoismus: Die kosmische Urkraft
Der Tao Te King, »Das Buch vom Tao und Te«, ist unter den zeitreisenden Büchern eines der kleinsten. Es umfasst gerade mal 5000 chinesische Schriftzeichen in 81 kurzen Kapiteln, so viele Worte wie ein schmales Gedichtbändchen, mehr nicht. Geschrieben hat es ein chinesischer Philosoph namens Laotse, der vermutlich im 4. Jahrhundert vor unserer Zeit lebte. Laotse, manche sagen auch Laozi oder Lao-tse, ist chinesisch und bedeutet »alter Meister«. Aus einer Entfernung also von 2500 Jahren kam sein Büchlein 1947, zwei Jahre nach Kriegsende, zum ersten Mal in meine Hände. Bis heute hat es mich begleitet. Aber nie wieder riss ich die Augen auf wie damals, als ich frisch und unvorbereitet darin blätterte und las.
Ein Manifest gegen den Krieg
»Wo Heere lagern, wachsen Disteln und Dornen, auf lange Kriege folgen Jahre der Not«, schrieb Laotse, und genau das war meine Situation. Mit Glück hatte ich den Krieg überlebt und befand mich inmitten einer unermesslichen Trümmer- und Ruinenlandschaft, die Hitler uns hinterlassen hatte. »Disteln und Dornen«, die auf den Schutthalden wuchsen, soweit die Augen reichten.
Ich las die Worte des Weisen: »Ein guter Führer kennt seine Kraft, wenn er siegt, hält er inne und lässt der Gewalt nicht freien Lauf. Er kennt seine Kraft, doch prahlt er nicht damit, nur widerwillig macht er von seiner Kraft Gebrauch, er hasst die Gewalt. Treibt man die Dinge bis ans bittere Ende, geht nichts mehr nach Tao-Art. Doch übst du am Tao Verrat, kommt bald die Wende.«
Was Tao-Art ist, wusste ich nicht, jedenfalls hatte Hitler diese nicht praktiziert. Laotses Worte klangen wie eine nachträgliche Untergangsprophetie:
»Ein böses Werkzeug sind Waffen, ein Mensch von Tao-Art benutzt sie nicht. Widerwillig nur greift er zur Waffe, Frieden, Nachdenklichkeit schätzt er am |17|meisten. Er siegt, aber freut sich nicht daran. Wer sich an Siegen berauscht, ist der Mordlust verfallen, wer aber der Mordlust verfällt, erreicht nicht sein Ziel in der Welt. Mit Trauer, unter Tränen, soll man der Abgeschlachteten gedenken, mit Trauerriten feiern den Sieg.«
Ich war mit Wehrsport groß geworden, in der Hitlerjugend. Siegesfanfaren ertönten zu Kriegsbeginn, und germanisches Heldentum predigten uns die Schulbücher. Gelobt sei, was hart macht, war unser Wahlspruch. Jetzt lernte ich bei Laotse:
»Das Feste und Harte gehört dem Tode, das Weiche und Schwache gehört dem Leben. Daraus folgt: Durch Waffenhärte gewinnst du nichts.« Und weiter: »Wie weich und schwach ist der Mensch, wenn er geboren wird, wie fest und stark, wenn er stirbt. Weich und biegsam sind Kräuter und Bäume, wenn sie entstehen – sterben sie ab, sind sie trocken und dürr. Festigkeit und Härte sind des Todes Begleiter, das Weiche und Schwache sind Begleiter des Lebens. Daraus folgt: Sind die Waffen stark, siegen sie nicht, ist ein Baum stark, wird er gefällt. Das Große geht an sich selbst zu Grunde, das Weiche und Schwache obsiegt.« Und noch einmal: »Was andere lehren, das lehre ich auch: Ein Balkenstarker nimmt kein gutes Ende! Das soll der Ausgangspunkt meiner Lehre sein!«
Noch nie hatte ich dergleichen gehört oder gelesen. Viel später erst erschloss sich mir die historische Dimension dieser Sätze. Im gleichen Zeitraum, als in China der Tao Te King entstand, schwor Ashoka, der große indische Herrscher und Buddha-Verehrer, öffentlich dem Krieg ab. In Israel predigten die Propheten gegen den Krieg, und der Grieche Sophokles legte Antigone die Worte in den Mund: »Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich geboren.«
Durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht sich der Widerstand gegen den befohlenen Mord. Und mit welcher Wirkung? Mit durchschlagendem Erfolg gewiss nicht. Hätte es aber nicht immer wieder diese Stimmen gegeben, die wie Laotse der Gewalt und dem Hass Einhalt geboten, wären die Menschen längst im eigenen Blut ertrunken.
Die Geschichte ist keine Tragödie. Durch alle Bedrohungen, Katastrophen und Gefahren begleitet uns ein Wärmestrom, der immer wieder für kurze Zeit an die Oberfläche gelangt und Trost und Erleichterung bringt, wie bei Laotse, dem Tao-Freund. Wie bei Martin Luther King, dem schwarzen Pfarrer und Bürgerrechtskämpfer, der im vorigen Jahrhundert in den USA den Schwarzamerikanern die Gleichberechtigung erstritt. Den gewaltfreien Widerstand hatte Martin Luther King von Gandhi und dessen Freiheitskampf in Indien gelernt, und Ghandi wiederum war bei Laotse in die Schule gegangen, beim großen |18|Buddha sowie bei Jesus. In den 1980er Jahren ließ sich die Friedensbewegung der Bundesrepublik mit dem Lied auf der Straße vernehmen: »Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein.« Ein Zitat aus dem Tao Te King, wo es weiter heißt:
»Nichts ist nachgiebiger und weicher als Wasser, doch gibt es nichts wie das Wasser, das Hartsein und Starksein bezwingt. Das Schwache besiegt die Stärke, das Weiche besiegt die Härte, wer in aller Welt wüsste das nicht!« Denn: »Höchste Güte ist wie Wasser: Wohltätig ist es und nützt den zehntausend Wesen, ohne mit ihnen zu streiten. An niedrigen Orten, die alle verachten, weilt es, darin der Tao-Bewegung ähnlich.«
Tao in Theorie und Praxis
Tao-Philosophie – der Begriff klingt esoterisch, vielleicht, weil man ihn nicht übersetzen kann. Wörtlich bedeutet Tao »der Weg«, und so wird es meist auch verstanden. Laotse hat den Begriff nicht erfunden. Tao ist ein chinesisches Alltagswort und bedeutet in Zusammensetzungen einfach »sagen«, etwas verlautbaren. So begegnet es uns auch in der ersten Zeile des Buches: »Das Tao, das getaot werden kann, ist nicht das beständige Tao.« Es kann nicht in Worte gefasst werden.
Laotses Büchlein trägt den Titel: »Das Buch vom Tao und Te.« Auch das Wort Te ist kaum in eine westliche Sprache übertragbar. Manchmal wird es mit dem Begriff »Tugend« wiedergegeben. Aber das klingt zu sehr nach erhobenem Zeigefinger. »Moral« bietet sich eher an, und zwar in dem Sinn, wie Sportreporter das Wort verwenden: Die Moral der Mannschaft ist gut, ungebrochen. Hier meint Moral etwas Ähnliches wie Laotses Begriff vom Te, der damit in einem weiteren Sinn die Idee von einem spontanen, natürlichen Verhalten verbindet. Te ist das zur persönlichen Energie gewordene Tao. »Tao Te King« heißt demnach streng genommen: »der rechte Weg und das rechte Tun«. Etwas freier übersetzt können wir sagen: Tao in Theorie und Praxis.
Was bedeutet das genau? Tao ist die Ordnungsmacht des Universums, des Himmels und der Erde, die universelle Regel, die nach dem Prinzip des Ausgleichs funktioniert: Tao sorgt dafür, dass alle Ereignisse und Begebenheiten der Welt sich immer wieder ausgleichen und die Waage halten. China kennt viele Gottheiten, die man anbetet und um Hilfe bittet. Zur Tao-Regel würde jedoch kein Chinese beten. Kein Gott steuert das Tao, es steuert sich selbst.
|19|Am Anfang, als Himmel und Erde sich ins Dasein brachten, gab es ein ungestörtes Gleichgewicht zwischen den Dingen. Es herrschte grenzenlose Harmonie: »So hatten in den Tagen, da die Natur noch vollkommen war, die Menschen ruhige Bewegungen und ein heiteres Aussehen. Damals führten keine Pfade über die Berge, keine Boote und Brücken über das Wasser. Alle Dinge wurden, jedes in seiner naturgegebenen Gegend, erzeugt, Vögel und Tiere mehrten sich, Bäume und Sträucher gediehen. So kam es, dass Vögel und Säugetiere sich an der Hand führen ließen und man den Baum besteigen und in das Elsternnest gucken konnte. Denn in den Tagen der vollkommenen Natur lebten die Menschen mit Vögeln und Tieren beisammen und bildeten mit allen Dingen eine große Familie. Konnten sie da etwa einen Unterschied zwischen Adel und Volk wissen? Alle waren in gleicher Weise ohne berechnendes Wesen und darum verließ sie ihre natürliche Spontaneität [Te] nicht. Und weil alle in gleicher Weise frei von Begierden waren, befanden sie sich im Zustand natürlicher Unversehrtheit«, so erzählt Tschuangtse (oder Zhuangzi, »Meister Zhuang«), ein berühmter Schüler Laotses, der zwischen 369 und 286 vor unserer Zeit lebte und zeitweise als königlicher Beamter diente. Als der König ihn zum Minister ernennen wollte, lehnte er ab. Tschuangtse zog es vor, ein unabhängiges Gelehrtendasein zu führen. Aus seinen Schriften kennen wir ihn als einen Mann von sprudelnder, heiterer Gedankenfülle, die er sich bis an sein Sterbelager bewahrte.
Dahin gilt es wieder zurückzukommen: zur »natürlichen Unversehrtheit«. Aber wie? Mit Gewalt geht gar nichts, soviel ist sicher. Blinder Aktionismus bringt auch nichts. Augen zu und durch? Nein, nimm dich zurück, rät Laotse. Geh mit Gefühl die Dinge an, mit Fingerspitzengefühl, beginne nichts, solange du nicht mit dir im Gleichgewicht bist. Das ist Handeln nach Tao-Art. Laotse hatte dafür ein besonderes Wort: Wu-wei.
Vom Wu-wei handelt eine Geschichte, die chinesische Kinder in ihren Schulbüchern lesen. Einem Bauern ging das Wachstum seiner Reissetzlinge nicht schnell genug. Er zupfte sie alle Stückchen für Stückchen in die Höhe. Erschöpft von seiner Arbeit kam er nach Hause. »Ich habe mich sehr geplagt«, erklärte er seiner Familie. »Den ganzen Tag habe ich unserem Reis beim Wachsen geholfen!« Da lief sein Sohn auf das Feld und fand alle Setzlinge verwelkt. Die Moral von der Geschichte? Wegen der Ungeduld verloren die Menschen das Paradies, schreibt Franz Kafka, und wegen der Ungeduld finden sie nicht wieder zurück.
Der dumme Bauer hatte vom Wu-wei noch nie etwas gehört. Zurückhaltung |20|und Geduld kannte er nicht. Wörtlich bedeutet Wu-wei das Nichtvorhandensein von Tun, ein Nichttun. Wenn wir uns zurücknehmen, nicht ständig und überall mitmischen, handeln wir nach der Tao-Art. Denn auch das Tao wirkt lautlos, allein durch seine universelle Gegenwart in den Dingen. »Drei Besitztümer bewahre ich, die währen. Als Erstes nenne ich die Liebesfähigkeit, als Zweites die Einfachheit, als Drittes die Bescheidenheit: liebesfähig, bin ich zu allem fähig, einfach, kann ich verschwenderisch sein, bescheiden, wird mir alles zuteil«, heißt es im Tao Te King. Laotse glaubte daran, dass die Menschheit zu ihrer »natürlichen Unversehrtheit« zurückfinden könne. Vielleicht ist das unmöglich. Aber jeder kann es versuchen und einen Anfang machen.
In unserer heutigen Welt ist das Gleichgewicht der Dinge ständig bedroht. Statt mit dem Tao und in Harmonie mit der Natur zu leben, versucht der Mensch, sie zu überlisten. Dies ist das Thema einer weiteren Geschichte von Tschuangtse:
»Tsekung reiste einmal nach Thschu und kam auf dem Rückweg nach Tschin durch Hanyin. Dort sah er einen Bauern, der seinen Gemüsegarten bearbeitete. Er ließ einen Eimer in den Brunnen hinab, zog ihn wieder herauf, ergriff ihn mit der Hand, ging umher und begoss seine Pflanzen. Das alles kostete viel Arbeit und brachte nur wenig Erfolg. ›Ich weiß von einer Maschine, die in einem Tag |21|hundert Felder bewässert, Arbeit spart und gute Ergebnisse erzielt. Möchtet Ihr nicht so eine Maschine haben?‹, sagte Tsekung. Der Gärtner sah auf und fragte: ›Wie sieht sie aus?‹ ›Es ist ein hölzernes Gerät, dessen Hebel hinten schwer und vorne leicht ist. Es zieht das Wasser auf, das dann in einen Graben strömt. Die Maschine wird Schwingbaum genannt!‹, sagte Tsekung. Das Gesicht des Gärtners veränderte plötzlich seinen Ausdruck, und er lachte: ›Ich hörte von meinem Meister, dass wer listige Geräte besitzt, auch in seinen Geschäften listig ist und, wer listig in seinen Geschäften ist, auch List im Herzen trägt. Wenn List im Herzen eines Menschen sitzt, hat er etwas verloren und wird ruhelos. Mit dieser Ruhelosigkeit des Geistes fliegt das Tao fort. Ich wusste wohl von dem Schwingbaum, würde mich aber schämen, das Ding zu benutzen!‹« Tschuangtse hatte wie sein Lehrer Laotse große Vorbehalte gegenüber der Technik. Was hätten die beiden wohl zu dem Computer gesagt, auf dem ich jetzt gerade schreibe?
|20|
Das Tao wirkt lautlos durch seine universelle Gegenwart in allen Dingen.
|21|Warum ist die Welt nur so schwierig? Eine Frage, die die Menschen seit jeher beschäftigt. Ein chinesischer Mythos erzählt, wie Kung-Kung, ein gehörntes Ungeheuer, die Welt durcheinander brachte. Er stürzte sich auf einen der Himmelspfeiler und beschädigte ihn. Im Nordwesten brach der halbe Himmel ein, dort wo sich die weibliche Seite des Erdreichs befindet. Spalten taten sich in der Erde auf, Wasserfluten schossen hervor, Drachen, Schlangen und Bestien griffen die Menschen an, ganze Wälder standen in Flammen. Die Göttin, die Schöpferin der Menschen und deren gute Mutter, war tief betrübt, dass ihren Kreaturen solches Leid widerfuhr. Sie machte sich daran, den Himmel auszubessern. Aber Himmel und Erde fanden ihr ursprüngliches Gleichgewicht nicht vollkommen wieder. Seit diesem Sündenfall neigt das Universum dazu, den Halt zu verlieren, von seinen Pfeilern abzurutschen und ins Chaos zu versinken.
Laotse erwähnt Kung-Kung nicht. Gewiss aber kannte er den Mythos. Immer wieder weist er darauf hin, dass den Menschen die Einfachheit des Taos abhanden kam. Statt sich wieder darauf zu besinnen, versuchen sie mit Tricks und Kniffen, die gestörte Natur zu überlisten. Doch die Entfremdung von der Natur wird dadurch nur noch schlimmer. Die Menschen sollten sich lieber bemühen, ihr inneres Gleichgewicht zu finden. Dann nämlich erhalten auch die Dinge ihre Balance zurück. Denn die Tao-Kraft funktioniert wie ein Regelkreis, ein sich selbst regulierendes System.
Ich will in die Tao-Philosophie nichts hineingeheimnissen. Aber mich beeindruckt, dass auch die Astrophysik sozusagen mit einem Sündenfall im Weltall |22|rechnet. Beim ersten kosmischen Lichtblitz, dem Urknall, muss ebenso viel Materie wie Antimaterie entstanden sein. Dann kam es zu einem Symmetriebruch. Die Materie überwog um ein Winziges die Antimaterie, und die Materie, aus der wir bestehen, gewann die Oberhand. Gegensätze bestimmen auch die Elementarteilchenphysik, die die Wechselwirkungen zwischen den kleinsten bisher beobachtbaren physikalischen Einheiten untersucht. Das Universum der Astrophysiker funktioniert tatsächlich auf Tao-Art, in einem wechselwirkenden Prozess seiner Bestandteile, die ihre Balance ständig neu einpendeln müssen. Man könnte geradezu von einem Harmoniebedürfnis des Kosmos sprechen, ein Gedanke, der mir auch in den Schriften von Albert Einstein begegnet.
Dass der Kosmos ein atmendes Ganzes sei, klingt für uns esoterisch. Für Chinesen ist es ein Lebensgefühl, dass kosmische Wechselwirkung alles, was in der Welt geschieht, bedingt und in Bewegung hält. Ausatmen und Einatmen, weiblich-männlich, Yin und Yang, sagt man in China, sind wie unsere beiden Hände einander zugeordnet, wie der rechten meine linke Hand.
Der Abstecher in die Welt des Makrokosmos soll den Lesern die Tao-Kraft als universales Prinzip vor Augen führen. Sie ist die kosmische Kraft schlechthin und durchwaltet den Mikrokosmos wie den Makrokosmos. Tao ist die Weltsubstanz. Ihrer Wirkkraft verdanken sich die »fünf Elemente«: Wasser, Feuer, Holz, Metall und Erde, ebenso wie die »fünf Tätigkeiten«: die Geste, das Wort, der Wille sowie die Wahrnehmung durch Augen und Ohren. Im Tao leben heißt, sich der Weite des Himmels zu öffnen und gleichzeitig im Dunkel der Erde zu wurzeln. Alles gedeiht, wenn die »Zehntausend Dinge« dies tun. Das ist die Botschaft des Tao Te King. Tao ist allgegenwärtig. Es ist das Sein, das allem Seienden innewohnt.
Ich hätte es in meiner Umschreibung der Texte gern so übersetzt. Die erste Zeile des Tao Te King würde dann lauten: »Das Sein, das begriffen werden kann, ist nicht das wahre Sein.« Diese Übersetzung wäre sogar sehr vorteilhaft. Denn »Sein« ist in den westlichen Sprachen ein Wort, das jeder versteht. Versuchen wir jedoch zu erklären, was »Sein« ist, finden wir keine Worte. Das hat Tao mit dem Sein gemeinsam, und so gesehen passt es genau in unser westliches Denken. Vom Sein sagt Hegel, der Weltphilosoph des 19. Jahrhunderts: »Das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe.« Ähnlich lesen wir bei Laotse: »Zehntausend Dinge entstehen im Sein, das Sein aber entsteht im Nichtsein.«
Allerdings, das Tao öffnet und verschließt sich, es sucht und findet seinen Weg. Tao ist kosmischer Rhythmus, Bewegung. Es sammelt und gibt frei, kommt |23|und geht weg. Diese Sichtweise ist uns fremd. Für uns bedeutet »Sein« bloßes Beharren. Außerdem ist unser Wort »Sein« ein geschlechtsloses Neutrum, Tao aber hat für mich einen spezifisch weiblichen Klang. Ich lese Tao darum als »Tao-Art« oder auch als »Tao-Bewegung«, beide Doppelbegriffe stehen im Femininum.
Mit Yin und Yang im Einklang
Ich gebe zu: Diese Erklärung ist langatmig, aber sie ist unerlässlich. Denn die Tao-Philosophie ist das einzige unter den großen philosophischen Systemen, das nicht patriarchalisch daherkommt. Nach dem Gleichgewichtsprinzip von Laotse halten Yin-Weiblichkeit und Yang-Männlichkeit einander die Waage, eine Vorstellung, die mir sehr gefällt. Ja, im Augenblick unserer Weltzeit, so sah Laotse es voraus, scheint die Tao-Bewegung das Yin deutlich zu bevorzugen. Die einseitige Sonderstellung des Yang in den patriarchalischen Gesellschaften wird sich früher oder später über das Yin ausgleichen müssen: eine Gegenbewegung. In unserer heutigen Gesellschaft sehen wir Spuren dieser Bewegung in den Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter, vom Tao Te King gleichsam vorweggenommen.
In diesen Zusammenhang gehören die folgenden Zitate: »Die Gottheit im Talgrund stirbt nicht, ein dunkles Weibchen ist sie. Ihrem geheimnisvollen Schoß entstammen Himmel und Erde. Unergründlich ist die Gottheit des Talgrunds, vereinigst du dich mit ihr, weicht alles Mühen von dir.«
Im »Talgrund« sieht Laotse ein Symbol des Weiblichen, wie auch im Wasser, dem Dunkel-Geheimnisvollen. Und wenn er von Stille, Nachgiebigkeit, dem Weichen und Schwachen spricht, ist immer das Weibliche mitgedacht.
»Sein Männliches kennen, sein Weibliches wahren, wirst du zum Talgrund werden. Zum Talgrund geworden folgst du dem Ruf der Natur, bringst dich aufs Neue zur Welt.« Oder: »Der Himmel öffnet und schließt sich, so kannst auch du zum Weibchen werden.« Welch eine Provokation inmitten einer Männergesellschaft!
Laotses Philosophie versteht sich als Abwägung der Aspekte des Yin und des Yang, des Weiblichen und des Männlichen. Das Zusammenspiel zwischen ihnen ließ das Universum entstehen. Ihre Dynamik, die veränderliche Vorherrschaft des einen oder des anderen, erklärt den Fluss der Ereignisse. »Einmal Yin, einmal Yang, das ist das Tao«, heißt es im I-Ching, dem chinesischen »Buch der |24|Wandlungen« aus dem 7. oder 6. Jahrhundert vor unserer Zeit, das ursprünglich nur aus 64 Hexagrammen bestand und den Chinesen bis in unser Jahrhundert hinein als Wahrsage- und Orakelbuch dient. Seine Passung, seinen Platz in der materiellen und geistigen Welt, findet der Weise in der inneren Ausgewogenheit. Und indem er sich dem kosmischen Rhythmus von Yin und Yang anvertraut, widersteht er zugleich dem Anpassungsdruck der herrschenden Verhältnisse.
Gegen die Herrscher, für das Volk
Während Heraklit in Griechenland zur gleichen Zeit den Krieg zum »Vater aller Dinge« erklärte, hören wir vom chinesischen Weisen: »Ein Balkenstarker nimmt kein gutes Ende! Das soll der Ausgangspunkt meiner Lehre sein.« Die »Balkenstarken« – das war die feudale Oberschicht.
Die Masse des Volkes darbte zu Laotses Zeiten. Fast 90 Prozent der Bevölkerung waren Bauern. Um ihren Herren ein glänzendes Leben zu gewährleisten, mussten sie endlos schuften. »Die Bauern pflügen im Frühjahr, jäten im Sommer das Unkraut, ernten im Herbst und lagern im Winter die Ernte ein. Sie schneiden Unterholz und Bäume als Brennmaterial und leisten Arbeitsdienst für die Regierung. Während des ganzen Jahres können sie keinen einzigen Ruhetag einlegen.« Und um ihre Abgaben an die Lehnsherren, die »Balkenstarken«, bezahlen zu können, »müssen die Bauern ihre Besitztümer zum halben Preis weggeben, und wer mittellos ist, muss sich Geld zu einem Zinssatz von 200 Prozent leihen. Schließlich müssen sie ihre Felder und Unterkünfte veräußern oder ihre Kinder und Enkel als Sklaven verkaufen, um die Schulden zurückzuzahlen«. So schilderte ein zeitgenössischer Chronist das harte Leben der chinesischen Bauern. Laotse reagierte darauf mit öffentlichem Tadel.
»Sind des Adels Höfe wohl versehen, siehst du die Felder voll Unkraut stehen. Sind auch die Scheunen leer, kommen sie in bunten Kleidern daher: Am Gürtel das prunkende Schwert, von Trank und Speise beschwert, mit Luxusgütern ohne Ende voll die beiden Hände: Das nenne ich Banditen-Allüren, solche Leute kann Tao nicht führen!« Schuld am Unglück des Volkes war die Oberschicht: »Nur darum hungert das Volk, weil die da oben zu viel Steuern fressen, nur darum hungert es. Nur davon wird ein Land unregierbar, wenn die da oben sich in alles einmischen, nur dadurch wird ein Land unregierbar.«
|25|Aus dieser Zeit stammt die folgende Erzählung: »Als Kaiser Tschou Essstäbchen aus Elfenbein verlangte, ahnte sein Minister nichts Gutes. Denn wer mit Elfenbeinstäbchen isst, dem werden irdene Schüsseln nicht mehr genügen. Er wird Schalen aus Jade verlangen. Und statt Reis und Gemüse wird er das zarte Fleisch von Leoparden-Jungen oder von Elefantenschwänzen fordern. Das raue Alltagskleid wird er verschmähen und kostbare Seide wünschen. Ein Strohdach wird ihm zu gering sein und er wird in prächtigen Gemächern wohnen. Wo soll das alles hinführen, dachte der Minister, als der Kaiser Essstäbchen aus Elfenbein verlangte. Schon fünf Jahre später war Tschou ein gefürchteter Gewaltherrscher, der seine Untertanen grausam quälte. Berge von Fleisch häuften sich auf seiner Tafel, und es floss so viel Wein, dass man damit einen Teich hätte füllen können. So kam es schließlich zu seinem sicheren Fall.« Die sozialkritischen Passagen des Tao Te King lesen sich wie ein Kommentar zu dieser Geschichte. Wo waren die Zeiten der »vollkommenen Natur« geblieben? Als die Menschen noch auf ihr inneres Gleichgewicht achteten? Als es noch keinen Unterschied zwischen Volk und Adel gab?
Das vollkommene Wesen ist weiblich und männlich zugleich. Aber die »balkenstarken« Herren vernachlässigten die weibliche Seite ihrer Natur und verursachten so ein Ungleichgewicht. Gewinnt das Yang die Oberhand, entsteht Aggressivität. Typisch dafür sind zum Beispiel das männliche Imponiergehabe, der Egoismus, die Rechthaberei, das Streben nach Macht, Ruhm und Ehre, der Herrscherwille. Ohne das Yin kann und darf das Yang nicht bestehen, da die männliche Seite die Welt im Alleingang ins Unglück stürzt und selbst untergeht. Denn: »Wer auf den Zehen steht, hält sich nicht. Wer mit gespreizten Beinen geht, eilt sich nicht; wer sich selbst ansieht, leuchtet nicht, wer sich recht gibt, den liebt man nicht, wer sich rühmt, den ehrt man nicht, wer sich zur Schau stellt, wird niedergemacht. Im Blick aufs Tao gilt: Schlemmen, dicke Spesen, verachten die anderen Wesen, wer auf solchen Dingen beharrt, ist fern von Tao-Art.«
Die große Krise kommt, warnte Laotse. Sie kam schleichend, fast unmerklich: »Die Tao-Art ging verloren, so kamen Moral und Ordnung auf, Berechnung und Schlauheit stellten sich ein, so entstanden die großen Lügen, die Blutsverwandtschaft löste sich auf, seitdem fordert man Kindesehrerbietung, der Staat versinkt in Anarchie, und man verlangt von Untertanen Ehrlichkeit.« Die Oberschicht störte das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, indem sie dem rein Männlichen folgte und dem Volk Anarchie, Gewalt, Ausbeutung und Armut bescherte. Deshalb hat sie den Anspruch auf die Herrschaft verwirkt: |26|»Würden Adel und Fürsten nach Tao-Art leben, räumte man freiwillig ihnen die Herrschaft ein. Himmel und Erde vereinigten sich, süßen Regen herabzusenden, und zwanglos kehrten die Menschen zur Eintracht zurück.« Ich sehe in unserer heutigen demokratischen Ordnung auch die Erfüllung von Laotses fernem Traum. Sie ist schließlich die einzige Regierungsform, die mit möglichst wenig Gewalt auskommt, weil wir den Gewählten freiwillig die Regierung anvertrauen. Das Gegenteil, die »große Lüge« der Hitlerzeit, habe ich noch deutlich vor Augen. Gerade deshalb weiß ich die Demokratie so sehr zu schätzen.
Konfuzius begegnet dem Drachen