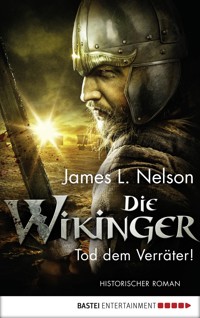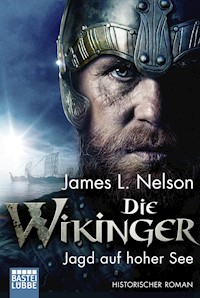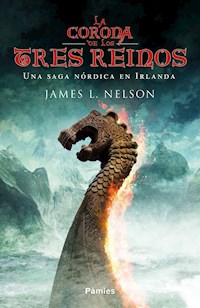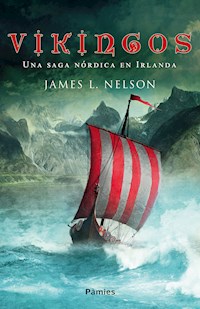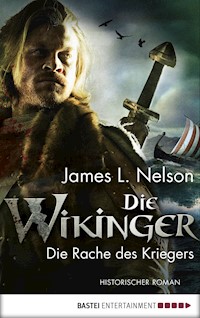9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn der eigene Sohn zur Geisel wird ...
Irland, im 9. Jahrhundert. Ohne Segel und Ruder sind Thorgrim und seine Wikinger mit ihren Langbooten an der südirischen Küste gestrandet. Um ihre Schiffe wieder flottmachen und heimkehren zu können, sind sie auf die Hilfe der Iren angewiesen. Die aber wissen die missliche Lage der Wikinger auszunutzen: Während Thorgrim genötigt wird, die Abtei von Ferns bei der Verteidigung zu unterstützen, ist sein Sohn Harald Starkarm in die Geiselhaft des Gegners geraten und wird von ihm zum Angriff auf die Mönche gezwungen ...
Siebter, unabhängig zu lesender Band der Wikinger-Reihe um Thorgrim Nachtwolf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Hinweis
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Epilog
Historisches Nachwort
Glossar
Über das Buch
Wenn der eigene Sohn zur Geisel wird ... Irland, im 9. Jahrhundert. Ohne Segel und Ruder sind Thorgrim und seine Wikinger mit ihren Langbooten an der südirischen Küste gestrandet. Um ihre Schiffe wieder flottmachen und heimkehren zu können, sind sie auf die Hilfe der Iren angewiesen. Die aber wissen die missliche Lage der Wikinger auszunutzen: Während Thorgrim genötigt wird, die Abtei von Ferns bei der Verteidigung zu unterstützen, ist sein Sohn Harald Starkarm in die Geiselhaft des Gegners geraten und wird von ihm zum Angriff auf die Mönche gezwungen ... Siebter, unabhängig zu lesender Band der Wikinger-Reihe um Thorgrim Nachtwolf
Über den Autor
James L. Nelson stammt aus Lewiston, Maine. Nach seinem Universitätsabschluss in Film- und Fernsehproduktion folgte er Herman Melvilles Rat, segelnd die Meere zu entdecken. Sechs Jahre lang lebte und arbeitete er so an Bord traditioneller Segelschiffe. Dann entschied er, fortan über das Segeln zu schreiben, statt es selbst zu betreiben. Seither hat er zahlreiche Sachbücher und Romane über Seefahrer und Seefahrtsgeschichte verfasst, wofür er unter anderem mit dem William Young Boyd Award der American Libary Association und dem Naval Order’s Samuel Eliot Morison Award ausgezeichnet wurde. Nelson liest in ganz Amerika aus seinen Büchern und ist gefragter Gesprächspartner im Discovery Channel, im History Channel und im BookTV. Heute lebt er mit seiner Frau Lisa und vier gemeinsamen Kindern in Harpswell, Maine.
James L. Nelson
DIE WIKINGER
Der Schatz der Mönche
HISTORISCHER ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Rainer Schumacher
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2017 by James L. NelsonTitel der amerikanischen Originalausgabe: »Loch Garman«Originalverlag: Fore Topsail Press
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Frank Weinreich, BochumUmschlagmotive: © Arndt Drechsler, LeipzigUmschlaggestaltung: Thomas KrämerE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-8631-8
www.luebbe.dewww.lesejury.de
Der vorliegende Roman ist frei erfunden. Namen, Figuren, Orte und Ereignisse sind entweder vom Autor ausgedacht oder werden ausschließlich fiktional verwendet. Jede Übereinstimmung mit tatsächlichen Geschehnissen, Schauplätzen, Organisationen oder Personen, lebend oder bereits verstorben, ist rein zufällig und weder vom Autor noch vom Verlag beabsichtigt.
Für Patrick Lockard, Ire und Ehrenwikinger. Willkommen im Clan. Du bist selbst schuld.
Prolog
Die Saga von Thorgrim Ulfsson
Einst lebte ein Mann mit Namen Thorgrim Ulfsson, der auch als Thorgrim Nachtwolf bekannt war, denn manche hielten ihn für einen Gestaltwandler, der des Nachts bisweilen Wolfsgestalt annahm. Thorgrim lebte an einem Ort mit Namen Vik im Lande Norwegen, das später unter Harald Schönhaar vereint werden sollte.
Sein Vater war Ulf Ospaksson, und Thorgrim wuchs auf einem Bauernhof auf. Er war ein guter Bauer. Doch auch wenn er hart auf dem Land seines Vaters arbeitete, war seine Liebe zum Schiffsbau weit größer als die zum Ackerbau. So nutzte er jede Gelegenheit, den Schiffsbauern in seinem Dorf zu helfen, und derer gab es viele. Dabei lernte Thorgrim viel über den Umgang mit Axt, Deichsel und Bohrer. Er lernte, Eiche und Kiefer zu formen und Taue zu knüpfen und zu spleißen. All das eignete er sich schon in frühen Jahren zusammen mit dem Gebrauch von Waffen an. Letzteres erwartete man von allen Jünglingen.
Als Thorgrim zu einem jungen Mann herangereift war, wurde er Hirdman eines Jarls mit Namen Ornolf, der auch als Ornolf der Rastlose bekannt war. Thorgrim begleitete Ornolf auf vielen Plünderfahrten, und schon bald wurde er vom Hirdman zum zweiten Mann hinter dem Jarl erhoben, was große Verantwortung mit sich brachte. Dieses Arrangement gab Ornolf mehr Zeit zum Essen und Trinken sowie für Frauen, die er allem anderen vorzog. In dieser Zeit erwies sich Thorgrims Können als Schiffsbauer immer wieder als genauso wertvoll wie seine Fertigkeiten mit Schwert und Schild.
Nach einigen Jahren war Thorgrim in Ornolfs Diensten reich geworden. Er kaufte sich einen eigenen Hof, und mit Ornolfs Segen heiratete er eine von dessen Töchtern, eine liebreizende Frau mit Namen Hallbera. Sie führten eine gute Ehe und lebten in Wohlstand, und Hallbera schenkte Thorgrim drei Kinder: einen Sohn mit Namen Odd, einen weiteren mit Namen Harald und eine Tochter mit Namen Hild. Alle drei waren gesund und stark und bereiteten Thorgrim große Freude.
Dann, als Hallbera schon älter war, wurde sie wieder schwanger, doch sie starb im Kindbett, und Thorgrim wurde von großer Trauer übermannt. Zu dieser Zeit waren Odd und Hild bereits verheiratet, und Harald und das Neugeborene, das Thorgrim nach seiner Mutter Hallbera nannte, waren die einzigen Kinder, die noch daheim lebten. Getreu seinem Namen war Ornolf der Rastlose begierig darauf, wieder auf Wiking zu fahren, und obwohl Thorgrim seinen Hof nicht mehr hatte verlassen wollen, erklärte er sich nach dem Tod seiner Frau bereit, ihn zu begleiten. Sein Sohn Harald wollte ebenfalls gehen. Der Junge war erst fünfzehn Jahre alt, aber breit und stark und ausgesprochen geschickt im Umgang mit Waffen, denn er übte damit, wann immer er konnte, und Thorgrim erlaubte ihm, sie zu begleiten.
Ornolf versammelte eine Mannschaft für sein Schiff Roter Drache, und sie segelten zum Land der Pikten und von dort über das Meer nach Irland. Das war im Jahr 852 nach dem christlichen Kalender, als Olaf der Weiße die Dänen aus Dubh-Linn vertrieb. In Irland erwarteten sie viele Abenteuer, sowohl unter den Iren als auch mit den anderen Nordmännern, die zu jener Zeit in großer Zahl nach Irland segelten. Obwohl sie anfangs nur einen Sommer lang hatten plündern wollen, blieben sie mehrere Jahre auf der Insel. In dieser Zeit wurde Ornolf der Rastlose getötet, und Thorgrim Nachtwolf wurde zum Anführer der Männer und kurz darauf Herr eines Longphorts mit Namen Vík-ló.
Einer der Krieger Thorgrims war ein Mann mit Namen Starri, der als Starri der Unsterbliche bekannt war. Nun war Starri ein Berserker, ein Auserwählter der Götter, der Wildeste in der Schlacht, und er verstand Dinge, die andere nicht verstehen konnten. Starri war sicher, dass Thorgrim ebenfalls von den Göttern auserwählt worden war und dass die ihm erst gestatten würden, Irland zu verlassen, wenn sie die Lust dazu verspürten. Thorgrim glaubte diese Worte zunächst nicht, doch jedes Mal, wenn er versuchte, die Insel hinter sich zu lassen, wurde er wieder zurückgeworfen, und so dauerte es nicht lange, da betrachtete er Starris Worte als wahr.
Im Frühling ihres dritten Jahres in Irland beschloss Thorgrim, von Vík-ló fortzusegeln, um an der irischen Küste auf Plünderfahrt zu gehen. Dort stieß er auf einen friesischen Kaufmann mit Namen Brunhard, einen ebenfalls sehr guten Seemann. Eine Zeitlang verfolgte Thorgrim den Friesen in der Hoffnung, ihn zu stellen und seine Schiffe zu plündern, doch Brunhard entwischte ihm immer wieder, was Thorgrim äußerst wütend machte. Schließlich gelang es ihm dann doch, Brunhard in die Falle zu locken, aber just in diesem Augenblick kam ein großer Sturm auf, der Thorgrims und Brunhards Schiffe an die Küste trieb, wo sie schwer beschädigt wurden. Einige wurden sogar zerschmettert.
Wieder einmal hatten die Götter Thorgrim und seine Männer an die irische Küste zurückgeworfen und sie blutend am Strand zurückgelassen. Und wieder einmal schwor Thorgrim Nachtwolf sich, er würde immer weitermachen, so lange, bis die Götter ihm endlich gestatteten, nach Hause zurückzukehren.
Und davon erzählt diese Geschichte …
Kapitel 1
Warum trauert ihr um ihn, meine Freunde?
Sein Tod war gut für einen Sterblichen,
wie eine Wolke, die zu den Heiligen im Himmel emporsteigt.
DIE ANNALEN VON ULSTER
Zwei Wälle umschlossen das Kloster von Ferns. Der innere bestand aus Stein. Er wurde Vallum genannt und diente nicht der Verteidigung, jedenfalls nicht vor irdischen Angriffen. Er war nicht höher als drei Fuß, und er umschloss die heiligsten Gebäude des Klosters – die Kirche und das Skriptorium –, wie auch einige, die zwar nicht ganz so heilig, aber trotzdem wichtig waren: die Zellen der Mönche, das Haus des Abts und das große Gebäude, in dem die Nonnen arbeiteten und wohnten.
Der zweite Wall befand sich über hundert Meter vom Vallum entfernt und war deutlich beeindruckender; ein zehn Fuß hoher Erdwall, gekrönt von einer Palisade. Zwischen dem Vallum und dem äußeren Wall lagen Felder, auf denen ein Großteil der Nahrung wuchs, mit der das Kloster versorgt wurde. Dazu kamen die Flechthütten der Laienbrüder, die die profanen Arbeiten für die Priester, Mönche und Nonnen übernahmen. Da gab es einen Brauer, einen Schmied und gleich mehrere Zimmerleute. Auch Ställe und eine Molkerei fanden sich hier.
Wie so viele andere Klöster in Irland auch war Ferns inzwischen weit mehr als nur ein heiliger Ort. Es war wie eine Eiche, die immer größer wird und schließlich allen möglichen Vögeln, Eichhörnchen und Insekten eine Heimat bietet. Und wie bei einer Eiche, so kam auch bei solch einem Kloster irgendwann einmal jemand mit einer Axt.
Tatsächlich waren die heidnischen Nordmänner schon mehrmals gekommen. Sie hatten geplündert, gebrandschatzt und versklavt. Doch das war nun schon länger nicht mehr passiert, und Abt Columb, der dem Kloster schon seit Jahren vorstand und noch viel länger dort lebte, gestattete sich die Hoffnung, dass Gott sie fürderhin vor diesem Übel bewahren würde.
Und vielleicht tat er das auch, doch die Nordmänner stellten nicht die einzige Gefahr für das Kloster dar. Jetzt waren wieder Männer mit Äxten eingetroffen, und sie hatten auch Schwerter, Speere und Schilde mitgebracht.
Abt Columb seufzte.
Da er auf einem Pferd saß – was zum Glück nur äußerst selten vorkam –, konnte er über das schwere Eichentor hinwegsehen, das den östlichen Ausgang des äußeren Walls versperrte. Durch die Tropfen, die von seiner Kapuze fielen, schaute er zu dem dichten Wald, der im starken Regen als dunkelbraune Masse dalag.
»Herr im Himmel«, murmelte er vor sich hin, »wenn du mir in deiner Gnade erlaubst, mir in diesem Regen den Tod zu holen, dann wäre das ein wahrlich großer Segen für mich.« Doch er glaubte nicht, dass Gott ihm seinen Wunsch einfach so gewähren würde. Er wandelte nun schon mehr als sechs Jahrzehnte auf dieser Welt, hatte Krankheiten und Verletzungen überstanden und gleich mehrere Plünderungen durch die Nordmänner. Da glaubte Columb nicht, dass ausgerechnet Regen ihm den Tod bringen würde, so kalt und stark er auch sein mochte.
Abt Columb nickte den verängstigt dreinblickenden Männern am Tor zu. Die erwiderten das Nicken, und einer von ihnen bekreuzigte sich sogar. Dann zogen sie mit aller Kraft, und das schwere Tor schwang auf.
Der Schlamm, auf dem das Pferd des Abtes stand, schien förmlich aus dem Tor zu fließen und in eine Straße überzugehen. Das war die Hauptstraße, die von Ferns zum Meer im Osten und über mehrere Abzweigungen nach Glendalough im Norden und Dumamase im Nordwesten führte. Was jenseits davon lag, kümmerte Abt Columb nicht.
An klaren Tagen konnte der Abt von dort, wo er jetzt saß, meilenweit über die grünen Hügel von Laigin sehen; doch an diesem speziellen Morgen hatte der Himmel sich verdunkelt. Die Hügel waren im Nebel verborgen, und hundert Bewaffnete hatten sich zu einer Schlachtreihe auf der Straße formiert. Abt Columb seufzte und trat seinem Pferd in die Flanken. Langsam trottete das Tier los. Hinter sich hörte der Abt, wie das Tor sich wieder schloss.
Für Kämpfer sahen die Männer nicht sonderlich Furcht einflößend aus, fand Columb. Jene auf den Flanken waren voll ausgerüstete Krieger, ohne Zweifel die Fürstenwache. Sie waren gut ausgebildet und ihrem Herrn treu ergeben. Doch die Männer im Zentrum wirkten nicht so kampflustig. Sie lehnten auf ihren Speeren und ließen die Schilde an den Seiten baumeln. Einige wenige hielten sie sich aber auch zum Schutz vor dem Regen über den Kopf, und Männer, deren größte Sorge es war, nicht nass zu werden, bereiteten sich nicht auf eine Schlacht vor.
Ein Dutzend Fuß vor der Schlachtreihe saß ein Mann auf einem Pferd und wartete. Das Pferd, ein Hengst, schwarz und mit langer Mähne, war wesentlich beeindruckender als der alte Gaul, auf dem der Abt ritt. Der Mann auf dem Hengst trug ein Kettenhemd und einen Helm, und er wurde von vier Leibwächtern flankiert. Auch er war beeindruckender als der Abt. Das war Airtre mac Domhnall, der Rí Túaithe des Landes östlich von Ferns; in den Augen des Abts ein Arschloch.
Abt Columb zügelte sein Pferd gut fünfzehn Fuß von Airtre mac Domhnall und seinen Männern entfernt. »So, Airtre, was führt dich zu meiner Tür?«, rief er. Seine Stimme war nicht mehr so kräftig wie früher, und das ärgerte ihn.
»Du weißt, warum ich hier bin, Abt«, erwiderte Airtre.
Columb schüttelte den Kopf. Natürlich wusste er, warum Airtre mit seinen Kriegern hier war, aber er wollte es trotzdem hören.
»Ich habe nicht die geringste Ahnung, was dich an so einem Tag hierherführt«, sagte der Abt deshalb.
»Du bist der Hüter des Schatzes von Sankt Aiden«, erklärte Airtre und hob die Hand, um einem Widerspruch des Abts zuvorzukommen. »Leugne nicht. Das wäre nur Luftverschwendung. Ich weiß, dass es den Schatz gibt. Das haben mir Männer erzählt, denen ich vertraue. Ein Teil des Schatzes gehört mir als Rí Túaithe, und jetzt bin ich hier, um diesen Teil einzufordern.«
Abt Columb seufzte.
»Du bist nicht der Rí Túaithe dieses Landes, und selbst wenn du das wärest, hättest du über die heilige Mutter Kirche keinerlei Autorität«, erwiderte der Abt. Airtre mac Domhnall wusste das natürlich ganz genau. Er wollte auch keine Steuern eintreiben. Er wollte das Kloster plündern und suchte nur nach einer Rechtfertigung dafür.
»Darüber lässt sich streiten«, entgegnete Airtre, wischte sich den Regen aus dem Gesicht und strich mit den behandschuhten Fingern über seinen Bart.
»Tuathal mac Máele-Brigte ist der Rí Ruirech, der Hochkönig«, sagte der Abt. »Wenn du das Gefühl hast, Anspruch auf einen Teil eines nicht existierenden Schatzes zu haben, dann solltest du das mit ihm besprechen.«
Airtre lächelte. »Tuathal ist weit weg von hier, und er hat alle Hände voll damit zu tun, seine Familie davon abzuhalten, ihm den Hals durchzuschneiden … und ich glaube nicht, dass ihm das gelingen wird.«
Das stimmte, und Columb wusste das. Am Hof des Hochkönigs tobte ein Machtkampf. Es ging um die Herrschaft über Laigin. Solche Machtkämpfe waren nichts Ungewöhnliches, und Airtre profitierte nur allzu gerne von dem Chaos.
»Schau mal«, fuhr Airtre fort, und Columb hörte deutlich, dass der Mann allmählich die Geduld verlor. »Ich bin das Gequatsche leid. Bitte, öffne jetzt das Tor, und lass meine Männer rein. Ich will dem Kloster nichts tun. Ich will nur, was mir zusteht.«
»Du bist wahrlich ein Mann Gottes«, erwiderte Columb in leidenschaftslosem Tonfall und ohne auch nur einen Hauch von Spott. »Ich kann nichts tun. Selbst wenn ich das Tor nicht öffne, würden unsere armseligen Erdwälle dich nicht lange aufhalten. Gestatte mir nur, die Nonnen vorzuwarnen, damit sie sich in ihr Haus zurückziehen können. Dann werde ich dir das Tor öffnen.«
»Meinetwegen, Abt«, knurrte Airtre. In seiner Stimme lagen sowohl Triumph als auch Misstrauen. »Einer meiner Krieger, Ailill, wird dich begleiten, wenn du nichts dagegen hast.«
Abt Columb zuckte mit den Schultern. Das war ihm egal. Der Mann links von Airtre ritt nach vorn. Der Abt wendete sein Pferd, und Seite an Seite ritten der Geistliche und der Krieger zum Klostertor, das für sie aufschwang.
Der Schatz von Sankt Aiden …, sinnierte Columb, während er durch den dichten Regen ritt. Die uralte Geschichte plagte ihn schon seit Jahren. Tatsächlich hatten bereits alle Äbte vor ihm unter der Legende gelitten. Natürlich glaubte niemand, dass der heilige Aiden, der das Kloster vor fast dreihundert Jahren gegründet hatte, persönlich den Schatz angehäuft hatte. Das war schlicht ein Name, dem man diesem angeblichen Gold- und Silberschatz gegeben hatte, der sich irgendwo innerhalb der Mauern verbergen sollte und der so gut versteckt sein sollte, dass ihn die Nordmänner stets übersehen hatten, wann immer sie über das Kloster hergefallen waren.
Weder Columb noch sonst irgendjemand wusste, wo diese Legende ihren Ursprung hatte. Ferns war zwar wirklich ein reiches Kloster, doch nur der Abt und ein paar wenige wussten, warum das so war; und mit einem Schatz hatte das nichts zu tun.
Wenigstens ist er nicht in die Hügel raufmarschiert, dachte Columb. Dass Männer wie Airtre oder die Heiden stets direkt im Kloster nach Reichtümern suchten und gar nicht erst auf die Idee kamen, in die Hügel im Norden zu ziehen, war einer der wenigen Vorteile der Legende vom Schatz. Fast war diese Tatsache sogar den Ärger wert, den Leute wie Airtre verursachten.
Der Abt schaute zu dem Mann mit Namen Ailill, der neben ihm ritt. Sie lenkten ihre Pferde durchs Tor. Columb zog an den Zügeln, und das Tier bog nach rechts ab. Ailill folgte ihm.
Der Mann blickte überheblich drein. Das war ja so typisch für diese jungen Krieger, dachte Columb. Hinter dem Tor standen Dutzende Bewaffnete und Berittene, die Männer des Abts, die er bis jetzt vor den Augen des Feindes verborgen hatte. Columb versuchte noch nicht einmal, seine Befriedigung zu verbergen, als er sah, wie der Hochmut von Ailills Gesicht verschwand und erst Überraschung, dann Panik wich.
Ailill schnappte hörbar nach Luft, doch bevor er sich auch nur räuspern konnte, hatten vier Männer ihn gepackt und zogen ihn aus dem Sattel und in den Schlamm. Drei Männer fixierten ihn mit Füßen und Beinen, und der vierte drückte Ailills Gesicht in den nassen Schlamm, damit er nicht schreien konnte.
Über dem jungen Krieger stand Bruder Bécc mac Carthach mit gezogenem Schwert. Bruder Bécc trug einen gepolsterten Waffenrock und darüber ein Kettenhemd. So gut wie nichts an ihm deutete darauf hin, dass es sich bei ihm um einen Mönch handelte, außer dem großen, schlichten Holzkreuz, das an einem Lederband um seinen Hals baumelte.
Bécc schaute zu Columb hinauf. Das lange dunkle Haar klebte ihm am Kopf. Nur ein Auge, das linke, war in einem halb zerstörten Gesicht zu sehen. Das andere Auge hatte Bécc zusammen mit dem Fleisch auf seiner rechten Gesichtshälfte durch das Schwert eines Nordmanns verloren, in einem Kampf, lange bevor Bécc Zuflucht im Schoß von Mutter Kirche gesucht hatte.
Allein dass der Mann durch den Hieb nicht gestorben war, war schon unglaublich. Narbengewebe bedeckte seine gesamte rechte Seite, und Bécc hatte Gott für sein Leben gedankt und geschworen, sich fortan dem Dienst am Herrn zu widmen. Doch er diente Gott nicht nur im Gebet, sondern auch mit seinen ganz speziellen Fähigkeiten.
Nun blickte er wie immer zu Columb und wartete auf Befehle. Columb schüttelte den Kopf. Sagen musste er nichts, und so wusste Ailill noch nicht einmal, dass der Abt ihm gerade das Leben geschenkt hatte. Bécc winkte einem seiner Männer, der sofort zu ihm trat und Airtres sich windenden Krieger fesselte und knebelte.
Columb wandte sich von Ailill ab, der noch immer im Schlamm lag, und schaute zu einem weiteren Berittenen. Auch dieser Mann trug ein Kettenhemd sowie einen Helm auf dem Kopf und hatte das Schwert gezogen. Er beobachtete das Ganze aus einer Entfernung von gut einem Dutzend Fuß. Der Mann erwiderte Columbs Blick. Der Abt nickte abermals, und genau wie Bécc, so wusste auch dieser Mann sofort, was der Abt von ihm verlangte.
Der Berittene, ein Mann mit Namen Faílbe mac Dúnlaing, hob sein Schwert und rief: »Vorwärts! Vorwärts!« Dann trat er seinem Pferd in die Flanken, und das Tier sprang voran. Seine Männer folgten ihm und galoppierten an Abt Columb und seinem müden Gaul vorbei, gefolgt von vierzig Mann zu Fuß, alle mit Speeren und Äxten bewaffnet, und viele trugen auch Lederpanzer und Schilde. Faílbe war der Rí Túaithe des Landes westlich von Ferns, ein Freund des Klosters, wohlhabender als Airtre und bald auch noch reicher, sobald Columb ihn für die Vertreibung von Airtre bezahlen würde.
Als die Männer, die sich zur Verteidigung von Ferns versammelt hatten, aus dem Tor stürmten, schwang sich auch Bruder Bécc aufs Pferd und führte die zwanzig Krieger des Klosters hinterher, um sich an der Seite Faílbes in den Kampf zu stürzen. Columb gebot vielleicht nicht über den Schatz von Sankt Aiden, aber er war auch nicht arm.
Als die letzten Krieger an ihm vorbeiliefen, wendete Columb sein Pferd und ritt ein paar Schritte bis zu einer Stelle, von wo aus er durch das noch immer offene Tor aufs Schlachtfeld sehen konnte … das heißt, falls man das, was dort geschah, denn als »Schlacht« bezeichnen wollte.
Dass berittene Krieger aus dem Klostertor strömten, schien Airtre und seine Männer vollkommen zu überraschen. Für gewöhnlich stritten Iren nicht zu Pferd. Sie nutzten die Tiere eigentlich nur, um auf das Schlachtfeld zu gelangen. Dann stiegen sie ab und kämpften zu Fuß. Doch Columb und Faílbe waren gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass der Anblick heranstürmender Pferde vermutlich schon ausreichen würde, um Airtres Männer in die Flucht zu schlagen.
Und sie sollten recht behalten. Dank des Regens, der Entfernung und des Gedränges konnte Columb zwar nicht viel erkennen, aber er sah, dass Airtres Männer panisch nach den Schilden griffen, die Waffen hoben und sich auf den Aufprall der Reiter vorbereiteten.
Airtre und seine Leibwache ließen sich von dieser Überraschung allerdings nicht so leicht einschüchtern. Sie setzten sich sofort in Bewegung und ritten der Bedrohung mit erhobenen Schwertern und eingelegten Speeren entgegen. Doch Faílbes Männer ignorierten sie einfach und griffen stattdessen die Leichtbewaffneten in der Schlachtreihe an.
Und es funktionierte genau so, wie Abt Columb gehofft hatte. Die Reiter waren noch gut fünfzig Fuß von den Kriegern entfernt, als die ersten von Airtres unglücklichen Bauernkriegern die Waffen wegwarfen und rannten. Beinahe sofort folgten ihnen die anderen. Als die Reiter schließlich die Stelle erreichten, wo die Schlachtreihe gewesen war, hatte sie sich bereits in Luft aufgelöst.
Doch trotz des schändlichen Rückzugs der meisten waren einige noch immer zum Kampf bereit. Airtre und seine Krieger waren schlicht viel zu stolz, um einfach so wegzulaufen, ohne vorher Widerstand geleistet zu haben, und so trieben sie ihre Pferde gegen die Angreifer. Sie stürmten mitten in Faílbes Reiter hinein, tauschten Schwerthiebe aus, stießen mit den Speeren zu und drehten sich mit ihren Tieren wie in einem seltsamen Tanz. Das Klirren von Stahl auf Stahl, untermalt vom Kriegsgeschrei der Männer, hallte durch den Regen.
Columb schaute interessiert zu. Die einzige Frage war, wie lange Airtre und seine Leibgarde das durchhalten würden, bevor auch sie die Flucht ergriffen, denn schließlich hatten ihn die meisten seiner Männer bereits im Stich gelassen. Dann, plötzlich, löste sich der erste von Airtres Kriegern aus dem Kampf, dann noch einer und noch einer. Sie rissen ihre Pferde herum und galoppierten über die verschlammte Straße davon. Die Fußkämpfer wiederum waren da schon fast nicht mehr zu sehen. Airtre brach den Kampf als Letzter ab, und das gerade noch rechtzeitig, bevor die Männer des Klosters ihm die Flucht abschneiden konnten.
Auch das war so geplant. Sosehr Columb Airtre, dessen Gier und Ehrgeiz auch verachtete, er wollte nicht für ein Gemetzel verantwortlich sein. Was Faílbe betraf, so hatte es ihm schon nichts ausgemacht, quer durchs Land zu reiten und sein eigenes Tuath ungeschützt zurückzulassen. Auch das Töten war ihm egal. Schließlich hatten die beiden sich jedoch darauf geeinigt, dass Faílbe die unverschämten Angreifer zwar vertreiben sollte, aber er sollte ihnen nicht hinterherjagen und sie erschlagen.
Und Faílbe hielt Wort. Seine Reiter jagten Airtre und dessen Männer nur ein kurzes Stück die Straße hinunter; dann zügelten sie ihre Pferde und schauten ihnen über die Felder hinweg hinterher. Als sie schließlich sicher sein konnten, dass die Möchtegernplünderer verschwunden waren und nicht so bald wieder zurückkehren würden, machten sie kehrt und ritten im Schritt zum Kloster zurück.
Ein paar Männer lagen allerdings doch auf dem Schlachtfeld. Sie waren verwundet oder vielleicht auch tot, und Abt Columb machte den Weg für einen Karren frei, der aus dem Tor fuhr, um sie einzusammeln. Faílbe und Bruder Bécc würdigten die Gefallenen keines Blickes, als sie an ihnen vorbeikamen. Gefolgt von ihren Männern ritten sie durchs Tor und hielten vor dem Abt an.
»Ich gratuliere dir zu diesem Sieg, den Gott dir in seiner Gnade gewährt hat«, sagte Columb. Faílbe nickte und lächelte schwach, als amüsiere ihn die Vorstellung, dass er diesen Sieg nur göttlicher Gnade zu verdanken habe. Bruder Bécc bekreuzigte sich jedoch und senkte den Kopf. Dann schaute er wieder auf.
»In der Halle warten Essen und Bier auf dich und deine Männer«, fuhr Columb fort. Das schien Faílbe zu gefallen.
Und tatsächlich gab es reichlich Bier und Essen. Das Herdfeuer in der Mitte des Raums flackerte so hoch, dass es fast drohte das Reetdach zu entzünden, und so dauerte es nicht lange, bis Faílbe und seine Männer wieder trocken und ihre körperlichen Bedürfnisse befriedigt waren. Mehr konnte Columb nicht tun. Um ihre geistigen Bedürfnisse musste er sich wohl kaum kümmern.
»Lasst uns das Glas erheben, mein Herr Abt«, sagte Faílbe.
Er und der Abt saßen am Kopf des Tisches, vor sich die Reste der Mahlzeit, und das Licht des Feuers tanzte über ihre dampfenden Kleider. Auch Bruder Bécc hatte Essen und Trinken vor sich, doch Columb vermochte ihm seine Gedanken nicht anzusehen. Das war nicht ungewöhnlich. Columb fragte sich allerdings, ob das an der stoischen Ruhe des Mönches lag oder an den schweren Verletzungen in Béccs Gesicht. Vermutlich hatte es mit beidem zu tun, schloss er.
Columb hob den Becher. Faílbe hatte bereits mehrere geleert, doch nach allem, was der Kleinkönig heute für ihn getan hatte, nahm der Abt ihm auch das nicht übel.
»Auf den Schatz von Sankt Aiden«, sagte Faílbe. Ein leichtes Lächeln erschien auf seinem Gesicht, und Columb hob den Becher noch ein wenig mehr.
»Auf den Schatz von Sankt Aiden«, erwiderte Columb. »Möge er auch weiterhin nicht existieren. Als Kindergeschichte ist er schon Ärger genug. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn es ihn wirklich gäbe.«
Die beiden Männer lächelten einander an. Und sie tranken. Bruder Bécc trank ebenfalls … und schwieg.
Dieser verdammte Schatz von Sankt Aiden, dachte Abt Columb.
»Ich danke dir, Faílbe mac Dúnlaing«, sagte Columb als Nächstes. »Ich danke dir, dass du dem Kloster zu Hilfe geeilt bist. Der Herr wird dich dafür belohnen.«
»Das will ich doch hoffen«, erwiderte Faílbe. »Ich kann alle Hilfe brauchen, die ich bekommen kann. Aber natürlich helfe ich dir auch gerne, mein Herr Abt. Wann immer ich kann. Allerdings bin ich vielleicht schon bald nicht mehr dazu in der Lage.«
»Herrscht Unruhe im Norden?«, fragte Abt Columb.
»Es herrscht Unruhe am Hof des Rí Ruirech, Tuathal mac Máele-Brigte«, antwortete Faílbe. »Einige aus seiner Familie würden ihm nur allzu gern den Hals durchschneiden, um die Herrschaft über Laigin zu erringen, und ich denke, das werden sie auch bald tun. Im Augenblick sind sie jedoch viel zu sehr mit ihren Intrigen beschäftigt, als dass wir uns hier Sorgen machen müssten. Doch wenn Tuathal getötet wird, dann könnte sein Nachfolger seinen Blick hierhin richten. Und sollte das geschehen, dann kann ich schon von Glück sagen, wenn er mich in Ruhe lässt, vom Kloster ganz zu schweigen.«
»Dann lass uns beten, dass es nicht so weit kommen wird«, sagte der Abt.
Ein plötzlicher Luftzug ließ die Kerzenflammen tanzen. Der Regen wurde lauter, und die beiden Männer hoben den Blick, als die Tür der Halle aufflog. Ein sehr nasser und sehr müder Bote stand in der Tür und schaute zwischen Columb und Faílbe hin und her, unsicher, mit wem er reden sollte. Schließlich blieb sein Blick auf dem Abt haften, und er lief auf ihn zu.
»Das verheißt nichts Gutes«, bemerkte Faílbe, während der Neuankömmling sich ihm und dem Abt näherte.
»Abt Columb?«, fragte der Mann, als er das Kopfende des Tisches erreichte und sich knapp verneigte.
»Ja, der bin ich«, antwortete Columb. »Und das hier ist Faílbe mac Dúnlaing, dem du ebenfalls die Ehre erweisen solltest.«
Der Mann schaute zu Faílbe, verneigte sich noch einmal ungeduldig und wandte sich dann wieder an den Abt. »Ich komme von Abt Donngal, aus dem Kloster von Beggerin«, sagte er.
Columb nickte. Das Kloster von Beggerin lag gut fünfzehn Meilen im Süden, direkt an der Mündung des Flusses Slaney. »Ja?«, hakte er nach.
»Der … der Abt hat mich gebeten, dir zu sagen, dass die Nordmänner gelandet sind!«, keuchte der Bote. Er war offensichtlich froh, seine Nachricht endlich überbracht zu haben. »Die Heiden! Es sind Hunderte und eine ganze Flotte von Schiffen. Und der Abt ist sicher, dass sie auf Blut aus sind!«
Columb nickte erneut. Er blieb auffällig ruhig. »Ich verstehe«, sagte er. »Und was möchte Donngal nun von mir?«
Der Bote straffte die Schultern und runzelte die Stirn. »Nun ja … Jeder, der Beggerin zu Hilfe eilt, sei Gott ein Wohlgefallen, hat der Herr Abt gesagt.«
Gott, jaja …, sinnierte Columb. »Ferns kann da leider nichts tun. Wir haben nur ein kleines Häuflein Krieger, nicht mehr als Beggerin.« Er drehte sich zu Faílbe um. »Und was sagst du? Kannst du deine Männer nach Beggerin bringen?«
»Nein«, antwortete Faílbe. »Sobald die Heiden mit Beggerin fertig sind, werden sie den Fluss hinaufkommen, und das heißt, sie werden in mein Land eindringen. Es ist meine Pflicht, mich zuerst um mein eigenes Volk zu kümmern.«
Columb drehte sich wieder zu dem jungen Mann um, der mit großen Augen vor ihm stand. »Bitte, sag deinem Abt, was du hier gehört hast, und danke ihm für die Warnung. Ich bin sicher, dass Gott Beggerin vor der Wildheit der Heiden schützen wird. Aber trockne dich zuerst, und iss und trink etwas. In solch einer Nacht werden die Heiden wohl kaum vor eure Tür ziehen.«
Kapitel 2
Viel bin ich gereist, viel habe ich gefunden,
viel haben die Götter mir geschenkt.
Wer sind die Maiden, weise Geister,
die übers Meer streifen?
SNORRI-EDDA
Nur wenige Stunden, nachdem die Nordmänner an der Mündung der Slaney angelandet waren, erreichte die Kunde davon das Kloster von Beggerin. Sie wurde von einem jungen Schafhirten überbracht, der auf der Suche nach einem verirrten Muttertier über die steilen, sandigen Hügel oberhalb des Strandes gezogen war.
Der Schafhirte hatte noch nie Nordmänner gesehen, aber von ihren Schandtaten gehört, und diese Geschichten waren mit jedem Mal schlimmer geworden. Deshalb erkannte er auch sofort, dass das Nordmänner waren, was er da sah. Iren hatten solche Schiffe nicht. Iren fuhren mit ihren Schiffen auch nicht so kühn auf den Strand, während sich ein Sturm zusammenbraute, und Iren sahen auch nicht so furchterregend aus.
Das erste Langschiff schien förmlich auf den Strand zu fliegen. Der Hirte beschloss, nicht länger dortzubleiben, und wirbelte herum und rannte los. Den Stab warf er einfach weg, und das verirrte Schaf war vergessen. Sein Ziel war das Kloster von Beggerin, gut drei Meilen vom Strand entfernt.
Der Hirte wusste nicht, wo er sonst hätte hinrennen sollen, denn das Kloster war in mehreren Meilen Umkreis der einzige bedeutende Ort. Wenn das Schiff am Strand wirklich Heiden gehörte, dann war mit Sicherheit Beggerin ihr Ziel. Der Hirte wusste jedoch nicht genug über die Nordmänner, um erklären zu können, warum sie am Strand landeten und nicht direkt nach Beggerin segelten. Schließlich lag das Kloster unmittelbar am Fluss.
Der junge Hirte hörte erst auf zu rennen, als er das Klostertor erreichte. Dort ließ man ihn rasch ein, und atemlos erzählte er seine Geschichte einem Mann nach dem anderen, bis er schließlich vor Abt Donngal stand; einem in Ehren ergrauten alten Kirchenmann, den der Hirte als weit weniger angsteinflößend empfand als die Nordmänner.
Der Hirte – panisch, jung und nicht allzu helle – hatte jedoch vergessen, die Schiffe und ihre Besatzungen zu zählen. Allerdings hatte er die Szene am Strand auf seiner Flucht immer wieder vor seinem geistigen Auge gesehen, wie einen stets wiederkehrenden Albtraum. Und jedes Mal waren es ein paar Schiffe mehr gewesen, ein paar blutrünstige Heiden mehr, die an Land gesprungen waren.
Als Abt Donngal sich den Bericht schließlich angehört und einen Reiter herbeigerufen hatte, der nach Ferns eilen sollte, da hatte der junge Hirte bereits ein Dutzend Schiffe heraufbeschworen und Hunderte von mörderischen Heiden, die vom Strand auf die Felder strömten. Das war dann auch die Kunde, die der Reiter nach Norden brachte. Während er sich auf den Weg machte, versteckten die Priester, Mönche, Nonnen und Laien von Beggerin alles von Wert: Silber- und Goldteller, Kelche und Weihrauchfässer, Kerzenhalter, die Manuskripte, an denen sie so lange gearbeitet hatten, sowie alles andere, was sie vor dem Zorn der Nordmänner schützen wollten.
Thorgrim Nachtwolf, der gerade am Strand stand, wäre sicherlich von der angeblichen Zahl der Schiffe und Krieger überrascht gewesen, die der Hirte dem Abt genannt hatte. Er zählte nämlich nur dreiundneunzig Nordmänner, die verbliebenen Mannschaften von zwei Langschiffen, und gut ein Dutzend irischer Krieger, die sich ihnen angeschlossen hatten. Dazu kamen noch knapp zwanzig weitere Iren, die als Sklaven an Bord des Friesenschiffs gewesen waren. Schließlich gab es dann noch einen Franken, den am Leben zu lassen, man Thorgrim überredet hatte.
Ursprünglich war da auch noch gut ein Dutzend Friesen gewesen, die Mannschaften der beiden Sklavenschiffe, auf denen die Iren gefahren waren. Doch die befreiten Iren hatten sie kurz nach der Landung allesamt erschlagen, und jetzt pickten Raben und Möwen an den Kadavern.
Was die Schiffe betraf, so waren es nur drei, und von diesen dreien war nur eins auf den Strand gefahren. Das war die Blutfalke, das Langschiff, das Thorgrim seinem Sohn Harald gegeben hatte. Harald hatte die Blutfalke an Thorgrims sinkendes Schiff herangeführt, die Meereshammer. Die Männer der Meereshammer waren daraufhin hinübergesprungen, und Harald hatte den Blutfalken auf den Sand gesetzt. Jetzt trieb die Meereshammer noch immer da draußen, keine fünfzig Meter entfernt, und die See drückte sie gnadenlos weiter aufs Ufer zu. Thorgrim und die anderen konnten nichts tun, außer darauf zu warten, dass die Wellen ihr Schiff schlussendlich an Land werfen und in Stücke schlagen würden.
»Da«, sagte Thorgrim und deutete zu einem Häuflein Treibgut, das einen seltsamen Tanz in der Brandung aufführte. »Das scheinen Fässer zu sein. Holt sie an Land. Und da drüben …« Er deutete nach Norden. »Da könnten noch mehr sein.«
Die Sonne ging bereits unter, und dichte Wolken bedeckten den Himmel. Der Wind, der schon den ganzen Tag über heftig von Osten wehte, hatte sogar noch an Stärke zugenommen, und jetzt war er auch noch kalt, was die vollkommen durchnässten Männer und die beiden Frauen am Strand nicht gerade erfreute.
Die Männer bei Thorgrim verteilten sich am Ufer, wateten ins Wasser und schnappten sich alles, was sie zu fassen bekamen. Thorgrim selbst schaute über die Wogen hinweg. Seine geliebte Meereshammer war in einem unglücklichen Manöver von einer Welle angehoben worden und auf das Heck des friesischen Schiffes gekracht, das sie seit Dubh-Linn verfolgt hatten. Derart ineinander verkeilt waren die beiden Schiffe vom immer stärker werdenden Wind in Richtung Ufer gedrückt worden und schließlich fünfzig Fuß vom Strand entfernt auf Grund gelaufen.
Thorgrims Sohn, Harald, trat neben ihn. »Brunhards Schiff kann man noch nicht einmal mehr als Schiff erkennen«, bemerkte er.
Thorgrim grunzte. »Stimmt«, erwiderte er. Brunhard war der Kapitän des Sklavenschiffes gewesen, auf das die Meereshammer gekracht war. Er war der Mann, der Thorgrim tagelang an der Nase herumgeführt, das Segel der Meereshammer verbrannt und das Langschiff fast zerstört hatte. Thorgrim hätte den Kerl nur allzu gern erschlagen, doch wie sich herausstellte, hatte eine Sklavin, eine Irin mit Namen Conandil, ihn dieser Freude beraubt. Das war zwar eine Enttäuschung gewesen, aber bei Weitem nicht die größte, die Thorgrim je erlitten hatte.
»Da! Der Bug könnte sich lösen!«, rief Harald. Er war ein junger Mann, und die Zerstörung, die er dort draußen sah, erregte ihn noch sehr. Tatsächlich hatte eine große Welle den noch teilweise intakten Bug von Brunhards Schiff angehoben, auf dem die Meereshammer lag, und ihn gedreht, sodass er nun auf den Strand zutrieb. Das war der einzige Teil von Brunhards Schiff, der noch als solches erkennbar war. Das Heck war zwischen dem Bug der Meereshammer und den Sandbänken vor dem Strand förmlich zermahlen worden.
»Lass uns nur hoffen, dass es der Meereshammer besser ergeht«, bemerkte Thorgrim. So geschunden sein Schiff auch sein mochte, es wirkte noch mehr oder weniger intakt, und Thorgrim hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man es wieder würde instand setzen können.
»Ja, hoffentlich«, erwiderte Harald wenig optimistisch.
»Nachtwolf, glaubst du, Njörd wird dein Schiff verschonen? Oder wird er es in Stücke reißen?« Das kam von Starri dem Unsterblichen, der auf der anderen Seite neben Vater und Sohn getreten war.
»Du weißt doch, dass ich nicht darüber reden mag, was die Götter tun könnten und was nicht«, erwiderte Thorgrim. »Damit provoziert man sie nur, und sie machen genau das Gegenteil.«
»Vielleicht solltest du dann einfach davon ausgehen, dass Njörd dein Schiff zerstören wird«, schlug Starri vor, und Thorgrim wusste nicht, ob das ein Scherz sein sollte oder nicht. Aber wie auch immer, es war sicher keine gute Idee zu versuchen, die Götter derart hinters Licht zu führen.
»Ich glaube nicht, dass Njörd so dumm ist, dass er auf diesen Trick hereinfallen würde«, sagte Thorgrim dann auch.
Am Strand wateten Thorgrims Männer und die Iren immer wieder in die Wellen und schnappten sich, was sie zu packen bekamen, und zogen es an Land: Fässer, Planken, Speere, zerbrochene Spiere, an denen noch Segel- und Taufetzen hingen, und Ruderbänke; einfach alles, was im Flachwasser zu finden war.
Sie waren noch immer damit beschäftigt, als die Sonne hinter dichten Wolken verschwand und sich ein Grauschleier über Land und Wasser legte. Dann fielen die ersten Regentropfen, und Thorgrim hatte keinen Zweifel daran, dass es noch vor Einbruch der Dunkelheit wie aus Eimern schütten würde.
Er schaute in den Himmel, dann den Strand hinauf und hinunter. Überall lagen Trümmerteile im Sand.
»Männer! Hört mir zu!«, rief er, und knapp hundert Köpfe drehten sich zu ihm um. »Schnappt euch die längeren Holzstücke und lehnt sie an die Blutfalke. Gegen die dem Land zugewandte Seite. Wir werden uns einen Unterstand bauen. Das ist zwar nicht viel, aber wenigstens etwas.«
Und er hatte recht. Viel war es nicht.
Sie hatten nicht genug Holz, um einen Unterstand über die gesamte Länge der Blutfalke zu bauen, eines Schiffs von fast zwanzig Metern. Ein paar Männer der Blutfalke hatten noch Unterstände aus den Deckplanken gebaut, und andere zwängten sich unter den Bug und das Achterdeck, sodass schlussendlich doch fast alle vor dem Regen geschützt waren. Es war eine furchtbare Nacht, aber glücklicherweise nicht allzu kalt, denn sie hatten Sommer, und die Männer und Frauen kauerten sich so zusammen, dass die Tropfen ihnen nicht direkt auf die Gesichter fielen. Außerdem waren alle vollkommen erschöpft, und so schliefen sie rasch ein.
Als sie kurz nach Sonnenaufgang aus ihren Unterschlupfen krochen, hatte der Regen noch immer nicht nachgelassen. Erneut standen sie am Ufer, mitten im Regen, doch der wusch wenigstens das Salzwasser aus ihren Haaren, von der Haut und aus den Kleidern. Das war zwar kein wirklicher Trost, aber besser als nichts.
Die Meereshammer war fast ans Ufer getrieben. Ihr Bug hatte sich ein paar Fuß oberhalb der Brandung in den Sand gegraben, und der Kiel lag auf Grund. Thorgrim watete zu dem Schiff hinaus und lugte über die Seitenwand. Das Wasser im Rumpf war auf gleicher Höhe wie das Meer, was hieß, dass die Lecks so groß waren, dass das Wasser ungehindert hinein- und wieder hinausströmte. Aber Lecks konnte man flicken. Ansonsten sah die Meereshammer ganz in Ordnung aus, und Thorgrim schöpfte neue Hoffnung, sie wieder seetüchtig machen zu können.
Allerdings wusste er, dass seine Hoffnung mehr auf Wunschdenken gründete als auf einer ehrlichen Einschätzung, doch das war ihm egal. Manchmal reichte auch ein Wunsch.
Aber was auch immer man tun musste, um das Schiff zu retten, hier war das unmöglich. Der Strand war viel zu ungeschützt. Sowohl das Wetter als auch Feinde konnten ihnen hier das Leben schwermachen, egal ob von See oder von Land. Und mehr noch: Es gab keine Bäume in der Nähe – jedenfalls nicht, soweit Thorgrim sehen konnte – und auch keine Möglichkeit, Bäume von weiter landeinwärts hierherzutransportieren. Die Meereshammer zu reparieren war keine leichte Aufgabe. Außerdem musste auch die Blutfalke repariert werden. Irgendwo mussten sie ein geschütztes Lager bauen. Eine Schiffsburg. Einen Longphort.
Thorgrim ließ seinen Blick über den Strand wandern. Dann drehte er sich zu Failend um, die nicht weit von ihm entfernt bis zu den Knöcheln im Wasser stand.
»Failend, weißt du, wo wir sind?«
Failend schaute sich um. »In Irland, denke ich.«
»Das ist schon mal ein Anfang«, seufzte Thorgrim. »Und wo in Irland?«
»Bis ich dich getroffen habe, bin ich nie weiter als zwanzig Meilen von Glendalough entfernt gewesen«, antwortete Failend. »Ich kann dir also nicht helfen. Aber ich habe ein wenig mit Conandil gesprochen, und ich glaube, dass sie viel gereist ist. Ihr Vater war Kaufmann, und gemeinsam sind sie von einem Markt zum anderen gezogen, um ihre Waren zu verkaufen.«
Thorgrim nickte. Er rief Conandil zu sich, und sie kam mit ihrem Mann, Broccáin, im Schlepptau. Sie sprach recht gut Nordisch, zwar nicht so gut wie Failend, aber gut genug.
»Conandil, weißt du, wo genau an der irischen Küste wir hier sind?«, fragte Thorgrim.
»Nein, genau nicht«, antwortete die junge Irin. Offensichtlich hatte sie schon darüber nachgedacht. »Aber ich habe da so eine Ahnung. Die Landzunge südlich von hier kommt mir vertraut vor. Wenn wir wirklich da sind, wo ich glaube, dann liegt die Mündung der Slaney nur ein kleines Stück südlich von hier. Am Nordufer des Flusses gibt es ein Kloster. Es heißt Beggerin. Mein Vater und ich waren dort einmal auf dem Markt.«
Thorgrim nickte und dachte darüber nach. »Diese Slaney … Ist das ein großer Fluss?«
»Sehr groß sogar. Reicht weit ins Land hinein.«
Genau das hatte Thorgrim hören wollen. Wenn sie tief ins Land gehen mussten, um Holz für die Reparaturen zu finden, dann war ein großer Fluss von Vorteil. Er bot ihnen Zugang zum Land, Frischwasser und Schutz vor den Unbilden der See. Es war kein Zufall, dass nordische Longphorts wie Dubh-Linn und Vík-Ló an Flussmündungen lagen.
»Du hast von einem Kloster gesprochen … Gibt es da auch Dörfer oder andere Siedlungen?«
»Nicht, dass ich mich erinnere«, antwortete Conandil. »Ich glaube, das Südufer ist so ziemlich menschenleer. Da gibt es höchstens ein paar Fischerhütten, mehr nicht.«
Das klang immer besser, und so was machte Thorgrim nervös, denn es beunruhigte ihn stets, wenn alles so lief, wie er es sich wünschte. »Nun gut«, sagte er. »Wenn es wirklich so ist, wie du sagst, wenn wir dort sind, wo du glaubst, dann klingt das nach einem guten Ort, um unsere Schiffe zu reparieren. Dann sollten wir wohl nachsehen, ob dem wirklich so ist.«
Thorgrim rief seine Schiffsführer zu sich, von denen allerdings nur Harald und Godi übriggeblieben waren, sowie Conandil und Broccáin. Starri gesellte sich ebenfalls zu ihnen, denn das tat er immer. Dass er bei solchen Beratungen eigentlich nichts zu suchen hatte, war ihm egal.
»Ich weiß nicht, warum die Götter uns wieder auf den Strand geworfen haben«, begann Thorgrim und spie beim Sprechen Regenwasser aus. »Aber wenigstens wissen wir jetzt, wie es weitergeht, jedenfalls fürs Erste. Ohne unsere Schiffe können wir gar nichts tun. Also müssen wir sie reparieren. Dann schauen wir nach, ob die Drache und die Fuchs noch immer da sind, wo Harald sie zurückgelassen hat.«
Mit List und der Hilfe der irischen Sklaven war es Brunhard gelungen, die beiden kleineren von Thorgrims Langschiffen zu kapern und deren Mannschaften zu ermorden. Harald hatte es jedoch geschafft, sie wieder zurückzuerobern, und beschlossen, sie erst einmal weiter oben an der Küste auf den Strand zu setzen, in der Hoffnung, sie später holen zu können. In Thorgrims Augen die richtige Entscheidung.
Harald, Godi und Starri nickten zustimmend. Conandil übersetzte für ihren Mann, doch beide schienen keine Meinung dazu zu haben. Aber schließlich ging sie das auch nichts an.
»Hier können wir die Schiffe nicht reparieren«, fuhr Thorgrim fort. »Am Strand ist es viel zu ungeschützt, und es gibt hier auch kein Holz. Wenn wir aber wirklich sind, wo Conandil sagt, dann gibt es ein Stück weiter südlich einen passenden Ort dafür: die Mündung eines großen Flusses.«
Wieder nickten die anderen.
»Ich werde ein paar Männer nehmen, nach Süden gehen und nach der Mündung suchen«, sagte Thorgrim. »Dann werden wir ja sehen, ob es da wirklich einen Ort gibt, an den wir die Schiffe bringen können. Und ob es das Kloster gibt, von dem Conandil glaubt, dass es hier liegt.«
»Und wenn dem so ist, überfallen wir es dann, Nachtwolf?«, verlangte Starri zu wissen. »Werden wir es plündern, bevor sie überhaupt merken, dass wir hier sind?«
»Nein«, antwortete Thorgrim. »Wenn es da ein Kloster gibt, dann werden wir dort hingehen und Frieden schließen.«
Allein die Vorstellung war Starri vollkommen fremd. »Frieden? Mit Christen?«
»Ja, Frieden. Unser Hauptproblem ist die Reparatur der Schiffe. Damit das gelingt, brauchen wir Ruhe. Wenn wir das Kloster plündern, dann wird es nicht lange dauern, bis einer dieser Zwergenkönige eine Heerschar gegen uns führt, um uns zu vertreiben. Wir haben schon viel zu viele Männer verloren. Wir können jetzt keinen Kampf gebrauchen.«
»Wie du meinst, Nachtwolf«, sagte Starri. Tatsächlich schien ihn der Plan gar nicht so sehr aufzuregen, wie Thorgrim geglaubt hatte.
»Bist du nicht enttäuscht, Starri?«, fragte Thorgrim dann auch.
»Nein, Nachtwolf«, antwortete Starri. »Denn jedes Mal, wenn du so etwas sagst, gibt es anschließend mehr Kämpfe, als selbst der wildeste Krieger sich vorstellen kann. Ich bin zufrieden.«
Thorgrim grunzte. Er wusste, wenn er darüber nachdachte, würde er vermutlich feststellen, dass Starri recht hatte. Also ließ er es einfach.
»Und in der Zwischenzeit werdet ihr beide …« Er nickte zu Harald und Godi, »… dafür sorgen, dass die Männer weiter alles Treibgut zusammenklauben, das sie finden können. Und auch Beute, wenn sie welche entdecken. Brunhards Schiff hatte eine Menge Gold und Silber geladen. Vielleicht wird davon ja was angeschwemmt.«
»Was ist mit den Iren?«, fragte Conandil. Harald hatte ihnen die Freiheit versprochen, aber sie waren deutlich in der Unterzahl. Thorgrims Männer konnten sie problemlos wieder versklaven.
»Wenn ich zurück bin, werde ich gut die Hälfte meiner Männer nach Norden schicken, um nachzusehen, ob unsere anderen beiden Langschiffe noch immer am Strand liegen«, antwortete Thorgrim. »Wenn ihr Iren noch ein wenig wartet und sie begleitet, wird das zu unserem beiderseitigen Vorteil sein. Mehr Männer und mehr Waffen für den Fall, dass ihr angegriffen werdet.«
Conandil übersetzte das für Broccáin, und der drehte sich zu Thorgrim um und nickte.
»Gut«, sagte Thorgrim und wandte sich an Godi. »Such eines der Proviantfässer heraus, brich es auf, und verteil das Essen an die Männer. Da sollte auch ein Fass Bier sein. Lass sie in Ruhe essen, und dann plündert die Wracks.«
Godi nickte. Thorgrim drehte sich zu Harald um. »Ich brauche ein wenig Silber von der Blutfalke«, sagte er.
Als sie in der Absicht, nie mehr zurückzukehren, von Vík-Ló aufgebrochen waren, hatten sie alle Reichtümer mitgenommen, die sie während ihrer Zeit in Irland angehäuft hatten, und das war eine Menge. Ein Teil davon war auf der Blutfalke, und auch die Drache hatte etwas davon an Bord gehabt, als Harald sie auf den Strand gesetzt hatte. Das Silber von der Fuchs war jedoch auf Brunhards Schiff gewesen, und das lag jetzt auf dem Meeresgrund. Die Nordmänner konnten nur darauf hoffen, dass wenigstens ein Teil davon an Land gespült wurde.
Harald schaute verwirrt drein, aber er war viel zu diszipliniert, als dass er den Befehl seines Vaters hinterfragt hätte, Starri jedoch nicht. »Silber?« Überrascht riss der Berserker die Augen auf. »Bei den Göttern, wofür brauchst du denn Silber?« Er drehte sich im Kreis und suchte den Strand ab, als gebe es da einen Markt, den er bis jetzt übersehen hatte.
»Conandil hat gesagt, sie glaube, da gebe es ein Kloster an der Flussmündung. Wenn das stimmt, dann hat man dort vermutlich vieles, was wir brauchen.«
»Ha!« Starri lachte. »Ist das wahr? Du willst Silber in ein Kloster bringen? Sollte das nicht eigentlich andersherum laufen?«
»Ich weiß«, erwiderte Thorgrim. »Aber wir haben auch so schon genug zu tun. Da müssen wir nicht noch Streit mit dem ganzen Land anfangen. Und wie kann man besser Freunde finden als mit Silber?«
Kapitel 3
Und sie tadelten ihn mit bösen Worten, dass er sie töten und der Fluch der Fin Gall auf ihn fallen würde.
DIE ANNALEN DER VIER MEISTER
Sie gingen in Richtung Süden am Strand entlang. Der Sand war ungewöhnlich fein und weich, sodass sie dicht an der Brandung entlangmarschierten, wo der Untergrund härter war und das Gehen nicht so anstrengend. Dabei regnete es immer weiter, mal mehr, mal weniger.
Sie waren zu sechst, Thorgrim Nachtwolf und die Handvoll, die er ausgewählt hatte, um ihn zu begleiten. Vali und Armod, die schon einige Zeit bei Thorgrim waren, gehörten ebenso dazu wie Gudrid und ein Mann mit Namen Onund. Letztere waren ursprünglich Teil von Grimmars Heerschar gewesen, doch inzwischen hatten sie sich als gute, zuverlässige Männer erwiesen.
Failend war die sechste. Sie war auf eine Art gekleidet, wie Thorgrim es nur selten bei ihr gesehen hatte. Sie trug Rock und Hemd, das Kleid einer Irin, und nicht Hemd und Hose der Nordmänner wie sonst. Im strömenden Regen glich sie einer Kreatur des Waldes, die ertrunken und ans Ufer gespült worden war.
Failend war dabei, weil Thorgrim ihre Gesellschaft genoss, weil sie Irin war und weil Thorgrim glaubte, eine Übersetzerin zu brauchen, der er vertrauen konnte. Harald beherrschte die Sprache zwar auch leidlich, aber nicht perfekt. Sollte es jedoch zu Verhandlungen kommen, wollte Thorgrim jemanden an der Seite haben, der auch die Feinheiten der Sprache seines Gegenübers verstand, und das hieß, er brauchte jemanden mit Irisch als Muttersprache.
»Ich sehe, wie das Land da drüben abfällt«, sagte Thorgrim und deutete den Strand hinunter. Die anderen blinzelten. Gut eine Meile entfernt schien der Strand abrupt aufzuhören, als hätte das Meer ein Stück herausgerissen und eine meilenlange Lücke zwischen diesem Teil des Ufers und dem anderen hinterlassen, das jenseits davon zu erkennen war. Das mochte durchaus eine Flussmündung sein, war vielleicht aber auch nur eine breite Bucht. Um das herauszufinden, gab es nur eine Möglichkeit: Sie mussten dort hingehen.
Failend, die neben Thorgrim ging, hob eine Ecke ihres Rocks und presste das Wasser heraus, eine sinnlose Geste, doch das schien ihr ein wenig Befriedigung zu verschaffen.
Sie hatten ausführlich über die Kleidung diskutiert und darüber, auf wen oder was sie wohl treffen würden. Sollte es da wirklich ein Kloster geben, würde Failend für sie sprechen müssen. Sie konnten die Christenpriester niemals davon überzeugen, dass Failend eine Nordfrau war. Ihr Akzent würde sie sofort verraten. Und einer bewaffneten Irin, die wie ein Nordmann gekleidet war, begegneten die Priester sicher nicht freundlich. Aber was sollte sie dann spielen? Eine Sklavin? Eine Kriegsgefangene der Heiden? Das würde zumindest ihr Mitgefühl erregen.
Also hatten sie sich für eine Irin im Kleid entschieden. Failend watete zur Meereshammer hinaus, kletterte über die Bordwand und kramte ein paar ihrer alten Kleider aus der Seekiste, die noch immer an Deck vertäut war.
Failend hatte allerdings darauf bestanden, ihr Sax tragen zu dürfen. Unbewaffnet, so argumentierte sie, würde sie keine große Hilfe sein, sollte es hart auf hart kommen. Doch das war ein schwaches Argument. Thorgrim kannte den wahren Grund für Failends Wunsch: Wie die Nordmänner liebte diese Frau einfach das Gefühl einer Waffe an ihrer Seite. Ohne fühlte sie sich nackt. Doch jetzt sollte sie eine Sklavin spielen, und Sklaven trugen keine Waffen am Gürtel; also hatte sie widerwillig zustimmen müssen, ihre Klinge zurückzulassen.
Sie erreichten den Ort, wo das Land zu enden schien, und folgten dem Strand nach Westen. Eine breite Bucht öffnete sich vor ihnen. Aufgrund des Regens konnte man nicht weit sehen, doch das andere Ufer schien gut vier Meilen entfernt zu sein.
Ob das nun einfach nur eine Bucht oder tatsächlich eine Flussmündung war, vermochte Thorgrim nicht zu sagen. Aber er sah Sandbänke im Wasser, und solche Sandbänke deuteten häufig auf Flüsse hin, und das machte ihm Mut.
»Das wird ziemlich kompliziert«, bemerkte Gudrid, und Thorgrim grunzte zustimmend. Tatsächlich war es mehr als nur kompliziert, ein Schiff durch diese Art von Flachwasser zu bringen.
»Man muss sich langsam vorantasten, Zoll für Zoll«, erwiderte Thorgrim.
Sie gingen zum Nordrand der Bucht weiter, und als das Ufer nach Westen abbog, blieben sie stehen. Vom Rand des Wassers stieg der Strand gut hundert Schritt sanft an, um dann plötzlich steil in die zwanzig Fuß hohen Sanddünen überzugehen, auf denen hohes Gras wie eine Palisade wuchs.
Die Blicke der Männer wurden jedoch von einer Reihe unidentifizierbarer dunkler Formen in der Ferne angezogen; vielleicht ein halbes Dutzend Schemen, die über den Strand verstreut waren. Sie spekulierten darüber, was das wohl sein mochte, doch erst als sie knapp fünfzig Fuß davon entfernt waren, erkannten sie es als Curragh, mit Leder bespannte, irische Boote. Gegenüber den Curragh sah Thorgrim eine Lücke zwischen den Dünen, die vielleicht natürlichen Ursprungs, unter Umständen aber auch von Menschenhand geschaffen war. Er deutete dorthin und führte die Männer und die beiden Frauen durch die Lücke und in das Land dahinter.
Die sechs ließen ihren Blick über das flache Marschland schweifen, das sich vor ihnen erstreckte. Da waren Felder, die im Sonnenschein sicher grün strahlten; doch bei diesem Wetter wirkten sie nahezu farblos, wie ein Teppich aus Tannennadeln. Bäche schlängelten sich durch die Felder, und Vogelschwärme flatterten an Stellen auf oder landeten dort, wo das Wasser sich in großen Teichen sammelte.
Doch die Nordmänner betrachteten nichts von alldem. Gut eine Meile von der Lücke zwischen den Dünen entfernt lag das Kloster.
»Offenbar hat Conandil recht gehabt«, sagte Thorgrim. Von ihrem Aussichtspunkt aus konnten sie den Erdwall erkennen, der den Ort umschloss, ohne Zweifel ein Ringwall. Aber viel mehr war nicht zu sehen, nur ein großes Steingebäude mit hohem, spitzem Dach und einem Turm an einem Ende. Das war eine christliche Kirche und eine große noch dazu.
Es gab auch noch andere Gebäude, runde Häuser mit Reetdächern, wie sie für die Iren typisch waren, und ein paar rechteckige Gebäude, die vermutlich zum Kloster gehörten. Trotz des Regens konnte man erkennen, dass aus den Gebäuden Rauch aufstieg, ein verlockender Anblick in diesem miesen Wetter.
Onund stieß einen leisen Pfiff aus. »Ich kann mir gut vorstellen, was für Schätze man dort finden kann«, sagte er.
»Nein«, erwiderte Thorgrim. »Nicht dieses Mal.«
Thorgrim ging die Düne hinunter voran und über den verschlammten Pfad; ein weit unangenehmerer Untergrund als der feste Sand am Strand. Sie liefen an Marschfeldern und Teichen vorbei, auf denen Hunderte von Enten und anderen Wasservögeln schwammen.
Erst gut hundert Fuß vor dem Tor wurden sie angesprochen. Eine Stimme rief ihnen etwas entgegen. Der Rhythmus der Worte war vertraut, doch sie selbst klangen vollkommen fremd in Thorgrims Ohren. Durch den Regen hindurch konnte er nur den behelmten Kopf eines Wachmanns auf dem Erdwall als Sprecher ausmachen.
Die Männer blieben zurück, und Failend trat vor. Sie wusste, was sie zu sagen hatte. Sie und Thorgrim hatten sich das auf dem Weg überlegt.
Failend und der Wächter riefen sich abwechselnd zu; dann drehte sie sich um und kehrte wieder zu Thorgrim zurück. »Er hat nach jemandem geschickt, der mehr zu sagen hat«, berichtete sie. Damit hatte Thorgrim gerechnet. Der Mann, der das Tor bewachte, entschied nie, wer hereingelassen wurde und wer nicht.
Kurz darauf erschienen weitere Köpfe über dem Wall, nur diesmal trugen sie keine Helme, sondern die Kapuzen der Kutten von Christenmännern. Failend ging wieder zu ihnen, hörte sich an, was sie zu sagen hatten, und kehrte zurück.
»Sie fragen: ›Woher sollen wir wissen, dass das keine List der Heiden ist?‹«
»Sag ihnen, sie können sich ruhig umschauen, über Meilen hinweg. Da ist kein Heer, das ihnen auflauert. Hier sind nur wir: fünf Männer und eine Frau. Gegen solch eine ›Streitmacht‹ werden sie sich ja wohl verteidigen können.«
Failend ging wieder zum Wall und kehrte kurz darauf zurück. »Sie sagen, ihr könnt reinkommen und mit dem Abt reden. Aber zuerst müsst ihr eure Waffen abgeben.«
Thorgrim und die Männer schauten einander an. Das war zwar keine unvernünftige Forderung, aber Nordmänner waren nicht gerne unbewaffnet.
»Sollten wir Waffen brauchen, können wir sie immer noch den armseligen Kerlen abnehmen, die sie Wachen nennen«, warf Vali ein, und die anderen nickten zustimmend.
Failend kehrte noch einmal zum Tor zurück, und einen Augenblick später öffnete sich das schwere Eichentor nach innen, gerade weit genug, dass die Männer hindurchgehen konnten. Einer nach dem anderen traten sie hinein, Thorgrim als Erster. Drinnen wurden sie von Männern in Mönchskutten und einem Dutzend Wachen mit Speeren empfangen. Thorgrim lächelte.
Ich wünschte, wir wären nur halb so furchterregend wie diese Iren uns sehen, dachte er.
Die Männer schnallten ihre Schwertgürtel ab und übergaben die Waffen zwei Priestern. Ein weiterer Priester, ein älterer Mann, dessen Gesicht halb unter einer Kapuze verborgen war, sagte etwas, und Failend übersetzte: »Er sagt, dass ihr eure Waffen später wieder zurückbekommen werdet. Jetzt sollen wir ihm erst mal folgen.«
Der Priester drehte sich um und ging davon, und Thorgrim, Failend und die anderen folgten ihm. Thorgrim ließ seinen Blick über die Gebäude schweifen, den Erdwall, die Felder und die Hütten. Er war auch früher schon in Klöstern gewesen, doch noch nie bei Tageslicht, und er hatte auch nie Zeit gehabt, sich gründlich umzuschauen. Bis jetzt hatten seine Besuche immer drängendere Probleme aufgeworfen.
Sie gingen durch eine Öffnung in einer niedrigen Steinmauer, die mehrere Morgen voller Gebäude umschloss, in deren Mitte die große Steinkirche stand, die sie schon von den Dünen aus gesehen hatten.
»Warum haben die eine Mauer innerhalb des Walls?«, fragte Thorgrim Failend. »Wenn ein Feind den Wall überwindet, hält das kleine Ding ihn auch nicht mehr auf.«
»Das hat nichts mit Verteidigung zu tun«, erklärte Failend. »Das nennt man ein Vallum. Es markiert den heiligen Bereich um die Kirche. Außerhalb dieser Mauer liegen die Felder und Gebäude der Menschen, die nicht zur Kirche gehören, also Bauern, Schmiede und so weiter. Innerhalb des Vallums ist alles Kirche.«
Thorgrim nickte. All diese Männer und Gebäude nur für die Kirche. Die Nordmänner hatten weder Priester noch Kirchen oder dergleichen. Sie beteten zu ihren Göttern in ihren Hallen, und die Zeremonien wurden von denselben Männern geleitet, die sie auch in den Kampf führten. Er schüttelte den Kopf. Wirklich seltsam, dachte er.
Schließlich kamen sie zu einem der kleineren Gebäude, das ebenfalls aus Stein bestand. Es sah aus wie eine kleinere Version der Kirche, nur dass der Turm fehlte. Der Priester führte sie zur Tür, blieb dann stehen und drehte sich zu Failend um. Er sagte irgendetwas, und das offenbar mit Nachdruck.
»Er sagt, dies sei das Haus des Abts, und es sei eine große Ehre für uns, dass er uns hier empfängt. Er fordert, wir sollen uns angemessen benehmen und dem Abt Respekt erweisen.«
Es hatte eine Zeit gegeben, da hätte es Thorgrim sehr, sehr wütend gemacht, wenn ihm jemand gesagt hätte, wie er sich zu benehmen hatte, doch jetzt konnte er nur lächeln. »Sag ihm, wir werden es versuchen«, bat er Failend. »Aber von Heiden kann man ja nicht viel erwarten.«
Die drehte sich wieder um und sprach mit dem Iren, doch Thorgrim nahm an, dass sie den letzten Teil ausließ. Der Priester nickte, öffnete die Tür und führte sie hinein.
Es war einfach wunderbar, aus dem Regen raus zu sein, und noch viel wunderbarer, ein großes Kaminfeuer vor sich zu sehen. Zwar brannte es am anderen Ende, doch es war groß genug, um den gesamten Raum zu erwärmen. Ein alter Mann saß so nah am Feuer, wie er konnte. Er trug die gleiche, schlichte braune Kutte, wie Thorgrim sie bei allen Christenmännern im Kloster gesehen hatte. Der Kopf, der aus der Kutte ragte, war voller weißer Haare, das Gesicht schmal und faltig, und die Mundwinkel waren nach unten gezogen.