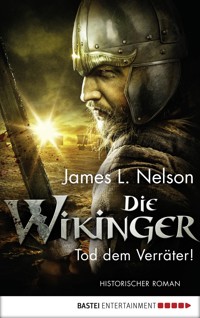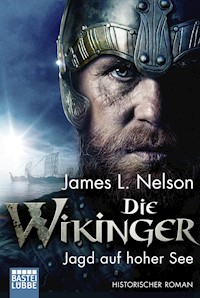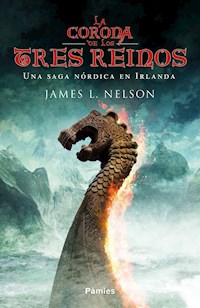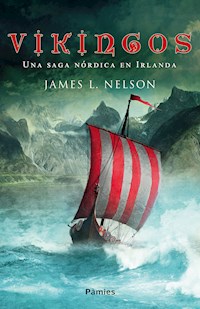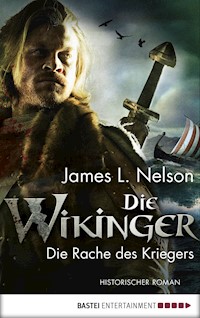9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Nordmann-Saga
- Sprache: Deutsch
Irland, Mitte des 9. Jahrhunderts: Nach einem ereignislosen Winter platzen die Wikinger um Thorgrim Nachtwolf beinahe vor Tatendrang. Da kommt es gelegen, dass Thorgrim durch den irischen Stammeskönig Kevin von Glendalough erfährt, einer schlecht geschützten Abtei im Binnenland. Der Zeitpunkt ist günstig, denn der Jahrmarkt steht bevor und bringt zusätzliches Geld in den Ort. Thorgrim lässt sich auf den Raubzug ein. Doch schon auf der Fahrt über den Fluss nach Glendalough zeigt sich, dass Kevin wenig zu trauen ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Hinweis
Widmung
Erklärung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Epilog
Glossar
Dank
Über das Buch
Irland, Mitte des 9. Jahrhunderts: Nach einem ereignislosen Winter platzen die Wikinger um Thorgrim Nachtwolf beinahe vor Tatendrang. Da kommt es gelegen, dass Thorgrim durch den irischen Stammeskönig Kevin von Glendalough erfährt, einer schlecht geschützten Abtei im Binnenland. Der Zeitpunkt ist günstig, denn der Jahrmarkt steht bevor und bringt zusätzliches Geld in den Ort. Thorgrim lässt sich auf den Raubzug ein. Doch schon auf der Fahrt über den Fluss nach Glendalough zeigt sich, dass Kevin wenig zu trauen ist …
Über den Autor
Bevor er sich entschied, über das Segeln zu schreiben, lebte und arbeitete James L. Nelson sechs Jahre lang an Bord traditioneller Segelschiffe. Seine zahlreichen Sachbücher und Romane wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit Preisen der American Library Association. Nelson liest in ganz Amerika aus seinen Büchern und tritt regelmäßig im Fernsehen auf. Er lebt mit seiner Frau Lisa und den gemeinsamen Kindern in Harpswell, Maine.
James L. Nelson
DIE WIKINGER
DER VERRAT VON GLENDALOUGH
HISTORISCHER ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Alexander Lohmann
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2016 by James L. NelsonTitel der amerikanischen Originalausgabe: »Glendalough Fair«Originalverlag: Fore Topsail Press
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Frank Weinreich, BochumTitelillustration: © Arndt Drechsler, Regensburg,unter Verwendung einer Fotografie von Thomas LewinUmschlaggestaltung: Nele Schütz Design, MünchenE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6136-0
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Der vorliegende Roman ist frei erfunden. Namen, Figuren, Orte und Ereignisse sind entweder vom Autor ausgedacht oder werden ausschließlich fiktional verwendet. Jede Übereinstimmung mit tatsächlichen Geschehnissen, Schauplätzen, Organisationen oder Personen, lebend oder bereits verstorben, ist rein zufällig und weder vom Autor noch vom Verlag beabsichtigt.
Für meine geliebte Abigail, meine kleine Wikingerin, meine wunderschöne Tochter –mit dem Stolz und der Liebe eines Vaters.
Glendalough – (ausgesprochen Glen-dah-lock) ist ein Ortsname, der sich als »Tal der Zwei Seen« übersetzen lässt. In den Wicklow Mountains gelegen, wurde Glendalough im späten sechsten Jahrhundert vom heiligen Kevin als Einsiedelei gegründet und entwickelte sich rasch zu einer von Irlands bedeutsamsten mittelalterlichen Klostersiedlungen.
Weitere Begriffe finden Sie im Glossar.
Prolog
Die Saga von Thorgrim Ulfsson
Einst lebte ein Mann mit dem Namen Thorgrim Ulfsson, dem ein großer Bauernhof in Ost-Agder in Vik im Lande Norwegen gehörte. Zu dem Hof zählten fruchtbare Felder, die in jedem Jahr reiche Ernte brachten. Zudem besaß Thorgrim viel Vieh und zahlreiche Bedienstete und Sklaven.
Da Thorgrim klug und bescheiden war und zudem fleißig wie nur irgendein Mann, gedieh sein Besitz. Thorgrim war beliebt und angesehen bei seinen Nachbarn und den Angehörigen seines Haushalts, und viele suchten seinen Rat. Doch zu Zeiten, wenn die Nacht hereinbrach, wurde er oft von einer düsteren Stimmung heimgesucht, und niemand wagte es dann, sich ihm zu nähern. Manch einer glaubte, dass er ein Gestaltwandler sei, und deswegen erhielt er den Spitznamen »Nachtwolf«.
Viele Jahre früher, als Thorgrim gerade erst zum Manne gereift war, war er mit dem Jarl, der in Ost-Agder herrschte, auf Wikingerfahrt gegangen. Dieser Mann hieß Ornolf Hrafnsson und war auch als Ornolf der Rastlose bekannt. Auf ihren vielen Reisen wurden die beiden Männer zu Freunden, und als sie heimkehrten, gab Ornolf Thorgrim seine Tochter Hallbera zur Frau.
Es war eine gute Ehe, und Thorgrim und Hallbera lebten glücklich auf ihrem Hof. Hallbera gebar Thorgrim vier Kinder, zwei Söhne namens Odd und Harald, eine Tochter namens Hild und eine weitere Tochter, die nach ihrer Mutter Hallbera genannt wurde.
Thorgrims Frau war schon über dreißig und nicht mehr ganz jung, als dieses letzte Kind zur Welt kam, und sie starb bei der Geburt. Thorgrim brach es das Herz, und als Ornolf ihn fragte, ob er noch einmal auf Wikingerfahrt gehen wolle (denn Ornolf blieb nie gerne lang bei seinem zänkischen Weib zu Hause), schloss Thorgrim sich ihm wieder an.
Thorgrims ältester Sohn Odd war zu dieser Zeit bereits verheiratet; er hatte selbst Kinder und einen eigenen Hof, den Thorgrim ihm überlassen hatte. Thorgrim fand es falsch, dass Odd zu diesem Zeitpunkt seine Familie verließ, und darum fragte er nicht nach seiner Begleitung. Doch sein zweiter Sohn, Harald, war erst fünfzehn und begierig auf die Reise, und so nahm Thorgrim ihn mit. Obwohl Harald jung war, war er stärker als manch ein ausgewachsener Mann und hatte einen großen Teil seiner Kindheit über für die Schlacht geübt, mitunter sogar insgeheim, so dass er sich als guter Krieger erwies und sich bei der Mannschaft Respekt erwarb. Als er älter wurde, nahm seine Kraft noch zu, und bald erhielt er den Beinamen »Starkarm«.
Ornolf segelte mit seinem Schiff, dem Roten Drachen, nach Irland. Die Nordmänner plünderten schon seit einer Weile in diesem Land und hatten dort sogar Longphorts errichtet, in Dubh-Linn und weiteren Orten. Es gab immer noch einiges zu holen, obwohl andere Wikinger bereits da gewesen waren, und Ornolf und Thorgrim und ihre Leute, ungefähr sechzig an der Zahl, machten gute Beute.
Die Lage in Irland war unruhig, denn die Iren kämpften nicht nur gegen die Nordmänner, sondern auch untereinander. Ornolf und Thorgrim und Harald fanden sich in eine große Intrige verwickelt, die sich um Tara entspann, den Sitz des irischen Königs von Brega. Erst nach hartem Kampf und mit dem Beistand der Götter waren sie in der Lage, mit ihrem Leben und einem beachtlichen Schatz zu entkommen.
Thorgrim war während des Kampfs verwundet worden, und sobald er sich von seinen Verletzungen erholt hatte, sammelte er eine Mannschaft an Bord seines Schiffes und verließ Dubh-Linn. Er war entschlossen, zu seinem Heim nach Ost-Agder zurückzukehren und niemals mehr auf Fahrt zu gehen. Doch die Götter, die sich daran erfreuen, mit den Männern ihr Spiel zu treiben, beschädigten sein Schiff in einem Sturm, und er und seine Mannschaft waren gezwungen, zum Longphort von Vík-ló zu segeln. Der Herr dieses Longphorts, ein Mann namens Grimarr der Riese, schätzte Thorgrim zuerst, wandte sich aber bald gegen ihn und wünschte seinen Tod.
Dies brachte Thorgrim und seine Männer in beträchtliche Schwierigkeiten, doch am Ende wurde Grimarr besiegt, und Thorgrim wurde zum Herrn von Vík-ló ernannt. Dies war das Jahr, nachdem Olaf der Weiße mit einer großen Flotte von Norwegen herangesegelt war, um Dubh-Linn von den Dänen zurückzugewinnen. Nach dem christlichen Kalender schrieb man das Jahr 853, und Thorgrim und seine Männer hatten da schon mehr als ein Jahr in Irland verbracht.
Thorgrims einziger Wunsch blieb es, auf seinen Hof zurückzukehren, aber er hatte erkannt, dass die Götter ihn daran hinderten, wann immer er es versuchte. Thorgrim hatte einen guten Freund namens Starri den Unsterblichen, der ein Berserker war. Thorgrim fragte Starri selten um Rat, denn er wusste, dass man kaum gut beraten war, wenn man einem Berserker folgte. In dieser Angelegenheit jedoch glaubte er, dass Starri eine gewisse Einsicht haben könnte.
Thorgrim sagte: »Wann immer ich versucht habe, Irland zu verlassen, haben die Götter mich zurückgeworfen. Nun bin ich der Herr von Vík-ló. Denkst du, dass die Götter mich vielleicht nach Hause schicken, wenn ich beschließe, in Irland zu bleiben?«
Starri grübelte einige Zeit darüber, dann sagte er: »Thorgrim Nachtwolf, du wurdest von den Göttern gesegnet, doch für Männer wie uns, die wir in Midgard wohnen, sind die Segnungen der Götter mitunter schwer zu verstehen. Ich weiß so wenig wie jeder andere, was die Götter denken. Aber das, was du sagst, klingt vernünftig in meinen Ohren, und all die Schwierigkeiten, die die Götter dir in den Weg gelegt haben, scheinen deine Worte zu belegen. Ich glaube, du solltest tatsächlich in Irland verweilen und abwarten, ob die Götter dir dann die Gunst erweisen, dich ziehen zu lassen.«
Thorgrim erwog Starris Antwort, und am Ende nahm er den Rat an und beschloss, in Vík-ló zu bleiben – in der Hoffnung, dass die Götter ihm dann erlaubten, nach Hause zurückzukehren.
Was dann geschah, erzählt die folgende Geschichte …
1. Kapitel
Lang reiste ich auf Meergottes Rossauf wildbewegtem Wellenpfad.
EGILS SAGA
Nach den langen, dunklen Wintermonaten hatte im Longphort von Vík-ló die Varonn begonnen, die Zeit der Frühjahrsarbeit. Für die Nordmänner fühlte es sich an, als würden sie aus einem langen Schlummer erwachen, und sie waren auf Streit aus, gewalttätig und blutig.
Starri der Unsterbliche hörte es zuerst, wie so oft. Die Männer saßen in Thorgrims Halle, dem mächtigsten Bauwerk in Vík-ló, dessen großer Saal fast dreißig Fuß in jede Richtung maß und dessen Dachfirst bis auf zwanzig Fuß über ihren Köpfen anstieg. Es regnete an diesem Nachmittag in Strömen, und beständiger Niederschlag drang wie Brandungsrauschen an ihre Ohren. Der Laut schwoll an und ebbte ab im Takt der Windböen, die das Wasser gegen die Wände aus lehmbeworfenem Flechtwerk trieben. Das Feuer in der Herdstelle knisterte und sprühte Funken.
Thorgrim und ein paar seiner Männer spielten, das Klicken der Spielsteine und ihre leise Unterhaltung gingen fast unter im Dröhnen des Regens. Thorgrims sechzehnjähriger Sohn Harald lag auf einem Stapel Felle an der erhöhten Stirnseite der Halle und schnarchte.
Starri saß in einer Ecke und schärfte Klingen, die längst so scharf waren, wie sie nur werden konnten. Das Schaben seines Wetzsteins war ein weiterer Laut, der beständig den Tag erfüllte. Wenn er sitzen musste, was Starri nur selten tat, zog er einen Platz hoch über allen anderen vor, auf der Mastspitze eines Schiffes, beispielsweise, oder zwischen den Dachsparren. Bot sich dazu keine Gelegenheit, wählte er einen Platz möglichst weit unten. Die Mitte, die die meisten Männer bevorzugten, war ohne jeden Reiz für Starri den Unsterblichen.
Thorgrim schüttelte die Würfel in einem Lederbecher, kippte sie auf den Tisch und bewegte selbstvergessen seine Spielsteine. Er verlor, doch davon bekam er kaum etwas mit. In Gedanken war er ganz woanders. Er dachte an die Schiffe unten am Fluss, von denen eins schon zu Wasser gelassen war, während die beiden anderen nur auf die gebührende Zeremonie und das Opfer warteten, die jeden Stapellauf begleiteten. Das Kleinere der zwei lag sogar bereits auf den Rollen.
Es hatte einige Mühen erfordert, aber sie hatten es geschafft, hatten drei Langschiffe von Grund auf neu gebaut. Und es waren gute Schiffe. Sie waren solide gezimmert, und Thorgrim wusste, dass sie so seetüchtig waren, wie ein gutes Schiff nur sein konnte.
Was die Männer anging, war er weniger sicher. Ihre Gemeinschaft zerfiel, die Seile, die sie zusammenhielten, waren verrottet und lösten sich. Es war inzwischen ein Wettrennen geworden, ob sie aufs Meer kamen und bei einem Raubzug ihren Ärger herauslassen konnten, bevor die einzelnen Mannschaften, die Thorgrim während des Winters nur mit Mühe zusammengehalten hatte, sich gegeneinander wandten.
»Nachtwolf.«
Thorgrim blickte zu Starri hinüber, der in Richtung Dach starrte und die Ohren spitzte. »Ja?«
»Ärger, denke ich«, sagte Starri. »Ein Kampf.« Starri war ein Berserker, in gewisser Hinsicht vollkommen verrückt, und eines der Dinge, die ihn von gewöhnlichen Menschen unterschieden, war sein außerordentliches Gehör.
Thorgrim sprang so schnell auf, dass er seinen Hocker umkippte, und ein Teil von ihm war hocherfreut, endlich etwas anderes zu tun zu bekommen, als seine Zeit bei einem sinnlosen Spiel zu vergeuden. »Harald! Wach auf! Alarmier die Wache!«, rief er, aber Harald war schon halb auf den Beinen. Wenn Harald schlief, dann schlummerte er so tief wie ein Bär in der Winterruhe. Doch sobald man zu den Waffen rief, war er von einem Augenblick zum nächsten hellwach.
Die anderen am Tisch erhoben sich auch. Starri, rege wie ein Eichhörnchen und verstohlen wie eine Katze, glitt so mühelos auf die Füße, als hätte der Wind ihn emporgehoben. Godi, ein baumlanger Kerl, und Agnarr sprangen von ihren Plätzen am Feuer auf. Weitere Männer strömten aus einem der Zimmer am anderen Ende der Halle. Dies war Thorgrims Leibwache, von ihm persönlich ausgewählt, nachdem er die Stellung als Herr von Vík-ló angetreten hatte. Seinem Sohn Harald Starkarm hatte er die Führung der Wache übertragen.
»Mir nach!« Thorgrim hielt auf die Tür zu.
Aber Starri sprach erneut: »Thorgrim, ich höre Stahl …«
Thorgrim hielt inne. Während der Wintermonate war es oft genug zu Raufereien gekommen, doch von einem gelegentlichen Messer abgesehen, hatten Waffen dabei nie eine Rolle gespielt.
»Schwerter?«, fragte Thorgrim.
Starri nickte.
»Also gut, Männer. Nehmt eure Schilde. Keine Zeit für die Kettenhemden.«
Die Leibwache stob auseinander und holte die Schilde. Ihre Schwerter trugen sie bereits – die Nordmänner gingen so wenig unbewaffnet umher, wie sie sich nackt zeigen würden –, doch sie hatten sich bis jetzt nicht die Mühe gemacht, ihre Schilde mitzunehmen. Niemand hatte damit gerechnet, dass eine Auseinandersetzung zu erwarten gewesen wäre, die so etwas erforderlich machte. Aber wenn Schwerter gezogen wurden, mochte mehr hinter dem Streit stecken als ein betrunkenes Gerangel.
Thorgrim stieß die Tür auf und trat in den wild vom Himmel prasselnden Regen. Ein starker Wind hob sein langes Haar und ließ es leewärts flattern, er riss an seinem Bart, und bevor er den Bohlenweg auch nur halb überquert hatte, war er nass bis auf die Knochen. An so was war er allerdings gewöhnt, nachdem er schon mehr als ein Jahr in diesem Land verbracht hatte. Ohne innezuhalten, schritt er also auf die Halle zu, die der seinen gegenüber stand. Er hämmerte gegen die Tür und schrie: »Bersi! Komm raus! Bring deine Wache mit! Probleme!«
Er wartete nicht auf eine Antwort, sondern winkte seinen Männern, ihm zu folgen. Im Laufschritt hielt er auf das Ufer zu. Er konnte den Kampf jetzt selber hören, das Geschrei und das Klirren von Waffen, und er wusste, dass es aus dieser Richtung kam. Er zweifelte keinen Augenblick daran, dass Bersi ihm gleich mit seinem eigenen Trupp folgen würde.
Bersi Jorundarson war unter Grimarr dem Riesen, dem früheren Herrn von Vík-ló, der zweite Mann im Ort gewesen. Nach Grimarrs Tod hätte Bersi die Führung beanspruchen können. Aber der Däne war kein Mann, der gern an der Spitze stand – jedenfalls hatte Thorgrim diesen Eindruck gewonnen. Stattdessen überzeugte Bersi die Übrigen, dass Thorgrim das Kommando übernehmen sollte, und Thorgrim hatte es getan.
Dennoch hatte Bersi seine Anhänger, vor allem unter den Männern, die früher Grimarr gefolgt waren. Thorgrim achtete deshalb darauf, den Mann bei seinen Entscheidungen stets mit einzubeziehen und seinen Rat anzuhören. Mehr noch, Thorgrim hatte Bersi im Laufe der Zeit schätzen gelernt.
Er eilte voran und wischte sich das Wasser aus den Augen. Der prasselnde Regen übertönte die Schritte der Männer hinter ihm. Sie folgten dem Bohlenweg an kleinen Häusern und Werkstätten vorüber, die ihm in den letzten Monaten so vertraut geworden waren. Es war alles so trist anzusehen. Jegliche Farbe schien aus diesem Land verbannt. Alles – die Häuser, der Boden, der Himmel, die Straße, das ferne Meer – war braun oder grau oder schwarz, und das spiegelte Thorgrims Stimmung.
Die Rufe wurden deutlicher, genau wie das Klirren aufeinandertreffender Klingen. Aber noch konnte Thorgrim den Kampf nicht sehen. Die an- und abschwellenden wütenden Stimmen, vom Regen gedämpft, klangen wie eine schwere Brandung, die auf einen Kiesstrand traf.
Ärger, Wut, Verdruss – all das hatte sich über Monate in dem Longphort aufgestaut. All das schlummerte, aber im Verborgenen nahm die Stärke der bösen Gefühle beständig zu. Fast dreihundert Männer lebten in Vík-ló, allesamt Krieger, die es gewohnt waren, sich in der Schlacht auszuleben, und denen nun die Gelegenheit dazu fehlte ebenso wie der besänftigende Einfluss von Frauen.
Im Winter hatte es nahezu ständig geregnet und der Wind bitterkalt und bösartig geblasen. Das hatte sie in den Häusern gehalten, wann immer sie nicht arbeiteten, und wenn sie arbeiteten, war es bei diesem Wetter eine elende Angelegenheit gewesen. Im ganzen Longphort lebten nur zwei Dutzend Frauen, und die Hälfte davon war verheiratet oder alt oder beides. Allerdings gab es einen reichhaltigen Vorrat an Wein und Met und Ale. Und genauso, wie die Fäulnis an den dunklen, nassen Stellen im Rumpf eines Schiffs wuchs, so fand die Reizbarkeit der Nordmänner in dem Winter von Vík-ló die perfekte Umgebung, um sich auszubreiten.
Thorgrim Nachtwolf hatte alles Mögliche getan, um dem Einhalt zu gebieten. Aber es war, als müsse er ein Schiff bei auflandigem Wind von der Küste lösen: Er konnte all seine Fertigkeiten und sein ganzes Wissen einbringen und wusste doch, dass er am Ende scheitern würde; er konnte den unausweichlichen Moment des Schiffsbruchs nur hinauszögern.
Thorgrim hatte unterschiedliche Kniffe verwendet, um eine Katastrophe zu verhindern, und für eine Weile hatte er Erfolg damit gehabt. Schwere Arbeit hatte dabei im Mittelpunkt gestanden, denn er wusste, dass nichts besser geeignet war, um die Streitlust im Zaum zu halten.
Nach den Kämpfen des vergangenen Sommers war ihnen nur ein einziges Langschiff geblieben, der Fuchs, auf dem nicht mehr als dreißig Krieger Platz fanden. Ihr wichtigstes Anliegen war also gewesen, neue Schiffe zu bauen. Während der langen Wintermonate hatten sie drei gefertigt und mit Beil und Dechsel, Beitel und Bohrer Schiffe von solcher Qualität zurechtgezimmert, wie Thorgrim sie sich vorstellte. Andere Männer waren in die Wälder geschickt geworden, Meilen entfernt vom Schutz des Longphorts, um Holz für den Schiffsbau zu fällen. Sie hatten mit Wölfen und Banditen zu kämpfen gehabt, während sie Eichen- und Kieferstämme in den Fluss Lietrim warfen und sie zum Longphort an der Mündung treiben ließen.
Wieder andere hatte Thorgrim eingeteilt, um den Erdwall auszubessern, der Vík-ló umgab. In seinen besseren Tagen mochte das eine beachtliche Schutzwehr gewesen sein, aber mittlerweile hatte der Wall begonnen, sich aufzulösen, während die Palisade darauf schon halb verrottet war. Die Arbeit daran war erbärmlich, dreckig und mühevoll gewesen, und wenn die wenigen Stunden Tageslicht verstrichen waren, blieb den Männern gerade genug Kraft zum Essen und Trinken, bevor sie einschliefen. Und so war es Thorgrim am liebsten.
Er versuchte, alle Männer unter seinem Kommando gerecht zu behandeln, die Norweger wie die Dänen. Niemand wurde länger als ein anderer zu einer speziellen Aufgabe eingeteilt. Jeder Mann leistete seinen Dienst beim Schiffsbau, beim Holzschlagen und am Wall. Von den Männern mit besonderen Fähigkeiten abgesehen – wie Mar der Schmied oder Aghen der Schiffsbaumeister – verrichtete jeder dieselben Arbeiten. Es ging so gerecht zu, wie Thorgrim es nur einrichten konnte. Und die Männer murrten und klagten über alles mit derselben unaufhörlichen Beständigkeit, mit der auch der Regen fiel.
Thorgrim wusste, dass Arbeit das beste Mittel war, um die Unzufriedenheit im Zaum zu halten, so wie Salz im Kielraum eines Schiffes die Fäulnis abwehrte. Doch er wusste auch, dass Arbeit allein nicht ausreichte. Er konnte keine Frauen herbeizaubern, aber er sorgte dafür, dass genug zu essen da war und regelmäßige Festmähler alle Männer im Longphort zusammenbrachten.
Zur gebotenen Nacht an der Wintersonnwende veranstaltete er das Blót, eines von drei großen Opferfesten, welche die Nordmänner in jedem Jahr feierten. Das Blót zu Mittwinter sollte die Götter dazu bringen, zur Zeit der Aussaat die Erde wieder fruchtbar zu machen. Es wurde ein wüstes Gelage, ganz wie es üblich war. Vieh wurde geschlachtet, und während das Fleisch über einem tosenden Feuer garte, bespritzte Thorgrim als Herr dieses Ortes Boden und Wände seiner Halle, die zugleich als Tempel diente, mit dem Blut der Tiere. Hörner voll Met wurden zur Feier gehoben, und zumindest in dieser Nacht vergaßen die Männer das Elend des Winters. Dann jedoch war das Blót zu Ende, das wilde Fest vorbei, der nächste Tag brach an und die Arbeit begann aufs Neue.
Die Wochen verstrichen, und schließlich wurden die Tage länger und die Kälte verlor ihren Biss. Nun, da das Wetter besser wurde und die Arbeit sich ihrer Vollendung näherte, hoffte Thorgrim, dass die Stimmung der Männer sich ebenso aufhellen würde. Er hoffte, die kürzeren Nächte und die Sonne, die gelegentlich schon durch die Wolken brach, würden auch den Menschen einen neuen, hoffnungsvolleren Blick auf die Welt vermitteln.
Aber das geschah nicht, jedenfalls bemerkte Thorgrim nichts dergleichen. Während der langen, kalten und nassen Monate hatten die Gegensätze zwischen den Männern sich stärker verhärtet, als Thorgrim bewusst geworden war. Splittergruppen hatten sich gebildet, Feindseligkeiten türmten sich auf, und die Erleichterung bei der Arbeit, die mit dem Frühlingswetter einherging, verschaffte den Männern nur mehr Zeit, über ihrem Groll zu brüten.
Kleinere Gereiztheiten waren in offenen Hass umgeschlagen. Faustkämpfe hatten sich zu größeren Schlägereien ausgeweitet, die zertrümmerte Möbel und gebrochene Knochen hinterließen. Aber aller schwelender Ärger und jeder Ausbruch von Gewalt war nie so weit gegangen, dass die Schwerter gezückt worden und Tote zurückgeblieben waren.
Bis jetzt.
2. Kapitel
Die Göttin des Goldregens,die große Freude mir schenkt,voll Stolz soll sie hörenvon ihres kühnen Freundes Tapferkeit.
GISLI SURSSONS SAGA
Thorgrim näherte sich der Bodenwelle, die zwischen ihm und dem Fluss lag und ihm den Blick auf den Kampf versperrte. Die Hand lag am Griff seines Schwertes Eisenzahn, und der Regen fiel ohne Unterlass weiter. Er hörte Schritte hinter sich und drehte sich um. Bersi Jorundarson rannte auf ihn zu und trat an seine Seite.
»Thorgrim«, sagte Bersi. »Was sind das für Probleme?«
»Ich weiß es noch nicht«, erwiderte Thorgrim. »Aber ich kann mir vorstellen, wer dahintersteckt.«
»Kjartan?«
»Genau das nehme ich an.«
Thorgrim hatte nie daran gezweifelt, dass die Männer von Vík-ló sich der einen oder anderen Gruppe anschließen würden und dass sich zwischen diesen Gruppen dann gewisse Feindseligkeiten ergaben. So waren die Männer eben. Seine größte Sorge war gewesen, dass sich die Norweger gegen die Dänen stellen würden. Doch so kam es nicht. Stattdessen hatten die Männer sich danach aufgeteilt, wem sie folgten: den Anführern, die später die einzelnen Schiffe kommandieren sollten.
Thorgrims Mannschaft stand größtenteils treu zu ihm, auch wenn einige – zumeist die Männer, die sich ihm erst vor sechs Monaten in Dubh-Linn anschlossen – sich mit Dänen angefreundet hatten und in andere Lager übergewechselt waren.
Die meisten Gefolgsleute von Grimarr dem Riesen folgten inzwischen Bersi und zeigten darum auch Thorgrim gegenüber eine gewisse Loyalität. Skidi Oddson, auch als Skidi Streitaxt bekannt, war ein weiterer, der unter den Männern eine herausgehobene Stellung errungen hatte, nach all den Verlusten, die er den Iren zugefügt hatte, und nach dem Tod von so vielen von Grimarrs früheren Unterführern. Skidi hatte seine eigene Gefolgschaft, und diese Männer waren nicht so glücklich darüber, dass Thorgrim zum Herrn von Vík-ló ernannt worden war. Allerdings war auch keiner von ihnen so entschieden dagegen, dass sie deswegen Ärger gemacht hätten, und man konnte sich auf sie verlassen, solange man niemandem zu viel abverlangte.
Doch einige der Männer, ungefähr eine Schiffsmannschaft von fünfzig oder sechzig Köpfen, waren unter den Einfluss von Kjartan Thorolfson geraten, der auch Langzahn genannt wurde. Kjartan diente niemandem außer sich selbst, und diese herausfordernde Haltung war genau das, was seine Leute an ihm bewunderten und worin sie ihm nacheiferten.
Kjartan hatte den ganzen Winter über Thorgrims Autorität untergraben; auf hunderterlei verstohlener Arten, aber nie so nachdrücklich, dass es eine Antwort mit den Waffen herausgefordert hätte. Auf Dauer jedoch würde das unausweichlich werden. Thorgrim konnte spüren, dass das bislang sorgfältig gewahrte Gleichgewicht bald kippen würde, und wenn es dazu kam, würde er Kjartan töten und abwarten, wie dessen Männer darauf reagierten.
Vielleicht ist es endlich so weit, dachte Thorgrim. Er stieg das letzte Stück die Anhöhe empor, hielt an und wischte sich den Regen aus den Augen. Vor ihm, auf der freien Fläche am Fluss, wo sie ursprünglich das Holz für den Schiffsbau gelagert hatten, bot sich der womöglich merkwürdigste Anblick, dem er je gegenübergestanden hatte.
Wenigstens hundert Männer waren dort, zu viele, um ihr Treiben noch als einfache Schlägerei abzutun. Es glich eher einer Schlacht mit klirrenden Schwertern, Männern, die reglos am Boden lagen, und anderen, die brüllend auf dem Feld aufeinander eindroschen.
Einen Moment stand Thorgrim verblüfft da. Das Geschehen erschien ihm wie verlangsamt in dem sturmgepeitschten Regen, der in Thorgrims Augen schlug und die Sicht erschwerte. Der Boden war weich und von der Auseinandersetzung zu einem schlüpfrigen Morast aufgewühlt. Ein paar der Männer waren schlammverschmiert, wo der Regen den Dreck nicht weggespült hatte, einige waren regelrecht davon eingehüllt.
Etwa die Hälfte der Männer war noch auf den Beinen. Die anderen prügelten sich und rollten durch den Matsch. Sie kämpften gegeneinander, kämpften darum, wieder auf die Füße zu kommen, und rangen nach Luft. Die Stehenden schlidderten und schwankten und schienen ebenso sehr damit beschäftigt zu sein, auf den Beinen zu bleiben, wie damit, ihrem Gegner zuzusetzen. Schwerter und Beile schimmerten schwach im gedämpften Tageslicht, und Thorgrim sah Blut auf Gesichtern und Armen, rot und vom Regenwasser verdünnt.
Zehn Herzschläge, nicht länger, blickte er auf die Szenerie hinab. Lang genug, um festzustellen, dass zumindest die Hälfte der Kämpfenden zu Kjartan Langzahn gehörte und Kjartan selbst mitten im Getümmel steckte. Die übrigen scharten sich um einen Mann namens Gudrun, einen von Skidis Leuten. Skidi selbst war nirgendwo zu sehen – ohne Zweifel schlief er noch und erholte sich von den Ausschweifungen der vergangenen Nacht! Thorgrim konnte sich nicht vorstellen, was diesen Tumult verursacht hatte.
»Kommt, mir nach!«, befahl Thorgrim seinen Männern. »Treibt sie auseinander, und versucht, niemanden zu töten oder allzu schlimm zu verwunden!« Er trat vor, den Schild am Arm, Eisenzahn über den Kopf gehoben. Er brüllte, als er den Abhang hinabstürmte, sein Schlachtruf ein auf- und abschwellendes Wolfsheulen, mit dem er hoffentlich die Aufmerksamkeit der Kämpfenden gewann.
Thorgrim erreichte den Rand der Kampffläche. Mit aller Kraft warf er sich gegen die nächststehende Gruppe aufeinander einschlagender Männer und schwang seinen Schild. Von den Kriegern in dem Handgemenge trug keiner einen, wie Thorgrim erkannte. Also waren sie nicht zum Kampf hierhergekommen, ein großer Vorteil für ihn und seine Leibwache.
Als er eintraf, schlug der Mann links von ihm mit dem Schwert nach ihm. Thorgrim fing die Klinge mit dem Schild, und der Stahl landete klirrend auf dem Schildbuckel. Der Aufprall brachte den Mann aus dem Gleichgewicht, und Thorgrim führte den Schild herum, traf den Gegner zu seiner Rechten mit der Kante und stieß ihn in den Schlamm.
»Weg mit dem Schwert! Schluss mit diesem Unsinn!«, brüllte Thorgrim, und der Mann, durchnässt und erschöpft, nickte benommen, während Thorgrim tiefer in das Gefecht vorrückte.
Eine Streitaxt wirbelte wie durch Zauberei gelenkt plötzlich aus dem Getümmel heran. Thorgrim konnte den Schild gerade noch rechtzeitig hochreißen, um sie aufzuhalten. Das Blatt fraß sich ins Holz, und er drehte den Schild hart herum. Die Bewegung riss das Beil aus der Hand seines Besitzers, und Thorgrim hieb mit der flachen Seite des Schwertes nach dem Mann. Mitten im Schlag spürte er, wie seine Füße den Halt verloren.
Mit einem Fluch ging er zu Boden. Er bereitete sich auf einen harten Aufprall vor, doch es fühlte sich eher so an, als würde er auf einem Stapel Felle landen. Klebrig schloss sich der Morast um seinen Leib, aber Thorgrims Augen waren nach oben gerichtet, und er sah ein Schwert auf sich herabfahren. Er hob den Schild, fing den Schlag ab, setzte sich halb auf und schwang Eisenzahn gegen die Beine des Angreifers. Wieder traf er mit der flachen Seite der Klinge, und auf dem schlüpfrigen Boden reichte das aus, um seinen Gegner zu Fall zu bringen.
Thorgrim stand auf, als der Mann fiel. Er stützte sich auf die Schildkante, um wieder auf die Füße zu kommen. Ein weiterer Krieger drang von vorn auf ihn ein. Thorgrim, der nun wusste, was für ein Verbündeter der Schlamm sein konnte, stieß den Mann einfach an und sah zu, wie er nach hinten kippte.
Das ist Wahnsinn, dachte Thorgrim. Er bemerkte keine echte Feindschaft seitens der Männer, gegen die er kämpfte. Es gab keinen Grund für diese blutige Auseinandersetzung. Sie hatten sich in ihre Wut hineingesteigert, und all der Verdruss und der Ärger des langen Winters, der sie im Longphort eingeschlossen hatte, brach hier auf dem Schlachtfeld aus den Männern heraus. Es war wie eine Schlägerei in der Festhalle, nur in größerem Maßstab. Er hatte schon Haie beobachtet, die in dieselbe Raserei geraten waren.
Jemand fiel ihm in die Flanke, und Thorgrim wandte gerade rechtzeitig den Kopf, um zu sehen, wie Godi den Mann packte und regelrecht von den Beinen hob. Eine seiner wuchtigen Pranken schloss sich um den Hals des Angreifers, die andere ging in den Schritt. Godi hob den schreienden, zappelnden Krieger hoch über seinen Kopf und schleuderte ihn auf einen ganzen Haufen anderer Kämpfer, die allesamt übereinander purzelten.
Weiter rechts konnte Thorgrim Starri den Unsterblichen sehen, der sich ins Getümmel stürzte. Das war ein Problem! Thorgrim wollte den Kampf beenden und ihn nicht noch mehr anheizen. Das erforderte Zurückhaltung, und Zurückhaltung war Starris Stärke nicht.
Thorgrim blickte nach rechts, überzeugt davon, dass er Harald dort finden würde, und tatsächlich stand der Junge da. Als Thorgrim gerade zum Reden ansetzte, schlug Harald seinen Schild gegen zwei Männer zu seiner Linken, die sich im Ringkampf umschlangen. Der Hieb stieß sie beide zu Boden, wo sie einander losließen und versuchten, im dicken Morast wieder auf die Füße zu kommen.
Harald hatte sein Schwert eingesteckt, und als einer von Skidis Männern unbeholfen auf ihn zustürmte, streckte er die Hand aus, packte den Mann an den Haaren und rammte dessen Kopf gegen sein Knie. Der Mann schien von dem Knie abzuprallen, dann taumelte er mit blutverschmiertem Gesicht rückwärts und riss zwei weitere Wikinger mit sich um.
»Harald!«, schrie Thorgrim. »Halt dich an Starri! Pass auf, dass er niemanden schlimmer verletzt als nötig!«
Harald nickte, er drehte sich um, rutschte aus und ging mit einem Schimpfwort zu Boden, genau wie Thorgrim zuvor. Thorgrim deckte sie beide mit dem Schild und reichte dem Jungen die Hand. Er zog Harald auf die Füße, und nur ein breitbeiniger Stand und viel Glück verhinderten, dass sie wieder wegrutschten.
Harald bahnte sich einen Weg durch das Handgemenge. Thorgrim rammte die Männer vor ihm mit dem Schild und ließ sie rückwärts taumeln, und in der kurzen Atempause, die er dadurch gewann, sah er sich um.
Seine Männer, ausgeruht und mit Schilden gewappnet, schafften es allmählich, die Streithähne zu trennen. Einige, die mitten im Getümmel gesteckt hatten, stellten den Kampf nun ein; manche aufrecht, andere am Boden – vielleicht verletzt, vielleicht tot. Ein paar waren davongetaumelt und hatten sich an den Stellen zu Boden fallen lassen, wo noch Gras stand. Viele jedoch droschen weiter aufeinander ein, mit Schwertern, Äxten und Fäusten.
Thorgrim wandte sich nach links. Einer von Kjartans Männern, ein großer Bursche namens Gest, dem Rang nach der zweite an Bord des Drachen, löste sich aus dem Gemenge und stürmte mit erhobener Streitaxt heran, den von einem beeindruckenden Bart umrahmten Mund in wütendem Gebrüll aufgerissen. Die Axt sauste auf Thorgrim herab, und der schaffte es gerade noch, den Schild hochzureißen und den Schlag abzufangen, bevor der Hieb ihm den Kopf spaltete.
Das Blatt grub sich tief in das Holz, und Thorgrim fühlte, wie seine Füße auf dem glitschigen Grund erneut den Halt verloren. Aber ehe er fiel, riss Gest die Axt wieder heraus und zog damit auch Thorgrim weit genug hoch, dass er sein Gleichgewicht wiederfand und auf den Beinen blieb. Danke, dachte Thorgrim.
Gest schlug erneut unbeholfen zu, und diesmal konnte Thorgrim ausweichen. Bevor er aber dazu kam, zurückzuschlagen, erblickte er einen weiteren von Kjartans Kriegern, der mit dem Schwert in der Hand aus der Menge trat und die Klinge nach seinem Unterleib stieß.
Thorgrim parierte mit Eisenzahn. Er setzte den rechten Fuß fest auf den saugenden Boden. Dann nahm er den Schild dicht an seine Schulter und rammte Gest damit, der gerade wieder mit dem Beil über dem Kopf ausholte. Gest stolperte, seine Füße rutschten im Morast weg, und mit ausgebreiteten Armen und einem empörten Brüllen landete er auf dem Rücken.
In die Lücke, die sein Sturz eröffnete, drang Kjartan Thorolfson, das Schwert in der einen Hand, eine Axt in der anderen. Er atmete schwer und war über und über mit Matsch bedeckt; Haar und Bart waren durchweicht, und er blickte Thorgrim entschlossen an. Schnell trat er um den zappelnden Gest herum und griff sofort an.
Solltest du nicht lieber versuchen, dem Einhalt zu gebieten, du Mistkerl?, dachte Thorgrim, noch während er Kjartans Angriff abwehrte und konterte. So aufsässig er sein mochte, gehörte Kjartan doch zu den Anführern von Vík-ló. Er sollte seine Männer lieber davon abhalten, sich gegenseitig umzubringen, anstatt selbst den Herrn des Longphorts anzugreifen.
Thorgrim nahm eine Bewegung zu seiner Rechten wahr und parierte mit der Klinge, schnell genug, um einen tödlichen Treffer zu verhindern, aber nicht so schnell, dass er die Klinge aufgehalten hätte, bevor sie durch seine Tunika drang und eine Wunde in seine Flanke riss.
»Bastard!«, rief Thorgrim. Er hob Eisenzahn und trieb ihn dem Mann in den Bauch. Alle Zurückhaltung war vergessen, als die Kampfeswut ihn überkam. Er wirbelte wieder zu Kjartan herum, stieß mit dem Schild voran die Waffen beiseite und stach nach dessen Brust. Er spürte, wie die Klinge über ein Kettenhemd schrammte – eine vertraute Empfindung, die sich nicht fehldeuten ließ. Sofort fuhr er zurück, als noch mehr von Kjartans Männern hinzustießen.
Kettenrüstung, dachte Thorgrim. Kettenrüstung.Eine warnende Stimme regte sich in seinem Kopf, doch in dem Regen, dem Gebrüll und mit der brennenden Wunde in seiner Seite drang sie nicht zu ihm durch. Er wehrte den nächsten Angriff ab, schlug nach dem Angreifer und verfehlte sein Gesicht um wenige Zoll, als der Mann zurücksprang.
Wieder spürte Thorgrim, wie seine Füße den Halt verloren, doch er trat zurück und fand sein Gleichgewicht wieder. Kjartan griff erneut an.
Rüstung! Der Kerl trägt eine Kettenrüstung! Niemand sonst in diesem Kampf trug eine Rüstung, Kjartan schon. Als hätte er all das die ganze Zeit erwartet. Als hätte er es geplant!
Thorgrim parierte Kjartans Schwert mit Eisenzahns Klinge und fing das Beil mit dem Schild ab. Er stieß vor und trat seinem Gegner in den Bauch. Der taumelte rückwärts, aber er fiel nicht.
»Darum geht es also bei diesem Kampf?«, rief Thorgrim. »All das nur, um mich aus dem Weg zu räumen?«
Kjartan stieß einen Laut aus, irgendwo zwischen einem Knurren und einem Ruf. Er stürmte los, das Schwert nach vorn gestreckt, die Axt erhoben. Thorgrim ließ den Schild sinken und wartete, Eisenzahn stoßbereit in der Hand. Zwei Schritte, und Kjartan war bei ihm, aber Eisenzahn bewegte sich nicht. Stattdessen riss Thorgrim den Schild wieder hoch und schwang ihn dem anstürmenden Mann entgegen. Der Schild krachte gegen den Angreifer, brachte ihn abrupt zum Stehen, schleuderte ihn zurück. Kjartan stolperte und fiel mit ausgebreiteten Armen und weit aufgerissenen Augen. Seine Füße lösten sich vom Boden, und er schrie auf, als er stürzte. Dann landete er flach auf dem Rücken und versank halb im klebrigen Morast.
Thorgrim sprang vor. Ein Dröhnen in seinem Ohr löschte das Prasseln des Regens fast aus, genau wie das Gebrüll der Schlacht und diese eine, eigentümliche Stimme, die rief: »Thorgrim! Thorgrim!«
Die Stimme drang wie in einem Traum zu ihm, und im nächsten Augenblick fühlte er sich von Händen gepackt, die seine Arme ergriffen, seine Schultern, und die ihn aufhielten, bevor er zu Kjartan gelangte und ihm das Schwert durch die Brust stoßen konnte. Erst als die Wörter wiederholt wurden, wurde ihm bewusst, dass tatsächlich jemand nach ihm rief.
»Thorgrim, Herr!«
Er senkte Schwert und Schild, und sein Körper entspannte sich. Die Männer, die ihn an Armen und Schultern hielten, ließen los und traten beiseite. Thorgrim wandte sich um und sah einen Jüngling auf sich zulaufen, einen von Skidis Leuten, die als Wache auf dem wiederhergestellten Wall postiert worden waren.
»Was?«, fragte Thorgrim. Sein Blick wanderte zu Kjartan zurück.
»Skidi schickte mich, um Euch von den Reitern zu berichten. Da kommen Reiter auf uns zu! Iren.«
Thorgrim dachte über die Worte nach. Reiter. Iren. Das konnte alles bedeuten. Es konnte wichtig sein. Oder bedeutungslos. Jedenfalls war es nichts, das man ignorieren durfte.
Thorgrim schaute seine Klinge an. Der Regen hatte sie sauber gewaschen. Er stieß sie zurück in die Scheide. Dann blickte er auf Kjartan hinab, der immer noch der Länge nach im Schlamm lag. »Andere Pflichten rufen mich fort«, sagte er. »Wir werden das später zu Ende bringen.« Er wandte Kjartan den Rücken zu und schritt davon, ohne auf eine Antwort zu warten.
3. Kapitel
Die spirituelle Hauptstadt der westlichen Weltist der Konvent von Glendalough.
FÉILIRE VON OENGUS, CA. 800 N. CHR.
Das Land westlich von Vík-ló, das die Iren Cill Mhantáin nannten, stieg hinter der Küste rasch an und ging in eine Reihe hoher, gerundeter Berge über, die sich weit landeinwärts erstreckten. Dabei handelte es sich nicht um die zerklüfteten und unwirtlichen Steilhänge, wie man sie anderswo an der irischen Küste oder in der Heimat der Nordmänner fand, sondern alles in allem eher sanfte, gut zugängliche Hügel. Und in diesen Tagen des beginnenden Frühjahrs schien das Hochland den Reisenden tatsächlich willkommen zu heißen und ihn einzuladen, durch die üppigen Täler zu streifen.
Zwölf Meilen weit in diesen Bergen, in einem Tal mit zwei Seen, die wirkten, als würde Gott selbst das Wasser in den Händen schöpfen, lagen das Kloster und die Stadt Glendalough.
Das Christentum war zweihundert Jahre zuvor nach Glendalough gelangt, mit der Ankunft von St. Kevin, der dort nur die Einsamkeit gesucht hatte. Das Tal der zwei Seen war eine hervorragende Wahl. Wer an diesen beschaulichen Wassern stand und auf die grüne, geschwungene Landschaft schaute, die ringsum anstieg, der spürte sofort, dass hier etwas Ewiges und Mystisches zu finden war. Zwei Jahrhunderte lang waren Pilger zu diesem heiligen Ort geströmt.
Am Anfang hatte Glendalough nicht mehr zu bieten gehabt als eine einfache Kirche aus lehmbeworfenem Flechtwerk, doch im Laufe der Zeit war hier eines der größten Klöster Irlands entstanden, ein Hort des Glaubens wie auch der Gelehrsamkeit, in dem das gesammelte Wissen der Zivilisation bewahrt wurde, nachdem die einigende Macht von Rom in Chaos und Krieg zerfallen war. Glendalough, einst reich an mönchischer Gesinnung, war inzwischen fett geworden vor weltlicher Fülle, durch die Viehherden, die auf den umliegenden Feldern grasten, und das Gold und das Silber und die juwelengeschmückten Reliquiare, die die steinerne Kathedrale zierten.
Die Kirche stand im Zentrum von Glendalough, sowohl räumlich wie spirituell. So massiv wie ein Granitfelsen ragte sie fünfzig Fuß über den festgestampften Boden auf und erstreckte sich mehr als einhundert Fuß von Ost nach West. Die kleineren Gebäude der Abtei – die Dormitorien der Mönche und die Gästehäuser, ein strohgedecktes Klostergebäude aus schweren Eichenbalken, eine Bibliothek und das Wohnhaus des Abts – umringten die große Kirche wie Höflinge ihren König. Das Ganze war dann noch von einem Vallum umgeben, einem niedrigen Erdwall, der allerdings weniger der Befestigung diente, als dass er vielmehr die Grenze des geheiligten Bodens markierte, der allein klösterlichen Regeln unterworfen war.
Eine zweite niedrige Steinmauer, zweihundert Fuß vom Vallum entfernt, umschloss den Rest des Landes, der noch unmittelbar zum Kloster gehörte. Innerhalb dieses äußeren Rings fanden sich jene Gebäude des Klosters, die eher weltlichen und banalen Zwecken dienten: die Bäckerei, die Küche, die Molkerei und die Ställe. Der äußere Wall war höher und solider als das Vallum, aber als Verteidigungsanlage taugte er nur geringfügig mehr.
An den äußeren Wall geschmiegt, erstreckte sich die Stadt, die im Schatten des Klosters von Glendalough gewachsen war; eine Stadt zumindest nach irischen Maßstäben. Ein paar unbefestigte Straßen – die nach dem unaufhörlichen Regen inzwischen zu Schlammpisten aufgeweicht waren – verliefen wie Speichen vom Kloster fort, hier und da in unterschiedlichen Winkeln von weiteren Wegen gekreuzt. Entlang der Straßen lagen verschiedene kleine Häuser mit angebauten Werkstätten. Schmiede und Glaser und Fleischer, Lederschneider und Weber und all die anderen Geschäfte, die im Umkreis des Klosters gediehen wie Moos an einem Felsblock, waren hier zu finden.
So wie die Kirche das Herz des Klosters war, so stellte der Marktplatz das Zentrum der äußeren Gemeinde dar. Bei einer Seitenlänge von hundert Ruten war der Platz an Markttagen voller Menschen und Verkaufsbuden, und zu Festtagen und besonderen Anlässen wurden es sogar noch mehr. Die wohlhabenden Kaufleute und Grundbesitzer, die in Glendalough wohnten, residierten in Gebäuden gleich am Rand des Platzes. Die Bedeutsamsten darunter grenzten unmittelbar an die Außenmauer des Klosters, wodurch sie näher an der Kirche und an der Zuflucht lagen, die darin zu finden war.
In einem dieser Häuser, dem vornehmsten von allen, dem größten in ganz Glendalough, hielt Louis de Roumois sich auf. Es war aus lehmbeworfenem Flechtwerk errichtet, genau wie die erbärmlichen Hütten der Handwerker, allerdings war es solide gebaut und mit einem hohen, steil ansteigenden Strohdach versehen. Es hatte eine Küche mit steinerner Herdstelle vorzuweisen, die durch eine Wand von der Halle getrennt war, sowie Schlafgemächer auf einer Galerie im Obergeschoss, welche die halbe Länge des Gebäudes einnahm. Es gab zwei kleine Fenster, hoch oben, die mit Glasscheiben versehen waren. Die Haustür führte auf den Marktplatz hinaus. Durch eine zweite Tür an der Rückseite gelangte man in eine Gasse, die unmittelbar entlang der Klostermauer verlief und einen guten Ausblick auf die Kirche dahinter gewährte.
Louis war ein junger Mann von zweiundzwanzig Jahren, und im Gegensatz zu den meisten Bewohnern von Glendalough fand er das Haus nicht besonders beeindruckend.
Ein schönes Heim, dachte er, wenn es die Hütte eines Schäfers wäre, oder eines einfachen Bauern. Tatsächlich jedoch war es das beste Haus, das in der ganzen erbärmlichen Stadt zu finden war, und das kam Louis lächerlich vor. Trotzdem kam er immer wieder hierher, und dafür gab es einen sehr guten Grund.
Die Straßen von Glendalough waren an diesem Morgen belebt und übervoll, und der Andrang nahm mit jedem verstreichenden Augenblick zu, obwohl der Regen ohne Unterlass fiel, als hätte Gott ihn als Plage an diesen Ort geschickt. Provisorische Verkaufsstände wurden ringsum am Rand des Platzes aufgebaut und liefen in Reihen zum Zentrum weiter. Auf den freien Flächen entstanden Bühnen. Viehherden aus dem Umland wurden in behelfsmäßige Pferche getrieben; Händler aus ganz Südirland trafen mit eigenen Wagen oder Bündeln auf dem Rücken ein. Sie suchten eine der wenigen Schenken mit Gästebetten auf, kehrten auf ein Ale ein oder errichteten sich eigene Unterkünfte auf den Feldern. Ein Gefühl der Vorfreude hing wie eine Sommerwolke über der Stadt.
Das Kloster von Glendalough und die gleichnamige Stadt waren nichts verglichen mit den großen Longphorts der Nordmänner in Dubh-Linn und Wexford oder anderswo. Doch auf einer Insel voller Bauern und Grundbesitzer und unbedeutender Königreiche, die wahllos übers Land verstreut lagen, war Glendalough ein bedeutendes Handelszentrum. Als solches veranstaltete der Ort Feste und Markttage während all der Monate, in denen es den Menschen überhaupt möglich war, ihre Häuser und Höfe und Raths zu verlassen und hier zusammenzukommen.
Von all diesen Anlässen war keiner so wichtig, so beliebt oder so einträglich wie der, auf den sich die Stadt jetzt vorbereitete: das jährliche Oénach, der Jahrmarkt von Glendalough.
Es war das Ereignis des Frühlings, die erste echte Möglichkeit, bei der die Leute den elenden Winter hinter sich lassen konnten und wieder mehr im Sinn hatten als das bloße Überleben. Es blieben immer noch drei Wochen Zeit bis zum Beginn des Jahrmarkts, aber die Vorbereitungen waren im vollen Gange.
Tatsächlich warteten die Menschen bereits seit Monaten darauf, und das galt nicht nur für die einheimischen Handwerker. Kaufleute von so fernen Orten wie dem Frankenreich und Friesland schickten ihre Waren zum Jahrmarkt von Glendalough. Zu dieser Zeit fanden Pilger ganz anderer Art – Schauspieler und Jongleure, Dompteure mit ihren Tieren genauso wie Beutelschneider und Huren – ihren Weg in die Klosterstadt, wo sie auf ihren Anteil an dem Silber hofften, das während des eine Woche dauernden Fests durch die Straßen floss.
Die Vorbereitungen waren im vollen Gange, doch Louis hörte kaum etwas von dem Hämmern und Hacken, den Rufen der Arbeiter, dem Ächzen der Wagen und dem Muhen der Ochsen. Das Prasseln des Regens und das Stöhnen der jungen Irin, die sich derzeit unter ihm wand, löschten jedes andere Geräusch aus.
Ihr Name war Failend, und Louis schätzte, dass sie um die zwanzig sein musste, gewiss nicht viel älter. Sie war so schön wie nur irgendeine Frau, bei der er je gelegen hatte, und das waren viele gewesen. Ihre Haut war weiß und weich wie Butter, ihr langes schwarzes Haar lag in diesem Augenblick in wilder Fülle über das Fell unter ihr ausgebreitet.
Louis bewegte sich schneller, und Failend grub ihre Fersen in seinen Rücken, während sie seine Schultern mit den Nägeln bearbeitete, eine Gewohnheit, die ihn anfangs erregt hatte, die er aber inzwischen nur noch schmerzhaft fand. Sie keuchte und schrie etwas, das Louis nicht verstand. Er war seit nicht mal einem Jahr in Irland, und bei seiner Ankunft hatte er nur Fränkisch gesprochen. Mittlerweile beherrschte er die Landessprache halbwegs, doch Failends Worte, durch die zusammengebissenen Zähne gezischt, während sie sich unter ihm aufbäumte und verdrehte, die verstand er immer noch nicht.
Er glaubte aber auch nicht, dass sie besonders wichtig waren. Seiner beträchtlichen Erfahrung nach sagten Frauen unter diesen Umständen alle so ziemlich dasselbe, egal in welcher Sprache. Er bewegte sich noch schneller, und Failend schloss die Arme um ihn, zog ihn zu sich hinab und presste ihren Leib heftig gegen den seinen. Sie keuchten jetzt beide, während sie sich auf diesen letzten Moment zubewegten und einander dann gegenseitig über die Kante stießen.
Einen langen Augenblick lagen sie einfach nur da, tief in die dicken Felle gesunken, die über der erhöhten Sitzfläche im vorderen Raum ausgebreitet waren. Als er an diesem Morgen bei ihrem Haus angekommen war, leise an die Tür geklopft und sich auf dem Platz umgeschaut hatte, um sicherzugehen, dass niemand in seine Richtung schaute, da war er davon ausgegangen, dass sie es oben in der Schlafkammer miteinander treiben würden, wie die letzten Male. Doch so weit waren sie diesmal gar nicht gekommen.
Failend hatte die Tür geöffnet, ihn aus dem Regen ins Haus gezogen und in ihre Arme geschlossen. Sie drückte die Lippen gegen die seinen, und er hatte ihren dünnen Leib umklammert. Bald schon rissen sie sich gegenseitig die Kleidung herunter, gruben ihre Finger in die Haare des anderen und pressten die Münder aufeinander. Sie betteten sich auf den Stapel Felle neben der Feuerstelle und gaben sich einander hin. Sie hatten es nicht mal zehn Fuß von der Tür weg geschafft.
Louis’ Atem wurde langsam wieder ruhiger, und er fragte sich, wo die Diener sein mochten, die für gewöhnlich hier beschäftigt waren. Sie muss sie weggeschickt haben, ging es ihm durch den Kopf. Das Mädchen dachte voraus. Das gefiel ihm.
Dann hörte er eine Stimme hinter sich, ruhig, beherrscht und kalt. »Na, sind wir jetzt fertig?«
Failend schnappte nach Luft, und Louis rollte sich herum. Das warme, behagliche Gefühl war schlagartig verschwunden. Colman mac Breandan stand in der Küchentür. Er war anscheinend durch die Tür an der Rückseite hereingekommen. Er war der Eigentümer des Hauses, wahrscheinlich der reichste Mann in Glendalough und vor allem aufgrund dieser Tatsache auch Failends Ehemann.
Colman war alles andere als gutaussehend. Er war doppelt so alt wie seine Frau, von mittelmäßiger Größe und stämmiger Statur. Sein Haar war schütter und mausbraun, wo es nicht bereits grau wurde. Seine feine Kleidung konnte die allgemeine Plumpheit seiner Erscheinung nicht überspielen. Aber Louis interessierte sich weniger für Colmans Aussehen als vielmehr für das lange, gerade Schwert in dessen Hand. Allerdings war Louis auch nicht so gebannt von dieser Waffe, dass er sich nicht gefragt hätte, wie lange Colman wohl schon dort stand und sie beobachtete.
Vielleicht gefällt es ihm ja, dachte Louis. Vielleicht hab ich ihm einen Gefallen erwiesen.
Aber Gefallen oder nicht, Colman wirkte nicht sonderlich dankbar. Er trat einen Schritt auf sie zu, und Failend keuchte wiederum. Louis’ Augen flogen hin und her und hielten nach der eigenen Waffe Ausschau.
Dann erinnerte er sich daran, dass er gar keine hatte.
»Du hast kein Schwert«, merkte Colman im selben Augenblick an, in dem auch Louis diese Tatsache bewusst wurde. Colman trat einen weiteren Schritt vor. Louis setzte sich ganz auf.
»Erinnerst du dich auch, warum du kein Schwert hast?«, fragte Colman.
Louis erinnerte sich, aber er schwieg.
»Es liegt daran, dass du ein Mann Gottes bist«, sagte Colman. »Hast du das etwa vergessen?«
4. Kapitel
Manch süße Maid, wenn man sie kennt,findet man dem Manne launenhaft.
HÁVAMÁL
Louis rollte sich herum und kam auf die Füße. Halb ge duckt und kampfbereit landete er auf dem Boden. Es war eine katzenhafte, kraftvolle Bewegung, und Louis wäre beeindruckt gewesen von seiner eigenen Eleganz, hätte er sich nicht so nackt und verwundbar gefühlt.
Er nahm wahr, wie Failend das Fell hochnahm und sich damit bedeckte, doch ihm blieb kein solcher Schutz. Es gab nichts, was er zu Colman hätte sagen können, außer um sein Leben zu betteln, und das hatte er gewiss nicht vor. Also sprach er kein Wort. Stattdessen wich er zurück und hielt nach links und rechts Ausschau auf der Suche nach etwas, das er als Waffe verwenden konnte.
Und dann blieb Colman stehen und senkte das Schwert. »Du kannst aufhören, wegzulaufen, du feiges Stück Scheiße«, sagte er. »Ich habe nicht vor, dich zu töten, nur weil du es mit dieser Schlampe von Ehefrau getrieben hast. Wenn ich damit anfinge, hätte ich inzwischen schon halb Leinster erschlagen müssen. Also verschwinde einfach.«
Louis schwieg weiterhin. Er trat einen Schritt zur Seite, ohne den Blick vom Herrn des Hauses abzuwenden. Dann streckte er den Arm nach seiner Kleidung aus, die aus nicht mehr als einer Mönchskutte und einem Strick als Gürtel bestand. Colman hob wieder sein Schwert, und Louis wich zurück.
»Das bleibt hier«, befahl er. »Ich werde es als Trophäe behalten. Vielleicht kann mein Weib es ja auch tragen, wenn ich sie ins Kloster schicke. Hau ab!«
Louis trat wieder zurück und hielt auf die Haustür zu. Er wollte dem Mann mit dem Schwert nicht den Rücken zuwenden, selbst wenn der ihm sicheren Abzug versprach. Er stellte sich vor, wie er nackt auf den regendurchweichten Platz hinaustrat. Bei seiner Ankunft war dort alles voller Menschen gewesen. Er fragte sich, wie er unbemerkt zu seiner Zelle zurückkommen sollte oder wie er dem Abt den Verlust seiner einzigen Kutte erklären würde.
»Halt!« Colman trat zur Seite und wies mit der Klinge ins Haus hinein. »Durch die Hintertür, du fränkischer Scheißhaufen.«
Dieser Forderung kam Louis nur allzu gern nach. Vorsichtig ging er in die Richtung, die ihm das Schwert wies, und schlug einen weiten Bogen um Colman und die scharfe Waffe. Er konnte es kaum glauben, dass der Mann ihm sogar die Demütigung ersparte, nackt aus dem Haus geworfen zu werden. Dann verstand er. Colman verhinderte damit in Wahrheit die eigene Schande, öffentlich als Hahnrei bloßgestellt zu werden.
Louis bewegte sich um Colman herum, der zurücktrat und den Weg freigab. Dann war er in der dunklen Küche. Die Hintertür stand immer noch einen Spalt offen, das trübe Licht des verhangenen Himmels umrahmte die Eichenbretter. Louis stieß sie ganz auf und trat in den Regen hinaus. Seine bloßen Füße sanken einen halben Zoll in den Schlamm ein; jedenfalls hoffte er, dass es nur Schlamm war. Es war kalt, aber das hielt zumindest die Fliegen und den üblen Gestank der Abfälle im Zaum, die in der engen Gasse aufgehäuft lagen.
In dem Augenblick, da er das Haus verließ, war er bereits durchnässt. Das schulterlange Haar klebte ihm an Hals und Stirn, der Regen strömte über seine bloße Haut. Er zitterte und schlang die Arme um den Leib. Über die niedrige Außenmauer des Klosters, die Louis gerade bis zur Brust reichte, konnte er die Kirche aufragen sehen wie eine der Felsnadeln an der Küste. Gleich dahinter war die Ecke des kleinen, hässlichen Gebäudes auszumachen, in dem seine Zelle lag; eine winzige Kammer mit strohgefüllter Matratze, einem einzelnen Stuhl und einem Schreibtisch, an dem er sorgfältige Abschriften der Heiligen Schrift und anderer alter Texte anfertigen sollte. Haus und Zelle lagen gerade einmal fünfhundert Fuß entfernt, aber bei all dem offenen Gelände dazwischen hätten es auch fünfhundert Meilen sein können.
Von seinem Platz hinter der Mauer konnte er Männer in schwarzen Kutten kreuz und quer über den Kirchhof oder unter dem Dach des Kreuzgangs laufen sehen. Schlimmer noch – es waren auch Schwestern aus dem nahe gelegenen Konvent unter den Umhereilenden. Er hatte keine Ahnung, wie er je seine Zelle und die damit verbundene, wenn auch trügerische, Privatsphäre erreichen sollte. Ihm entging die Ironie der Situation nicht, die darin lag, dass er gerade die Klostermauer nutzte, um seine Nacktheit und Sünde zu verdecken.
Unwillkürlich duckte er sich tiefer und blickte umher, aber außer ihm hielt sich niemand in dieser Gasse zwischen den reichen Häusern und der Mauer auf.
Ein Windstoß traf ihn. Er zitterte wieder, und seine Zähne schlugen aufeinander. Er schlang die Arme fester um sich, und zu dem Elend, das mit der Nässe und der Kälte kam, gesellten sich auch noch tiefes Selbstmitleid und Verzweiflung.
Wie, bei Gottes Gnade, bin ich nur in diese Lage geraten?, fragte er sich.
Failend blickte zu ihrem Gatten auf, der sich wiederum in der Küche umsah, um sicherzustellen, dass der fränkische Novize Louis de Roumois tatsächlich das Haus verlassen hatte. Nachdem er anscheinend hinreichend überzeugt davon war, schob Colman sein Schwert in die Scheide zurück.
Colman war ein Herr von gutem Ansehen und hatte das Kommando über die Verteidigung von Glendalough. Doch dies war mehr als alles andere ein Ehrentitel, der ihm vom örtlichen Rí Túaithe, dem Colman Gefolgschaft leistete, verliehen worden war, und diente ihm hauptsächlich dazu, indirekt Geld von den ihm unterstellten Bewohnern Glendaloughs in seine Taschen umzuleiten. Colman mochte einst ein Krieger gewesen sein, aber diese Tage waren lange vorbei. Seine körperliche Verfassung hatte sehr gelitten unter dem luxuriösen Leben, wie es sich nur ein Mann mit seinen Mitteln leisten konnte.
Unwillkürlich dachte Failend an die Unterschiede zwischen ihrem Mann und dem schlanken, muskulösen Louis de Roumois. Wäre Louis bewaffnet gewesen und hätten beide die Klingen gekreuzt, so hätte der junge Franke ihren fetten Gemahl vermutlich getötet, auch wenn Failend sich da nicht völlig sicher war.
Und sie würde es wohl auch nie herausfinden. Colman hatte Louis gehen lassen. Das hieß wohl, dass sie den Ärger nicht wert war, den eine Anklage wegen Totschlags nach sich ziehen würde. Oder das Wergeld, das dafür vielleicht zu zahlen wäre.
Sie fragte sich, ob Louis de Roumois wohl bereit gewesen wäre, Colman zu töten, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Ob er sein Leben oder seine Freiheit für ihre Ehre riskieren würde.
Vielleicht, wenn Colman gekommen wäre, bevor er mit mir fertig war, dachte sie. Aber wahrscheinlich nicht mehr danach. Failend war keine Frau, die sich in romantischen Schwärmereien erging.
Colman fuhr herum, während er sein Schwert wegsteckte. Ihre Blicke kreuzten sich, und eine Vielzahl unschöner Gefühle stieg dabei in ihr auf: Ekel, Verachtung, Hass, Wut. Bedauern war nicht darunter, so wenig wie Kummer oder Demut.
»Denk nicht, dass mir entgangen wäre, wie lange das schon so geht«, stellte Colman fest. Seine Stimme blieb bedrohlich ruhig. »Glaub bloß nicht, ich wüsste nicht, wie oft du mit dem kleinen Bastard herumgehurt hast.«
Failend funkelte ihn herausfordernd an. »Wenn du ein richtiger Mann wärest, müsste ich vielleicht nicht anderswo nach Befriedigung suchen«, fauchte sie, obwohl ihr gleich klar wurde, dass sie ihn damit nicht verletzen konnte. Colman war zu reich, zu mächtig und zu alt, um sich Kritik an seinen groben Bemühungen im Bett besonders zu Herzen zu nehmen.
Sie war Jungfrau gewesen, natürlich, als sie vor vier Jahren geheiratet hatten. Ihr Vater war kein armer Mann. Er war einer der wohlhabenderen Kaufleute in Glendalough, einer der Aire Déso, ein Herr der Pächter und bedeutsamer Mann, wenn auch nicht annähernd von Colmans Rang. Für ihn war die Ehe seiner Tochter mit Colman mac Breandan eine Möglichkeit gewesen, die Stellung seiner Familie erheblich zu verbessern; nicht nur in der Klosterstadt, sondern in der ganzen Region und darüber hinaus.
Colman besaß hunderte Stück Vieh und erhielt jedes Jahr einhundertfünfzig weitere von seinen Gefolgsleuten. Ihm gehörten Schmieden und Brauereien sowie ein halbes Dutzend Schiffe, die seine Waren nach England und in noch weiter entfernte Länder transportierten. Er leistete großzügige Stiftungen an die Kirche, war mächtig und angesehen. Das machte ihn zum idealen Ehemann, ungeachtet seines Alters, seiner Erscheinung und gelegentlicher Unaufrichtigkeit.
Failend war jung gewesen und wusste nichts von der Welt, und sie hatte keine Einwände gehabt gegen diese Ehe. Jeden Widerwillen, den sie vielleicht bei dem Gedanken verspürt hatte, Colman beizuliegen, tat sie als natürliche Furcht davor ab, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Ihre Hochzeitsnacht war so schmerzhaft und unangenehm gewesen, wie sie es sich vorgestellt hatte, aber sie hatte sich gesagt, dass es im Laufe der Zeit besser werden würde. Und das wurde es, wenn auch nicht viel.
Das erste Jahr verging, und Failend, nachdem sie so zum Erwachsenwerden gezwungen worden war, fühlte sich zunehmend unruhig und neugierig auf die Welt jenseits der Stadt. Durch klug dosierte Streitereien und das Verweigern von Gefälligkeiten überzeugte sie ihren Mann schließlich, sie auf eine Rundreise zu seinen Besitztümern mitzunehmen. Wochenlang bereisten sie das Umland. Failend genoss fast jeden Augenblick davon, doch es stillte ihre Unruhe nicht. Ganz im Gegenteil. Ihre Neugier wuchs, und mit ihr eine Sehnsucht nach etwas, das sie nicht klar benennen konnte.
Weitere Jahre vergingen, und Failend kam zu dem Schluss, dass möglicherweise ein Liebhaber das war, was ihr fehlte; einer mit mehr Geduld und Geschick, mit weniger Haaren am Körper und mehr auf dem Kopf als bei ihrem Mann. Also gewann sie schließlich einen, dann einen anderen. Und dann Louis de Roumois, den besten von ihnen. Und der stellte sie zufrieden. Ein wenig, jedenfalls. Aber sie wusste, dass die körperliche Lust nicht alles war, was sie suchte.
Die Erregung, die sie bei diesem hässlichen Zwischenfall empfunden hatte – ihr Mann und Louis, dazu die geschwungene Waffe –, das kam der Sache schon näher. Es erinnerte sie an den Augenblick der Reise, als sie und Colman auf dem Weg durch das Umland von Räubern überfallen worden waren. Es war nichts Großartiges gewesen. Im Leben eines echten Kriegers, so vermutete sie, war dieser Zwischenfall kaum eine Erwähnung wert. Für sie jedoch, die an solche Dinge nicht gewöhnt war, kam es einer Schlacht gleich.
Sie hatten die Nacht in einem Gasthaus an einer Kreuzung verbracht, jene Art von Kaschemme, wo Rauch und Schatten stets willkommen waren, weil sie verbargen, was sonst noch in den dunklen Ecken lauerte. Im Morgengrauen waren sie auf dem Rücken ihrer Pferde wieder aufgebrochen. Colman reiste nie mit weniger als einem Dutzend Männern als Leibwache, aber an diesem Tag waren fünf von ihnen aus irgendeinem Grund aufgehalten worden – Failend erinnerte sich nicht mehr genau an den Grund. Vermutlich waren sie ausgesandt worden, um eine überfällige Pacht einzufordern. Ohne diese Männer bestand ihre Reisegesellschaft jedenfalls nur noch aus acht Reitern, die allein auf der Straße unterwegs waren, und eine von ihnen war eindeutig eine Frau. Die geringe Zahl hatte den Räubern wohl den Mut verliehen, ihnen aufzulauern.
Sie kamen aus einem Wäldchen heraus, das ein Stück abseits der Straße lag. Mit Keulen und Äxten stürmten sie heran, und einer der Räuber hielt ein Schwert in die Höhe. Es mussten zehn gewesen sein, nahm Failend an, auch wenn sie damals viel zu erschrocken gewesen war, um zu zählen. Die Wachen zogen ihre Waffen, und Colman zückte sein Schwert. Failend zügelte ihr Pferd, und bevor einer von ihnen mehr tun konnte, waren die Angreifer über sie gekommen.