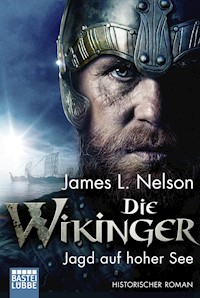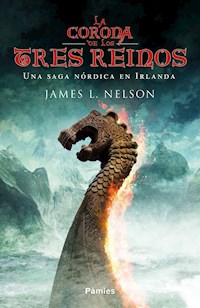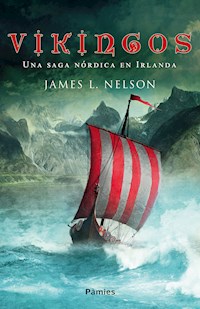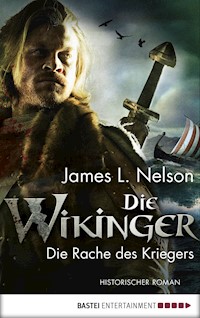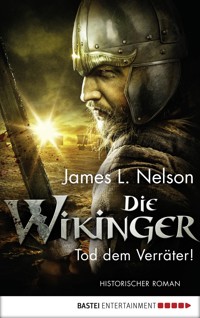
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Irland, Mitte des 9. Jahrhunderts: Im Kampf um die Abtei Glendalough hat Thorgrim Nachtwolf bis auf zehn Männer alles verloren. Ein vermeintlicher Freund hat ihn und seine treuen Wikinger schändlich verraten. Noch auf der Flucht schwört Thorgrim, neue Verbündete zu finden - und Rache zu üben. Tatsächlich gelingt es ihm, bei einem erneuten Überfall auf Glendalough Gold zu erbeuten. Genug, um siebzig Männer anzuwerben. Genug, um den Angriff auf den verräterischen Kevin zu wagen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Hinweis
Widmung
Erklärung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Epilog
Glossar
Dank
Über das Buch
Irland, Mitte des 9. Jahrhunderts: Im Kampf um die Abtei Glendalough hat Thorgrim Nachtwolf bis auf zehn Männer alles verloren. Ein vermeintlicher Freund hat ihn und seine treuen Wikinger schändlich verraten. Noch auf der Flucht schwört Thorgrim, neue Verbündete zu finden – und Rache zu üben. Tatsächlich gelingt es ihm, bei einem erneuten Überfall auf Glendalough Gold zu erbeuten. Genug, um siebzig Männer anzuwerben. Genug, um den Angriff auf den verräterischen Kevin zu wagen …
Über den Autor
Bevor er sich entschied, über das Segeln zu schreiben, lebte und arbeitete James L. Nelson sechs Jahre lang an Bord traditioneller Segelschiffe. Seine zahlreichen Sachbücher und Romane wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit Preisen der American Library Association. Nelson liest in ganz Amerika aus seinen Büchern und tritt regelmäßig im Fernsehen auf. Er lebt mit seiner Frau Lisa und den gemeinsamen Kindern in Harpswell, Maine.
James L. Nelson
DIE WIKINGER
Tod dem Verräter!
HISTORISCHER ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Alexander Lohmann
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2016 by James L. NelsonTitel der amerikanischen Originalausgabe: »Night Wolf«Originalverlag: Fore Topsail Press
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Frank Weinreich, BochumTitelillustration: © Arndt Drechsler, Regensburg, unter Verwendung einer Fotografie von Thomas LewinUmschlaggestaltung: Thomas KrämerE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-7256-4
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Der vorliegende Roman ist frei erfunden. Namen, Figuren, Orte und Ereignisse sind entweder vom Autor ausgedacht oder werden ausschließlich fiktional verwendet. Jede Übereinstimmung mit tatsächlichen Geschehnissen, Schauplätzen, Organisationen oder Personen, lebend oder bereits verstorben, ist rein zufällig und weder vom Autor noch vom Verlag beabsichtigt.
Steve Cromwell gewidmet, in Dankbarkeit für die gute Arbeit, mit der Du das Gesicht der Reihe gestaltet hast, und für all deine Freundlichkeit in diesen Jahren.
GESTALTWANDLER: Eng verbunden mit dem Berserker-Glauben hielt man jene, die man als Hamrammir (Gestaltwandler) bezeichnete, für fähig, des Nachts oder in Zeiten großer Anspannung ihre Körper zu verlassen (die dann scheinbar schlafend zurückblieben) und die körperliche Gestalt von Tieren anzunehmen, wie von Bären oder Wölfen.
AUS DEM GLOSSAR VON »DIE ISLÄNDISCHEN SAGAS«
Stets ging er früh am Abend schlafen und wachte früh am Morgen wieder auf. Die Leute meinten, dass er ein Gestaltwandler sei, und sie nannten ihn Kveldulf (Nachtwolf).
EGILS EAGA
Weitere Begriffe finden Sie im Glossar.
Prolog
DIE SAGA VON THORGRIM ULFSSON
Einst lebte ein Mann mit dem Namen Thorgrim Ulfsson, der Sohn von Ulf Ospaksson, der als Ulf der Listige bekannt geworden war. Thorgrim war ebenfalls schlau und ein geschickter Krieger dazu, sodass die Männer ihn bald als einen Anführer ansahen. Wenn er eine Schwäche hatte, so war es die üble Stimmung, die ihn nach Sonnenuntergang oft befiel. Er war dann so reizbar, dass niemand sich ihm zu nähern wagte. Manch einer glaubte, dass er ein Gestaltwandler sei, und dies trug ihm den Namen Thorgrim Kveldulf ein, was Nachtwolf bedeutet. In seinen jüngeren Jahren suchte der Wolfsgeist ihn häufig heim, doch als er älter wurde, fand er, dass es seltener geschah, und im Großen und Ganzen war er froh darüber.
Als junger Mann ging Thorgrim mit einem heimischen Jarl auf Wikingerfahrt, der als Ornolf der Rastlose bekannt war. Viele Sommer lang plünderten sie in der Gegend von England und mitunter an so weit entfernten Orten wie dem Frankenreich. Die Beute war gut in diesen Tagen, und Ornolf, der schon vorher wohlhabend gewesen war, wurde noch reicher, während die Männer, die mit ihm segelten, gleichfalls zu Wohlstand gelangten. Aber von all diesen Männern schätzte Ornolf Thorgrim am meisten, und so bot er ihm die Hand seiner Tochter Hallbera an. Das war eine Verbindung, die Thorgrim nur zu gerne einging. Er zahlte Ornolf fünfzig Silbermünzen als Brautgeld, und Ornolf überließ seiner Tochter einen ertragreichen Bauernhof als Mitgift.
Thorgrim und Hallbera führten eine gute Ehe, und sie waren glücklich. Thorgrim gab die Raubzüge auf und kümmerte sich um seinen Hof und um seine Familie, zu der bald auch zwei Söhne – Odd und Harald – sowie eine Tochter namens Hild gehörten. Odd, der Älteste, war ein ernsthafter Junge, der hart und gewissenhaft arbeitete. Harald war ebenfalls fleißig, doch er träumte davon, wie sein Vater und sein Großvater auf Wikingerfahrt zu gehen. Harald verwendete großen Eifer darauf, von Thorgrim alles über den Gebrauch von Waffen zu erlernen, und er suchte auch jeden anderen auf, der ihm etwas darüber beibringen konnte. Wenn er seine täglichen Pflichten erledigt hatte, zog sich Harald oft an eine verborgene Stelle im Wald zurück, wo er mit Schwert, Axt, Speer und Schild übte.
Viele Jahre vergingen, und Thorgrim mehrte seinen Wohlstand und seinen Ruf. Odd heiratete, und Thorgrim überließ ihm den Bauernhof, den Ornolf ihm als Mitgift gegeben hatte. Dann, nachdem Thorgrim schon vierzig Winter erlebt hatte, stellte Hallbera fest, dass sie wieder schwanger war. Sie war nicht mehr jung, und sie starb bei der Geburt, was Thorgrim das Herz brach.
Thorgrims Schwiegervater Ornolf wollte noch einmal auf Wikingerfahrt gehen, dieses Mal nach Irland, und weil Thorgrim feststellte, dass er ohne Hallbera auf seinem Hof nicht mehr glücklich war, schloss er sich ihm an. Thorgrim nahm den inzwischen fünfzehn Jahre alten Harald mit. Sein Sohn war nicht übermäßig groß, aber dafür sehr kräftig, und er erwarb sich bald den Spitznamen »Starkarm«. Nachdem er sich so lange und eifrig im Waffenhandwerk geübt hatte, war ein guter Krieger aus ihm geworden, auch wenn er nicht die Schläue seines Vaters besaß.
Ornolf und seine Mannschaft segelten an Bord von Ornolfs Schiff, dem Roten Drachen, nach Irland, und dort erlebten sie viele Abenteuer und gewannen und verloren mehrere Vermögen. Ornolf starb im Kampf gegen einen Dänen mit Namen Grimarr der Riese, Herr eines Vík-ló genannten Longphorts. Nachdem Harald Grimarr getötet hatte, wurde Thorgrim der Herr von Vík-ló. Er und seine Männer verbrachten genau wie Grimarrs frühere Gefolgsleute dort den Winter und bauten Schiffe, mit denen sie im Frühjahr wieder zu Raubzügen aufbrechen wollten.
Als der Frühling endlich kam, erschien in Vík-ló ein Ire namens Kevin mac Lugaed, mit dem die Nordmänner zuvor bereits Handel getrieben hatten. Er schlug vor, dass seine Krieger und Thorgrims Krieger sich vereinen sollten, um ein Kloster an einem Ort zu überfallen, der Glendalough genannt wurde. Thorgrim und seine Leute stimmten dem zu, und unterwegs stieß noch eine weitere Streitmacht von Nordmännern zu ihnen, die von einem Mann namens Ottar Thorolfson angeführt wurde, dessen Spitzname »Blutaxt« lautete.
Thorgrim und Ottar begaben sich nach Glendalough, indem sie ihre Schiffe so weit den Fluss hinaufruderten, wie sie nur konnten. Glendalough war tatsächlich ein reiches Kloster, doch bevor sie dorthin gelangten, stießen sie auf ein großes Heer der Iren, gegen das sie kämpften. Thorgrim wurde von Kevin verraten, der noch vor der Schlacht die Seiten gewechselt hatte, und dann auch noch von Ottar, der sich in der Nacht davonstahl. Ottar und seine Männer machten sich mit allen Schiffen davon, mit Ausnahme von Thorgrims Schiff Meereshammer, dem sie ein Leck geschlagen hatten. Ottar wollte nach Vík-ló und den Longphort und sämtliche der dortigen Reichtümer für sich beanspruchen. Thorgrim und dessen Krieger ließ er zurück, damit sie unter den Schwertern der Iren den Tod fänden.
Die irischen Krieger richteten unter Thorgrims Leuten ein großes Massaker an, während diese zu entkommen versuchten, und am Ende lebten nur noch der Nachtwolf und zehn seiner Männer. Die Iren versuchten, den Meereshammer zu verbrennen, aber durch einen schlauen Trick konnte Thorgrim sie in die Flucht schlagen, bevor sie das Schiff in Brand steckten. Dann ließ Thorgrim das Loch so gut wie möglich zustopfen, und er und seine verbliebenen Männer segelten mit dem Schiff flussabwärts bis zu einer Stelle, wo sie den Schaden richtig ausbessern konnten. Thorgrim gelobte, dass er an jenen Rache nehmen würde, die ihm all dieses Unrecht zugefügt hatten.
Und davon erzählt die folgende Geschichte …
1. Kapitel
Ich, der ich dem Schwert eine Stimme gebe,hörte zwei Eistaucher streiten,und wusste, bald wird Blut fließen.
GISLI SURSSONS SAGA
Sechs Meilen flussabwärts von Glendalough fand Thorgrim Nachtwolf die Stelle am Fluss, wo er den Meereshammer, sein Langschiff, an Land setzen wollte. Er hatte den Ort bereits bei ihrer Fahrt flussauf entdeckt und sich eingeprägt. Das war vor einer Woche gewesen.
Damals war ihm natürlich nicht die Idee gekommen, dass er und seine Männer bald einen Platz benötigen würden, an dem sie ihr Schiff verstecken und ausbessern konnten, um eine verzweifelte und so gut wie aussichtslose Flucht fortsetzen zu können. Aber auch wenn ihm dieser Gedanke völlig ferngelegen hatte, hatte er doch diese Stelle wahrgenommen und im Gedächtnis behalten. Vielleicht hatten die Götter ihm eine Eingebung geschickt. Thor, der ihm zur Seite stehen wollte. Oder Loki, der ihm einen Streich spielte, um sein Leiden zu verlängern.
Die Stelle lag am Südufer, was wenig genug zu bedeuten hatte auf einem Gewässer, das so viele Furten zur Überquerung aufwies. Dennoch brachte es das Wasser zwischen die Nordmänner und das Kloster sowie das Lager, von dem aus die Berittenen sie verfolgen würden. Der Fluss war zu beiden Seiten dicht bewaldet, sodass die Nordmänner von Weitem nicht zu sehen waren und nur entdeckt werden konnten, wenn jemand sich den Weg durchs Gehölz bis ans Ufer bahnte. Eine steinige Sandbank reichte bis in den Strom hinaus und eignete sich perfekt, um das Schiff auf Grund zu setzen. Der weite Bogen im Fluss, in dem sich der Kies hier abgesetzt hatte, verbarg das Schiff auch vor Blicken von stromauf- und -abwärts.
»Dort«, sagte Thorgrim so, dass man ihn vernahm, aber nicht übertrieben laut. Der Kiesstreifen erstreckte sich zweihundert Fuß vor ihnen, und er sprach zu der Handvoll Männer an den Rudern, damit sie wussten, dass ihre Mühen bald ein Ende hatten. Er selbst führte die Ruderpinne und hielt das Schiff so gut es ging in der Mitte des Stroms.
Vor sich sah er einige Köpfe herumschwingen und einen Blick riskieren; nicht viele Köpfe, denn es waren auch nicht mehr viele Männer an Bord. Harald, sein Sohn. Der baumlange Godi, der gegenüber von Harald am Ruder zog. Ein Krieger namens Olaf Thordarson, der mit ihnen aus Dubh-Linn gekommen war, und ein anderer namens Ulf. Insgesamt waren es zehn Männer, einschließlich Starri dem Unsterblichen, der beim ersten Kampf gegen die Iren verwundet worden und an Bord des Meereshammers zurückgeblieben war, als sie zum Angriff auf Glendalough aufgebrochen waren. Zehn Männer von mehr als zweihundert, die von Vík-ló aus zu diesem Raubzug losgesegelt waren.
»Harald, mach ein paar Taue bereit, damit wir sie zu den Bäumen am Ufer legen können«, rief Thorgrim. Harald nickte, holte sein langes Ruder ein und legte es auf den Seekisten ab, die die Ruderer als Bänke benutzten. Das fehlende Ruder verlangsamte die Fahrt der Meereshammer kaum, denn hauptsächlich trieb die Strömung das Schiff voran. Die Männer an den Riemen beschränkten sich im Wesentlichen darauf, das Schiff auf Kurs zu halten, den Rumpf in Fahrtrichtung zu halten und ein wenig zusätzlichen Vortrieb zu liefern, damit das Steuerruder greifen konnte.
Und das war auch gut so, denn zehn Männer – zehn verletzte, erschöpfte, entmutigte Männer – und dazu zwei Gefangene, einer davon eine Frau, hätten unmöglich ein fünfundsechzig Fuß langes Schiff aus Eichen- und Kiefernholz aus eigener Kraft bewegen können.
»Ein Zug noch! Dann holt die Ruder ein!«, rief Thorgrim danach, und die verbliebenen Männer – fünf an Backbord und vier an Steuerbord – hängten sich ein letztes Mal in die Riemen, zogen daraufhin die Ruder ein und legten sie ab, wie Harald es getan hatte. Thorgrim drehte die Ruderpinne, und der Meereshammer schwenkte zur Seite. So lief er nicht mit dem Bug voran auf den Kies, sondern glitt mit der gerundeten Flanke des Schiffsbodens ins seichtere Wasser, auf eine Weise, bei der die Sandbank das angeschlagene Schiff so wirksam wie möglich stützen würde.
Eine leichte Erschütterung lief durch den Rumpf, als dieser aufsetzte, und Harald sprang mit den Tauen in der Hand über die Bordwand und auf die Sandbank hinab. Das Wasser, das einen Zoll hoch auf dem Deck des Meereshammers stand, schwappte wie eine kleine Brandungswelle zur Backbordseite.
Noch zehn Minuten, und wir wären im Flussbett gestrandet, dachte Thorgrim. Sie hatten das zwei Fuß breite Loch im Schiffsboden mit den Tuniken der Toten ausgestopft, aber so ließ sich ein Leck kaum wirkungsvoll abdichten.
Der Meereshammer war als Einziges von neun Schiffen zurückgeblieben, nachdem Ottar der Verrückte und seine Männer Thorgrims Krieger in den Stunden vor dem Morgengrauen im Stich gelassen hatten, sodass sie allein den Iren in der Schlacht gegenüberstanden. Thorgrims Schiff war nur deswegen zurückgelassen worden, weil Ottars Bruder Kjartan sich gegen den Verrückten gestellt und ein Loch in den Rumpf geschlagen hatte, um zu verhindern, dass Ottar auch dieses Schiff stahl. Thorgrim und die Handvoll Männer, die dem Massaker durch die Iren entgangen waren, hatten es dann halb versunken am Flussufer gefunden.
Später waren auch die Iren auf das Schiff gestoßen. Es waren zwanzig Männer gewesen, berittene Krieger – zu viele, als dass die Wikinger es mit ihnen hätten aufnehmen können. Während Thorgrim und seine Leute vom Schutz der Bäume aus zusahen, hatten die Iren sich angeschickt, das Boot zu verbrennen. Das war für Thorgrim zu viel gewesen. Er wäre lieber gestorben, als auch noch diese letzte Demütigung hinzunehmen.
Am Ende war so ein Opfer nicht notwendig gewesen. Thorgrims Gefangener, sein männlicher Gefangener, war ein Ire namens Louis, und Thorgrim hatte ihn vorgeschickt, um die irischen Reiter zu vertreiben, indem er ihnen einredete, dass sechzig Wikinger den Fluss entlang auf sie zuhielten. Mit den paar Männern, die ihm geblieben waren, hatte Thorgrim dann die Ankunft einer viel größeren Truppe vorgetäuscht, und das hatte ausgereicht, um die Iren zum Abzug zu bewegen. Er wusste jedoch, dass sie nicht lange wegbleiben würden, und wenn sie zurückkamen, würden es nicht mehr nur zwanzig Mann sein.
Als der Hufschlag in der Ferne verklang, führte Thorgrim seine Männer zurück an Bord des Meereshammers. Das Schiff war zwar übel leckgeschlagen, aber sie mussten nicht weit damit kommen, nur ein Stück weiter, als die Iren voraussichtlich nach ihnen suchen würden.
»Wir brauchen etwas, um das Loch abzudichten«, sagte Thorgrim, nachdem er durch das klare Wasser, das den Schiffsrumpf geflutet hatte, einen Blick auf den Schaden geworfen hatte. Er richtete sich auf und blickte umher. Überall am Ufer lagen Tote. Die meisten davon waren seine eigenen Leute; jene Männer, die er zurückgelassen hatte, um die Schiffe zu schützen. Sie hatten ihr Leben dafür hingegeben, doch es waren nicht annähernd genug gewesen, um die beinahe dreihundert Mann unter Ottars Kommando aufzuhalten.
Aber nicht alle Toten gehörten zu Thorgrim. »Sucht euch ein paar von Ottars Gefallenen«, ordnete Thorgrim an. »Zieht ihnen die Tuniken aus und bringt sie mir. Schneidet sie ihnen einfach vom Leib.« Thorgrim quälte bereits der Gedanke an die Männer, die wegen seiner Fehleinschätzung gestorben waren. Es quälte ihn, dass keine Zeit blieb, um sie anständig zu bestatten. Der Gedanke, dass er ihre Leichen auch noch nackt und aufgedunsen zurücklassen musste, sodass Raben und Wölfe sich daran gütlich tun würden, war ihm gänzlich unerträglich.
Die anderen bestätigten seine Worte mit einem Nicken und gingen zurück an Land, um die Leichen zu finden, denen sie die Kleidung nehmen konnten. Sie schlurften, sie humpelten, sie bewegten sich unter offensichtlichen Schmerzen. Alle waren während des Kampfes in irgendeiner Form verwundet worden, hatten einen Schwertstreich abbekommen, einen Stich mit dem Speer oder einen Huftritt. Sie waren verletzt, aber sie konnten sich noch bewegen, und deswegen hatten sie überlebt. Jene, die zu schwer verwundet worden waren, um zu laufen, hatten die Iren auf dem Schlachtfeld niedergemacht.
Einer nach dem anderen kehrten die Männer wieder zurück, mit Bündeln von Kleidung, die am Morgen noch lebende Krieger umhüllt hatte, und Thorgrim wusste, dass er eine weitere Entscheidung treffen musste. Eine härtere Entscheidung. Er nahm die Tuniken entgegen und ließ den Blick noch einmal über das Ufer schweifen. Seine Männer waren im Kampf gefallen. Die Walküren waren schon bei ihnen gewesen – sie mussten es gewesen sein; es war bereits Stunden her. Welchen Nutzen hatten die Männer dann noch von ihren Waffen? Inzwischen tafelten sie in Odins Halle, oder sie würden nie dorthin gelangen.
»Vier von euch sollen nach Helmen suchen, um das Schiff auszuschöpfen.« Thorgrim wies auf das Wasser im Rumpf des Meereshammers, das an der tiefsten Stelle einen Fuß hoch stand. »Die Übrigen sammeln sämtliche Schwerter, Schilde, Kettenhemden und Waffen, die sie finden können, und bringen sie an Bord.«
»Von Ottars Männern, Herr?«, fragte Ulf. »Oder von allen Toten?«
»Von allen. Sie brauchen keine Waffen mehr«, erklärte Thorgrim, und sein Tonfall lud nicht zur Widerrede ein. »Und nenn mich nicht ›Herr‹«, fügte er hinzu. »Es gibt nichts mehr, worüber ich noch herrschen würde. Nicht einmal einen Misthaufen. Gar nichts mehr.«
Ich bin kein Herr, weil ich ein Dummkopf bin, dachte er.
Wieder kletterten die Männer über die Bordwand und schwärmten am Ufer aus. Starri der Unsterbliche humpelte hinterher, seine Wunde war schwerer als die der anderen, und die Ereignisse des Tages hatten das noch verschlimmert. Er war hier gewesen, als Ottars Männer eintrafen, hatte trotz seiner Schmerzen zu den Waffen gegriffen und gekämpft, bis er zusammengebrochen war. Aber die Qual, nichts zu tun, war für Starri schlimmer als jeder Schmerz, den die Bewegung auslösen mochte.
»Starri«, sagte Thorgrim, als Starri mühsam ein Bein über den Rand des Bootes schwang. »Bleib an Bord und lausche, ob du die Reiter zurückkommen hörst. Keiner der anderen würde sie so früh bemerken wie du.«
Starri nickte. Sein Gehör war legendär. Er zog sein Bein wieder zurück und stieg auf das Vorderdeck, lehnte sich dort gegen den hohen Bugsteven. Der elegant geschwungene Pfahl endete zehn Fuß über ihm in einem geschnitzten Haupt: das Haupt Thors, der rachsüchtig und bedrohlich über den Bug des Schiffes hinausblickte. Nun spähten Thor und Starri gemeinsam auf das Land jenseits des Flussufers und achteten wachsam auf jedes Anzeichen einer Bedrohung.
Thorgrim breitete die zerschnittenen Tuniken über der Bordwand aus und kniete sich ins Wasser am Boden des Schiffsrumpfs. Er nahm eine der Tuniken und stieß sie in das Loch, drückte den Stoff so fest in einen Winkel der Öffnung, wie er nur konnte, dann griff er nach einer weiteren.
Er hörte, wie jemand an Bord kam, und im nächsten Augenblick das Spritzen von Wasser. Er blickte über die Schulter. Harald schöpfte bereits mit einem Lederhelm Wasser zurück in den Fluss. Thorgrim hatte damit gerechnet, dass er sich für diese Aufgabe entscheiden würde. So gern Harald auch den erwachsenen Mann gab, Thorgrim konnte sich doch nicht vorstellen, dass ihm der Gedanke gefiel, Leichen Rüstungen auszuziehen.
»Harald«, sagte Thorgrim. »Warte wenigstens, bis ich das Loch verstopft habe, bevor du zu schöpfen anfängst.«
Harald lief rot an. »Oh … Ja … Natürlich.« Das war alles, was er hervorbrachte. Harald war stets gern der Erste bei allem, und manches Mal handelte er vorschnell.
Zwei weitere Tuniken, und das Loch war so gut abgedichtet, wie es auf diese Weise nur möglich war. Thorgrim wusste genau, dass das Wasser weiter hineinströmen würde, aber nicht schneller, als sie es herausschöpfen konnten. Jedenfalls für eine Weile.
»In Ordnung«, sagte er. »Du kannst jetzt anfangen.«
Harald machte sich gleich ans Werk, er füllte den Helm und schleuderte das Wasser über die Bordwand. Er war nun schon seit mehreren Jahren unterwegs. Wikingerboote waren die besten Schiffe der Welt – schnell, beweglich, wendig und hochseetauglich –, aber es blieben im Grunde einfache Langboote, groß und oben offen, und so hatte Harald wie alle anderen Seefahrer aus den nördlichen Ländern beträchtliche Erfahrung im Wasserschöpfen.
Thorodd Bollason schloss sich Harald in seinen Bemühungen an und schleuderte mit großem Eifer Wasser über die Bordwand, ungeachtet einer klaffenden Wunde am Oberarm, die von einem irischen Schwertstreich zurückgeblieben und mit einem blutdurchtränkten Verband umwickelt war. Zwei weitere Männer, Vali und Armod, kamen hinzu, und es dauerte nicht lange, bis Thorgrim sehen konnte, wie der Wasserstand im Schiff fiel.
Er spähte den Fluss entlang und beurteilte die Stärke der Strömung. Da hörte er, wie etwas aufs Deck polterte, spürte die Planken unter seinen Füßen erbeben und wandte sich um. Godi ließ eine beachtliche Menge von Kettenhemden, Schwertern und Äxten über den Bootsrand am Bug fallen. Hinter ihm standen weitere Männer an, die ähnlich beladen waren. Sie schauten grimmig drein. Genau wie Thorgrim wussten sie, dass es nötig war, was sie da taten, aber sie waren nicht froh darüber.
Thorgrim blickte auf den Uferstreifen. Seine Leute kehrten wieder zu den Toten zurück und plünderten sie, doch die zwei Gefangenen standen nur mit verschränkten Armen daneben und schauten zu. Sie waren ihm ein Rätsel, der Mann und die Frau, die beide Kettenhemden und Schwerter getragen hatten, wobei man ihnen Letzteres abgenommen hatte. Sie waren am Wasser entlang flussabwärts gewandert und dabei auf Thorgrim und seine Männer gestoßen. Soweit Thorgrim sagen konnte, waren es Iren, aber er hatte trotzdem das Gefühl, dass sie vor irgendwas oder irgendjemandem auf der Flucht waren.
Der Mann trug einen Sack über der Schulter, und Thorgrim hatte von Anfang an richtig vermutet, dass sich eine kleine Truhe mit Silber, Gold und Juwelen darin befand.
Diebe?, überlegte Thorgrim. Vielleicht, aber sie waren besser gekleidet und bewaffnet als jeder umherstreifende Räuber, den Thorgrim je gesehen hatte. Nicht, dass das im Augenblick von Bedeutung war. Wer auch immer sie waren, sie würden nicht müßig herumstehen.
»Harald!«, rief Thorgrim. »Sag unseren neuen Freunden dort, sie sollen sich ein paar Helme suchen und schöpfen.«
Harald nickte und rief den beiden an Land etwas zu, erklärte ihnen etwas auf Irisch. Er hatte während ihres Aufenthalts in diesem Land viel von der einheimischen Sprache aufgeschnappt, getrieben von dem Wunsch, mit den verschiedenen irischen Frauen zu sprechen, die er getroffen hatte, was auch immer ihm das eingebracht hatte.
Widerwillig hoben die Gefangenen Helme auf, kletterten an Bord und begannen zu arbeiten. Thorgrim spürte, wie sich das Schiff unter ihm bewegte. Der Kiel löste sich vom Boden. Mehr Wasser ging über den Rand, und der Meereshammer richtete sich weiter auf.
»Nachtwolf«, rief Starri vom Bug. »Reiter.«
Thorgrim nickte. »Das war’s«, rief er. Diese Reiter mochten die Iren sein, die mit zusätzlichen Männern zurückkehrten, oder auch nicht. Aber sie durften nicht abwarten, bis sie es genauer erfuhren. Thorgrim blickte über die Bordwand hinab. Das Schiff schien zu schwimmen und lag hoch genug im Wasser, um es vom Ufer zu lösen. »Schiebt es in den Fluss, verschwinden wir!«, sagte er. Die Männer, die am Ufer die Waffen einsammelten, hörten damit auf und stemmten ihre Schultern gegen den Rumpf. Harald sprang über Bord und tat dasselbe.
Mit einem Minimum an Grunzen und Fluchen löste sich der Bug des Meereshammers vom steinigen Ufer, und bevor die Männer, die das Schiff angeschoben hatten, an Bord kletterten, drehten sie es noch so, dass es flussabwärts zeigte. Die Strömung ergriff das Schiff und trug es davon. Thorgrim hielt Kurs, bis das Schiff Fahrt aufnahm. Sie ließen die Biegung hinter sich und waren außer Sicht, bevor die Reiter am Ufer auftauchten.
Zwei Stunden lang bewegten sie sich flussabwärts, ruderten und schöpften Wasser, bis der Meereshammer endlich auf der Sandbank zur Ruhe kam, die Thorgrim sich eingeprägt hatte.
Harald trat über den Kies auf die Bäume dahinter zu. Dabei entrollte er das Tau, und bald hatte er das Schiff an Bug und Heck festgemacht. Auf Thorgrims Befehl hin ließen die Männer die Rah auf Deck hinab, lösten die Halterung, mit der sie am Mast festgemacht war, und legten die schweren Spiere dann an der Backbordseite ab.
Nachdem das erledigt war, entfernten sie die Spanner, um die unteren Enden der Wanten freizubekommen, den Mast aus dem Mastfuß zu heben und ihn neben der Rah abzulegen. Mit so wenig Männern war das keine leichte Aufgabe, vor allem, wenn diese wenigen in so schlechter Verfassung waren, aber es würde ihnen sehr dabei helfen, das Schiff versteckt zu halten. Wichtiger noch, das Gewicht der Spieren auf der Backbordseite hob das Leck an Steuerbord höher aus dem Wasser, sodass das Schiff nicht weiter volllief.
Thorgrim zog die durchweichten Tuniken aus dem Riss in der Bordwand und konnte das Loch endlich genauer untersuchen. Er kniete auf dem Deck und beugte sich über den Schaden. Im Geiste malte er sich aus, wie die zertrümmerten Planken bis zu den Stellen zurückgeschnitten wurden, an denen sie noch unbeschädigt waren, wo die neuen Stücke angebohrt und die Nägel gesetzt werden mussten, um sie zu halten. Seine Gedanken wanderten zu der Stelle unter dem Deck, wo die Ersatzplanken verstaut lagen. Er ging sie im Kopf durch, wie er es mit den Augen getan hatte, als er sie an Bord genommen hatte.
Der Meereshammer war in jeder Hinsicht Thorgrims Schiff. Er hatte ihn selbst gebaut, gemeinsam mit Aghen Ormsson, dem alten, erfahrenen Schiffsbaumeister, der sich in Vík-ló niedergelassen hatte. All die Wintermonate über hatten Thorgrim und Aghen Seite an Seite gearbeitet und dem Meereshammer sowie den anderen Schiffen, Drache und Blutfalke, Form verliehen. Jeden einzelnen Schritt hatten sie miteinander erörtert, über manches gestritten, während sie bei anderem rasch einer Meinung waren. Sie hatten das Holz ausgesucht, die Planken zurechtgeschnitten, den Kiel, die Spanten und den Mastfuß geplant. Während jeder Mann im Longphort beim Bau mitgeholfen hatte, hatten Thorgrim und Aghen allein alles entworfen.
So hegte Thorgrim auch keinen Zweifel daran, dass er sein Schiff wieder instand setzen konnte. Nicht nur so weit, dass es auf dem irischen Fluss bestehen würde, sondern dass es erneut volle Seetüchtigkeit erlangte. Aber er wusste auch, dass dies keine einfache Aufgabe war.
Ebenso wusste er, dass er nicht schon heute damit beginnen würde. Die Sonne versank bereits im Westen, und während er noch die beschädigten Planken betrachtete, spürte Thorgrim, wie die Erschöpfung ihn einholte. Mit einiger Überraschung wurde ihm klar, dass er und seine Männer erst an diesem Morgen gegen die irischen Reiter um ihr Leben gekämpft hatten, dass es gerade nach der Morgendämmerung gewesen war, als er zugesehen hatte, wie seine Schiffskameraden rings um ihn niedergemetzelt wurden. Es kam ihm vor, als hätte dieses knappe Dutzend Stunden Tageslicht genug Grauen und Wut und Leid für ein halbes Leben gesehen.
Er versammelte die Männer und teilte Wachen ein, und trotz seiner Erschöpfung übernahm er selbst die erste Schicht. Die anderen schleppten sich zu ihren Schlafstellen, und Thorgrim nahm seinen Platz auf dem Achterdeck ein, die Augen auf das im Dunkel versinkende Ufer gerichtet und aufmerksam auf alles lauschend, was aus den nächtlichen Geräuschen hervorstach.
Die Einzelheiten am Ufer verblassten mit dem schwindenden Sonnenlicht, und im selben Maße erschienen die Geister, die Bilder jener Männer, die er an diesem Tag verloren hatte: Agnarr, Skidi Streitaxt, Bersi, Sutare Thorvaldsson, all jene, die sich seinem Befehl anvertraut hatten, die ihm gefolgt waren und die er in den Tod geführt hatte. In seinem Geist sah er sie alle noch lebendig vor sich, und manche standen ihm in dem Augenblick vor Augen, da sie gestorben waren, als irische Schwerter oder Speere sie niedergestreckt hatten.
Er hatte lange schon Männer geführt. Und er hatte Gemetzel erlebt. Aber noch nie war es ihm geschehen, dass seine eigenen Leute auf diese Weise niedergemacht wurden. Und niemals hatte er sich in diesem Maße für ihren Tod verantwortlich gefühlt.
In jüngeren Jahren und selbst bei der Rückkehr nach Irland waren es letztendlich Ornolfs Männer gewesen, die er befehligt hatte, nicht seine eigenen. Er mochte sie geführt haben, aber die Verantwortung hatte auf Ornolfs Schultern und nicht auf den eigenen gelegen.
Er erinnerte sich daran, dass die anderen Schiffsführer – Skidi und Bersi und Kjartan – alle für diesen Raubzug gestimmt hatten. Sie hatten daran teilnehmen wollen, genau wie die ihnen folgenden Männer. Doch dieser Gedanke minderte nicht im Geringsten die Last, die er trug.
»Nie wieder«, sagte er leise zu sich. Die Männer unter seinem Kommando mochten auch in Zukunft einen blutigen und gewaltsamen Tod finden, aber niemals mehr, weil er sich zum Narren halten ließ.
Die Stunden vergingen, und Thorgrim fühlte, wie irgendwo hinter den dichten Wolken die Sterne auf ihrer Bahn über den Himmel zogen. Schließlich weckte er Godi, damit dieser ihn ablöste. Ächzend kam der riesige Kämpfer auf die Beine und streckte sich. Thorgrim sah sich ein letztes Mal um. Alles war still. Ein paar der Männer schnarchten. Er legte sich auf einem Fell an Deck nieder und schloss die Augen. Er war nicht sicher, ob er einschlafen könnte oder welche Träume ihn heimsuchen würden, wenn er es tat. Am Ende jedoch gewann die Erschöpfung die Oberhand, und er schlief tief und traumlos.
Dann schreckte er hoch und wusste, dass etwas nicht stimmte. Er öffnete die Augen und erkannte das graue Dämmerlicht der Rismál, der Stunde des Tageserwachens. Alles war ruhig, niemand gab Alarm, doch er wusste, dass etwas nicht in Ordnung war. Er setzte sich auf, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Godi auf ihn zutrat. Er bewegte sich seitwärts und ließ das Flussufer keinen Moment aus den Augen.
Thorgrim richtete sich auf. Männer kamen zwischen den Bäumen hervor, bewaffnete Männer. Mindestens zwanzig, wahrscheinlich mehr. Es waren Iren, aber sie sahen nicht wie Krieger aus. Es waren viel schlimmere Gesellen.
2. Kapitel
Ein großzügiger und besonnener Mann der Schilde,Wohlstand brachte er Temair,Er bot Schutz gegen die eisernen Spitzen der Speere,geschmiedet in den Landen der Söhne von Mil.
DIE ANNALEN VON ULSTER
Lochlánn mac Ainmire, vormals Bruder Lochlánn, Novize im Kloster von Glendalough, führte seine zwanzig berittenen Krieger zurück zum Dúnad, dem Lager der Krieger gleich außerhalb der Stadt. Sie ritten schnell, denn sie wussten nicht, ob die Nordmänner ihnen folgten. Doch ob sie das taten oder nicht – Lochlánn war in jedem Fall begierig darauf, mehr Männer zu sammeln, zum Fluss zurückzukehren und die Heiden zu vernichten, bevor sie fliehen konnten. Aber ungeachtet dessen bekam er kaum etwas mit von dem Ritt. Seine Gedanken waren anderswo.
Louis … verflucht soll er sein … Louis … du Mistkerl. Diese unzusammenhängenden Beschimpfungen wechselten einander in seinem Kopf ab, während er ritt. Wut, Verwirrung, Furcht – all das wirbelte in einer unheiligen Mischung durcheinander und ließ ihn kaum einen klaren Gedanken fassen.
Louis de Roumois.
Ein Mitnovize. Ein Franke, ein ehemaliger Krieger, ein zweiter Sohn, von seiner Familie ins Kloster abgeschoben genau wie Lochlánn. Aber dann war Louis dieser misslichen Umstände enthoben und an die Spitze der Klostertruppen gesetzt worden mit dem Auftrag, Glendalough gegen die Heiden zu verteidigen, und er hatte Lochlánn zu seiner Unterstützung mitgenommen. Damit hatte er dem unwilligen Novizen ein Ziel und ein neues Leben gegeben. Er hatte ihm beigebracht, wie er ein Krieger sein konnte, und ihm gezeigt, wie man gegen die Heiden kämpfte.
Louis, du Mistkerl … Und dann hatte Louis den zweiten Mann unter seinem Kommando, einen Hauptmann namens Aileran ermordet und war mit der Frau Colman mac Breandans durchgebrannt, der den nominellen Oberbefehl über die Verteidigung Glendaloughs führte. Auch Colman war inzwischen tot, und Lochlánn hatte keinen Grund zu der Annahme, dass ein anderer als Louis ihn getötet hatte.
Abgesehen von der Tatsache, dass Louis darauf bestand, dass er es nicht gewesen sei.
Dort am Fluss. Gerade als Lochlánn dazu ansetzte, das Schiff der Heiden zu verbrennen, war ausgerechnet Louis de Roumois aus dem Wald gekommen, hatte die Arme ausgebreitet, um anzudeuten, dass er niemandem etwas tun wollte. Lochlánn hatte sein Schwert gezogen, und wäre er nicht so verblüfft gewesen, hätte er Louis vielleicht an Ort und Stelle niedergestreckt.
Louis ergriff das Wort, eindringlich, mit einem flehentlichen Unterton und dem fränkischen Akzent, den Lochlánn so gut kannte. »Lochlánn, zwei Dinge muss ich dir sagen, und du wirst mir zuhören, und dann kannst du mich töten oder nicht, ganz wie du es wünschst«, sagte er.
Lochlánn war immer noch viel zu überrascht, um zu antworten.
»Das Erste ist, Colman entsandte Aileran, um mich zu töten«, erklärte Louis. »Colman wurde von meinem Bruder dafür bezahlt, glaube ich. Es ist kompliziert. Aber ich habe Aileran getötet, weil er mich umbringen wollte.«
»Also hast du Aileran doch getötet?«, fragte Lochlánn. Eine dumme Frage, aber er konnte noch nicht wieder klar denken.
»Ja. Weil er mich töten wollte. Das Nächste ist: Sechzig Heiden kommen in diesem Augenblick den Fluss herauf. Sie sind nicht mehr weit, und sie werden euch alle niedermachen, wenn ihr nicht flieht.«
Lochlánn kniff die Augen zusammen und sah Louis an. Der Rest seiner Männer bewegte sich um Louis herum, um jeden Fluchtversuch zu unterbinden. »Woher weißt du das?«, fragte Lochlánn.
»Weil sie mich geschickt haben. Sie wollen, dass ihr verschwindet. Sie wollen nicht kämpfen. Sie wollen einfach nur weg von hier.«
Lochlánn lag die Antwort auf der Zunge. Warum sollte ich einem Mörder wie dir glauben? Doch bevor er es aussprechen konnte, nahm er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr. Er blickte auf. Zweihundert Fuß flussabwärts traten die Heiden aus dem Wald, die Waffen in der Hand. Sie kamen auf sie zu, genau wie Louis es gesagt hatte.
»Geht«, sagte Louis. »Geht jetzt. Es gibt keinen Grund, warum du und deine Männer sterben sollten.«
Lochlánn zögerte. Er schüttelte den Kopf, nicht um zu widersprechen, sondern weil er hoffte, dass er dadurch klarer denken konnte. Es half nichts. »Komm mit uns«, sagte er.
»Nein«, erwiderte Louis. »Die Heiden halten Failend gefangen. Sie töten sie, wenn ich mit euch gehe.«
Failend. Colmans Frau. Dieser Name erinnerte Lochlánn an etwas anderes. »Colman ist tot«, sagte er. »Hast du ihn etwa auch umgebracht?«
Ein überraschter Ausdruck erschien auf Louis’ Gesicht, und er sah nicht gespielt aus. »Nein«, bestritt Louis die Anschuldigung. »Wie ist er gestorben?«
»Man hat ihm die Kehle durchgeschnitten. In seinem eigenen Haus. Ich war es, der seine Leiche fand. Es sah so aus, als hätte er eine Truhe ausgegraben, aber wenn es so war, dann wurde sie gestohlen.«
Louis wusste keine Antwort darauf. Zum ersten Mal, seit er so plötzlich am Flussufer aufgetaucht war, wirkte er genauso verwirrt wie Lochlánn. Dann gab Senach, der dem Rang nach der Zweite in der kleinen Reiterschar war, einen leisen Warnlaut von sich. Lochlánn blickte auf. Die Heiden wateten weiterhin durch das seichte Wasser auf sie zu, mindestens zehn Männer und wahrscheinlich noch mehr zwischen den Bäumen.
Louis sah, wie Lochlánns Blick flussabwärts wanderte. »Geh«, wiederholte Louis. Lochlánn schob sein Schwert in die Scheide zurück.
»Männer!«, rief Lochlánn. »Lasst uns aufsitzen und verschwinden. Für heute haben wir genug gekämpft.« Und das stimmte auch, obwohl Lochlánn bereits entschieden hatte, dass sie mehr Krieger aus dem Dúnad holen und mit etwas Glück rechtzeitig zurückkehren würden, um die übrigen Heiden zu töten und Louis de Roumois gefangen zu nehmen. Wenn man ein Nest von Giftschlangen aushob, dann ließ man nicht ein paar davon am Leben, damit sie wieder zustoßen konnten.
Er wandte sich an Louis, der gleichfalls zurückwich. »Ich bin nicht fertig mit dir«, sagte er, und Louis reagierte sichtlich gereizt auf diese Worte.
»Pass lieber auf, wie du mit mir sprichst, Junge«, erwiderte er. Die Ruhe in seiner Stimme war verschwunden und wich zunehmender Wut. »Du wusstest gar nichts, bevor ich dich ausgebildet habe, und inzwischen weißt du kaum mehr.«
Lochlánns Männer zogen sich zurück. Sie flohen nicht, bewegten sich aber auf ihre Reittiere zu, und auch Lochlánn trat einen Schritt zurück. Er wies auf Louis. »Du hast Aileran getötet, das hast du selbst zugegeben. Ob du ihn töten musstest oder nicht, das weiß ich nicht. Aber du bist mit Colmans Frau davongelaufen. Für diese Dinge wirst du dich verantworten müssen. Vor dem Gesetz und vor Gott.«
Louis schüttelte den Kopf. »Verschwinde, Junge«, sagte er. »Geh und lern erst mal, wie es in der Welt der Männer wirklich zugeht.«
Das war das Letzte, was Lochlánn mac Ainmire von Louis de Roumois gesehen hatte. Er, Senach und die anderen waren auf ihre Pferde gestiegen und davongaloppiert. Fast eine Stunde waren sie geritten, bis der Turm der großen Kirche von Glendalough in Sicht kam, und Lochlánns Gemüt war in dieser Zeit nicht ruhiger geworden, als es am Fluss gewesen war.
Tatsächlich kannte er Louis gar nicht mal so lange, doch in dieser kurzen Zeit hatte er ihn schätzen gelernt wie keinen anderen Mann, nicht einmal seinen Bruder. Und gewiss mehr als seinen Vater. Dies trieb ihn nun umso mehr dazu, Louis gefangen zu nehmen, die Wahrheit herauszufinden und ihm ein Schwert durchs Herz zu stoßen, sollte Louis sie tatsächlich verraten haben.
Lochlánn ließ sein müdes Pferd in Schritt fallen und hörte, wie die Männer hinter ihm dasselbe taten. Senach trieb sein Tier noch einmal kurz an und setzte sich neben Lochlánn. Eine Weile ritten sie so weiter, ohne etwas zu sagen. Senach war nur wenige Jahre älter als Lochlánn, aber er war ein ausgebildeter Krieger mit einiger Kampferfahrung. Dennoch missgönnte er dem Jüngeren das Kommando nicht. Lochlánns Vater war ein Herr von gutem Ansehen, vermögend und einflussreich, und der junge Mann selbst konnte lesen und schreiben. Das schien Senach zu reichen, um ihn als Anführer anzusehen.
Noch vor wenigen Wochen wäre das auch alles gewesen, was Lochlánn überhaupt vorweisen konnte, das und ein paar spielerische Kampfübungen in seiner Jugend. Aber seitdem hatten er und Senach Seite an Seite in mehreren erbitterten Schlachten gekämpft. Und trotz aller Ängste, die Lochlánn in den Nächten davor wach gehalten hatten, hatte er sich gut geschlagen. Jeder würde zugeben müssen, dass Lochlánn ein fähiger Krieger war.
»Diese Männer …« Lochlánn nickte in Richtung der Reiter hinter ihnen. »Werden sie wieder zurückreiten und sich den Heiden noch einmal stellen? Haben sie noch die Kraft dafür, oder sind sie zu erschöpft?«
»Die Pferde sind zu erschöpft«, erwiderte Senach. »Wir brauchen frische Pferde. Die Männer? Wenn du sie zurückführst, um zu kämpfen, werden sie dir folgen. Sie haben mehr Angst davor, feige zu erscheinen.«
Lochlánn nickte. »Gut«, sagte er. Er war bereit für einen weiteren Kampf, aber ihm war auch klar, dass er möglicherweise ein wenig motivierter war als die anderen.
Sie ritten über eine Anhöhe, und das Dúnad erstreckte sich vor ihnen – jedenfalls das, was vom Dúnad noch geblieben war. Nach den Kämpfen am Morgen waren noch drei- oder vierhundert Männer dort gewesen, von denen einige zu den Bóaire und den Fuidir zählten, den ärmeren Bauern, die keine Freien waren und die man zu dem Kriegsdienst einberufen hatte, den sie ihren Herren schuldeten. Andere gehörten zur Leibgarde oder zu den Kriegern verschiedener Rí Túaithe. Aber schon löste das Heer sich auf; die Bauern kehrten zu ihren armseligen Höfen zurück, die Krieger in die Hallen ihrer Herren. Die Heiden waren vertrieben; niemand hatte Lust, noch länger zu verweilen.
»Diese verdammten Narren«, bemerkte Lochlánn. »Glauben die wirklich, die Gefahr ist vorbei? Wollen sie das Dúnad einfach aufgeben?« Er blickte Senach an und hoffte auf eine Antwort, aber der zuckte nur die Achseln.
Eine Weile ritten sie weiter, dann sagte Senach: »Wir haben heute Morgen ein Gemetzel angerichtet unter den Heiden. All ihre Schiffe sind fort, außer dem einen, das wir fast verbrannt hätten, und das hat ein großes Loch in der Seite. Ich nehme an, sie sehen keinen Grund, noch länger hier auszuharren.«
Lochlánn schnaubte. Es gab Grund genug, das Heer zusammenzuhalten. Sie wussten nicht, wohin die Heiden gegangen waren, ob sie zum Meer zurückgekehrt waren oder nur ein paar Wegstunden den Fluss hinabgefahren, um einen besseren Augenblick abzuwarten. Louis de Roumois hatte behauptet, dass wenigstens sechzig von ihnen noch in der Nähe von Glendalough verblieben waren.
Außerdem hatten Lochlánn und seine Männer es nicht geschafft, Louis gefangen zu nehmen. Das, so erkannte Lochlánn, störte ihn am meisten. Es war der Hauptgrund, warum er so verärgert war beim Anblick des Heeres, das auseinanderbrach wie die Eisdecke auf einem Frühlingssee.
Sie gelangten an den Rand des Lagers, wo ein Trupp Krieger Zeltplanen faltete und ein ziemlich beeindruckendes Rundzelt abbaute, das ohne Zweifel dem Herrn gehörte, dem sie dienten. Louis brachte sein Pferd zum Stehen.
»Du da«, sagte er, und der nächststehende Mann legte seine Arbeit nieder, richtete sich auf, drehte sich um und sah zu Lochlánn hoch.
»Ja?«, fragte er.
»Wer hat jetzt den höchsten Rang im Dúnad?«, fragte Lochlánn. »Wer hat hier das Kommando?« Nun, da Colman tot und Louis davongelaufen war, wusste Lochlánn nicht, an wen er sich für neue Anweisungen wenden sollte oder wer die Autorität besaß, ihm weitere Reiter für den nächsten Angriff auf die Heiden an die Seite zu stellen.
Die Bewaffneten, die ihm jetzt folgten, waren Colmans Männer gewesen, Louis’ Männer. Sie kannten Lochlánn und respektierten ihn und waren bereit, seinen Befehlen zu folgen. Wie Lochlánn waren sie aufgebracht darüber, dass Louis de Roumois Aileran getötet hatte, einen Mann, den sie geachtet hatten. Manche von ihnen verübelten Louis vielleicht sogar den Mord an Colman, auch wenn keiner von ihnen Colman besonders geschätzt hatte. Als Lochlánn diesen Männern befohlen hatte, ihm zu folgen, hatten sie ihm jedenfalls gerne gehorcht. Doch sonst gab es niemanden, den Lochlánn zum Kampf rufen konnte.
»Der höchste Rang …«, wiederholte der Krieger. Er runzelte die Stirn und sah sich um. »Ich nehme an, das ist Niall mac Oengus, dem ich folge. Ich und diese Männer. Ich wüsste sonst keinen.«
Lochlánn nickte. »Und wo ist dein Herr?«, fragte er.
Der Krieger wies auf eine Gruppe von Männern die Straße hinunter. »Das ist er, dort drüben. Der auf dem großen schwarzen Wallach«, erklärte er. Lochlánn dankte ihm und spornte sein Pferd an. Seine ermüdeten Männer folgten ihm.
Niall mac Oengus unterhielt sich mit zwei anderen Männern, die – ihrer Kleidung und den unterwürfigen Blicken nach zu urteilen – von deutlich geringerem Rang zu sein schienen.
»Herr!«, rief Lochlánn, als er heranritt. »Lord Niall?«
Niall drehte sich auf dem Pferd herum und betrachtete Lochlánn und die Männer hinter ihm. »Ja?«, fragte er. Was auch immer Lochlánn zu sagen hatte, Niall klang nicht allzu interessiert daran, es zu hören.
»Herr«, sagte Lochlánn und brachte sein Pferd zum Stehen. »Ich bin Lochlánn mac Ainmire; ich führe die Leibwache von Colman mac Breandan«, erklärte er, was genau genommen nicht ganz richtig war. Eigentlich stimmte überhaupt nichts daran. Aber Lochlánn kam zu dem Schluss, dass die Wahrheit viel zu kompliziert war, um sie hier zu erklären, und er wollte den Namen von Louis de Roumois nicht ins Spiel bringen.
»Colman ist tot«, sagte Niall.
»Ja, Herr«, erwiderte Lochlánn. Er wartete, dass Niall fortfuhr und erklärte, inwieweit das eine Rolle spielte. Als das nicht geschah, sprach Lochlánn weiter: »Herr, es treibt sich immer noch eine Schar der Heiden unten am Fluss herum. Ein Haufen, der uns heute Morgen entkommen ist. Sechzig Mann oder so. Herr, wenn Ihr mir drei Dutzend Krieger zu Pferde überlasst, reite ich sie nieder und töte alle. Wir sollten keinen von ihnen am Leben lassen.«
»Sechzig Heiden?« Niall klang nicht beeindruckt. »Wir haben fast dreimal so viele heute getötet. Wie viel Schaden können sechzig Heiden schon anrichten? Sollen die Wölfe sie holen.«
»Herr, sie sind die Wölfe.« Lochlánn versuchte, sich die Enttäuschung nicht anhören zu lassen. »Sie müssen getötet werden, oder sie werden zurückkehren.« Er überlegte, ob er Niall erzählen sollte, dass Louis de Roumois bei ihnen war, tat es dann jedoch nicht. Er wusste nicht, was für eine Reaktion – wenn überhaupt irgendeine! – diese Nachricht hervorrufen würde.
»Schau … Lochlánn«, sagte Niall und wählte einen merkwürdig väterlichen Tonfall dafür. »Es kostet mich eine ganze Menge Silber, diese Männer hier im Dúnad zu halten. Sechs von ihnen habe ich im Kampf bereits verloren, und da so viele weitere hier gefallen sind, wird es teuer werden, neue Krieger zu bestellen, so viel kann ich dir sagen. Und nur Gott der Herr weiß, was zuhause auf meinen Ländereien geschieht, während ich fort bin. Sechzig Heiden? Es gibt nichts, was die ausrichten könnten. Lass sie ziehen. Du hast gut gekämpft heute, du und deine Männer. Es gibt nichts mehr, was noch getan werden müsste.«
Mit diesen Worten stieß Niall seinem Pferd die Fersen in die Flanken und ritt zurück zu den Männern, die das Lager abbrachen und allerlei Ausrüstung auf die Wagen packten. Lochlánn hörte, wie Senach die Nase hochzog und ausspie. »›Du hast gut gekämpft heute‹«, sprach er in spöttischem Singsang nach. »Der verdammte Wichser, als ob der wüsste, wie wir gekämpft haben. Ich hab keine Spur von ihm im Getümmel gesehen.«
»Er ist ein Dummkopf«, pflichtete Lochlánn ihm bei. »Aber wir werden keine Männer von ihm kriegen.« Er drehte sich im Sattel herum und sah Senach an. »Suchen wir Pater Finnian.«
Finnian war einer der Priester des Klosters von Glendalough, jedenfalls soweit Lochlánn wusste. Allerdings schien der Mann auf eine Weise zu kommen und zu gehen, wie es sonst niemand im Kloster tat, und anscheinend reichten sein Einfluss und seine Autorität weit über alles hinaus, was Lochlánn von einem einfachen Mann Gottes erwartet hätte. Es gab eine ganze Menge an Pater Finnian, was Lochlánn nicht verstand.
Es war Finnian gewesen, der Louis das Kommando über die Krieger verschafft hatte, und Finnian hatte auch Louis und Lochlánn zusammengeführt. Pater Finnian verstand gewiss, wie gefährlich es war, die Heiden am Leben zu lassen. Außerdem war der Pater fast genauso versessen darauf wie Lochlánn, Louis gefangen zu nehmen und die Wahrheit über alles herauszufinden. Wenn jemand willens und in der Lage war, mehr Krieger zusammenzutreiben, dann war es Finnian.
Doch sie konnten ihn nicht finden. Lochlánn führte die Männer und ihre kraftlosen Rösser zurück zum Kloster von Glendalough. Sie erkundigten sich nach Pater Finnian, aber niemand hatte ihn gesehen. Sie sahen überall nach, wo man ihn vermuten konnte, aber er war an keinem dieser Orte.
Am Ende, entmutigt, wund geritten und erschöpft, stieg Lochlánn ab und setzte sich auf die niedrige Mauer, die das Kloster umgab. Er ließ den Kopf hängen, zu müde, um ihn aufrecht zu halten. Senach setzte sich neben ihn, und der Rest setzte oder legte sich um sie herum, während die Pferde sich dem Gras des Klosters zuwandten.
»Weißt du«, sagte Senach schließlich, »wir haben nie mehr als etwa zehn dieser ungläubigen Hunde gesehen, von denen Louis der Franke gesprochen hat. Eher noch weniger.«
Lochlánn richtete sich auf, aber er hatte nicht das Gefühl, dass die Last auf seinen Schultern sich verringerte. »Ja, und?«, fragte er.
»Vielleicht waren diese zehn ja alle, die da waren. Vielleicht hat Louis gelogen, als er von sechzig Mann sprach. Er ist niemand, dem ich vertrauen würde, dieser verdammte fränkische Hundesohn. Womöglich wollte er uns Angst einjagen.«
Lochlánn dachte darüber nach. »Vielleicht hast du recht«, erwiderte er. Einen Augenblick schwiegen sie beide, bis Senach wieder das Wort ergriff.
»Weißt du …«, fing er an. »Ich, diese Männer, wir waren Colmans Leute. Und der ist tot. Wir haben keinen Herrn, dem wir Rechenschaft schulden. Genau wie du.«
Lochlánn nickte. Er wartete darauf, dass Senach weitersprach, was er auch tat.
»Jeder von uns will Louis de Roumois tot sehen. Aileran war unser Hauptmann. Unser Freund. Wir haben Waffen und wir haben Pferde. Und nun dich als Hauptmann. Was hindert uns daran, allein nach diesen Hurensöhnen zu suchen?«
Allerdings – was?, überlegte Lochlánn.
Es war eine verrückte Idee. Beinahe zu verrückt. Nichts, was er tatsächlich tun konnte. Diese Männer bei der Jagd auf Louis anzuführen? Mit einem hatte Senach allerdings recht: Sie besaßen alles, was sie dafür brauchten, und er, Lochlánn, hatte auch eine gute Menge an Silber beiseitegeschafft – Silber, das ihm sein Vater geschickt hatte, Silber, das er beim Wetten gewonnen hatte, und weiteres Silber, das er seinem Vater gestohlen hatte. Er konnte für alles bezahlen, was sie noch brauchen würden.
Doch es gab andere Dinge zu bedenken. Lochlánn hatte nicht die Autorität, so etwas zu tun. Im schlimmsten Fall würde man ihn als Gesetzlosen betrachten. Er unterstand dem Abt, hatte Verpflichtungen gegenüber dem Kloster.
»Nein«, sagte Lochlánn. »Das ist ein verrückter Einfall. Ich kann das nicht tun.«
»Natürlich«, sagte Senach. »Natürlich nicht. Wie töricht von mir, es überhaupt anzusprechen. Ich bin mir sicher, du brennst schon darauf, zu deinem Leben im Kloster zurückzukehren. Zu den Gesängen und Stundengebeten und all dem. Der Küchenarbeit.«
Lochlánn nickte. Noch bevor Senach fertig war mit seiner Rede, hatte er seine Meinung geändert.
3. Kapitel
Denn ungewiss ist,ob kein Feind dort lauert,vor dir im Haus.
HAVAMAL
Thorgrim sah zu, wie sie näher rückten, wie die Männer zwischen den Bäumen hervorkamen und auf die Sandbank traten, die bis zum Ufer reichte. Nicht zwanzig Mann, wie er zuerst gedacht hatte, sondern mehr. Mindestens fünfundzwanzig. Sie trugen Waffen und schwärmten in einer langen Reihe aus. Ihr Anführer – oder der Mann, den Thorgrim dafür hielt – bewegte sich in der Mitte. Ein großer Kerl und so hässlich wie die Nacht.
Godi, der gekommen war, um Thorgrim zu wecken, blieb an Ort und Stelle stehen. Er hielt eine Streitaxt in der Hand, war aber schlau genug, sie tief und hinter der Bordwand außer Sicht zu halten. Genau wie Thorgrim hatte auch Godi erkannt, dass es nicht nötig war, feindselig zu wirken, solange nicht klar war, dass Feindseligkeiten unausweichlich waren.
Thorgrim sprang vom Achterdeck und ging nach vorn. Er bewegte sich unbeholfen, denn der Meereshammer lag immer noch teilweise auf der Backbordseite. Er warf einen kurzen Blick auf seine eigenen Leute, die überall auf dem Schiff schliefen. Er musste sie auf die Beine bringen und die Waffen aufnehmen lassen, ohne die Iren zu einem Angriff zu reizen, bevor seine Krieger bereit waren. Gerade überlegte er, wie er das schaffen konnte, da sah er schon, wie sich ein Mann regte, dann ein weiterer und noch einer. Sie schüttelten die Decken ab und griffen nach ihren Waffen. Es war das Gespür eines Kriegers im Feld: Etwas stimmte nicht. Sie konnten es fühlen.
Als Thorgrims Männer sich aufrichteten, die Waffen gezückt, hielten die Iren inne. Der Anblick eines Wikingerschiffs, das auf die Sandbank aufgelaufen war, hatte ihr Interesse geweckt, doch sie hatten keine Ahnung, was dort auf sie wartete.
Wart auf leichte Beute aus, was?, dachte Thorgrim. Die findet ihr hier nicht.
Er erreichte die breiteste Stelle des Schiffs, blieb dort stehen und betrachtete die Neuankömmlinge genauer. Selbst im trüben Morgenlicht konnte er erkennen, was für ein abgerissener Haufen das war. Sie waren in schmutzige, zerlumpte, fleckige Tuniken gehüllt, mit langen Kapuzen, die ihnen am Rücken herabhingen, oder in fadenscheinige Kittel mit abgewetztem Saum und groben Schultertüchern darüber gekleidet. Ein paar von ihnen trugen spitze, weiche Lederschuhe, aber die meisten liefen barfuß.
Und sie waren bewaffnet. Aber nicht bewaffnet wie Nordmänner oder auch nur irische Krieger. Sie hatten geschnitzte Keulen und lange Messer und Äxte, wobei die Äxte eher dazu taugten, Feuerholz zu schlagen als Schädel zu spalten. Einige trugen Speere. Der Kerl in der Mitte der Reihe, der Große, führte ein Schwert. Es war eine nordische oder friesische Klinge, und sie war in schlechtem Zustand. Thorgrim nahm an, dass der Ire sie gefunden oder jemandem abgenommen hatte, den er getötet hatte. Der Mann zu seiner Linken, ein kleinerer Bursche, hager und sehnig und mit rotem Haarschopf, besaß ebenfalls ein Schwert. Keiner der beiden hielt seine Waffe mit jenem Selbstvertrauen, das von langer Erfahrung zeugte.
Aber ungeachtet all dessen, der groben Waffen und der zerlumpten Kleidung, erkannte Thorgrim, dass man diese Männer nicht einfach abtun durfte. Sie waren zäh und wirkten hartgesotten. Männer, die sich mit rücksichtsloser Gewalt durchs Leben schlugen. Dies waren Räuber, brutale Wilde, Geächtete, und es waren viele.
Harald trat an die Seite seines Vaters, noch bevor der nach ihm rufen musste. Das war gut. Thorgrim wusste, dass er seinen Sohn jetzt brauchen würde. In ihrer Lage waren sie besser dran, wenn sie die Angelegenheit mit Worten bereinigen konnten statt mit einem Kampf, und Harald war der Einzige unter ihnen, der Irisch sprach.
»Vater«, sagte Harald. Er sprach leise und behielt die Iren im Blick, die zwei Ruten entfernt wieder angehalten hatten. »Dieser Ire … der Gefangene … Louis, er möchte ein Schwert.«
Thorgrim brauchte eine Weile, um diesen Themenwechsel nachzuvollziehen, so konzentriert war er auf die Banditen aus dem Wald. Er sah sich um, und sein und Louis’ Blicke trafen sich. Er las vieles im Gesicht dieses Mannes: Entschlossenheit, Trotz, Sorge. Aber keine Furcht.
Auch ein Hauch von Ärger lag in seinem Blick, und Thorgrim nahm an, dass der Mann, dieser Louis, nicht froh darüber war, dass er um eine Waffe bitten musste. All das sprach in Thorgrims Augen für ihn. Er wandte sich Thorodd Bollason zu, der neben Louis stand und dessen Schwert und Gürtel verwahrte. Thorgrim nickte Thorodd kurz zu. Der gab Louis die Waffe, und auf Louis’ Gesicht zeigte sich Erleichterung.
Thorgrim wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Iren zu, die erneut vorrückten, langsam, vorsichtig, so wie man sich einer Felskante näherte, wenn man den Wind im Rücken hatte.
»Macht euch bereit«, wies Thorgrim seine Männer mit gesenkter Stimme und in nüchternem Tonfall an. Er sprach gerade laut genug, um auf dem ganzen Schiff gehört zu werden. »Nehmt die Waffen auf. Und die Schilde. Bewegt euch langsam. Bildet eine Reihe entlang der Steuerbordseite, genau hier.« Wie bei einem Wolfsrudel. Keine plötzlichen Bewegungen.
Thorgrim hörte, wie seine Leute die Befehle befolgten, aber er wandte den Blick nicht von den Räubern ab, vor allem nicht von dem Anführer. Wie dieser handelte, würde bestimmen, was die anderen taten, und das wiederum würde entscheiden, was die Nordmänner dagegen unternahmen. Harald entfernte sich und kehrte kurz darauf mit seinem und dem Schild seines Vaters zurück. Thorgrim nahm es entgegen, schob den Arm durch die Schlaufe und umklammerte den Griff unter dem Schildbuckel.
Die anderen bewegten sich ruhig, aber rasch. Sie bezogen Stellung an der Seite des Meereshammers und besetzten die Wälle ihrer behelfsmäßigen Festung. Wenn die Iren angriffen, würden sie gegen die Waffen der Nordmänner über die Bordwand klettern oder durch den Fluss zur tieferen Backbordseite waten müssen.
Thorgrim ließ den Blick rasch über die Reihe wandern. Seine Männer trugen Kettenhemden, weil sie darin geschlafen hatten. Sie waren mit Schwertern und Streitäxten bewaffnet, und sie hatten ihre Schilde angelegt. Es waren ausgebildete und erfahrene Krieger. Doch sie waren nur zu zehnt, und jeder Einzelne von ihnen war verwundet; alle Mann, außer ihren Gefangenen, dem Mann und der Frau, die ebenfalls eine Rüstung trugen und ihren Platz in der Reihe einnahmen.
Wir können diese Mistkerle nicht besiegen,dachte Thorgrim.
Wenn die Iren angriffen, würden viele von ihnen unter den Waffen der Nordmänner fallen. Vielleicht die meisten. Aber am Ende würde die Übermacht der Iren sich durchsetzen. Wären die Umstände anders gewesen, seine Männer in besserer Form und Starri der Unsterbliche, der sich nur mit Mühe aufrecht halten konnte, unverletzt, dann hätte Thorgrim sich zuversichtlicher in den Kampf selbst gegen eine zweifache Überzahl geworfen. Aber wie die Dinge standen, gefielen ihm die Chancen nicht im Geringsten.
Doch wenn die Iren nicht angriffen, wenn sie sich zurückzogen, dann würden sie wiederkehren. In den dunklen Stunden der Nacht, an einem nebligen Tag – irgendwann würden sie zurückkommen. Ein gestrandetes Schiff, das nur von einer Handvoll Männer beschützt wurde und möglicherweise gefüllt war mit geplündertem Silber, war zu verführerisch, um es zu ignorieren. Es gab keine Ruhe; keine Möglichkeit, den Meereshammer instand zu setzen, solange diese Bastarde ihnen nachstellten.
Die Sache muss jetzt geklärt werden, dachte Thorgrim. Er wandte sich an Harald.
»Ruf diese Mistkerle näher zu uns, damit wir reden können«, sagte er. Harald nickte.
»Aber nenn sie nicht ›Mistkerle‹«, fügte Thorgrim hinzu, und Harald nickte erneut. Er wandte sich der Reihe der Räuber zu und rief sie in ihrer eigenen Sprache an. Thorgrim bemerkte den überraschten Ausdruck auf dem Gesicht des großen Mannes, und auf den Gesichtern der anderen.
Der Ire mit dem Schwert, der Anführer, trat einen halben Schritt vor und wich dann wieder zurück. Er schaute nach rechts und links und wusste offenbar nicht, was er tun sollte. Der kleinere Mann hinter ihm, der mit dem roten Haar von der Farbe einer ausbrennenden Feuersglut, trat näher an ihn heran und flüsterte ihm etwas zu. Der große Mann wirkte verärgert, und der kleinere sagte erneut etwas. Der große Kerl sah womöglich noch gereizter aus, aber die beiden lösten sich gemeinsam aus der Reihe ihrer Gefährten und näherten sich dem Meereshammer so kühn, wie sie es nur fertigbrachten.
Eine Rute von der Flanke des Schiffs entfernt blieben sie stehen. Thorgrim wollte Harald schon anweisen, was er als Nächstes sagen sollte, da ergriff der große Mann das Wort, lauter und nachdrücklicher, als es nötig gewesen wäre. Er schien die Worte sehr hastig herauszustoßen, auch wenn Thorgrim das bei den Iren nicht wirklich beurteilen konnte.
»Er sagt: ›Gebt uns eure Waffen und eure Rüstungen und alles Silber, was ihr habt, und wir lassen euch am Leben‹«, übersetzte Harald.
Thorgrim lächelte. »Wie freundlich von ihnen«, sagte er, doch er spürte bereits, wie der Ärger in ihm aufstieg und sich zusammenballte wie Gewitterwolken am Horizont. Er hatte genug zu tun. Er brauchte keine solche Störung.
»Sag ihm, wir sind Krieger und sie tumbe Ochsen. Sag ihm, sie können uns gerne angreifen, wenn sie es wollen. Sie sind mehr als zweimal so viele wie wir. Vielleicht können sie uns schlagen. Aber die meisten von ihnen werden bei dem Versuch sterben. Und er, dieser große Bastard, er wird der Erste sein. Ich werde ihm persönlich mein Schwert ins Herz stoßen. Frag ihn, ob er glaubt, dass es das wert ist.«
Harald übersetzte. Der große Bursche runzelte die Stirn und warf einen kurzen Blick zurück auf seine Begleiter. Die Wahl, die ihm blieb, war einfach: die Nordmänner angreifen oder gedemütigt vor einem schwächeren Feind zurückweichen. Diese Grube hatte er sich selbst ausgehoben, und er war zielstrebig hineingelaufen.
Noch einmal trat der kleinere Mann vor und sprach mit dem großen, zu leise, als dass die Nordmänner ihn verstehen konnten. Der große Bursche wandte sich wieder an Thorgrim, schrie etwas und streckte sein Schwert in die Höhe, als wollte er es zur Schau stellen.
»Er sagt, sie hätten schon viele Nordmänner getötet, und sie werden uns auch töten«, erklärte Harald. »Er sagt, dass er sein Schwert von dem letzten Nordmann genommen hat, den er erschlug.«
»Klingt er sehr überzeugend dabei?«, fragte Thorgrim.
»Nein«, erwiderte Harald. »Ich glaube, der andere, der Rothaarige, hat ihm das vorgesagt.«
Thorgrim nickte. Zeit, dem ein Ende zu setzen, dachte er.
»Sag ihm, dass wir beide Anführer sind, er und ich, und ein Anführer lässt nicht grundlos seine Männer sterben. Sag ihm, wir werden kämpfen, nur wir beide. Wenn ich ihn besiege, ziehen sie ab. Wenn er gewinnt, geben wir unsere Waffen ab und unser Silber, und sie ziehen anschließend ab. Sag ihm, ein Mann, der so viele Nordmänner getötet hat wie er, sollte einen weiteren nicht fürchten. Und sag es ihm so laut, dass all seine Männer es hören können.«
Harald übersetzte. Die Stimme des Jungen war so kräftig wie seine Statur, und die Worte schallten weit über die Sandbank. Thorgrim brauchte keine Übersetzung, um die Gedanken zu deuten, die sich auf dem Gesicht des Iren widerspiegelten. Er hatte Ochsen gesehen, die man zur Schlachtbank führte und die verwirrt und ein wenig misstrauisch wirkten, während ihr träger Verstand allmählich erfasste, dass etwas nicht stimmte. Der Mann hier blickte genauso drein. Das war nicht der Kampf, den er gesucht hatte oder mit dem er gerechnet hätte. Aber er konnte auch keinen Weg erkennen, der ihn aus der Sache herausführte.
Der kleinere Mann sprach wieder, doch der größere scheuchte ihn fort. Er trat noch einen halben Schritt vor und ergriff erneut das Wort.
»Er sagt, er lässt sich von deinen Tricks nicht in die Irre führen«, übersetzte Harald. »Du trägst eine Rüstung und einen Helm und einen Schild.«