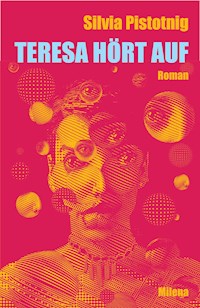Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elster & Salis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Gasthaus auf dem Land: Drei Frauen, drei Generationen, drei Geschichten: «Die Wirtinnen», das sind die musikalisch hochbegabte Großmutter Johanna, ihre Tochter, das pummelige Mathematik-Genie Marianne und die widerspenstige Enkelin Gertrud, das Fußball-Talent. Sie alle teilen das gleiche Schicksal, sie können und dürfen ihre Fähigkeiten nicht ausleben. Geprägt durch die Zeit, die Geschlechterrollen und die Familie werden Pflichtgefühl, Angepasstheit und Unsicherheit von Generation zu Generation weitergegeben. Das Gasthaus ist Zuhause und Lebensgrundlage für die drei Frauen, symbolisiert aber gleichzeitig das Festgefahrene und die Ausweglosigkeit ihrer Situation. Silvia Pistotnig erzählt lebendig und humorvoll aus den verschiedenen Perspektiven der Protagonistinnen, die liebevoll und teilweise skurril beschrieben sind. Sie zeichnet dabei eine Familiengeschichte aus Kärnten, die sich von den 1930er Jahren bis hin zur Gegenwart erstreckt und in der sich gleich mehrere Generationen von Frauen wiederfinden werden. Es geht um das Träumen und die Realität. Es geht um die Fragen, wohin man gehört und wer man sein möchte. Und es geht um Empowerment, darum, ob und wie man sich entwickeln kann als Frau in einer männerdominierten Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Pistotnig
Die Wirtinnen
ROMAN
Silvia Pistotnig
Die Wirtinnen
Roman
Verlag
Elster & Salis GmbH, Wien
www.elstersalis.com
LektoratGestaltung und Satz
Anja LinhartMichael Balgavy, DWTC
1. Auflage 2023
© 2023, Elster & Salis GmbH, Wien
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-03930-047-1
INHALT
JOHANNA, 1936
GERTRUD, 1983
MARIANNE, 1994
JOHANNA, 1936
GERTRUD, 1994
MARIANNE, 1994
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1936
MARIANNE, 1955
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1937
MARIANNE, 1956
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1938
GERTRUD, 1994
MARIANNE, 1994
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1938
MARIANNE, 1974
GERTRUD, 1983
JOHANNA, 1938
MARIANNE, 1979
GERTRUD, 1984
JOHANNA, 1939
MARIANNE, 1955
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1949
MARIANNE, 1957
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1956
MARIANNE, 1956
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1956
MARIANNE, 1973
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1974
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1980
MARIANNE, 1994
JOHANNA, 1994
MARIANNE, 1994
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1994
MARIANNE, 1994
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1976
MARIANNE, 1994
GERTRUD, 1994
JOHANNA, 1994
GERTRUD, 1995
MARIANNE, 1995
JOHANNA, 1995
GERTRUD, 1995
MARIANNE, 1995
JOHANNA, 1999
GERTRUD, 2022
DANK
JOHANNA, 1936
Hatten die Schweine Hunger, waren sie lauter als die Kirchenglocken. Noch dauerte es ewig bis zur Sonntagsmesse. Sie hielt sich die Hände über die Ohren. Die Mutter riss sie ihr herunter und keifte: „Tu die Hände weg, aber flott.“
„Die Schweine schrein so laut“, sagte Johanna leise. Sie glaubte, die Mutter hätte sie nicht gehört. Doch das hatte sie. „Eine Sau schreit nicht, du Treapn.“ Die Mutter war grantig.
Johanna hatte keine Wahl. Sie musste die Schweine füttern, ihr Schreien beenden. Und es war Schreien, beschloss sie innerlich und aß ihr hartes Brot, während der Stiefvater seine Pfeife anzündete. Johanna hörte das Zischen des Streichholzes. Es gab schöne Geräusche. Die Orgel, die spielte. Und ihr würde sie heute lauschen dürfen.
Sie marschierten alle in einer Reihe, ganz vorn der Stiefvater. Dann die Mutter, die älteren Brüder, die Schwestern, hinter ihr noch drei und das Tschoppale. Der Klatschmohn leuchtete am Weg, so rot, so hell, so unverschämt, besonders am heiligen Sonntag. In der Kirche setzte sich die Familie in ihre Bankreihe. Genau so, wie sie davor marschiert war, von links nach rechts. Johanna schloss die Augen, dafür brauchte sie keine Hände. Hier brauchte sie nur ihre Ohren, wenn die Orgel den Raum erfüllte. Die Töne, ganz anders als alles, was sie kannte. Nicht so stumpf wie die Ziehharmonika, auf der ihr Stiefvater manchmal spielte. Das war Gott. Johanna hörte nicht, was der Pfarrer sagte. Sie murmelte die Gebete mechanisch mit, das Schuldbekenntnis, alles wie von selbst. Aber nicht von Herzen. Das würde Gott strafen. „Wir dürfen uns nicht von Freigeistern treiben lassen, die uns die Sünde bringen. Der Teufel hat ihre Gestalt.“ Der Pfarrer sprach lauter. Er lispelte, das sündige „S“ verlor an Schärfe. Seine Stimme krächzte unmelodisch. Johanna dachte an die Orgelmusik und überlegte, ob es schwer war, so zu spielen. Sie streckte ihre Finger aus. Diese langen, dürren Krallen, keine zum Arbeiten, wie die Mutter immer sagte. Die Fürbitten. Gloria, Kyrie, Evangelium, Knien, Hinsetzen, Eucharistie. „Verzeih mir, Mutter Gottes, ich bin eine Sünderin.“
Johanna wollte neben dem Organisten sitzen, dem Franz, so nannten sie ihn im Dorf. Seinen Nachnamen kannte sie nicht, den brauchte hier keiner. Sie wollte sehen, was seine Finger taten, wie er solche Töne, solch eine Musik zaubern konnte. Ihre Entscheidung stand fest. Dafür würde sie zwar ein paar Tetschn kassieren, aber das würde sie ohnehin.
Während der Kommunion hatte Johanna einen Hustenanfall. Immer stärker wurde er, bis die Mutter „Verschwind!“ zischte und sie eilig die Kirche verließ, um nicht noch länger zu stören. Draußen hustete sie weiter. Sie wartete, bis sie die Orgel wieder hörte. Dann ging sie hinein, so leise, wie sie konnte, die sich windenden Stiegen hinauf, immer höher, den Geruch von Nässe und Kälte in der Nase und den Klang Gottes im Ohr. Sie presste sich an die Wand, unauffällig, dass der Organist sie nicht sehen konnte. Doch sie sah ihn. Und seine Hände. Wie sie die Tasten entlangglitten und himmlische Töne erzeugten. Sie blieb stehen, konnte nicht weg, wollte ihre Finger auf die Tasten legen, dieses mächtige Instrument spüren. Vorsichtig beugte sie sich vor. Da sah er sie. Johanna erschrak und wollte weglaufen, doch der Organist wirkte zu ihrem Erstaunen gar nicht böse. Er lächelte sogar ein wenig. Sein leicht ergrauter Schnauzbart zeigte nach oben. Franz hatte normalerweise ein sehr strenges Gesicht, harte, bittere Züge, wie alle hier. Sie kannte ihn, wie man die Menschen aus dem Ort eben kannte, und noch kein einziges Mal hatte sie ihn lächeln sehen. Und so blieb sie stehen. Sie blieb auch noch stehen, als der Pfarrer die Gemeinde entließ. Sie blieb stehen, als die Fußbänke verrückt wurden und die Leute sich zum Ausgang begaben. Sie blieb stehen, als die Kirche sich leerte, und sie blieb noch immer stehen, als auch der Letzte hinausgegangen war. Dann hörte Franz auf zu spielen. In der plötzlichen Stille bemerkte Johanna, wo sie war. Sie versuchte sich unsichtbar zu machen, senkte den Kopf so tief es ging, als könnte sie dadurch verschwinden. Sie sah auf die Spitzen ihrer Schuhe, es waren die der älteren Schwester, noch zu groß, aber das beste Paar, das sie besaß.
„Dir gefällt das, Diandle, ich weiß“, sprach Franz sie unvermittelt an. Sie sagte nichts. Er musste sie gesehen haben. Beim letzten Mal. Dabei war sie sich sicher, dass niemand sonst da gewesen war. Sie hatte sich so bemüht, ganz früh am Morgen unter der Woche, und die Tür zur Kirche hatte sich einfach öffnen lassen. Natürlich hatte sie nicht gespielt. Sie hatte nur auf der Bank gesessen und das Instrument angesehen. „Willst es lernen?“, fragte er und schnäuzte sich in ein schmutziges Tuch. Johanna traute ihren Ohren kaum. Sie blickte noch immer zu Boden und nickte. Vielleicht machte er sich lustig über sie. Aber der Organist deutete mit dem Kopf auf die Bank neben ihm, dass sie sich setzen sollte, murmelte: „Ein Weibsbild, das sich für Musik interessiert“, und schüttelte den Kopf. „Aber pass auf, ich zeigs dir nicht fünfmal.“ Sie gehorchte, saß wie versteinert auf der Bank, während er ihre Finger grob mit seinen schwieligen Händen auf die Tasten drückte. „So gehört das, die Füß machen was andres. Reiß dich zamm, Orgel spielen ist schwer, das ist was für Leut, die eine Ahnung haben, nichts für Bauersleut. Ich werd gleich sehn, ob dus kannst.“ Franz klang streng. Wie alt er wohl war, fragte sich Johanna. So alt wie ihr Stiefvater vielleicht? Seine Gesichtszüge waren verhärmt, er hatte gelbe Zähne und roch nach Tabak. Johanna hatte Angst zu sprechen und sich von der Stelle zu rühren, obwohl sie wusste, dass zuhause eine ordentliche Tracht Prügel auf sie wartete.
Der Klang entschädigte sie für alles. Der Organist drückte auf die Tasten. Sie bemühte sich, die Abfolge im Kopf zu behalten. „Jetzt du“, sagte er, „machs nach.“ Mit sanftem Druck entlockte Johanna dem Instrument die ersten eigenen Töne. Aber ihr Lehrer war nicht zufrieden. „Ordentlich zugreifen, du Tscholdra, man soll ja was hören, Kruzitürken!“, polterte er und presste ihre Finger auf die Tasten. Sie erschrak. Aber es funktionierte: Johanna drückte die Tasten fester und als sie den Klang hörte, den sie erzeugten, wurde ihr schwindelig. „Weiter, weiter!“, befahl Franz ungeduldig. Sein Schnauzbart verzog sich dabei, er kniff die Augen zusammen und sein Mund zuckte unruhig. „Tu jetzt weiter, Diandle“, ermahnte er sie. Sie hatte Angst, eine falsche Taste zu erwischen. Doch es klang harmonisch, richtig, mächtig. Und sie fühlte sich so, eins mit dem Instrument, eins mit dem Klang. „So ists recht“, sagte Franz schließlich und erhob sich. „Wenns dir ernst ist, kommst nächsten Sonntag in die Kirche.“ Johanna nickte. Es war ihr Ernst. „Danke“, antwortete sie mit zitternder Stimme und stürzte davon. Sie lief und lief, fühlte sich leicht und erhaben. Die Welt war laut, dachte sie, so schön laut.
GERTRUD, 1983
„Wir gehen jetzt“, sagt der Papa. Der Thomas mag nicht. Er spielt auf seinem Tric o tronic. „Kann ich mal?“, frag ich. Nie darf ich. Immer spielt nur er. „Du kommst mit“, sagt der Papa. Er hebt mich auf die Schulter. „Leg das jetzt weg“, sagt er zum Thomas. Der Thomas ist grantig. „Die Mama muss arbeiten. Heut ist viel los.“ Draußen sitzen Gäste. „Viel Spaß“, sagt die Mama. Sie trägt ein Dirndl. Die Oma seh ich nicht. „Pfiati“, sag ich. Der Thomas sagt nichts. Er ist noch immer grantig. „Er will gar nicht spielen“, sag ich dem Papa. Der Papa nickt. „Ich weiß, aber probieren wird er es.“
Auf der Schulter bin ich am größten. Ich seh, dass die Frau da drüben ihre Blumen schneidet. Hinter ihr gackern die Hühner. Wir haben auch Hühner. Und Gäste. Wir müssen die Straße hinuntergehen. Den Weg kenne ich. Da kommen wir bei einem Gitter vorbei. Drunter ist der Bach und rauscht. „Ich will runter“, ruf ich. „Jetzt nicht“, sagt der Papa. „Das Training fängt gleich an. So viel Zeit haben wir nicht.“ Er hält mich fest.
Der Fußballplatz ist grün. Schön schaut das aus. Ich bin öfter dort mit der Oma. Sie nimmt dann einen Ball mit und ich spiel. Ich treff immer ins Tor. Wenn die Buben kommen, lassen sie mich nicht mitspielen. Das ist blöd. Ich möcht lieber ein Bub sein. Die haben es viel lustiger. Als wir angekommen sind, lässt mich der Papa endlich runter. „Da drüben ist der Trainer“, sagt er zum Thomas. Der Thomas geht ganz langsam hin. Er hat mir daheim noch gesagt, dass er nicht spielen will. Die anderen spielen sicher alle besser. Das hat er nicht gesagt. Aber das weiß ich.
Der Thomas hat sogar ein Fußballleiberl an. Mir hat die Mama heut ein Kleid angezogen. Aber da hab ich Kakao drübergeleert. Jetzt hab ich eine Hose und ein Leiberl an. Ich trag gern schöne Kleider. Dann sehen die Leute endlich, dass ich ein Mädchen bin. Immer sagen sie Bub zu mir. „Wer ist der Bub?“ oder „Wie heißt der Bub?“. Ich bin kein Bub. Nur weil ich kurze Haare hab und kein Kleid trag. Damit kann man nicht so gut Fußball spielen. Die Hosen krieg ich vom Thomas. Die Mama hat gesagt, sie näht mir ein schönes Kleid. Aber sie hat nie Zeit, weil im Gasthaus so viele Leute sind. Im Winter dann vielleicht.
Der Thomas ist irgendwo verschwunden. „Die ziehen sich um“, erklärt mir der Papa. Er setzt sich auf eine Bank. Auf der sind noch andre Erwachsene. Und ein kleiner Bub. Aber mit dem kann ich nicht spielen. Der ist noch ein Baby. Weiter drüben sind zwei Mädchen. Sie sind größer als ich. Vielleicht geh ich mal hin? Eine zeigt mir die Zunge. Ich geh nicht. Ich bleib in der Nähe vom Papa. Da ist ein Sack, da sind ganz viele Bälle drinnen. Ich weiß nicht, ob ich einen nehmen darf. Der Papa redet mit irgendeinem Mann. Er schaut nicht her. Die Mädchen spielen mit ihren Puppen. Ich nehm einen Ball raus. Das Leder ist ganz glatt und kühl. Ein bisschen weich, aber auch hart. Ich probier damit zu spielen. Mit den Füßen. So wie es der Papa dem Thomas gezeigt hat. Der Thomas hat es nicht zusammengebracht, aber ich. Der Ball springt auf meinem Fuß auf und ab und auf und ab. Ich lauf und der Ball bleibt bei mir, wenn ich ihn richtig rolle. Wenn ich schieß, fliegt er weg. Ich hab einen Burschen gesehen, der hat so Tricks gemacht und ihn herumgewirbelt. Das hat mir gefallen. Das möcht ich auch können.
„Wo hast du den Ball her?“, fragt mich der Papa. Ich sag nichts. „Passt schon“, sagt er. Da bin ich froh. Auf der Wiese ist es inzwischen laut geworden. Die Buben sind wieder da. Sie haben jetzt alle Fußballleiberl und Fußballschuhe an. Ich trag die alten Schuhe vom Thomas. Das sind keine richtigen Fußballschuhe. Aber ich kann trotzdem mit ihnen spielen. Die Buben sind alle ungefähr so alt wie der Thomas. Die meisten sind dünner als er und einer ist ganz klein. Sie stellen sich im Kreis auf. Leider ist der Trainer zu weit weg, ich kann ihn nicht verstehen. Ich würd gern näher hin zu ihnen. Aber ich trau mich nicht. Ich spiel lieber mit meinem Ball weiter und schau zu, was die Buben machen. Die spielen gar nicht richtig. Einmal laufen sie herum, dann müssen sie Liegestütz machen und einmal schaut es so aus, als ob sie Fangen spielen würden. Dabei ist das doch ein Fußballtraining. Bei ein paar Sachen mach ich sogar mit. Aber nur bei denen mit dem Ball. Die anderen sind mir zu langweilig. Die Mädchen spielen noch immer Mutter-Vater-Kind. Aber sie schauen nicht her. Sollen sie, ich brauch die nicht mit ihren dummen Puppen. Als die Buben mit dem Ball das ganze Feld hinauflaufen, mach ich wieder mit. Das kann ich. Ich bin viel schneller als sie und mir springt der Ball nicht davon. Danach müssen wir wieder zurück. Da renn ich wieder mit und ich bin wieder schneller. Dabei sind die alle größer als ich. Und Buben. Plötzlich schreit der Trainer. Er hat eine Pfeife, mit der pfeift er immer, wenn er was sagen will. Komisch. Obwohl er schreit, kann man nichts verstehen. Die Buben offenbar schon, weil die stellen sich wieder im Kreis auf. Einer kommt dran und tritt vor und noch ein anderer. Die beiden zeigen dann abwechselnd immer auf einen der restlichen Buben. Das kenn ich. Ich bin ja schon in der Schule in der ersten Klasse. Wir dürfen auch manchmal wählen. Das ist aber nicht schön, weil ich meistens als Letzte drankomm. Der Thomas steht auch bis zum Schluss da. Er tut mir leid. Er ist der Dickste von allen. Deshalb wird er nicht gewählt. Und weil er nicht so gut spielen kann. Aber er kann super Tric o tronic. Ein paar Buben hüpfen herum. Ich hüpf auch ein bisschen. Eine Gruppe bekommt rote Bänder. Ich hoffe, jetzt werden sie endlich spielen. Zwei Buben stehen in der Mitte vom Spielfeld und dann ist Ankick. Der Papa hat mir erklärt, wie das heißt. Ich lauf mit. Einer schießt den Ball weit weg. Aber er trifft den falschen Mitspieler. Der spielt gar nicht in seiner Mannschaft, er hat kein rotes Band. Dann schießt einer zum Thomas, aber der weiß nicht, was er machen soll. Ich beiß nervös auf meinen Nägeln rum. Gott sei Dank gibt der Thomas doch noch ab. Und er erwischt sogar einen aus seiner Mannschaft. Der läuft durch. Aber er kommt nicht weit.
Es geht immer hin und her. Ich lauf mit. Einmal auf die eine Seite, einmal auf die andere. Ich hab meinen Ball liegen lassen. Auf einmal schießt einer von der Mannschaft vom Thomas bis zu mir, mir direkt vor die Füße. Der Ball bleibt vor mir liegen. Ich seh ihn an und lauf los. Der Ball ist bei mir. Ein Bub will ihn mir abnehmen. Aber ich lass ihn nicht. Ich geb den Ball nicht ab. Ich schau auf’s Tor und dann schieß ich. „Tor!“, schreit der Trainer und ich jubel: „Jaaaa! Tor!!!“
Ich schau mich um. Es ist ganz still. Der Papa hat aufgehört zu reden, er ist aufgestanden, der Mann neben ihm auch. Sie schauen zu mir, dann zum Trainer, dann wieder zu mir. Alle starren mich an. Sogar die blöden Mädchen und der Thomas. Das war wahrscheinlich nicht gut, was ich da gemacht hab. Ich geh aus dem Feld. Was soll ich sonst tun? Die anderen fangen wieder an zu laufen. Der Trainer ruft: „Weiterspielen!“ Ich geh zum Papa, der sagt gar nichts, aber da kommt der Trainer auf einmal zu uns. „So einen Spieler brauchen wir, wie heißt der?“, fragt er den Papa und mir wird schlecht. „Der ist ein Mädchen“, antwortet der Papa und seine Stimme klingt irgendwie komisch. „Ein Mädchen?“, fragt der Trainer ungläubig. „So ein Schaß!“
MARIANNE, 1994
Marianne knöpfte die Bluse zu. Sie zählte die Knöpfe. Sie musste zählen. Immerzu. Tat sie es nicht, war etwas nicht in Ordnung. Ihr Tag bestand aus Zahlen. Sie bestand aus Zahlen. Die Stiegen. Wie viele Bierflaschen noch da waren. Die Scheine in der Brieftasche. Die Münzen. Die Gäste. Manche Leute machten Kreuzworträtsel. Sie zählte.
Marianne organisierte sich nach den Zahlen der Uhr. 5 Uhr 50: aufstehen, anziehen, waschen, Zähne putzen. 6 Uhr 10: hinuntergehen. 6 Uhr 15: Kaffee aufsetzen. 6 Uhr 20: die Kinder wecken. 6 Uhr 30: Frühstück vorbereiten. So ging es weiter. Ein durchgetakteter Tag. Struktur, Halt, Sicherheit. Sie kannte kaum Momente, in denen sie die Zeit vergaß, außer wenn Erwin auf ihr oder sie auf ihm lag und sie, na ja, das eben. Ausnahmen, die sie ziemlich verwirrten.
Marianne verspätete sich nie, war meist früher mit allem fertig und ließ keine Minute ungenutzt. Manche Leute hatten Hobbys. Sie hatte Arbeit.
Am Montag war Kontrolle der Vorräte und Einkaufstag, am Dienstag Ruhetag im Gasthaus und deshalb für sie Putzund Bügeltag, am Mittwoch Waschtag, am Donnerstag ihr Lieblingstag: Buchhaltung, am Freitag Küche aufräumen und Organisation des Wochenendes, am Samstag Hochzeiten, Taufen oder ein Leichenschmaus, am Sonntag Mittagessen für die Kirchgänger. Es gab Abweichungen, es kamen mal weniger Leute, doch es war nie nichts zu tun, Gläser waren zu spülen, Tische zu wischen, Rechnungen einzuordnen.
Ihre halblangen Haare musste sie mit Haarspray zurechtformen. Sie hatte braune Locken und eine Brille. Trudi wollte heute mit ihr in der Stadt eine neue kaufen. Völlig überflüssig, fand Marianne. Aber sie hatte es sich schon durchgerechnet: Sie hatten zwei Stunden. Davon 30 Minuten für den Optiker. Sie sah sich an. Was war an der Brille überhaupt falsch? „Mit der kannst dich wirklich nicht mehr sehen lassen“, hatte Trudi gesagt. „Mama, das ist peinlich.“ Na gut. Auch wenn sie nicht verstehen konnte, was mit der Brille nicht stimmte – sie war noch voll funktionsfähig –, so wollte sie trotzdem nicht peinlich sein. Und sie brauchte Trudis Wohlwollen, um ihr klarzumachen, dass sich ihr Leben ändern würde. 6 Uhr 10. Marianne ging in die Küche. Am Vormittag musste sie das Mittagessen vorbereiten und danach kontrollieren, ob Getränke nachzubestellen waren. Außerdem musste ihre Mutter heute den Mittagsschlaf schon um 13 Uhr 30 beenden, also 30 Minuten früher als sonst, damit sie mit Trudi in die Stadt konnte. Dafür hatte die Senior-Chefin kein Verständnis: „Die Trudi soll lieber zum Friseur als mit dir ins Brillengeschäft gehen, mit dem Tschoda“, rief ihr die Mutter noch schlecht gelaunt hinterher.
Um 13 Uhr 50 stand Marianne pünktlich vor der Schule. Sie stieg nicht aus, blieb im Fiat ihrer Mutter sitzen und zählte die Autos auf dem Parkplatz. Sechzehn waren es. Dann die Bäume rund um das Schulgebäude. Zehn. Trudi kam immer zu spät, kein Wunder, so wie sie daherschlurfte. Ginge Marianne neben ihr, hatte sie Mühe, ihr nicht vorauszulaufen. 13 Uhr 58. Endlich, Trudi kam mit einer Gruppe Mädchen. Vier. Sie hatten denselben Gang. Das würde Mariannes Zeitplan durcheinanderbringen. Wie groß sie war. Beinahe erwachsen, sechzehn Jahre alt. So viele Jahre wie Autos auf dem Parkplatz. Was für eine schöne Ziffernkombination. Die zackige, gerade Eins, die sich mit der runden, sinnlichen Sechs verband. Die exakten, klaren Striche und die bauchigen, fast erotischen Bogen. Alle Ziffern waren einzigartig, die geschwungene Zwei, die variierende Sieben, die endlose Acht, die kopflastige Neun und dann die Kombinationen daraus, unzählige Möglichkeiten. Die Mädchen schwatzten noch immer, ganz dringend mussten sie etwas miteinander zu besprechen haben. Marianne sah auf die Uhr. 14 Uhr 03. Menschenskind, Trudi! Sechzehn, wie war sie mit sechzehn gewesen? Wie mit siebenunddreißig? Wie mit fünf? Eigentlich immer gleich, dachte sie, es hatte nur eine andere Anzahl an Knöpfen an der Bluse und längere, zu Zöpfen gebundene Haare gegeben.
Trudi, ein völlig anderes Wesen als sie, immer schon, mittendrin und laut. Bereits als Kind hatte sie die Leute im Gasthaus unterhalten, ihnen Getränke serviert, Witze erzählt. Alle waren begeistert gewesen. Währenddessen hatte sich Thomas in der Nähe der Kartenspieler herumgedrückt und sie beobachtet. Genau wie Marianne es früher getan hatte. Sein Lieblingsspielzeug war die Bonierkasse gewesen, die er mit zehn hatte reparieren können. Ihr Sohn war wie sie. Erwin, sie und Thomas, eingeklemmt zwischen ihrer unberechenbaren Mutter und der impulsiven Tochter. Trudi riss die Autotür auf. „Hallo!“, rief sie, setzte sich und knallte die Tür zu. Wieder laut. Sie fuhren zwei Straßen weiter und Marianne parkte.
14 Uhr 19. Trudi zwang ihre Mutter in das zweite Brillengeschäft. Marianne hatte mitgezählt, dreizehn Modelle musste sie aufprobieren. Langsam wurde es ihr zu viel, die Zeit drängte. „Ach, die ist doch gut“, sagte sie daher, als sie die vierzehnte aufsetzte. Trudi protestierte. „Mama, du musst eine nehmen, die dein Gesicht besser zur Geltung bringt.“
„Ach Blödsinn!“ Marianne genierte sich. Der Optiker, der ihr noch eine Brille gab, Nummer fünfzehn, kam ihr genervt vor. Wahrscheinlich dachte er, was will so eine langweilige alte Schachtel denn, sieht eh alles gleich aus.
Marianne war nicht eitel. Wer hässlich war, brauchte nicht eitel zu sein. Das war Schönheiten vorbehalten wie ihrer Cousine Herta. „Die sieht gut aus!“, meinte der Optiker, der plötzlich seine Verkaufstaktik geändert hatte und sich euphorisch gab. „Na ja, geht so“, erwiderte Trudi, die auch langsam die Geduld verlor. Marianne tat begeistert. „Ich finde die gut. Die nehmen wir.“ Vielleicht war das dann doch ein bisschen zu schnell. Als sie den Preis hörte, war sie geschockt. Nie zuvor hatte Marianne etwas gekauft, ohne die Kosten dafür zu kennen, aber diesmal hatte sie der Optiker überrumpelt. Und es war schon spät. 15 Uhr 23. Es hatte viel zu lang gedauert. 2.100 Schilling! Sie berechnete im Kopf, wie viel Bier sie verkaufen musste, um das wieder reinzuholen, und ihr wurde heiß. Marianne zahlte, zählte die Scheine. Die Münzen. Zum Glück hatte sie genug in der Brieftasche. Es tat ihr leid um das Geld. Sie verließen das Geschäft. 15 Uhr 31. Endlich. „Willst du noch irgendwohin?“, fragte Marianne und hoffte, Trudi würde verneinen „Danke, aber ich gehe lieber mit der Kathi einkaufen. Aber wir könnten Pizza essen!“
„Pizza?“, fragte Marianne. „Wir sind ja nicht im Urlaub.“
„Wir sind nie im Urlaub“, gab Trudi zurück und zuckte trotzig mit den Achseln. „Wir können ja einmal etwas anderes machen, oder?“
„Also das ist wirklich nicht nötig. Wir haben zuhause Essen genug und vergeuden sicher kein Geld und keine Zeit in einem fremden Gasthaus.“
„Ja, das haben wir selbst daheim“, zischte Trudi und kickte mit der Schuhspitze gegen einen kleinen Stein. „Komm, ich muss noch auf die Bank, die Post und in die Apotheke. Danach fahren wir heim“, sagte Marianne. Wie auf Befehl schritt Trudi los und ließ ihre Mutter hinter sich. „Versteh einer die Jugend“, sagte Marianne verwundert.
16 Uhr 49. Beim Nachhausefahren steckte Trudi eine Kassette ins Radio. Dumpfe, unmelodische Musik ertönte. Zum Glück war die Oma nicht dabei, sie hätte bestimmt geschimpft. „Ich muss mit Oma nächste Woche nochmal zum Röntgen, wir haben nur den Mittwochnachmittagtermin bekommen“, fällt Marianne ein. „Da musst du bitte die Gaststube übernehmen, Trudi.“ Trudi stöhnte. „Ach Mensch, Mama! Muss das sein?“ Na und, was soll das Theater schon wieder, dachte Marianne. Als Kind hatte sie nicht nur einmal aushelfen müssen und sich nie beschwert. „Ach komm, kommt ja eh keiner“, sagte sie beschwichtigend.
„Dann lassen wir doch gleich zu.“
„Das geht nicht. Wir haben Öffnungszeiten, an die wir uns halten müssen, außer es ist ein Notfall.“
„Wenn ihr nicht da seid, ist es ein Notfall.“
„Trudi, hör zu, wir fragen dich wirklich nur ganz selten, das wirst du ja wohl machen können. Ich werde deshalb sicher nicht extra Thomas kommen lassen.“
„Was ist mit den anderen Verwandten von der Oma? Können die sie nicht bringen? Ist ja nicht nur deine Mutter!“ Marianne seufzte. Wozu streiten und Zeit verschwenden für Dinge, die sich ohnehin nicht ändern ließen. „Du springst bitte ein und damit basta.“
„Die Kathi muss daheim nie was machen. Ihre Eltern lassen sie in Ruhe!“
„Du bist aber nicht die Kathi!“
„Ja, leider.“ Trudi schmollte und drehte das Radio lauter. Die Musik krachte und Marianne war sich nicht sicher, ob es am alten Radio lag oder tatsächlich die Musik so klang. Als sie ausstiegen, ging Trudi ohne ein weiteres Wort in ihr Zimmer und knallte die Tür zu. Nach kurzer Zeit tönte auch aus ihrem Zimmer dieser unangenehme Lärm. 17 Uhr 13.
JOHANNA, 1936
Nichts konnte Johanna etwas anhaben. Nicht die wütenden Ohrfeigen, mit denen die Mutter sie begrüßte. Die schadenfrohen Gesichter der Brüder. Das mitleidsvolle und zugleich anklagende Kopfschütteln der Schwestern. Die Klänge, die sie, ja sie!, erzeugt hatte, waren keine Sünde und entschädigten sie für alles andere. „So eine Schande“, wiederholte die Mutter noch mehrmals, als sie bereits am Tisch saßen und die dünne Suppe löffelten. „Ein Weibsbild, das Orgel spielt.“
„Halts Maul!“, schimpfte der Stiefvater. Die Mutter redete trotzdem weiter. „Hast ihm schöne Augen gemacht, dem eitlen Gockel? Im ganzen Ort hat man dich gehört. Glaubst, der macht das, weilst so schön bist?“ Johanna schwieg. In ihrem Kopf tönte die Musik der Orgel. Die Mutter war weit weg. Sie konnte ihr verbieten, den Organisten aufzusuchen, aber Johanna würde wieder hingehen. Das versprach sie sich in diesem Moment. Die Mutter würde staunen, wie zäh sie sein konnte. Das Orgelspielen würde ihr niemand nehmen.
Die Mutter kannte Johanna und hatte in der Vergangenheit oft gestaunt, wie stur sie sein konnte. Daran hatte das Kind vom ersten Schrei an keinen Zweifel gelassen. Wobei, den ersten Schrei hatte es erst spät getan. Als die Mutter mithilfe der Hebamme Johanna zur Welt brachte, war die Mutter überzeugt gewesen, dass dieses dünnhäutige, winzige, blaue Wesen keine Chance hatte auf der harten Welt. Schnell ließen sie es taufen, damit es nicht gotteslästerlich begraben werden musste. Der Pfarrer ließ sich erweichen, sie hatten noch Speck für ihn übrig. „Johanna solls heißen“, bestimmte die Mutter, „nach dem Vater, dem Johann.“ Den Speck hatten sie umsonst hergegeben. Das nahm die Mutter Johanna noch immer übel. Sie hatte genug andere Kinder, die sie ernähren musste, da konnte sie sich nicht an eines klammern, das sowieso nicht überleben würde. Aber Johanna starb nicht. Egal, wie wenig sich die Mutter um das Mädchen scherte, wie ausgetrocknet ihr Busen war, das Kind blieb. Es dauerte knapp drei Jahre, bis die Mutter verstand, dass das Kind überlebt hatte. Und erst ab diesem Zeitpunkt wurde das „Zniachtale“, wie alle zu ihr sagten, Johanna genannt. Schön? Nein, schön war sie nicht. Viel zu lang. Sie hatte die Figur ihres Vaters, ganz anders als die üppige Mutter und die rundlichen Schwestern. Die schmalen Hüften, die kleinen Brüste, da war nichts, was einen Mann verführen konnte. Es hatte nie genug zu essen gegeben. Trotzdem wurden ihre Schwestern zu Frauen. Nur Johanna blieb, wie sie war, der zähe, harte Knochen, ohne Polster, in die sich ein Mann hätte betten können.
Johanna wusste, was ihre Mutter dachte: Was sollte der Organist schon von ihr wollen? Ein eitler Gockel, das war er wohl, wie er dort oben saß, über ihnen. Und unverheiratet noch dazu. Aber er konnte wunderschön spielen und deswegen durfte er dort oben sitzen, über der ganzen Kirchengemeinde, und sie alle mit seiner Musik emporheben. Sie wollte dort hinauf. Auf die Empore, wo sie nicht dicht gedrängt neben ihren Geschwistern sitzen musste. Wo sie dem erhabenen Klang nahe war, ja, ihn vielleicht sogar selbst produzierte. Eines Tages.
Am nächsten Sonntag machte sie sich wieder zurecht, die Schürze sauber, das Kopftuch, unter dem die Haare versteckt waren, ordentlich geknotet und den Blick auf die Schuhe der Schwester gerichtet. Und bevor sie mit der Familie hinausging, sagte Johanna leise an die Mutter gewandt: „Er hat gesagt, ich soll wiederkommen heut. Damit ichs lern. Er hat gesagt, ich kanns lernen.“ Die Mutter wusste zuerst nicht, worüber das Kind redete. Aber auf einmal fiel ihr wieder ein, wie die Orgel im ganzen Ort zu hören gewesen war, die Scham, die sie empfunden hatte, darüber, was die Leute wohl dachten, dass ihre hässliche und unbegabte Tochter in der Kirche auf der heiligen Orgel herumklimperte, und die Wut. Und die Mutter lachte, so laut und ordinär, dass der Stiefvater sie hätte schimpfen müssen, aber er war schon draußen, nur die Frauen waren noch in der Stube. „Der Franz wird dir was Schönes zeigen“, sagte die Mutter zu Johanna. „Aber das kannst selber ausbaden mit dem Lump.“ Dann drehte sie sich abrupt um und ging ebenfalls hinaus, die älteren Töchter folgten ihr wie ein Schatten, während Johanna in der Tür stehen blieb und nicht wusste, was sie tun sollte.
In der Kirche waren sie aufgereiht wie immer, vor ihnen der Altar und der Pfarrer, der über die Welt und ihre Verführungen wetterte, dass es einem angst und bang wurde. Und von oben die Klänge, die das Himmelreich versprachen.
Während Johannas Familie am Ende der Messe zum vorderen Ausgang marschierte, lief sie zurück. Warum war sie so groß und auffällig? Schnell die Stiege hinauf zur Empore, dort oben im Schatten darauf wartend, dass die letzten Schritte verhallten. Franz sah sie nicht an, grüßte nicht, blätterte in einem Notenheft und strich über seinen Schnauzbart. Aber natürlich hatte er sie bemerkt: „Heut zeig ich dir das Spielen mit den Füßen“, sagte er ruppig. Johanna nickte, setzte sich auf die kleine Bank neben ihn und beobachtete, hörte, nahm auf.
Der Stiefvater hatte beim Ziehharmonikaspielen ihr gutes Gehör gelobt. Aber was war das gegen diese Töne, die hier inmitten der dicken Steinmauern unbezwingbare Höhen und bodenlose Tiefen erreichten? Sie bewunderte, wie die Füße vom Franz diese seltsamen Hebel unter der Orgel berührten, die sie noch gar nicht entdeckt hatte, wie er alle richtig erwischte, ohne hinzusehen. Er war schnell und rücksichtslos, ließ ihr keine Zeit, ihm noch einmal zuzuschauen. Sie versuchte es, tat es ihm nach, bemühte sich, die zittrigen Füße auf die Pedale zu stellen, nicht abzurutschen mit den viel zu großen Schuhen, die keinen stabilen Halt boten. Natürlich vertrat sie sich gleich einmal. Ängstlich und erschrocken sah sie, wie er das Gesicht verzog, als hätte er saure Milch getrunken. Aber er sagte nichts und Johanna schämte sich. Langsam lehnte er sich zurück. Sie fürchtete, er würde sie nun wegschicken, stattdessen zeigte er auf das Buch, das vor ihm auf dem Pult lag. „Kennst das? Das ist die Schrift von der Musik.“ Sie nickte. Der Stiefvater hatte sie ihr einmal gezeigt vor vielen Jahren. Aber sie wusste nicht, wie sie sie lesen sollte. „Kannst das Alphabet?“, fragte Franz. Sie nickte erneut, wagte nicht mehr, ihn anzusehen. „Aufsagen!“, befahl er.
„A, b, c …“
„Lauter!“
„A, b, c …“ Sie fürchtete, man könnte ihre Stimme im ganzen Ort hören. Doch sie machte weiter, Buchstabe für Buchstabe kam aus ihrem Mund, der es nicht gewohnt war, so laute Töne von sich zu geben. „Passt“, sagte der Organist zufrieden, „wennst das kannst, kannst das andre auch lernen.“ Er zog ein kleines vergilbtes Heft aus der Tasche. „Das lernst, verstehst? Bis nächsten Sonntag. Und wehe, du machst einen Fleck da hinein. Dann …!“ Johanna nickte heftig. Er deutete mit dem Kopf, dass sie gehen sollte. Sie machte einen unbeholfenen Knicks und verschwand, das Heft an sich gedrückt. In der Nacht stand sie auf, versuchte, beim Aufstehen nicht ihre Schwestern zu berühren, die neben ihr lagen, nahm eine Kerze und das Heft und stahl sich aus der Tür ins Freie. Drei Nächte hintereinander lernte sie, bis sie eines Mittags während des Kochens einschlief und sich beinahe die Finger verbrannte. Aber Johanna war zäh. Die Noten prägte sie sich leichter ein als die Buchstaben, die sie in der Schule so mühsam in ihren Kopf bekommen hatte. Wozu brauchte es überhaupt so viele, wenn es so wenig zu reden gab? Die kleinen Zeichen auf den Linien waren viel verständlicher, so wenige von ihnen ergaben so viele Töne, Klänge und Kombinationen.
„Und? Hast glernt?“, fragte Franz, als sie am darauffolgenden Sonntag nach der Kirche wieder neben ihm saß. Johanna hob den Kopf. „Ja“, sagte sie, so laut und deutlich, dass er sich tatsächlich zu ihr drehte und sie ansah.
GERTRUD, 1994
Ich hasse diese blöden Locken! Vielleicht hilft Wasser, sie zu glätten? Na super, da kommt schon wieder eine. Dann halt Gel. Na toll, hilft auch nichts. Jetzt sind es fettige Kringel. Locken sind peinlich. Die haben nur Prolo-Tussis oder alte Frauen. Schnurgerade Haare sind cool. So ein bisschen unfrisiert zerzaust. Wie die Kim Gordon oder die Shirley Manson. Ich schau mehr so aus wie Silvester Stallone in Rambo. Voll peinlich eben. Die Kathi hat keine Locken. Die hat Glück! Wir sind bei ihr im Badezimmer. Das Bad bei uns ist zwar viel größer, trotzdem gibt es keinen Platz. Alles ist vollgeräumt mit Wäsche. Der Bettwäsche der Gäste und unserer eigenen. Und es gibt ein tiefes und ekliges Waschbecken, in dem dann auch noch manchmal die Handwäsche landet. Unsere Badewanne ist dreckig und hat überall komische schwarze Streifen. Die muss man wenigstens nicht sehen. Weil da liegen meistens irgendwelche Geschirr- oder Handtücher drin. Darüber ist eine Schnur gespannt, auf der hängt die saubere Wäsche. Nicht einmal ordentlich duschen kann man bei uns. Der Abfluss ist ständig verstopft. Baden kann man überhaupt vergessen, weil ich dann stundenlang alles weg- und zurückräumen muss.
Warum können wir nicht wenigstens ein normales Bad haben? Mit Dingen, die man im Bad braucht? So wie hier. Bei Kathis Familie. Oder bei der Barbara aus unserer Klasse. Die hat sogar ein eigenes, ganz für sich allein, mit einer Dusche und einem kleinen Waschbecken. Wenn ich mir denk, wie ich früher sogar aufs Gasthausklo unten gehen musste, wäh, da würd ich mich jetzt anspeiben. Ein schönes Bad, das wünsch ich mir am meisten. Es muss ja kein eigenes sein. Aber wenigstens ein normales, sauber und aufgeräumt wie bei der Kathi. Kleine Laden mit nützlichen Dingen: Fläschchen, Döschen, Wattestäbchen. Keine riesigen Packungen Fleckenmittel oder Waschmittelpackungen. Hier stehen nur Lippenstifte, Nagellack und sogar ein Männerparfum herum. Mein Papa weiß nicht einmal, dass es so etwas gibt. Bei uns daheim stehen nur die Zahnbürsten und das Glas, in das die Oma ihre falschen Zähne legt. Das ist so ekelig. Müssen die im Bad stehen, wo ich sie immer anschauen muss? Das gibt es alles nicht bei der Kathi. Die hat so ein Glück! Kein Gasthaus. Und keine Oma daheim. Und keine Gäste, die nerven.
„Vielleicht hat er deine Nummer verloren“, sagt die Kathi. Sie sitzt auf dem Badewannenrand. „Pffff“, mach ich. „Sicher.“ Nicht, dass ich das nicht schon fünfhundertmal überlegt hab. „Sollen wir vielleicht nochmal anrufen?“, frag ich. „Nein, würde ich nicht“, antwortet die Kathi. Ja, eh klar, ich weiß selber, dass man das nicht tun sollte. Aber was, wenn Sollen und Wollen zwei ganz verschiedene Dinge sind?! Und wie kann es sein, dass der Typ, mit dem ich vorige Woche zum ersten Mal im Leben wild herumgeschmust hab, mich einfach nicht anruft? Hab ich was falsch gemacht? Kann ich vielleicht nicht schmusen? Aber er wollt ja gar nicht aufhören. Jetzt ist es so lang her. Ich weiß es. Er wird sich nicht mehr melden. Sicher nicht. Aber ich hoff es halt. Jeden Tag hab ich das blöde Telefon bewacht. Damit nicht die Oma abhebt, wenn er anruft. Voll peinlich. Obwohl es noch immer besser gewesen wäre als nichts. Einfach kein Klingeln. Keine ausgerichtete Nachricht von irgendwem. Kein „Da hat so ein Bursche angerufen“ von der Oma. Nix. Ich hab sogar nachgefragt. Jeden Tag. Hat wer angerufen für mich? Sie hat immer nur „Nein“ gesagt und den Kopf geschüttelt. Der Witz ist ja, dass der Typ nicht mal so besonders war. Von der HTL, eh nett, halblange Haare und somit maximal halb cool. Ich hab gemerkt, dass er mich angeschaut hat auf der Party. Und wie er dann gefragt hat, ob ich mit ihm hinausgehen will, hab ich so getan, als wärs mir wurscht. Dabei war ich voll nervös. Was hätt ich gemacht, wenn er einen Ofen hätt bauen wollen? Da wird mir nämlich immer schlecht und komisch. Kiffen ist für mich total arg, aber das kann ich niemand sagen, außer der Barbara und der Kathi, die damals dabei waren. Aber der Typ wollte keinen Ofen bauen. Er wollte schmusen. Mit Zunge sogar. Das war nicht super und gleichzeitig nicht schlecht. Das Küssen am Hals war gut, da war ich happy. Endlich. Mit sechzehn das erste Mal schmusen. In der Bravo Girl haben in dem Alter alle schon Sex. Mich interessiert Sex gar nicht. Aber das weiß auch niemand. Nicht einmal die Barbara und die Kathi. Ich find sogar Zunge irgendwie bäh. Das ist doch irgendwie nicht normal. Aber normal ist bei mir sowieso nichts. Ich hab ihm meine Telefonnummer auf den Unterarm geschrieben.
Arschloch!
„Vielleicht hat er sie runtergewaschen?“, sagt die Kathi. „Hm. Vielleicht sollt ich ihn doch nochmal anrufen?“
Vorigen Mittwoch hab ich es nicht mehr ausgehalten. Den Nachnamen von ihm hat Simone gewusst. Die Nummer hab ich dann im Telefonbuch gefunden und angerufen. So einfach ist das, wenn man will. „Der Bernhard ist leider nicht da“, hat eine Frau gesagt. Wahrscheinlich seine Mutter. Ich hab ihr meine Nummer gegeben und gesagt, dass er mich zurückrufen soll. Das war am Mittwoch.
Heut ist Samstag. Und ich hab immer noch nichts gehört von ihm. Vielleicht ist es besser. Weil wenn die Oma abgehoben hätt, hätt sie gesagt, sie kennt keine Geri. Hier gibt es nur eine Trudi. Das wär voll peinlich gewesen, wenn sie gesagt hätt, sie kennt keine „Geri“, nur eine „Trudi“. Der Oma kann ich tausendmal sagen, dass sie mich nicht mehr so nennen soll. Es ist ihr egal. Die Kathi steht auf, stellt sich neben mich und malt sich mit dem Kajal die Augen rundherum schwarz an. „Und wenn du ihn triffst?“
„Hast den mal bei uns wo gesehen?“
„Stimmt. Aber heut vielleicht, da kommen sicher viele.“ Die Kathi schaut voll fertig aus. Das ist cool. Es ist nicht leicht, fertig und gleichzeitig gut auszusehen. Ich nehm den Lippenstift. Meine Mama hat gar keinen. Sie hat nichts, außer ein Make-up, das sie nie benutzt, und eine vertrocknete Wimperntusche. „Für besondere Anlässe“, sagt sie dann immer. Es gibt aber nie besondere Anlässe. Dabei hab ich ihr einen Lidschatten zu Weihnachten geschenkt. Den hat sie einmal benutzt – und das nur, weil sie geglaubt hat, sie muss. Der Papa hat an dem Tag dann in der Früh gefragt, was mit ihren Augen los ist. Okay, es hat echt komisch ausgeschaut. Weil sie es halt sonst nie macht.
„Es ist noch zu früh“, sagt die Kathi und schaut auf die Uhr. „Im Fernsehen läuft jetzt aber auch nichts mehr. Gehen wir mal raus und drehen eine Runde.“ Die große Runde ist einmal um den Häuserblock herum. Wir gehen aus der Wohnung, die Stiegen runter, den Gehsteig entlang bis zum Eckhaus, wo dahinter der Park beginnt. Der ist klein, aber Natur haben wir hier eh genug. Plötzlich seh ich einen Ball auf der Wiese liegen. Es liegt noch kein Schnee, aber der Boden ist gefroren. „Hat wahrscheinlich wer vergessen“, sagt die Kathi und will weitergehen, aber ich lauf hin zu dem Ball. Mal schaun. Es ist ein Fußball, nicht mehr ganz aufgepumpt, aber immer noch gut genug zum Spielen. Wer vergisst denn so einen super Ball? Ist einer von der WM 1990, das seh ich sofort. Ich schnapp ihn mir und dribble ein bisschen herum, lauf auf ein Tor zu, das es nur in meiner Fantasie gibt, pass an einem Spieler vorbei, lass ihm keine Chance, pass an anderen Spielern vorbei und brüll: „Tor!“
„Es ist kalt“, ruft die Kathi. „Komm endlich, ich erfrier hier noch.“ Ich nehm den Ball in die Hände. Er fühlt sich richtig gut an. „Geri!“, ruft wieder die Kathi. „Ich werd ihn mitnehmen“, sag ich. „Echt? Den alten grauslichen Ball? Was willst denn damit?“ Ich zuck mit den Schultern. „Du kannst doch nicht mit einem Ball zur Grunge-Party! Außerdem ist Fußball voll prolo“, sagt die Kathi abschätzig. Fußball ist prolo. Wer cool ist, spielt Basketball, sagen meine Freunde. Ich mag alles, was mit Bällen zu tun hat. Aber am liebsten hab ich den Ball am Fuß. Früher hab ich jeden Tag gespielt. So mit Fantasiemannschaften gegen Fantasiegegner. Der Thomas und die anderen Buben haben nie Lust gehabt mit mir zu spielen. Haben immer nur gelacht. „Ein Mädchen!“ Dabei hätt ich sie fertiggemacht. „Na gut. Schade.“ Ich lass den Ball liegen. Wir sind noch immer zu früh, aber es ist zu kalt zum draußen Herumlaufen. Wir gehen ins „Kant“, das ist unser Stammlokal in der Nähe vom Park. 20 Schilling Eintritt. An der Kasse sitzt ein Mädchen. Keine Ahnung, wer die ist. Viel los ist noch nicht. Sie haben alles ein bisschen umgestellt. Wahrscheinlich zum Tanzen. Die dicken Couches stehen jetzt in der Ecke und ein paar Tische und Stühle sind überhaupt ganz weg. Hinten stehen der Martin und zwei andre Typen am DJ-Pult. Sie legen Musik auf. CDs, keine Platten. Dazwischen setzen sie sich Kopfhörer auf und nicken im Rhythmus. Kein einziges Mal schauen sie zu uns her. Und wir natürlich nicht zu ihnen. Die Kathi und ich schmeißen uns auf die Stühle an einem der Tische ganz im Eck und bestellen zwei Apfelsaft. Die Musik ist gut, wir wippen auch mit dem Kopf. Nach und nach füllt sich das Lokal, irgendwann kommt die Barbara. Sie hat ihre Haare zu einem Dreads-Turm gesteckt und trägt eine Jacke, die wie frisch aus der Altkleidersammlung ausschaut. „Coole Jacke“, brüllt die Kathi. „Caritas“, schreit die Barbara durch den Lärm zurück und wirft sich zu uns. „Es kommen sogar Leute aus Klagenfurt, geil, oder?“ Wir nicken. Und genau in dem Moment, als ich zur Tür schau, kommt der Bernhard rein. Seine halblangen Haare hat er zusammengebunden. Er sieht mich an und ich hab keine Zeit mehr wegzuschauen. Er lächelt, dann dreht er sich weg. Arschloch.
MARIANNE, 1994
Sie konnte es nicht sehr viel länger aufschieben. Schon jetzt hatte sie ein schlechtes Gewissen. Marianne räumte die Gläser aus dem Geschirrspüler. Irgendwann musste sie es ihnen sagen. 19 Uhr 42. Es war höchste Zeit. Sie wischte noch einmal über den Tresen, dann fiel ihr noch dies und das ein, ihn einfach nur ein bisschen hinauszögern, diesen unangenehmen Moment, wie die Kinder, wenn sie lernen mussten, immer fielen ihnen dann plötzlich Tausende andere wichtige Sachen ein. „Mama, ich hab Hunger“, krähte Trudi aus dem Jägerstüberl. „Gleich!“ Als Sechzehnjährige konnte sie sich doch selbst was zu essen machen, oder?, dachte Marianne. „Wann kommt der Papa?“, wollte Trudi wissen, die plötzlich vor ihr in der Gaststube stand. „Er kommt nicht.“ Kurz schien Trudi irritiert zu sein. „Mit wem hast du am Nachmittag telefoniert?“, fragte Marianne schnell, nicht aus Interesse, sondern um Zeit zu schinden. „Mit der Kathi. Warum kommt er nicht? Wo ist er denn?“
„Na ihr habt aber immer viel zu besprechen“, sagte Marianne. Trudi zuckte mit den Schultern. Und dann, endlich, gab sie sich einen Ruck: „Ich muss mit dir und Oma reden“, nuschelte sie so leise, dass es kaum verständlich war. Trudi verstand nicht. Natürlich nicht. „Wie? Reden? Was reden?“
Reden. Sie redeten doch nicht. Sie sagten sich etwas. Die Ankündigung „reden zu müssen“ war etwas völlig Neues. Trudi bekam Angst und schaute ihre Mutter mit großen Augen an. Sie atmete tief ein. „Hatte der Papa einen Unfall? Muss er sterben?“ Marianne schüttelte beruhigend den Kopf. „Nein, nein, keinen Unfall, Papa gehts gut. Alles gut.“ Sie warf den Fetzen in die Abwasch, legte den Arm auf Trudis Schulter, schob sie ins Jägerstüberl zurück und gab ihr zu verstehen, sich zu setzen. Es war so förmlich, dass es Marianne selbst komisch vorkam. So sind wir ja gar nicht, dachte sie und fühlte sich, als spielte sie eine Rolle in einer dieser Fernsehserien, die Trudi manchmal am Nachmittag schaute. Die Gaststube hatten sie zugesperrt, es war spät, die Arbeiter von der Straßenbaustelle waren die letzten Gäste gewesen und inzwischen auch schon gegangen. Die Stüberltür stand noch offen, Marianne trat einen Schritt hinaus. „Mutti!“, rief sie die Stiegen hinauf. „Kommst du bitte?“ Es war 20 Uhr 11.
„Warum?“
„Ich muss mit euch reden!“
Stille. Dann: „Was?“
„Ich muss euch was sagen!“ Jetzt hörte sie Johanna mit den schnellsten Schritten, die sie machen konnte. Wie rasch die Mutter über die Stiegen laufen konnte, wunderte sich Marianne. Johannas Blick war wie der von Trudi, erstaunt und verwirrt. „Ich hab Krebs, oder?“, fragte sie ängstlich. „Was? Wie kommst du denn darauf?“, fragte Marianne. „Nein, so ein Blödsinn!“
„Du hast so ein Gesicht gemacht, da hab ich gedacht, du hast die Ergebnisse vom Doktor Pfeifinger bekommen.“ Marianne schüttelte den Kopf.
„Nein, ich war gar nicht dort. Setz dich bitte, Mutti, es ist nichts Schlimmes.“ Trudi und Johanna schauten einander an. Sie saßen sich gegenüber, die Junge und die Alte, mit ihrem fragenden Blick auf Marianne gerichtet und auch wenn es Trudi nicht freuen würde: Sie sahen sich in dem Moment ähnlich. Marianne war nervös. Sie hasste es, vor anderen zu sprechen, sie stand nicht gern im Mittelpunkt wie Johanna und Trudi. Aber da musste sie jetzt durch. Lange hatte sie überlegt, wie sie es ihnen sagen sollte. In welcher Situation. Zu welchem Anlass. Dabei stand es tatsächlich bereits drei Monate fest (drei Monate! Kaum zu glauben, drei Monate!) und sie hatte es bis zum letzten Moment nicht geschafft, es auszusprechen. Und dieser letzte Moment, der war jetzt.
„Sag bitte endlich, was los ist, Mama, ich möcht noch was im Radio hören.“ Trudi verlor die Geduld. „Ich, also, es ist nicht so leicht“, sagte Marianne, nahm sich einen Stuhl und setzte sich zu Trudi und ihrer Mutter. „Was ist nicht leicht? Was ist denn los? Jetzt red schon, Marianne.“ Auch Johanna wurde ungeduldig. „Jaja, ich versuchs ja schon die ganze Zeit. Es hilft nichts. Erwin und ich …“
„Ihr lasst euch scheiden!“, rief Trudi unvermittelt. Sie sah aus, als hätte sie einen Scherz gemacht und würde auf ein „Nein, natürlich nicht“ warten. Aber das kam nicht. „Ja“, antwortete Marianne stattdessen knapp. Sie sah auf die Wanduhr: 20 Uhr 23.
Schweigen. Schlucken. Kopf schütteln. Und dann ein jäher Aufschrei von Johanna. „Ich habs ja immer gewusst, dass der nix taugt.“ Marianne stöhnte. „Mutti, bitte!“ Johanna hatte das Talent, Öl ins Feuer zu gießen. Aber warum musste sie so etwas vor Trudi sagen, Erwin war ihr Vater.
„Deshalb kommt er heut nicht“, kombinierte Trudi seufzend.
„Auch.“
„Hat er eine andre?“, fragte Johanna.
„Nein, es gibt keine andre.“
Die Mutter schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. „Du musst nur abwarten, Marianne, die Männer sind so. In ein paar Wochen ist er wieder da. Dann hat er von der andren genug. So schnell gibts keine Scheidung, wirst sehn.“
„Es gibt keine andre!“, wiederholte Marianne genervt. Johanna machte eine wegwerfende Handbewegung. „Sagt er, jaja.“
Trudi war völlig verwirrt. „Wieso ist er überhaupt weg? Warum habt ihr vorher nichts gesagt? Bleiben wir hier? Ziehen wir woandershin?“
Marianne versuchte, ihre Stimme beruhigend klingen zu lassen. Sie streichelte die Hand ihrer Tochter. „Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Trudi, wir bleiben hier. Ich wollte zuerst mit euch reden. Morgen möchte sich Papa mit dir treffen. Dann sehen wir weiter.“ Trudi zuckte zusammen. Da war es wieder, dieses bedrohliche Reden. Die ganze Welt, ihre ganze Welt brach zusammen und sie konnte sich nicht einmal mehr darüber aufregen, dass sie die ganze Zeit „Trudi“ und nicht „Geri“ genannt wurde.
„Papa hat fürs Erste eine kleine Wohnung gemietet, aber er wird wahrscheinlich was Größeres suchen, natürlich in der Nähe“, sagte Marianne. Trudi nickte und schwieg. „So schnell lasst man sich nicht scheiden“, wiederholte die Mutter. So schnell war es eigentlich gar nicht. Die Konflikte waren viele Jahre immer wieder die gleichen gewesen. Marianne wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Obwohl: Es würde weitergehen, und zwar wie bisher, nur ohne Erwin. Und die Leute hatten wieder etwas, worüber sie sich das Maul zerreißen konnten. Sie sah Trudi an, die ins Leere starrte. Zerstörten sie die Zukunft ihrer Tochter? Als hätte sie ihre Gedanken gelesen, sagte Johanna in diesem Moment: „Und an die Kinder musst auch denken. Die kommen schnell auf die schiefe Bahn bei geschiedenen Eltern, Marianne.“ Trudi schaute ihre Oma an. „Was heißt hier Kinder? Ich bin wirklich kein Kind mehr und der Thomas genauso wenig “, erwiderte sie. „Aber, Mama, du, sag …“
„Was denn, mein Schatz?“, fragte Marianne. Sie war auf alles gefasst. Seit Monaten hatte sie sich ausgemalt, welche Antworten sie auf welche Fragen, welche Stellungnahmen sie zu welchen Verleumdungen, welche Gegenargumente sie auf welche Behauptungen geben könnte. Was würde jetzt kommen? Die Frage nach der Schuld? Den Gründen? Weshalb jetzt? Würde ihre Tochter sie womöglich ablehnen und zum Vater ziehen wollen? Marianne schluckte und war auf alles gefasst. „Haben wir denn dann nur noch ein Auto, Mama, nur das von der Oma?“ Marianne grinste. Was ihre Tochter für Probleme hatte und dazu ihr herzzerreißender Hundeblick. „Das Auto? Ich weiß nicht, das haben wir noch nicht besprochen.“
21 Uhr 02. Die drei blieben noch eine ganze Weile sitzen und hingen ihren Gedanken nach. Wer hatte welche Gedanken? Wo blieben die Fragen, mit denen Marianne gerechnet hatte? Selbst ihre Mutter schwieg, bis sie den Kopf hob und ansetzte, etwas zu sagen. Marianne wappnete sich. „Heut kommt Klingendes Österreich mit dem Forcher. Vielleicht läufts noch. Ich schalt jetzt ein“, sagte die Mutter und nahm sich die Fernbedienung.
Am nächsten Morgen wachte Marianne um 5 Uhr 30 auf. Es war bereits hell. Die Vögel zwitscherten. Sie konnte noch eine halbe Stunde liegen bleiben, sich ausstrecken, querlegen. Wenn sie wollte, konnte sie einen Purzelbaum schlagen. Es würde niemanden stören. Nach so vielen Jahren plötzlich allein im Bett. Noch immer waren beide Seiten bezogen, noch immer lag Erwins Polster neben ihrem. Sie tauschte die Polster. Dann tat sie das Gleiche mit der Decke. Kindisch, aber warum nicht. Wie gut Trudi die Nachricht von der Scheidung aufgenommen hatte. Es war wohl richtig, was Erwin gesagt hatte. Die Kinder waren raus aus dem Alter, die interessierte das nicht mehr. Thomas hatte sie als Einzigem schon gestern Bescheid gegeben. Und er nahm es auf, wie er alles aufnahm: pragmatisch, ruhig, emotionslos. Bei Trudi hatte Marianne mit Tränen, vielen Warum-Fragen und dramatischen Ausbrüchen („Wie könnt ihr mir das nur antun?“) gerechnet. Und die Mutter? Ach, ihre Mutter. Sie hatte mit den Fragen nach einer anderen Frau genau so reagiert, wie Marianne es erwartet hatte. Erwin hatte auf ihre Entscheidung fast zwanzig Jahre warten müssen. Das war genug und er hatte recht. Sie nahm es ihm nicht einmal übel, dass er gegangen war. Eigentlich hatte sie vor langer Zeit damit gerechnet, mit diesem „Irgendwann“, das in der Luft schwebte, wenn sie sich gestritten hatten, wobei streiten das falsche Wort war, eher ein leises Anklagen seinerseits, auf das sie mit Schweigen reagierte. Und dann vor drei Monaten das endgültige „Aus“, von dem sie dann doch überrascht war, als Erwin es tatsächlich aussprach. Er hatte es ihr abends im Schlafzimmer gesagt, vor dem Einschlafen, sie hatte kaum noch die Augen offen halten können. Sie waren beide normalerweise nicht besonders gesprächig, nur beim Thema Arbeit und Geld konnte Erwin in eine Art Redeschwall verfallen. „Ich möchte es jetzt wissen“, hatte er gesagt und sie hatte kurz überlegt, so zu tun, als wäre sie eingeschlafen oder wüsste nicht, worum es ging, um dem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Wieder einmal. Doch sie hatte es nicht getan, sie war es ihm schuldig. Das wusste sie. So hatte sie sich aufgesetzt, den Blick nach unten gerichtet. Er hatte gewartet und sie hatte versucht, etwas zu sagen, aber ihr war nichts eingefallen. „Dir hat das Haus doch heute auch gefallen, oder?“, fragte Erwin schließlich. Marianne hatte die Knie angezogen und erwidert. „Ja, es ist schon schön …“
„Aber?“
„Die Mutti ist einfach alt.“
„Und wir? Wir werden immer älter, Marianne, wie lange willst du noch warten? Bis sie stirbt?“ Sie hatte nicht darauf geantwortet, sie hätte auch nur „Ja“ sagen können, aber das hatte sie sich nicht getraut, weil es eine Entscheidung gewesen wäre, die Entscheidung, auf die er so lange wartete.
Am nächsten Tag hatte er ihr kurz nach dem Aufstehen verkündet, er würde in rund drei Monaten ausziehen, und war aus dem Zimmer gegangen. Sie hatte sein Frühstück zubereitet, Trudi und ihre Mutter waren dazugekommen. Alles war wie immer. Sie sprachen nicht mehr darüber. Marianne hatte immer gehofft, er würde es sich anders überlegen, einfach dableiben und es würde weitergehen wie bisher. Aber sie