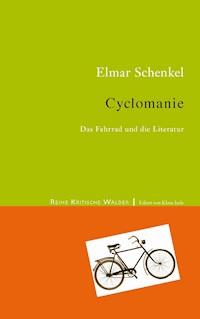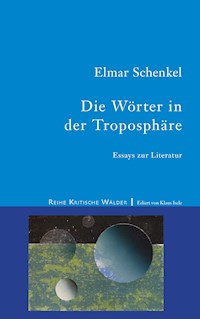
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Wenn die Wörter in die Troposphäre wandern, so zeigen sie an, dass die Phantasien globaler geworden sind. Schmetterlingseffekte und schwarze Schwäne nun, wohin man schaut: In dem Maße, wie alles mit allem zu korrespondieren anfängt, nehmen die Zufälle zu. In einer Welt, die so planbar wie möglich sein soll, erleben wir fortwährend Überraschungen. Von dieser paradoxalen Situation leben die gelehrten, aber immer lesbaren Essays in diesem Band – ob über Architektur oder Exzentriker, ob literarische Höhenflüge mit Conan Doyle oder Tiefsee-Erkundungen mit Jules Verne, ob Reisen über die Erde von Johann Gottfried Seume bis Joseph Conrad – immer geht es um das Verhältnis der Wörter zur Materie, zum Planeten und zu den Ambitionen dieser seltsamen Gattung, die sich diesen glaubt untertan gemacht zu haben. Literatur lockt, ebenso wie sie Täuschung entlarvt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorbemerkung
Paradoxien der Vergänglichkeit
Über Phantasie und Dauer in der Architektur
Das Gesicht der Wörter
Unordentlicher Versuch, die Zukunft der Philologie zu deuten
Lichter und Irrlichter
Die Rolle von Mythen und Archetypen bei kreativen Vergängen in Wissenschaft und Kunst
Bewegungen aus dem Abseits
Vom Nutzen und Nachteil des Exzentrischen in der Wissenschaft
Unruhiges Gewässer
Das Meer und die literarische Phantasie Europas um 1900
Ein himmlischer Geheimnisträger
Über unser Verhältnis zum Mond
Die Innenseite der Vergangenheit
Keltische und germanische Mythen in der englischsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts
Wie der Mensch ein Außerirdischer wurde
Aliens in der frühen Science Fiction 1880-1940
Seele und Stein
Architektur im Werk von Gilbert Keith Chesterton
Dämonen in der Troposphäre
Arthur Conan Doyles Phantastik und die Erzählung »The Horror of the Heights«
Die Bibliothek des Seefahrers
Joseph Conrad als Leser
Leben und Schreiben eines Grenzgängers
Johann Gottfried Seume
Borges oder die Melancholie des Wissens
Vorbemerkung
»Hier«, sprach er, »ändern sich die Dinge.
Du bist im Reich der Schmetterlinge.«
Wilhelm Busch
Die »Wörter in der Troposphäre« – das klingt im doppelten Sinne abgehoben. Was haben Wörter in diesen Höhen zu suchen? Die Troposphäre ist die unterste Schicht der Erdatmosphäre, in der der größte Teil des Wetters gemacht wird – also eine Art Wohnstätte der Wettergötter. Sie fängt bei ungefähr 8.000 m an und endet bei ca 18.000 m. In diesem Gebiet von zehn Kilometern ziehen gewaltige Ströme um die Erde und sorgen für alle möglichen Phänomene. Mich erinnert diese Wetterzone an die Sprache, durch die ebenfalls mächtige Ströme und Energien fließen und in der die Imagination ihr Potential entfaltet. Wenn die Wörter in die Troposphäre wandern, so zeigen sie an, dass die Phantasien globaler geworden sind. Schmetterlingseffekte und schwarze Schwäne nun, wohin man schaut: In dem Maße, wie alles mit allem zu korrespondieren anfängt, nehmen die Zufälle zu. In einer Welt, die so planbar wie möglich sein soll, erleben wir fortwährend Überraschungen.
Von dieser paradoxalen Situation leben einige der Essays in diesem Band. Architektur und Philologie zeigen hier Gemeinsamkeiten. Das Märchen kehrt in immer neuen Formen zurück und gibt Hinweise, wo die Quellen des Kreativen liegen. Meist doch in einem eher exzentrischen Bereich, der sich den Machtströmungen entzieht. Dort befindet sich eigentlich auch die Gattung des Essays selbst, dem es um Grenzbegehungen geht. Der Essay gibt Macht ab, indem er auf Spezialisierung verzichtet. Dafür kann sich der Sehbereich erweitern.
Wie weit akademisch kann ich gehen, wie weit will ich mich in die Sprache der Bilder und Rhythmen begeben, ohne dass man mir den Begriff »unwissenschaftlich« anhängen kann? Wenn die Wörter in die Höhe wandern, so entfernen sie sich von der Erde, wie es der Mensch virtuell schon seit Jahrtausenden tut, realiter aber erst mit Ballonflug und Luftfahrt. Dieser Aufstieg der sprechenden Spezies von ihrem angestammten Planeten in den Himmel bricht mit Tabus und fordert die Rache der Götter heraus. Doch eine solche Einsicht findet sich oft eher in Unterhaltungsliteratur als in literarisch ambitionierteren Texten. Conan Doyle soll hier einmal als Autor vorgestellt werden, der sich nicht nur auf Kriminalfälle verstand, sondern der auf spannende Weise in die Abgründe der Moderne führte – auch wenn er selbst noch konventionell schrieb. Plötzlich sehen wir, dass Kafka auf einer Flugschau in Norditalien ähnlich von Kopflosigkeit phantasiert wie Doyle fast zur selben Zeit in einer Horrorgeschichte.
Auf und ab gehen die Wörter – mal in den Himmel zu den Aliens und zum Mond, dann wieder in die Tiefe der Meere, in denen sich alte Symbolik anlagert. Wie kollidiert diese mit der Oberfläche des Meeres um 1900?
Mit den fliegenden und tauchenden Wörtern kommen die Menschen, denn vom Flug der Wörter haben sie gelernt, Grenzen zu überschreiten, Reisen zu machen und darüber zu schreiben – wie es Seume tat oder Conrad. Conrads Kongo war zuallererst ein Atlas, dann ein Buch, aus dem eine Reise wurde, die wieder in ein Buch zurückkehrte, das unsere Lesart von Afrika als »Herz der Finsternis« zutiefst beeinflusste. Wiederum lesen solche Autoren Bücher, die das Reisen und Wandern weiter vorantreiben. Andere Grenzen innerer Art hat Jorge Luis Borges überschritten, als er seine Fiktionen verfasste. Er führt die Wörter in die Bibliotheken zurück und dort werden sie erst recht ›troposphärisch‹: Die Welt verwandelt sich selbst in eine Bibliothek, sie wird zu ihrem eigenen Abbild.
Wenn Wörter in die Erdatmosphäre vordringen, so bedeutet dies auch immer eine Auseinandersetzung zwischen Literatur und Technik/Wissenschaften. Auch das macht die Wörter troposphärisch, fremdartig. Indem wir sprechen und phantasieren, sind wir selbst die Aliens, nach denen wir so lange vergeblich ausgeschaut haben. Der Mensch wird exzentrisch, und am besten lässt sich dies ablesen in den Wörtern, mit denen er traumhaft oder taghell diese Ablösung von der Erde ausmalt.
Der vorliegende Band versammelt Essays, die an verschiedenen Orten veröffentlicht worden sind. Mein Dank geht an die einzelnen Verlage und Personen, die einen Wiederabdruck erlaubt haben (s. Drucknachweise) sowie an Katja Brunsch und Denise Keil für das gekonnte Lektorat. Für Anregungen, Korrekturen und Druckmöglichkeiten danke ich Thorsten Bolte, Stephen Brodsky, Lisette Buchholz, Finn Harder, Katarzyna Krasoń, Karl Kegler, Ricarda Lukas, Jürgen Münch, Hazel Rosenstrauch, Elena Nikolaevna Shevshenko, Gabrielle Spaeth, Reiner Tetzner, Christian Trepte und Thomas Topfstedt – und nicht zuletzt meinem langjährigen Verleger Klaus Isele.
Paradoxien der Vergänglichkeit
Über Phantasie und Dauer in der Architektur
An Vergangenheit besteht ein großer Bedarf. Je mehr man davon hat, desto länger lebt man.
Matt Dekkers
Das Bauen und das Sprechen sind immer gegen die Zeit gerichtet. Selbstverständlich heißt das nicht, dass zwischen ihnen eine Harmonie herrscht. Das Sprechen dient nicht selten dazu, Bauten zu zerstören, und das Bauen kann Enzyklopädien der Sprache ersetzen. Bei aller Konkurrenz sind beide Akte Versuche, der Zeit zu entrinnen oder zumindest ihrem unerbittlichen Verlauf etwas abzuringen, seien es Gebäude, Denkmäler, Pfosten, seien es Sätze, Wörter oder Bücher, die sich eine Zeitlang vom Strom der Zeit tragen lassen, um dann als Spuren und Abdrücke zurückzubleiben. »Gegen die Zeit gerichtet« bedeutet somit zunächst eine Nutzung der zeitlichen Energien, doch am Ende bleibt nur ein Zeichen übrig: eine Zeichenzeit. Es wäre also besser zu sagen: Bauen und Sprechen sind nicht gegen die Zeit gerichtet, sondern kommen ihr irgendwann nicht mehr nach und hinterlassen Zeichen. Diese Zeichen richten sich gegen die jeweilige Gegenwart. Und die Gegenwart muss sich fragen, wie sie mit diesen Zeichen umgehen will: als Vorboten ihres eigenen Vergehens oder als Feinde ihrer momentanen Befindlichkeit.
HOCH HINAUS
Türme waren in der Menschheitsgeschichte immer Symbole von Einigung und Herrschaft – ob nun auf Staaten bezogen oder auf das Ich – denn auch Dichter und Denker pflegten gerne in Türmen zu wohnen oder sie gar zu bauen – man denke an Yeats, Rilke, Robinson Jeffers oder C. G. Jung. Leipzig baute von 1968-1972 nach Plänen des Architekten Hermann Henselmann einen Universitätsturm, der in mancher Hinsicht Aussagen zur Einigkeit machte. Henselmann war ein Stararchitekt der DDR, der in Jena und Berlin weitere Turmhochhäuser bauen sollte. 1968 wurde in einem heute als barbarischer Akt bezeichnetem Vorgang die Universitätskirche St. Pauli in die Luft gesprengt. Damit wollte die SED die Macht der Kirche in den Köpfen brechen – in dieser Hinsicht war Ulbricht ein 68er. An die Stelle der alten Unigebäude trat ein moderner Verwaltungsbau und das Hochhaus, das ursprünglich in Rostock gebaut werden sollte. Bei Fertigstellung war es mit seinen 155 m das höchste Gebäude Deutschlands. Darin steckte Anspruch, und der wurde von der Karl-Marx-Universität getragen: die geistige Schmiede des Sozialismus zu sein. Heute ist es noch das höchste Gebäude Leipzigs: So klein ist das frühere Deutschland geworden. Es war nicht nur hoch, es sollte auch Symbolkraft ausstrahlen. Henselmann baute es in Form eines offenen Buches, so als solle man in diesem Gebäude etwas lesen. Ich erinnere mich noch an die Auszugsparty 1998, als die alten Geister mit einem riesigen Schlagzeuglärm aus dem Gebäude getrommelt wurden. Das hatte schamanistische Qualität. Bis 1998 hieß es Weisheitszahn oder Unihochhaus, manchmal auch Professoren-Rampe, heute ist es halb anglisiert wie der JenTower von Jena und heißt City-Hochhaus. In den 1990ern wurde es verkauft, heute wird es von einem amerikanischen Unternehmen unter anderem an den MDR vermietet. Inzwischen ist es rundum erneuert und mit Naturstein verkleidet worden.
Von 1993 bis 1998 durfte ich in diesem Haus arbeiten. Es ragte für mich wie in eine andere Dimension hinein, es war nicht nur Raum, sondern auch Zeit. Zwanzig Jahre DDR hatten sich in dem Gebäude eingenistet, man konnte sie förmlich riechen. Einige Wände hatten Füllungen, die durch braune Plastikschichten abgedeckt waren. Wenn diese Risse hatten, so strömte ein Geruch des alten Systems in die Gegenwart hinein, als versuchten die Dinge, über die ihnen bemessene Zeit hinaus in andere Räume einzudringen. Die Vergangenheit war präsent in Schubladen, Briefköpfen, Stempeln, aber auch in der geordneten und getürmten Struktur des Hauses. Nicht anders als der Kapitalismus – heute stehen die höchsten Bauten Deutschlands in Frankfurt und gehören den Banken – wollte sich auch der Sozialismus vertikal in die Geschichte bringen: Wer die Schwerkraft am besten überwindet, hinterlässt das größte Zeichen. In der Horizontale lässt sich die Zeit weniger gut symbolisch beherrschen, denn im Ausdehnen von Fläche ist die Natur einfach besser; in Sachen Wüste, Meer und Steppe lässt sie sich nicht belehren. Allerdings ist sie uns auch in der Vertikale noch voraus: Türme, die den Mount Everest übersteigen, sind noch nicht geschaffen, immerhin aber Satelliten, Raumsonden und Raketen, die weit darüber hinaus gehen.
Die Vertikale – der Turm, ob Kirche oder Wohnhaus – ist ein Fingerzeig, Symbol für das Zeigen selbst, das ein menschliches Signum ist. Mit dem Zeigen wird Intention sichtbar: So soll es sein, das will ich haben. So beginnt das Zählen und Messen von Dingen und Zeitabständen. Mit dem Leipziger Hochhaus zeigt der Sozialismus auf den Himmel und misst seine Zukunft. Er stellt seinen Anspruch auf ein menschliches Allgemeinerbe, das so allgemein ist, dass es nur vom Himmel erfasst werden kann. Auch hierin zeigt er sein religiöses Fundament, das eher Firmament zu heißen hätte. Wenn ich auf dem Südfriedhof die Reihen der Gräber von Antifaschisten und Kommunisten sehe und dazu entsprechende Denkmäler, so wundert mich immer, dass eine Ideologie, die so sehr auf den Materialismus pocht, über den Tod hinaus wirken will, einem unbekannten Glauben zuliebe, den man vorerst Atheismus nennen muss. Der wahre Materialismus kann nichts anderes als totaler Nihilismus und Zynismus sein. Woher die Humanität auf den Fahnen des Sozialismus? Woher nimmt er seine Letztbegründung, wenn nicht als säkularisiertes Christentum? Inzwischen ist das Hochhaus übernommen worden, die Ideologie ist tot, das Haus lebt unter neuem Gewand weiter. Woraus hervorgeht, dass materielle Gebilde Gehäuse für alles Mögliche sein können, und damit sichern sie sich ihre Lebensdauer auf einige Generationen.
Wenn bei Marx der Überbau, also alles Geistige und Kulturelle, sekundär ist, dann erweist sich an solchen Vorgängen, dass es doch ganz anders ist. So hat der wahre Überbau, der Kopf von Marx nämlich, fast vierzig Jahre lang das Gebäude der Universitätsverwaltung am Augustusplatz getragen. Ein weiterer Überbau kam hinzu: Die Geschichte stellte sich nämlich als Legende heraus. Jahrelang hat man gezögert, die Skulptur vor dem Gebäude, die eine Symbiose aus Marx, Lenin und Proletariern zeigte, abzureißen, in der Furcht, das gesamte Haus könne einstürzen. Rektor Häuser hatte das geglaubt und dies auch der Öffentlichkeit mitgeteilt, zum Unmut etwa eines Erich Loest. Später musste der Rektor seinen Irrtum eingestehen. Die Statik des Baus hatte nichts mit der großen Skulptur zu tun. Eine Geschichte hatte dafür gesorgt, dass sich ein Gebäude länger hielt, als es sollte. Es war eine Art Tabu, das heute eben die Form einer urban legend annehmen kann.
1974 hatte man an der Stelle, wo einst die Universitätskirche stand, dieses riesige Bronzerelief mit dem Titel »Aufbruch« installiert (14 m x 7 m, 33 t, geschaffen von Rolf Kuhrt, Frank Ruddigkeit, Klaus Schwabe). Ging man zu den Verwaltern der Universität, musste man dieses Objekt unterqueren, und man fühlte förmlich die Veränderung der Gedanken. Das Relief »Aufbruch« wurde 2006 demontiert, ohne dass das Gebäude kollabiert wäre. Aber das Gebäude steht nun tatsächlich nicht mehr. Das Relief zersägte man in drei Teile und baute es 2008 wieder auf, etwas außerhalb des Zentrums, vor der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK), einst Schmiede der DDR-Goldmedaillen. Es gab Widerstand auch gegen diesen Versuch, Geschichte zu erinnern. An der Dauer einer Skulptur, die für ein Gebäude und eine Weltanschauung steht, rieben sich die Geister, und man kann sie gleichsam politisch verorten nach der Art und Weise, wie sie mit diesem Ungetüm umgegangen wären. Die einen wollten es verschrotten, andere gleich neben der Universität wieder aufstellen (natürlich mit einem informativen Mäntelchen), eine Schlossbesitzerin hätte es gerne in ihrem Park stehen gehabt. Die Universität entschied sich für einen Kompromiss: keine Vernichtung von historischen Zeichen, aber Entschärfung ihrer Wirkung durch Deplatzierung und Information. Symbole sind Bomben ähnlich, auf die man bei Ausgrabungen stößt.
Die Trümmer der Unikirche wurden 1968 in den Etzoldschen Sandgruben abgeladen, etwa 4 km südlich vom Zentrum, in der Nähe des Völkerschlachtdenkmals. Dort wurde nun etwa zeitgleich mit der neuen Universitätskirche eine Gedenkstätte eingerichtet: Stelen und Stufen, ein Aussichtspunkt und ein interaktiver Klangteppich, den der sächsische Tonkünstler Erwin Stache vorbereitet hat. Die Klänge sollen an den Einsturz der Kirche erinnern. Das neue Paulinum am Augustusplatz, das wahrscheinlich 2015 fertiggestellt sein wird, wurde nach Plänen des niederländischen Architekten Erick van Egeraat gebaut. Nach dessen Insolvenz dient er weiter als Berater bei der Fertigstellung. Der Bau stellt einen Kompromiss dar zwischen Moderne/Postmoderne und den Bedürfnissen nach einem spirituellen Mittelpunkt der Universität, wobei sich hier Vertreter einer dezidiert christlichen Linie mit denen eines multikulturellen Säkularismus in den Haaren liegen. Der Streit konzentrierte sich auf eine Glaswand, die die letzteren zwischen Aula und Andachtsraum einziehen möchten zum Schutz von Kunstwerken, die anderen aber ablehnen aus akustischen Gründen und als Teil eines Programms der Abtrennung des Christentums von den Belangen einer Universität. Hier wiederholen sich Kämpfe, wie sie durch die Jahrhunderte immer wieder zu besichtigen sind, zwischen den anciens et modernes. Swift hätte problemlos daraus ein Kapitel für seinen Gulliver beziehen können. Um die äußere Erscheinung des Baus, die allgemein auf Zustimmung stößt, gab es auch Fragezeichen. So ist die postmodern-gotische Fassade nicht symmetrisch. Als die Verschalung 2009 zum 600. Jubiläum der Universität fiel, bemerkten Passanten voller Unruhe, dass das Rundfenster nicht senkrecht über dem Portal steht. Auch das Dach ist nicht glatt, sondern versetzt und von Streifen durchzogen. Die Erklärung lautet: Hier wird die spätgotische Kirche nicht gezeigt, wie sie einige Jahrhunderte lang aussah, sondern im Moment ihres Zusammenbruchs. Filmdokumente und Fotos von 1968 zeigen diese wenigen Sekunden einer erschütterten Ordnung; der Architekt hat versucht, diesen Moment zu bannen – für die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte.
Daraus könnte man schlussfolgern: Architektur, die eine Krise versinnbildlicht, die aus einer Krise geboren wurde, hat eine lange Lebensdauer. So manch einer datiert sein Leben nach den Daten von Lebenskrisen, und nicht anders geschieht es in Kulturen. Der Turm von Babel lebt fort, nachdem er nie vollendet wurde, in Gestalt von tausenden von Sprachen in dieser Welt. Gott nahm den Menschen ihren Turm und gab ihnen dafür die Vielzahl der Zungen. War das ein schlechter Tausch? Man kann auch sagen: Gott verhinderte oder verzögerte die Globalisierung. Damit schuf er zumindest Arbeitsplätze für Linguisten, Übersetzer und Dolmetscher.
Die Symbole der Globalisierung – ob in Taiwan das Taipei 101 oder der Burdsch Chalifa in Dubai – wachsen zu neuen babylonischen Gestalten heran, und man wird sehen, ob ihre Höhe ihrer Dauer entsprechen wird. Sie brechen auf jeden Fall ein altes Tabu. Es ist nicht nur auf die Höhe, die Luftgeister und Gott bezogen, sondern spricht auch von Arroganz gegenüber Lebensbedingungen. Wer so hoch hinaus will, pfeift auf Erde, Umwelt und Wetter. Der Gedanke an solche Hochhäuser als Ruinen wird von Anfang an verworfen, sie sind die beständige Erinnerung an die Unsterblichkeit des Menschen, zumindest als Geschlecht. Der Mensch triumphiert durch seinen Sieg über die Höhe auch über die Zeit, oder so scheint es wenigstens. Hochhäuser sind in diesem Sinne gleichbedeutend mit den utopischen Aussagen einer Medizin, die das Ewige Leben verspricht. Sie sind bauliche Verwirklichungen des alchemistischen Traumes, der Europa seit der Neuzeit umhertreibt. Doch der Mensch, das hat Dostojewskij erkannt, will vielleicht gar nicht die ewige Glückseligkeit. In seinen Aufzeichnungen aus einem Kellerloch (1863) sinniert der menschenhassende Erzähler über diese Frage und macht sie an dem zwölf Jahre zuvor auf der Londoner Weltausstellung entstandenen Kristallpalast fest. Der Mensch ist von seinem Wesen her ein Zweifler, doch »was wäre das für ein Kristallpalast, wo man noch zweifeln könnte? Indessen bin ich davon überzeugt, dass der Mensch auf wirkliches Leiden, das heißt Zerstörung und Chaos niemals verzichten wird. Das Leiden – das ist ja der einzige Grund des Bewusstseins.« Ein Bau, der wie der Kristallpalast in alle Ewigkeit unzerstörbar scheint, ist demnach unmenschlich, man kann ihm weder die Zunge herausstrecken noch die Faust in der Tasche ballen. (Dostojewskij 39) Der Palast brannte übrigens 1936 vollständig ab. Dem traumatisierten Subjekt, das in diesem Bericht redet, dient ein Bau, der den Triumph des Menschen (oder des Britischen Empire) über Raum und Zeit verkörpert, nur als Verstärkung seines Traumas. Hätte Dostojewskij im 21. Jahrhundert geschrieben, so hätte er den Kristallpalast durch das World Trade Center ersetzt.
DENKMAL UND DENKLÜCKE
Jeder mächtige Bau ist zunächst Zeichen eines Triumphes über die Materie und die Schwerkraft sowie Demonstration von Macht über Arbeitskraft. So ist auch das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig zu sehen, das allerdings paradoxale Züge trägt. Der schon erwähnte Erich Loest umkreist in seinem Roman Völkerschlachtdenkmal (1987) die Dauer dieses Baus in Leipzig und legt im Erzählen historische und psychologische Schichten frei: die Absichten der Erbauer, die Wahrnehmung durch beteiligte Arbeiter und Außenstehende, die Umfunktionierung im Laufe der Zeit, den Ge- und Missbrauch durch verschiedene Ideologien und Systeme. Der Erzähler will das Denkmal sprengen, doch weiß er, wie aussichtslos das ist:
Nein, das Denkmal wird noch stehen, wenn in Leipzig alles zerfallen ist, die Gewölbe des Hauptbahnhofs werden verrostet sein, das Universitätshochhaus hat gerissene Fahrstuhlseile, seine Klimaanlage ist übergekocht. Reudnitz ist zusammengefallen wie Gohlis, in Grünau fault heißes Wasser in allen Kellern. Wenn Leipzig zerbröckelt und vermodert ist, wird immer noch das Völkerschlachtdenkmal aufragen. Wie eine Pyramide des alten Ägypten. (Loest 24)
Nur weil es solche dauerhaften Symbole gibt, kann auch der Verfall ringsum wahrgenommen werden. Diese Dauer nutzte auch die SS, als sie sich 1945 beim Anmarsch der Amerikaner in das Denkmal als letztem Refugium zurückzog. Es bleibt die Tatsache, dass das Denkmal gebaut wurde, um an die größte Schlacht der Weltgeschichte vor dem Ersten Weltkrieg zu erinnern, an die sogenannte Völkerschlacht von 1813, die das Ende Napoleons einläutete. Es ist aber kein Friedensdenkmal, wie es von sich behauptet, denn das Monument erinnert nur an die Gefallenen der einen Seite. Für die Gefallenen auf französischer Seite ist kein Platz im steinernen Gedächtnis von 1913. Diese Einseitigkeit macht Loests Erzähler den Erbauern zum Vorwurf, denn damit ebneten sie den Weg für künftige Kriege mit Frankreich. Auffällig und im Rückblick als Vorzeichen deutbar sind die bunkerähnlichen Bauten am Eingang des Denkmalparks. Der Bunkerstil sollte sich erst im Krieg entwickeln, wird hier aber auf unheimliche Weise vorweggenommen. Als ich mit chinesischen Freunden das Denkmal besichtigte, fühlten sie sich sofort an die Mausoleen chinesischer Kaiser erinnert, an monumentale Grabmäler. Man findet darin eingefrorenen Jugendstil ebenso wie Freimaurersymbolik, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Denkmal dem Tod geweiht ist. Es steht auf dem ehemaligen Schlachtfeld, gleich neben dem größten Friedhof der Stadt, dessen größtes Grab es sozusagen darstellt. Dauer ist hier gegeben, aber ist es lebendige Dauer? Architektur, die für eine halbe Ewigkeit geschaffen ist, ist dies um den Preis ihrer Lebendigkeit. Die Phantasie findet kaum Anhaltspunkte, da sie das Vergängliche braucht, um sich zu entfalten. Phantasie braucht Ruine und Fragment, keinen vollkommenen Bau. Ähnlich abstoßend für die Phantasie sind daher die Bauten von Albert Speer für Hitlers Unsterblichkeit oder die Kolosse, die Stalins Architekten hinterließen. Ihre Grenzenlosigkeit ist brutal, ihre Maßlosigkeit ein Gefängnis. Denn Phantasie und Denken brauchen die Begrenzung und Auslassung, die Lücke und das Offene, um tätig zu werden. Nicht anders ist es in der Pädagogik, wo eben nicht das Vollständige inspiriert, sondern das Unfertige, denn dieses regt die Eigentätigkeit an. Daher auch die Dauer, die den Ruinen eigen ist. Denn einzig die Dauer ist von Rang, die über das Materielle des Baus hinausgeht und sich in den Geistern der Menschen festsetzt und zu Geschichten führt, die sie von Generation zu Generation weitererzählen. Deshalb beschäftigt sich der Erzähler bei Loest nicht so sehr mit dem fertigen Denkmal – es erzeugt eher Aggressionen –, sondern mit dem Bauen, mit dem Sprengen, mit der möglichen Ruine und dem zerstörten Leipzig.
DAS VERGÄNGLICHE ZIEHT UNS HINAN
John Ruskin hat in seinem poetisch-dramatischen Manifest The Seven Lamps of Architecture (1849) der Sechsten Leuchte den Namen »Gedächtnis« gegeben. Darin formuliert er seine Absage an die Restauration von Gebäuden, denn ein solcher Wiederaufbau (etwa der Dresdner Frauenkirche) komme einer totalen Zerstörung gleich. Warum? Solch künstliche Wiedergeburt ist abgelöst von der Kultur der Zeit, in der sie einst entstand. Das Alte lebte, auch als Zusammenhang mit den Händen der Baumeister, doch das Wiedererschaffene ist Kopie, Inbegriff des Todes. Mögen die alten Gebäude vor sich hin dämmern und zerfallen, mag man sie hie und da ausbessern, mögen sie überwachsen werden – sie leben und regen damit die Phantasie an. Die Menschen beschäftigen sich durch sie als Medium mit der Vergangenheit und der Vergänglichkeit ihrer selbst. Solche Architektur spricht zu uns, sie nimmt uns in Anspruch. Wir erkennen uns selbst in ihr, in diesem Kampf gegen Erosion und Entropie. Die Dauer der Bauten steht immer in einem Wechselgespräch, besser Konflikt mit der Dauer der Natur. Die unendliche Natur, selbst wenn sie von Menschen verseucht ist, setzt sich am Ende durch, schlingt sich um Steine und Mauern, reißt den Asphalt auf und überflutet die Bibliotheken. Dem Menschen muss sie als zeitlos erscheinen, ein Meer der Zeitlosigkeit, auf dem wir eine Insel gefunden haben, die wir pausenlos verteidigen gegen die anströmenden Wasser. Unsere Insel aber ist die unserer Lebenszeit – unserer Taten und Bauten, Schriften und Mäler. In vorgeschichtlicher Zeit haben Siedler im heutigen Mitteldeutschland bei ihren Häusern Rot bevorzugt, ein Trend, der weltweit zu beobachten ist, und Grün vermieden. Man nimmt an, dass sich die Menschen mit ihren Häusern von der grünen Natur abheben wollten. Das Grün könnte als bedrohlich empfunden worden sein, denn es steht für das Verschlingen und Überwachsen durch Pflanzen (vgl. Landesmuseum für Vorgeschichte). »Kultur«, so schreibt Matt Dekkers, »ist nur dadurch zu erhalten, dass man sie ständig gegen die Natur verteidigt.« (Dekkers 69). Oft sind aber in den Menschen selbst Kräfte der Natur tätig: »Staatliche Archive vernichten neunzig Prozent dessen, was hereinkommt.« (Dekkers 68)
Das aber bedeutet: Dauer muss errungen werden und zwar zunächst durch Akzente und Abhebung. Hierin gleicht das Bauen jener anderen Kunst des Speicherns von Gedanken und Gefühlen: dem poetischen Sprechen und Singen. Auch dieses hebt sich ab durch Metrum, Intonation, Reime und Bilder. Es schafft sich eine Dauer in den Köpfen und Herzen der Menschen, und sein Medium ist mnemotechnisch angelegt. Das Abheben von der Umwelt der Alltagssprache oder den Wäldern, Gräsern und Büschen erzeugt Denk- und Wohnmale. Rot ist intentional, es richtet den Blick, so wie es den Menschen aufrichtet in der und gegen die Natur. Es ist Anspruch auf Dauer, denn Dauer heißt Wahrgenommenwerden oder Wahrnehmen, Berkeleys esse est percipi (vel percipere).
So ist Dauer nie zu trennen von sinnlicher Erfahrung. Die Augen, die Hände müssen im Spiel sein, wenn sich Erinnerung konstituieren soll, gar die Gerüche: »Ohne Augen hat man weniger Gegenwart, ohne Nase weniger Vergangenheit.« (Dekkers 208) Keiner wusste dies besser als Marcel Proust, der seinen großen Gedächtniszyklus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit nannte. Sprachlich sollte hier eine Kathedrale entstehen, deren Kapitel mit den architektonischen Fachtermini überschrieben sein sollte. Es kam nicht dazu, Proust fand eine strikte architektonische Aufteilung am Ende zu prätentiös. Aber dass literarische Werke zu architektonischen werden wollen, um sich der Dauer zu versichern, war schon zuvor der Fall, so bei dem englischen Romantiker William Wordsworth. Er beabsichtigte, ein gigantisches autobiographisches Poem zu bauen, das die Form einer Kathedrale annehmen sollte. Vollendet hat er nur das Portal, nämlich »The Prelude«, sowie kleinere Stücke des restlichen Baus. Auch die Dichter möchten ihre Schriften in Stein sehen, doch wissen sie sehr wohl, dass davon nicht ihre Dauer abhängen wird. Diese Steine, Monumente, Gräber, in denen sie ihre Liebe versenkten, um sie ewig zu machen, sind nur schwaches Abbild menschlicher Geistestätigkeit, verdinglichte Phantasie und Verkörperungen von Gefühlen. Was dauert, kann letztlich nicht Materie sein. Es muss Energie werden.
Solche Energien sieht Ruskin in den zerfallenden Steinen Venedigs. Sie setzen sich fort, könnte man sagen, im Geist, dort bilden sie neue Projekte und erzeugen neue und andere Bauten, keine Kopien der alten. Es muss nicht immer so kommen. Die Energie aus den Ruinen kann kanalisiert werden und dem Profit dienen, sie kann zur Erfindung des Alten führen. Nehmen wir das Schloss des Grafen Dracula in Bran bei Braşov/Kronstadt in Transsylvanien. Aller Wahrscheinlichkeit wurde das Dracula-Schloss nie von Dracula betreten. Aber der Tourismus funktioniert. Einem Schloss wird Dauer verschafft durch eine Legende, die durch ihre Energie eine große Wirkung auf die Zeitgenossen ausübt. So erging es den Ossian-Texten von James MacPherson im 18. Jahrhundert, die einen wahren Kult herbeiführten, obwohl sie nicht die authentischen Werke der keltischen Vorzeit waren, als die sie gehandelt wurden.
In Loests Roman wird ein Bau durch eine Legende geadelt. Die Genossen vom Kulturamt haben ein Problem, denn sie brauchen ein deutsch-sowjetisches Freundschaftssymbol. Dazu eignet sich am besten die Tatsache, dass Lenin 1905 in Leipzig war und hier seine revolutionäre Zeitung Iskra (Der Funke) drucken ließ. Doch wo? Der Erzähler lässt sich nicht lumpen und zeigt auf ein Haus in Probstheida, in der Nähe des Völkerschlachtdenkmals. Es könnte auch jedes andere Haus sein, aber »›wer könne beweisen, daß Lenin hier nicht habe drucken lassen?‹« (Loest 185) Zu DDR-Zeiten gab es hier in der Tat ein Museum, und noch heute steht dieses Haus unter Denkmalschutz, auch wenn unklar ist, wo nun die Druckerei wirklich war. Immerhin hat die Legende eine Zeit lang dafür gesorgt, dass ein Haus geschützt und verehrt wurde. Dauer ist eine Frage der Einstellung, nicht des Gegenstandes. Diese Einstellung kann auch Sinngebung genannt werden. Bauten, denen eine Gesellschaft Sinn zuschreibt, haben eine größere Chance, zu überleben. Krisen treten vor allem zwischen gesellschaftlichen Umbrüchen ein, die ja auch Sinnkrisen sind. Aber es gibt Beispiele, wo diese überwunden werden und der Bau weiterhin Sinn hat, wenn auch möglicherweise einen anderen als zuvor. Im siebenbürgischen Cisnădie/Heltau steht eine wunderbare alte Kirchenburg, die von den Siebenbürger Sachsen erbaut wurde. Heute leben kaum noch Deutsche im Dorf, sie sind in den 1990ern in großer Zahl ausgewandert. Die Kirchenburg wird aber nun von Rumänen betreut, die sehr gut deutsch sprechen und sich bestens auskennen. Für sie hat der Bau – ebenso wie für die meisten Touristen – eher einen historischen Wert, aber darin besteht natürlich ebenso Sinngebung.
Dauer kann auch eine Folge von Rätselhaftigkeit sein. Warum haben die Steine von Stonehenge so lange überdauert, über viele Generationen und Religionen hinweg? Ihre rätselhafte Offenheit lässt nach Lösungen suchen, bietet aber auch Anschlussmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Anschauungen. Astronomen und Druiden, Touristen und Archäologen wissen etwas damit anzufangen und verleihen dem Steinkreis durch ihr fortwährendes Interesse eine überdimensionale Dauer, die sich in Filmen und Büchern fortpflanzt.
Wären die griechischen Götter und Tempel bunt geblieben, wie sie es einst waren, so hätten sie möglicherweise nicht den Geist von Winckelmann und Schliemann erreicht. Sie wären als populäre Volkskunst im Kabinett des Kitsches verschwunden. Nur als kühle weiße Form, als lebensferne Rätsel gelang ihnen die Reise durch die Jahrhunderte. Als die Angelsachsen England besiedelten, stießen sie auf die Ruinen der Römer. In einem berühmten altenglischen Gedicht, »The Ruin«, wird über solche Ruinen gegrübelt: Sind es die Bauten von Riesen der Vorzeit? Die Romantik wird den Ruinenkult wiederentdecken und sich an der Unvollendeten Schöpfung erbauen, ja, die Ruine wird für Adlige zu einem festen und planbaren Bestandteil ihrer Parkanlagen, inklusive Eremit. Die Ruinen sind Zeitverlängerer, sie stoßen die Phantasie an, in die Tiefen der Zeit vorzudringen, sich das Leben von einst vorzustellen. Das Gegenteil, und doch ähnlich, ist in der Philosophie der Moderne zu suchen, die die Zukunft in die Gegenwart hereinholt und so dem Bau ebenfalls eine imaginäre Zeitebene einfügt. Manchmal ist diese Zukunft nur von kurzer Dauer, wie etwa Le Corbusiers Villa Savoye in Poissy (1931), die gleich nach Fertigstellung mit dem Zerfall begann. Eine Woche nach dem Einzug der Familie entwickelten sich schon Lecks im hochgerühmten Flachdach.
Wir sind auf das Unfertige ausgelegt, es steht ein für Vergänglichkeit, aber auch für Heimat und Nähe. Als sich Designer daran machten, die perfekte, nicht tropfende Teekanne zu gestalten, mussten sie bald bemerken, dass das Publikum kein Interesse daran hatte. Man zog die alten bauchigen Teekannen dem extrem futuristisch-perfekten Design vor und nahm dabei das Tropfen in Kauf. Der Grund lag darin: Die unvollkommene Kanne ist mit Assoziationen aus der Kindheit verbunden, sie ist der Zeit und der Vergangenheit verschwistert, und ohne diese scheinen wir nicht leben zu wollen.
Vergänglichkeit ist ein wichtiger Stimmungsfaktor in der japanischen Ästhetik, etwa im Haiku. Doch nicht überall. Es gibt Bereiche, in denen das Alte gar nicht erst zu Wort kommt, paradoxe Sinnbezirke, die gerade dem Ursprung gewidmet sind. Im wichtigsten Shinto-Tempel Japans, dem Ise-Jingu, wird alle 20 Jahre der Holzschrein abgerissen und durch einen neuen ersetzt, allerdings an einem leicht versetzten Ort. Der nächste Ab- und Neubau wird 2033 erfolgen. Damit fügt der Schrein sich in ein Naturgeschehen ein, dessen Geister ja hier verehrt werden. Das Alte ist das immer wieder Neue. Die Vergänglichkeit verschwindet, indem sie selbst Teil der Vergänglichkeit geworden ist.
Die Anerkennung von Vergänglichkeit kann in der Architektur wie anderswo nur heißen: Wir müssen uns verabschieden von utopischen Modellen – wie etwa Wolkenkratzern – die vorgeben, die Zeiten zu überdauern und der Ewigkeit nahe zu sein. Diese Modelle vergessen den menschlichen Geist, die Phantasie, das Mittun und Angeregtwerden. Erst diese erzeugen eine Dauer, die nicht-materiell ist, dafür aber um so realer. Eine ähnliche Erkenntnis wurde dem großen Kublai Khan zuteil, der die Vergeblichkeit seiner Siege und Eroberungen erkannte, denn sein Imperium würde zerbröckeln und formlos werden und den Feinden anheimfallen. Nur in den Berichten des venezianischen Gesandten Marco Polo, so schreibt Italo Calvino in Die unsichtbaren Städte, konnte Kublai Khan einen Halt finden, in Polos zauberhaften und phantastischen Städten, die es nie gab, allenfalls in der Sprache: »Nur bei den Berichten Marco Polos vermochte Kublai Khan durch die zum Einsturz bestimmten Mauern und Türme hindurch das Filigran einer Anordnung zu erkennen, die so subtil ist, dass sie dem Biss der Termiten entgeht.« (Calvino 8)
LITERATUR
Calvino, Italo. Die unsichtbaren Städte. München: dtv 1985.
De Botton, Alain. The Architecture of Happiness. The Secret Art of Furnishing Your Life. London: Penguin 2007.
Dekkers, Matt. An allem nagt der Zahn der Zeit. Vom Reiz der Vergänglichkeit. München: Blessing 1999.
Dostojewskij, Fjodor. Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Ditzingen: Reclam 2007.
Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle: http://www.lda-lsa.de/landesmuseum_fuer_vorgeschichte/fund_des_monats/2008/februar, konsultiert am 25.11. 2010.
Loest, Erich. Völkerschlachtdenkmal. München: dtv 1994.
Ruskin, John. The Seven Lamps of Architecture (1843). New York: Dover 1989 (= Reprint der Zweiten Auflage von 1880).
Das Gesicht der Wörter
Unordentlicher Versuch, die Zukunft der Philologie zu deuten
Als ich ein Jahr vor Beginn der Vortragsreihe über die Zukunft der Philologie einen Titel für meinen Vortrag angeben sollte, war mir die Doppeldeutigkeit der darin enthaltenen Worte nicht präsent. Denn was heißt es, dass Wörter ein Gesicht haben? Es heißt zunächst, dass sie ein Gesicht tragen, wie jeder Mensch – sie bilden individuelle, erkennbare Einheiten, sie sind in irgendeiner Weise persönlich, auch wenn sie dies oft abstreiten oder reduziert sehen wollen. Zum anderen aber haben sie ein Gesicht, gar Gesichter: will sagen, sie können selbst etwas sehen. Sie sehen uns an, sie sehen die Welt an, sie sehen die Zukunft, sie können träumen und andere Welten erkennen. Zumindest wurde der Untertitel dieser Intention gerecht, denn ich möchte in verschiedene Richtungen schauen, und was die Philologie betrifft, nach innen wie nach außen.
Ich beschäftige mich also mit den Fragen: Erstens, was sehen die Wörter? Können wir sie als Orakel für die Deutung der Zukunft lesen und sagen sie uns, wohin es geht mit der Philologie? Da dies ein ungewisses Geschäft ist und eigene philologische Fähigkeiten voraussetzt, frage ich zweitens, wie sehen die Wörter heute aus, was lässt sich ableiten aus ihrem jetzigen Zustand? Welche Problembereiche und Aufgaben tun sich auf?
Was ich an dieser Stelle nicht möchte, ist über Studiengänge, Module, die Bologna-Reform zu sprechen. Das müsste auch Selbstkritik sein, denn ich habe mich nicht bemüht, diese Reformen zu verhindern. Soviel nur: Die uns das eingebrockt haben, sind die erste Generation, die mit Lego aufgewachsen ist – der Urform der Module: Lego ergo sum.
Richtig verstanden könnte dieses »Lego ergo sum« doch das Motto des Philologen sein. Mit dem Lesen aber sieht es schlecht aus in diesen Zeiten, wie uns etwa ein ZEIT-Dossier 2009 versicherte, das überschrieben ist: »Ein Land verlernt das Lesen.« Zugleich stellt die OECD-Kommission fest, die Lesekompetenz sei heute wichtiger als je zuvor. Nur wer gut lesen könne, werde in einer modernen Gesellschaft systematisch begünstigt. Demnach beeinflusst die Fähigkeit zu lesen direkt das Einkommen, die Art der Arbeit und die Gesundheit. Mit anderen Worten: Wir leben in einer lese- und wissensintensiven Gesellschaft. So lauten die statistisch erhobenen und offiziell deklarierten Erkenntnisse. Aber von welchem Lesen ist die Rede, wenn es um Einkommen, Arbeit und Gesundheit geht? Wenn die Forderung nach Lesekompetenz erhoben wird, so ist nicht das Lesen als persönliche Bereicherung oder gar als Unterhaltung gemeint, sondern ein funktionales Lesen, bei dem am Ende etwas herausspringt: das Wissen, wie man ein Formular ausfüllt, ein Handy bedient oder eine Tabelle versteht. Um ein darüber hinausgehendes Wissen – Weltwissen, Lebenswissen – kann es nicht gehen, dafür haben wir Günther Jauch. Oder wenn es um Wissen geht, dann, so Wolfgang Wippermann im ZEIT-Dossier, werde der Container-Ansatz erprobt: Kind auf, Wissen rein, Kind zu.
Eine Frau, die von Wippermann befragt wurde, las ihrem Kind abends aus dem Duden vor. Früher nannte man dies das Prinzip des Nürnberger Trichters. Das scheint in seiner Abschreckung erfolgreich gewesen zu sein, denn inzwischen liest ein Viertel aller erwachsenen Deutschen überhaupt kein Buch mehr.
Wie gehen wir also mit den Wörtern um in unserer Wissenschaft, der Philologie? Wie sollten wir damit umgehen, wenn wir die Zukunft bestehen wollen?
1. PHILOLOGIE UND ÖFFENTLICHKEIT
Die Öffentlichkeit, also Abgeordnete, Leserbriefschreiber, Journalisten und Verwandte, fragen zu Recht: Warum ist es sinnvoll, Geld dafür auszugeben, dass sich Leute mit Literatur, Sprache und Büchern beschäftigen? Oder sich Filme anschauen, Videoclips, Comics studieren, Zeitung lesen? Das machen wir doch alles umsonst und sowieso.
Solange an den Universitäten nur die Hochkultur von Shakespeare bis Goethe gelehrt wurde, hatte sie einen unbefragbaren Nimbus. Seit der Ausdehnung des Kulturbegriffs in den siebziger Jahren wird nun vieles studiert, das sehr nach Unterhaltung riecht, vom Comic bis zur Comedy. Hier ist klarzumachen, dass wir Fähigkeiten einüben, mit einem wachsenden Teil von Medienwaren umzugehen und zwar im kritischen Sinn zu lernen, wie überhaupt Zeichensysteme wirken und genutzt werden – von der Politik bis zur Religion, von den Massenmedien bis zur Partnerschaft. Die Welt der Medien und Dienstleistungen hat vor allem eines: eine sprachliche Komponente. Die Sprache, Sprechen und Lesen, beherrschen unsere Welt, auch wenn viele glaubten, mit der Einführung von Fernsehen und später Handys und Computern würden wir sprachlos. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade deshalb müssen wir als Philologen den Umgang mit der Sprache prüfen und proben. Wir sind sozusagen in der Werkzeugmaschinenfabrik der Gegenwart tätig. Umgang mit Sprache heißt: Gebrauch und Interpretation, wobei der Gebrauch oft die vermutete Interpretation des späteren Lesers mit einbezieht, also Fähigkeiten zur Empathie voraussetzt. Deutsch und Englisch gehören in der Schule zu den wenigen Fächern, deren Kenntnisse auch nach dem Abitur für fast alle notwendig sind, wollen sie im Leben bestehen. Mathematik ist auch wichtig, aber es reicht fürs meiste, wenn man bis zum Prozentrechnen kommt. Die Philologie kann nicht im Einzelnen auf das richtige Lesen von Texten in Politik, Wirtschaft oder Geschäftskorrespondenz vorbereiten; sie kann keine berufsvorbereitende Maßnahme sein, wie so oft gefordert wird. Der Grund ist dieser: Die Berufe, auf die im Studium oft vorbereitet wird, gibt es nach dem Ende des Studiums nicht mehr, und ganz andere Fähigkeiten als solche spezifischen sind plötzlich gefragt. Daher ist die Philologie eher eine Grundlagenwissenschaft zu nennen, der theoretischen Physik vergleichbar. Mit dem Chemiker Gottfried Schatz wäre es aber vielleicht besser, nicht zwischen Grundlagenforschung und angewandter Wissenschaft zu unterscheiden, sondern zwischen langfristiger und kurzfristiger Forschung.
Das gilt sowohl für das Verhältnis der Philologie zu den anderen, besonders den Naturwissenschaften, deren Ergebnisse zumeist schneller sichtbar werden, als auch für unterschiedliche Linien innerhalb der Philologie. So ist die Edition von Goethes Briefen ein Langzeitprojekt, während die Annotation eines Reclam-Fremdsprachentextes auf einen baldigen Gebrauch in den Schulen angelegt ist. Diese Unterscheidung von langfristiger und kurzfristiger Forschung macht glücklicherweise Schluss mit den hierarchisierenden oder patronisierenden Untertönen, die bei der Terminologie von Grundlagenforschung und angewandter Wissenschaft herauszuhören sind (praxisferne Elfenbeinturmbewohner die einen, Praxishuber und -huberinnen die anderen). Wie im Leben muss das Kurzfristige mit dem Langfristigen harmonisiert werden, eins kann gar nicht ohne das andere gedacht werden. Einen Zahnarzttermin in der Zukunft festlegen ist das eine, das Zähneputzen hier und jetzt das andere.
Bei der wachsenden Vernetzung unserer technischen und kulturellen Verhältnisse wird ein Überblick immer wichtiger. Dieser kann aber nicht aus einer Ansammlung oberflächlichen Wissens bestehen, sondern muss im Sinne einer Grundlagenwissenschaft jene Koordinaten des Wissens benennen und vertraut machen, die uns eben diesen Überblick ermöglichen: keine Faktenmenge, sondern strategische Positionen.
Bislang war nur von Texten dieser oder jener Art die Rede. Mir als Literaturwissenschaftler muss es aber auch um die Literatur gehen als einer besonders verdichteten Form von Text, der die Räume des Imaginären aufreißt und dieses Imaginäre als Katalysator von Realität ernst nimmt. Welche Rolle Bücher für die Öffentlichkeit spielen können, zeigen einige Beispiele: Lesekreise, engl. reading groups oder reading circles, füllen zunehmend eine Lücke, die zuvor etwa von der Kirche und anderen sinnstiftenden Institutionen gefüllt wurden. Das Buch erweist sich als idealer Kommunikationsort jenseits des Internets, aber auch in ihm, als Möglichkeit nämlich, miteinander ins Gespräch zu kommen über Themen, die erweitern und bereichern und vor allem andere Menschen kennenlernen lassen. Das sogenannte einsame Medium Buch wird hier zum Gegenteil, zu einem gesprächsfördernden Gegenstand, über den eine gemeinsame Sinnsuche unternommen wird. Im Sinne einer anti-institutionellen Selbstorganisation entstehen hier in der Gesellschaft Zentren der Begegnung und Bedeutungssuche. Kein Zufall, dass Karen Joy Fowlers The Jane Austen Book Club von 2004 nicht nur ein Bestseller, sondern auch ein erfolgreicher Film wurde.
Ein zweites Beispiel für die Macht der Literatur sind eine Reihe von Buchtiteln, die westliche Literatur im Kontext schwieriger, demokratieferner Ländern zeigen. Darin zeigt sich möglicherweise ein eurozentrischer Narzissmus wie auch der Triumph westlicher Globalisierung – möglicherweise den Strategien der Verlage geschuldet. Inhaltlich vermitteln diese Bücher jedoch Kontakte zwischen den Kulturen, die ausgelöst werden durch Gespräche über Bücher, durch die Faszination der Literatur. Ich denke an Titel wie Dai Sijies Balzac und die kleine chinesische Schneiderin (2001, französischer Originaltitel: Balzac et la petite tailleuse chinoise, 2000) oder an Azar Nafisis Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books (2003) oder May Witwits und Bee Rowlatts Talking About Jane Austen in Baghdad: The True Story of an Unlikely Friendship (2010). Ich wünschte mir allerdings auch Bücher mit Titeln wie: Konfuzius lesen in Palermo oder Über Mandela sprechen in Tennessee.
Hier soll damit nur gesagt werden: Es ist der Öffentlichkeit klarzumachen, dass Bücher große Auswirkungen auf Gesellschaften haben können und dass es daher notwendig ist, sich mit ihnen, den Inhalten und den Strategien ihrer Verbreitung zu beschäftigen. Das Imaginäre, literarische wie nichtliterarische Bücher und Texte haben einen immensen Einfluss auf politische Entscheidungen und Tendenzen. Viele Umwälzungen, Revolutionen und Repressionen gehen auf Bücher und deren Verbreitung zurück, seien es die Bibel, der Koran, Ossian, Die Leiden des jungen Werther, Das Kapital, Mein Kampf oder die gefälschten Protokolle der Weisen Zions. Mit der Textkritik beginnt die Kritik an der Gesellschaft, die solche Bücher zulässt oder sie abwehrt.
Ich habe kürzlich einmal Studierende befragt, warum sie meinen, dass man Literaturwissenschaft studieren solle. Hier sind einige Antworten:
Die Menschen haben sich von jeher Geschichten erzählt, es ist eine der ältesten Tätigkeiten der Menschen und gehört zur anthropologischen Definition. Mit dem Erzählen wurde immer auch Macht ausgeübt, im Guten wie im Bösen. Wir müssen uns mit diesem wichtigen Machtinstrument wissenschaftlich auseinandersetzen, denn es wird weiter erzählt und weiter Macht ausgeübt. Es geht um eine Durchleuchtung von Machtmechanismen, und daher ist Literaturwissenschaft immer auch politisch.