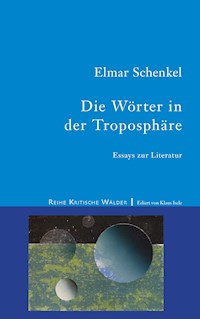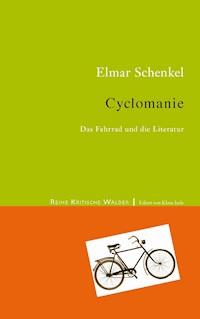14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Literatur und Wissenschaft, künstlerische Imagination und rationales Denken zählen zu zwei getrennten Kulturen. Dennoch gibt es Berührungspunkte: Was wäre die Entwicklung der Raumfahrt ohne Jules Verne? Was Sherlock Holmes ohne chemische Kenntnisse? Und umgekehrt: Ist die Wissenschaft ohne Phantasie, ohne literarisch-künstlerische Einflüsse denkbar? Um Episoden, Begegnungen, Schnittpunkte dieser beiden Welten geht es Elmar Schenkel in seinem neuen Buch. Er legt die wechselseitige Beeinflussung von Wissenschaft und Literatur frei und bringt u.a. Marie Curie, René Descartes, Alva Edison, Galileo Galilei, Friedrich August Kekulé oder Dimitri Mendelejew mit Douglas Adams, Flaubert, Calvino, Agatha Christie, Dante, Paul Valéry, Mary Shelley, Jonathan Swift oder Tolkien ins Gespräch. Eine faszinierende und brillant geschriebene Erkundung – voller neuer, überraschender Verbindungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Elmar Schenkel
Keplers Dämon
Begegnungen zwischen Literatur, Traum und Wissenschaft
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorwort: Keplers Dämon
»Wer nichts als Chemie versteht,
versteht auch die nicht recht.«
Lichtenberg
Wenn die Wissenschaften über eine Rose sprechen, reicht es nicht zu sagen, eine Rose ist eine Rose. Sie müssen Aussagen machen über Blütenstände, Pigmente, Wurzelwerk, Gattungszugehörigkeit, über die Zellbiologie und den Stoffwechsel der Pflanze und über Züchtungen und Märkte. Wenn die Dichtung über Rosen spricht, so wird auch sie nicht bei der Feststellung stehenbleiben, es handele sich um eine Rose. Sie ist dann viel mehr: ein Zeichen der Liebe, des Schmerzes, verströmende Romantik, mystisches Symbol. Doch beide streben zu dem Punkt hin, wo wieder gesagt werden kann, diesmal in vollem Wissen: Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Angelus Silesius hat es so ausgedrückt:
Die Ros ist ohn Warum.
Sie blühet, weil sie blühet.
Sie acht nicht ihrer selbst,
fragt nicht, ob man sie siehet.
Zu jedem Ding, zu jedem Wesen auf dieser Welt gibt es diese beiden Einstellungen und dazu die dritte. Wer zum Beispiel Wolken sieht, kann sie meteorologisch und physikalisch analysieren oder sich von ihnen zu phantastischen Vorstellungen inspirieren lassen. Am deutlichsten sind sich dieses Zwiespaltes jene Menschen bewusst, die für beide Einstellungen offen sind, sagen wir Johann Wolfgang Goethe, Roger Caillois oder Mary Shelley, Johannes Kepler, Jules Verne, George Eliot, Albert Einstein oder Gustav Theodor Fechner.
Es geht um die Beziehungen zwischen Fächern und Schubladen, und das ist immer auch eine Frage der beteiligten Menschen. Georg Christoph Lichtenbergs Sudelbücher stehen für die Kommode, in denen viele solcher Schubladen zu finden sind. Noch dazu sind sie untereinander verbunden. Doch nicht jeder sieht diese Verbindungen im Schrank. Ein Zeitgenosse Lichtenbergs hatte dies erkannt: »Man könnte die Menschen in zwei Klassen abteilen; in solche, die sich auf eine Metapher, und 2) in solche, die sich auf eine Formel verstehn. Deren, die sich auf beides verstehn, sind zu wenige, sie machen keine Klasse aus.«
Um diese Menschen, die nach Heinrich von Kleist keine Klasse ausmachen, geht es mir in diesem Buch. Sie sind sowohl die Protagonisten als auch hoffentlich Leser und Leserinnen mit Antennen für das jeweilig andere Gebiet.
Subjektivität und Objektivität sind ineinander verschachtelt, sie bilden sozusagen ein Kippbild, das immer wieder in ein anderes umschlägt: Hase oder Ente? Alte oder junge Frau? Gesichter oder Kerzenhalter?
In diesem Buch geht es um solche Kippeffekte zwischen Naturwissenschaften und Literatur, oder weiter gefasst, zwischen wissenschaftlichem Denken und literarisch-künstlerischer Imagination. Ich möchte Orte der Begegnungen, Episoden und Schnittpunkte aufsuchen und erkunden, welche Spannungen und fruchtbaren Momente, die Voraussetzungen für Erkenntnis, an diesen entstehen.
Es gibt Zwischenbereiche, gesellschaftliche und subjektive, die so groß sind, dass sie der Aufmerksamkeit entgehen. Sie sind unsichtbar wie die Rasenstücke an der Autobahnauffahrt oder der Bahnsteig auf dem Bahnhof. Man benutzt sie oder sieht sie fortwährend, und dadurch werden sie unauffällig. Ich denke, dies trifft auf das Zusammenspiel von Phantasie und Denken, oder historisch ausgedrückt: von Wissenschaften und literarischer Imagination ganz besonders zu. So hat man sich erst in den letzten Jahrzehnten diesen Gebieten zugewandt. Ist erst einmal der Blick für dieses Zusammenspiel geschärft, so kann man sich kaum noch literarische Werke vorstellen, in die die Wissenschaft nicht hineinspielt; wie soll auch Literatur ohne Wissensformen auskommen? Was wäre Homer ohne die Wissenschaften der Hirten und Krieger? Was ein Sherlock Holmes ohne seine chemischen Kenntnisse? Doch auch umgekehrt stellt sich die Frage: Ist die Wissenschaft ohne Phantasie, ohne literarisch-künstlerische Einflüsse denkbar? Ist nicht Mathematik ästhetisch und sucht Physik nicht nach vereinheitlichenden Gesetzen, wie es die phantastischen Alchemisten taten? Kann man sich einen Entomologen ohne Faszination für das Grauen und die seelenlose Mechanik vorstellen, wie sie dem Schauerroman eigen sind und Autoren von Nabokov bis Ernst Jünger anlockten? Eine Wissenschaft ohne Literatur hätte wenig Anknüpfungspunkte in der Realität der Menschen. Menschen brauchen Erzählungen, und ohne eine gute Erzählung werden sie sich für kaum etwas interessieren lassen, mag es noch so bedeutend sein. Das aber ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass Wissenschaft in der Öffentlichkeit ankommt und diskutiert wird. Denn die Gesellschaft besteht aus Laien: Wer sich Experte in einem Gebiet nennt, ist Laie in hundert anderen, und »wo immer er nicht außerordentlich gelehrt ist, ist er ganz überraschend unwissend«. (G.K. Chesterton)
Deshalb erlaube ich mir auch, als Laie über die Naturwissenschaften zu schreiben, denn uns Nichtfachleuten sind die Schwierigkeiten des Verstehens vertrauter. Der Außenseiter, schreibt der Wissenschaftsphilosoph Peter Pesic, hält die Wissenschaft nicht für selbstverständlich und erkennt eher das Merkwürdige und Bedeutende als jemand, der sich lange an wissenschaftliches Denken gewöhnt hat. Als Beobachter interessiert mich der Zusammenprall, die Osmose, mehr noch – der Dialog zwischen fremden Welten.
In diesem Buch geht es um derartige Zwischenräume, ohne die menschliches Tun und Vorstellen verkümmern würde. In ihnen entstehen oft die entscheidenden Intuitionen und Ideen, hier springen Funken, die sowohl wissenschaftliche Erkenntnis entzünden als auch Romane entfachen. Und hier haben gesellschaftliche und politische Prozesse, die sich die Wissenschaften im Guten wie im Bösen zunutze machen, ihren Ursprung – vom Darwinismus bis zur Raumfahrt, von der Hirnforschung zur Genetik.
Der Titel Keplers Dämon bedarf der Erklärung. Kepler beschrieb 1609 einen Traum über eine Reise zum Mond (Näheres dazu →2. Keplers Dämon). Diese Traumgeschichte besprenkelte er über die nächsten Jahre hin mit vielen Fußnoten wissenschaftlicher, autobiographischer und verspielter Art. Man könnte diesen Text als das erste Werk der Science-Fiction bezeichnen, denn hier wird erstmals eine fast mittelalterliche Traumvision mit der neuen kopernikanischen Wissenschaft verbunden. Die zwei Kulturen, die C.P. Snow im 20. Jahrhundert in seiner berühmten Rede diagnostizierte, die Welten der Geistes- und Naturwissenschaften, werden hier in ein Gespräch gebracht. Kepler erträumt dazu einen Dämon, der seinem Helden erklärt, wie man auf den Mond fliegt und was man dort vorfindet. Verstehen kann aber den Dämon erst einer, der sich die kopernikanische Astronomie zu eigen macht. Der Dämon verbindet wie Kepler selbst (er hat ja auch Horoskope gestellt) Welten, die sich durch jeweilige Spezialisierungen immer weiter entfernen sollten: Erde und Mond, Mittelalter und Neuzeit, Wissenschaft und Imagination, Metapher und Kalkül, Emotion und Messung. Daher möge er diesem Buch gleichsam als Wappen dienen.
Keplers Traum ist ein Ausgangspunkt für die Expeditionen, die ich im vorliegenden Buch in das teils unbekannte, teils vergessene Terrain machen möchte. Es sind Routen unterschiedlichster Art. Mal führen sie in den Kriminalroman, mal in die Poesie. Einige beginnen in der Frühzeit des Menschen und enden im 21. Jahrhundert, andere beschränken sich auf die Lebensdaten von Autoren oder bleiben bei einem Werk oder in einem Land unterwegs. Es gibt nicht den Königsweg in diesem spannenden Gebiet zwischen Literatur und den Wissenschaften, sondern viele Pfade und Wege, auf denen man zu den verschiedensten Aussichten kommt. Daher ist auch die Gliederung eher notwendiges Spiel: Hier Mensch, dort Materie, das geht von der Anlage des Buches aus gesehen eigentlich nicht. Beide sind ineinander verwoben, und die Technik kann als Vermittlerin stehen. Und wie lassen sich überhaupt Raum und Zeit ohne Mensch und Materie denken? Diese Widersprüchlichkeiten sind der Natur der Sache einbeschrieben; die Einteilung ist also nichts als ein Vergrößerungsglas, das man schnell wieder weglegen kann. Vielleicht hilft sie aber auch bei dem Erkennen von roten Fäden. Die Kapitel sind daher im Sinne eines Puzzles angelegt; keine einfache Linie durch die Zeit, sondern sich ineinander verfugende Teile eines großen Bildes, das hier in seinen Umfängen nur angedeutet werden kann.
Mir hat die Suche und das Schreiben an dem Buch viel Spaß gemacht, und es wäre mir eine Freude, wenn der Funke zum Leser überspringt und er oder sie es als Einstimmung auf ihr eigenes Suchen und Forschen zwischen den Wissenschaften und der Imagination aufgreifen würde. Ich hätte gerne weitergeschrieben, denn die Desiderata wachsen, je tiefer man in die Materie eindringt. Was hätte nicht alles gesagt werden können über: Poe (Mesmerismus, Phrenologie, Ballonfahrt), die Herzogin von Newcastle, die die Physik ihrer Zeit in Utopien verwandelte, Strindberg, als Alchemist, Soziologe, Linguist und Naturkundler oder Thomas Manns Professor Kuckuck aus Felix Krull; Themen wie die Quantenphysik und Chaostheorie, Elektrizität und Licht. Es gibt ein starkes Interesse an diesen Zwischenbereichen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur – von Heinar Kipphardt bis zu Ulrike Draesner, Daniel Kehlmann, Ralf Bönt und Judith Schalansky. Aus anderen Ländern wären zu nennen: Thomas Pynchon, Lavinia Greenlaw, Richard Powers oder Tom Bullough, Jorge Volpi (Das Klingsor-Paradox) oder Jean Echenoz (Blitze). Oder eine Entdeckung, die ich gern geteilt hätte: Jane C. Webb Loudon (1807–1858). Loudon veröffentlichte mit zwanzig den Science-Fiction-Roman The Mummy!: Or a Tale of the Twenty-Second Century, in dem sie Gesellschaftskritik mit Ägyptologie verbindet (sie erfand den »Fluch der Mumie«). Sie muss daher mit Mary Shelley zusammen als Begründerin der modernen Science-Fiction gesehen werden. Außerdem schrieb sie ein Standardwerk des Gartenbaus: Gardening for Ladies. Kein Ende in Sicht, umso besser.
Viele meiner Recherchen wurden unterstützt von Johanna Grabow, die Korrekturarbeiten begleitet von Stefanie Ohle, Denise Keil und Katja Brunsch. Für Gespräche, Anregungen, Korrespondenz und Ermutigung danke ich: Lisette Buchholz, Bernard Dupas, Ernst Peter Fischer, Maria Fleischhack, Alexandra Heidenreich-Lembert, Stefanie Jung, Stefan Lampadius, Minwen Huang, Hazel Rosenstrauch, Rainer Schürmann, Katrin Schumacher, Gabrielle Spaeth, Reiner Tetzner, Kati Voigt, Norbert Weitz und Stefan Welz. Und meine Frau Ulrike Loos stellte sich immer als erste Hörerin zur Verfügung. Ihnen allen sei herzlich gedankt.
Leipzig im September 2015
1. Mensch
Die Wissenschaften existieren nur durch und mit den Menschen, die sie betreiben, die ihnen nachfolgen und sie anbeten oder niederreißen. Das erste Problem aller Wissenschaft ist genau dieses Wesen, das sich für das einzige Erkenntnis suchende Subjekt auf dieser Erde hält. Diese gattungsspezifischen Illusionen wurden von Swift gegeißelt, und bereits die Antike konnte darüber lachen. Schopenhauer und Nietzsche nahmen sich mit Vorliebe dieses in Illusionen verstrickten Tieres an. Erkenntnis suchend? Vielleicht ist auch dies nur eine weitere Form der Selbsttäuschung. So kann man auch Mary Shelleys revolutionären Roman über einen Mann, der dem Menschen ein Ebenbild schaffen will (so wie es laut Bibel und Koran Gott einst getan hat), lesen: als eine weitere Form der Täuschung, der Selbstanbetung der Spezies. Aber warum sollten Illusionen schlecht sein? Sie mögen eine Zeitlang als Schutz dienen, sind aber langfristig destruktiv. Der Frankenstein-Mythos, der bis in unsere Gegenwart reicht, zeigt dies sehr deutlich. Die Wissenschaften spiegeln beide Seiten des Menschen wider, unerbittlich. Mal retten, mal töten, mal verführen, mal helfen sie, mal lassen sie verzweifeln. Solche Wechselbäder werden an den beiden Protagonisten in Flauberts letztem Roman, Bouvard et Pécuchet, geradezu slapstickhaft bebildert. Für sie erweisen sich die Wissenschaften insgesamt als eine Enttäuschung – völlig überbewertet! Also kehren sie zu ihrem alten Beruf der Kopisten zurück.
In diesem ersten Teil, der mit »Mensch« überschrieben ist, geht es darum, wie biographische Situationen Begegnungen zwischen Wissenschaften und Literatur ermöglichen. Oft sind es krisenhafte Momente, in denen sie sich gegenseitig erkennen oder wiederentdecken nach einem langen gleichgültigen Nebeneinander – angefangen mit den nächtlichen Krisen, die wir Träume nennen, bis hin zu Lebenskrisen, wie bei Agatha Christie oder Paul Valéry. Der Blick in Abgründe kann frei machen, neue Horizonte öffnen und das Denken vollständig umkrempeln. Aus den dunkelsten Kammern der Gefühle und der Lebenswirklichkeit, aus Traumgebilden entstehen dann Ideen und Systeme, die eines Tages alles andere als privat sind, sondern vielmehr die Welt erobern, im Guten wie im Schlechten. Mendelejew erträumte sich möglicherweise das periodische System ebenso wie Kekulé den Benzolring, Descartes wurde während des Dreißigjährigen Krieges bei Ulm möglicherweise in Träumen auf sein neues Denken vorbereitet. Oder zumindest gefallen uns diese Legenden.
Kekulé brauchte ein halbes Jahrhundert, um seinen Traum öffentlich zu benennen, so sehr ist alles ausgegrenzt, was die Wissenschaften dem Traum und damit realen Lebenssituationen verdanken. Insbesondere fällt unter solche Ausgrenzung die Frau. Die Verdrängung des weiblichen Anteils an der Wissenschaft – das betrifft neben den Akteurinnen und ihren Lebensläufen ebenso Fragestellungen wie Anwendungsbereiche – beginnt mit der Verfolgung der antiken Philosophin Hypatia und gipfelt in der Frauenfeindlichkeit der Royal Society und anderen Institutionen der Neuzeit. Ausläufer finden sich noch in der Gegenwart. Das Beispiel Mary Shelley zeigt, dass die Literatur einen Umweg für Frauen darstellte, sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen und andere Perspektiven – nämlich lebensweltliche, soziale und psychologische – einzubringen. Der Mensch ist das Subjekt der Wissenschaft, und das ist männlich wie weiblich, sozial ausdifferenziert und nicht klassenbeschränkt, schließlich auch transnational und weltweit – aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.
Subjektivität kann sich in Rückerinnerungen an die eigene Kindheit erleben lassen. Auch Wissenschaftler haben eine Kinderzeit hinter sich, sie muss sogar in besonderer Weise prägend gewesen sein. Es ist also auch Biographisches im Spiel, wenn sich gestandene Denker, die möglicherweise schon große Welterklärungen geschaffen haben, wieder kindlichen Fragen stellen. Hier liegen die Urformen einer Kinderuniversität, wenn ein Faraday über Kerzen spricht, Kepler die Schneeflocke einer tiefen Meditation unterzieht oder Darwin sich zu den Regenwürmern neigt. Fabre scheint sein ganzes Leben lang diesen Blick auf das Kleinste und Winzige gepflegt und daraus Lehren für die Naturgeschichte gezogen zu haben. Bei der Beobachtung des Alltäglichen finden die Genies zu einem Stil, der Präzision und Anschaulichkeit verbindet. Mit dem Kleinen, das von den Großen studiert wird, nähern wir uns auch auf andere Weise der Frage der Sterblichkeit. Denn auch wir Menschen sind, in Science-Fiction-Szenarien wie bei Nietzsche oder Schopenhauer, vielleicht nur kleinste Objekte für das Vergnügen und die Mikroskope der Demiurgen. Dass wir zerquetscht werden, ist wahrscheinlich, sicher ist, dass wir ein Ende haben.
Dieser Sterblichkeit stehen die Wissenschaften indifferent gegenüber wie eine Mauer. Doch sobald sich Lebensgeschichte in den Forschenden meldet, erhält das Thema ein neues Gewicht. Generell lässt sich sagen: Die Suche nach Unsterblichkeit ist dem Menschen, seit er von den Früchten des Paradieses gekostet hat, eine ewige Quelle der schöpferischen Antworten auf den Tod. Würden wir überhaupt etwas zu erzählen haben, wenn wir nicht sterblich wären? Fragen sind nicht losgelöst von den Fragenden. Der Mensch wäre zu definieren (unter anderem) als das Tier, das Fragen stellt. Es hat einige Antworten gefunden, einige sehr effektive und gefährliche wie die Atombombe waren darunter. Ebensolche Produkte entstehen, wenn wir das Biographische und das heißt auch die gesellschaftliche Vernetzung der Wissenschaften nicht zur Kenntnis nehmen und sie nicht stärker in unsere moralische Verantwortung einbinden wollen. Selbst die Neurologie, die sich ja mit dem Innersten des Menschen beschäftigt, muss sich solche Einbindung gefallen lassen. Der Mensch ist der rote Faden der Wissenschaften, und das soll in dem vorliegenden Teil besonders sichtbar werden.
Namenloser Schrecken Mary Shelleys Frankenstein
Manche Geschichten beginnen in der Erdformation, und ihre Anfänge liegen vor der Zeit. Man schrieb das Jahr 1815. Europa war von den napoleonischen Kriegen zermürbt, doch Napoleon hatte sich von Elba wieder auf den Weg gemacht; im Juni sollte seine letzte Schlacht stattfinden, bei Waterloo in Belgien. Drei Jahre zuvor war der Vulkan Tambora auf der Insel Sumbawa wieder aktiv geworden, die Erde bebte, und er begann Dampf zu lassen. Den kleineren Explosionen folgte am 5. April 1815 ein gewaltiger Auswurf; und die Ausbrüche ab dem 10. April stellten alles Bekannte in den Schatten. Sie waren noch in einem Umkreis von 2500 Kilometern weiter westlich zu hören. Man muss sich einmal in diese weitab von der bekannten Geschichte ereignenden Dinge hineindenken: Feuersäulen, Feuerstürme, heißer Ascheregen, entwurzelte Bäume und zerstörte Inseln, Menschen, Tiere und Hütten, die weggerissen werden von den Fluten, fünf Meter hohe Tsunamis. Der größte englische Geologe des 19. Jahrhunderts, Charles Lyell, notierte die Katastrophe in seinem Werk Principles of Geology, das Darwin begierig auf seiner Weltreise las.
Drei Tage lang herrschte um Tambora herum komplette Dunkelheit. Das lokale Ereignis entwickelte sich jedoch zu einer planetarischen Krise, denn längst vor der Globalisierung durch den Menschen war die Erde durch ihre Atmosphäre und andere Kreisläufe global. De Boers und Sanders zählen die Auswirkungen des riesigen Vulkanausbruchs auf: Der Boden auf Sumbawa und den Nachbarinseln wurde vergiftet, viele Menschen flohen und wanderten aus. Der Sommermonsun in Indien fiel aus und kam später als Flut; das führte zu Trockenheit und Hungersnöten. Im Gangestal brach, vielleicht als Folge, die Cholera aus – möglicherweise war dies der Beginn einer weltumspannenden Epidemie, die in den folgenden zwei Jahrzehnten Kairo, Moskau, Paris und Amerika erreichte. Eindeutig aber verschlechterte sich das Wetter weltweit. Durch die vom Wind transportierten Aschepartikel wurde für einige Jahre das Sonnenlicht abgeblockt, und Kälte herrschte wieder über der Erde. 1816 lag die Temperatur in der nördlichen Hemisphäre um zehn Grad Celsius unter dem Jahresdurchschnitt. Europa wurde dunkel, kalt und wetterwendisch. In Ungarn fiel brauner, in Italien gelblich-rötlicher Schnee. Es gab Frosttage im Sommer, Stürme und viel Regen. Zu den besonders betroffenen Ländern gehörte die Schweiz. So ging 1816 als das »Jahr ohne Sommer« in die Geschichte ein. Weltweit gab es Hungersnöte, die Ernten waren miserabel oder fielen aus, Überschwemmungen und Seuchen folgten (vgl. Behringer).
Die Pferde waren die Ersten, die zugrunde gingen – einerseits waren sie ohnehin durch die Kriege dezimiert, andererseits schlachtete man sie, weil man sie nicht mehr füttern konnte. Da begann sich in Mannheim ein Erfinder und Förster Gedanken zu machen, wie man das Pferd durch ein Laufrad ersetzen könnte, und kam so auf den Vorläufer des Fahrrads, die Draisine oder das Veloziped. Zur gleichen Zeit, am Genfer See, versammelten sich britische Poeten und Intellektuelle, junge Frauen und Männer, und versuchten, dem schlechten, kalten Wetter zu trotzen, indem sie sich Gruselgeschichten erzählten, denn diese Gattung war à la mode. Der Schauerroman stand hoch im Kurs, und man las deutsche Gespenstergeschichten in französischer Übersetzung. Dann schlug Lord Byron einen Wettbewerb vor: Wer kann die beste Gespenstergeschichte erfinden? Die berühmteste Geschichte wurde von einer Teilnehmerin des Kreises erdacht, die gerade erst 18 Jahre alt war. Und aus dieser Geschichte wurde einer der berühmtesten Romane, Frankenstein; or, The Modern Prometheus.
Das Wetter, der ferne Vulkan, die Kälte und die Dunkelheit sind in diesem Werk präsent, ja, sogar die in der Arktis herumirrenden Menschen, die sich wie letzte Menschen fühlen – und tatsächlich sollte Mary Shelley später einen Roman über einen Menschen schreiben, der als Einziger eine Epidemie überlebt hat: The Last Man, erschienen 1826.
Das Monster des Romans Frankenstein geistert durch unsere Filme wie unsere Träume, es ist der Inbegriff fehlgeleiteter, amoralischer Wissenschaft. Es ist im Übrigen namenlos wie jede Angst, und deshalb sind wir versucht, es nach seinem Schöpfer Frankenstein zu nennen. »Frankenstein«, ob als Schöpfer oder Monster, hat sich in uns festgesetzt, es steht für einen großen Tabubruch. Nicht umsonst trägt der Roman den Untertitel: »oder der neue Prometheus«. Auch Prometheus war der große Tabubrecher in der Ursprungsgeschichte der Menschheit. Er stahl den Göttern das Feuer und erschuf, nach einer anderen Version, sogar den Menschen. In beiden Mythen trägt er zur Entstehung des Menschengeschlechts bei, zur Entstehung eines rebellischen, selbstbewussten und neugierigen Stammes, der die Welt erobern sollte. Prometheus wurde von der Romantik wiederentdeckt als Figur der Rebellion, mit der man sich identifizieren konnte. Im Angesicht der Mächte des Ancien Régime stand er für Jugendlichkeit, Aufruhr und Angriff auf die Autoritäten und Hierarchien. Lord Byron und Percy B. Shelley, Goethe und viele andere tätowierten ihre Gedichte mit diesem Namen, der gern auch als griechische Entsprechung Satans gelesen wurde. Wie Francis Bacon für die Wissenschaft ein »Neues Atlantis« entwarf, so erneuerte Mary Shelley Prometheus im Licht des 19. Jahrhunderts, das mit vielen Versprechungen und Erwartungen und vor allem Ängsten begann, denn jener andere, den man auch mit Prometheus verglich, zog wie ein wildes Tier durch Europa und sprengte einen Staat nach dem anderen: Napoleon.
Frankenstein ist ein Schauerroman, der unauflösbar mit Landschaften verbunden ist. Sie taten sich der jungen Engländerin erst auf, als Napoleons Stern sank. 1814, als Napoleon nach Elba verbannt war, wurde die Kontinentalsperre aufgehoben, mit der er seit 1806 die englische Wirtschaft schädigen wollte (es gelang ihm nicht). Dies bedeutete, dass erstmals britische Reisende wieder den Kontinent ungehindert befahren konnten. Zu den frühen Touristen, die davon profitierten, gehörten englische Dichter, Maler und Intellektuelle. Man fuhr den Rhein entlang und ließ sich von den Schlössern und Felsen bezaubern, doch vor allem zog es die Touristen neben Italien in die Schweiz. Die großartige Berg- und Seenlandschaft mitten in Europa harrte der Entdeckung durch Ausländer. Die romantische Einstellung zur Landschaft, die nun möglichst wild und erhaben sein sollte, erleichterte den Zugang und machte die Bergwelt attraktiv. Byron und Shelley waren im Gegensatz zu der ersten romantischen Generation Englands ebendiesem erhabenen Anblick verfallen und ließen ihn in zahlreichen Texten erstehen – von Byrons »The Prisoner of Chillon«, den Cantos in Childe Harold bis hin zu Shelleys »Mont Blanc«.
Für die Gruppe um Byron und Shelley wurde die Schweiz kurzfristig zu einer Art Asyl. Byron floh vor einem Skandal, den er in England ausgelöst hatte. Soeben hatte sich seine Frau Annabella unter anderem wegen seiner Wutanfälle von ihm getrennt; sie waren so schlimm geworden, dass sie ihn auf Geisteskrankheit hin hatte untersuchen lassen. Vor allem aber sprach man in London von Byrons Beziehung zu seiner Halbschwester Augusta. So eilte er im Mai 1816, begleitet von seinem Leibarzt Dr. John Polidori, einer Kohorte von Dienstpersonal, einem Pfau, einem Affen und einem Hund in einer Kutsche, die der Napoleons nachgebaut war, in die Schweiz an den Genfer See. In Genf herrschte die Anglomanie, die Stadt zog massenweise englische Touristen an, was Byron aus verständlichen Gründen unangenehm war. So mietete er sich etwas außerhalb der Stadt die Villa Diodati in Cologny. Der Besitzer war der Nachkomme eines Theologen, der schon im 17. Jahrhundert John Milton in Genf als Gast bei sich hatte.
Zu der anderen Gruppe, die bald aus England folgte, gehörte ein Poet, der von Gläubigern wie Gläubigen verfolgt wurde, denn er hatte nicht nur Schulden, sondern sich auch in der Heimat durch atheistische Schriften höchst unbeliebt gemacht. Zwei Jahre zuvor war er zudem eine Liaison mit der Tochter eines der größten Denker und Schriftsteller der Zeit eingegangen, obwohl er noch mit der inzwischen schwangeren Harriet Smith verheiratet war. Der vierundzwanzigjährige Dichter Percy Bysshe Shelley zog also mit Mary Godwin und deren Stiefschwester Claire Clairmont hinab an den Genfer See zu Lord Byron (in den Claire wiederum verliebt war). Dort versprach man sich Freiheit, auch wenn es von Briten nur so wimmelte und damals schon die Paparazzi das Anwesen Byrons umschwärmten. Die Shelleys mieteten sich eine Villa in der Nähe der Villa Diodati, und nun begann ein reger Verkehr zwischen beiden Gruppen. Das Wetter sorgte dafür, dass man sich oft innen aufhielt und sich der Wissenschaft, der Phantasie und der intellektuellen Konversation hingeben konnte. Die Abende müssen trotz der Unbill schön gewesen sein, denn die Aschepartikel sorgten für wunderbare Sonnenuntergänge, die sich noch in der Malerei der Zeit von Turner bis Caspar David Friedrich niederschlagen sollten. Ähnliches sollte sich wiederholen, als 1883 der Krakatau ausbrach und mit seinen Aschewolken weitere solche Sonnenuntergänge und Gemälde hervorbrachte (→3. Unruhe im Innern). Eine günstige Stimmung für das Gespenstische und Atmosphärische: Geschichten über den Liebhaber, der seine Braut umarmen will und den Schatten der betrogenen früheren Geliebten in den Armen hält, über den Gründer einer Rasse, die mit dem Kuss des Todes gezeichnet ist, riesig und mit einer Rüstung bekleidet wie Hamlets Geist.
Und so begann man zu erzählen. Lord Byron, der gerade an seinem Childe Harold schrieb, schien nicht sehr ehrgeizig und brachte nur ein Fragment zustande. Percy Shelley war eher Poet und wollte sich nicht mit der »Maschinerie einer Erzählung« befassen. Byrons Leibarzt schrieb über eine Dame mit Schädel, daraus wurde nicht viel; später sollte er eine Idee von Byron aufgreifen und die erste literarische Vampirgeschichte verfassen. Somit wird an diesen Abenden in der Villa Diodati auch der Vorfahr des Grafen Dracula geboren, den Bram Stoker 80 Jahre später zum Welterfolg führen sollte.
Die berühmten Dichter brachen das kreative Experiment jedoch bald ab; es erschien ihnen alles ein wenig platt. Mary Godwin, die sich inzwischen Shelley nannte, die achtzehnjährige Tochter des Philosophen William Godwin und der Feministin Mary Wollstonecraft, verließ sich dagegen auf ihre Träume. Sie bemerkte, dass die intellektuellen Diskussionen am Abend in die Gesichter der Nacht hineinwirkten. Meist war sie stille Zuhörerin, eine Geschichte wollte ihr anfangs nicht einfallen. Sie mühte sich ab, es kam aber nichts. Jeden Morgen, so schreibt sie in ihrem Vorwort zu Frankenstein, fragte man sie: »Hast du dir eine Geschichte ausgedacht?«, und sie musste verneinen. Man sprach an diesen Abenden viel über die Entstehung des Lebens, so über die Experimente von Erasmus Darwin. Dieser war Arzt und Botaniker und bedichtete die Natur in lehrhaften Zeilen. Er zeigte in diesen Versen allerdings eine Vorahnung des evolutionären Prinzips, das sein Enkel – 1816 war Charles Darwin sieben Jahre alt – bald entwickeln würde. Ebenso faszinierte die Elektrizität, denn Galvani und anderen war es gelungen, tote Frösche zum Zucken zu bringen. Galvanis Neffe Aldini erweckte gehängte Verbrecher kurzfristig mit Stromstößen zum Leben: Augen gingen auf, Arme und Beine zuckten. Man stellte sich vor, dass man einen Menschen aus verschiedenen Teilen zusammensetzen und ihn dann durch ein vitalisierendes Prinzip wie die Elektrizität beleben könnte.
Die Wissenschaft war dabei, alte Grenzen von Religion und Anstand zu überschreiten, sie war prometheisch gesonnen. All dies Gehörte und Besprochene belebte Marys Phantasie und wirkte bis in einen hypnagogen Zustand zwischen Wachen und Schlaf hinein, der für kreative Vorgänge möglicherweise noch wichtiger ist als der Traum. Auffällig an dem entscheidenden Abschnitt, in dem sie über die Geburtsstunde des Ungeheuers in ihrer Phantasie schreibt, ist, dass sie immer wieder von den Augen und dem Schlaf spricht. Mary kann nicht einschlafen, da sieht sie vor ihrem inneren Auge ganz deutlich den »bleichen Studenten der unheiligen Künste«, der neben einem Wesen kniet, das er soeben erschaffen hat. Dieses liegt ausgestreckt da und wird von einer »mächtigen Maschine« zum Leben gebracht. Der Erfinder möchte fliehen und wieder zu einem gesunden Schlaf zurückfinden und hoffen, dass alles nur ein Traum gewesen sei. Er schläft ein, aber als er aufwacht, hat sich die Situation umgekehrt: Das Monster steht neben ihm und schaut ihn aus gelben, wässrigen Augen an. Es rätselt und sucht Rat, weil es den ausgestreckten Frankenstein ebenso wenig versteht wie der Schöpfer zuvor sein Geschöpf. Und nun der Heureka-Moment: Mary weiß, dass das, was sie mit Schrecken gesehen hat, auch andere mit Schrecken erfüllen wird – die Geschichte ist gefunden. Am nächsten Morgen kann sie guten Mutes verkünden, dass sie eine Erzählung begonnen hat. Sie fängt genau an dieser Stelle, den ihr die Eingebung verraten hat, mit ihrem Roman an, aber die Passage taucht erst im vierten Kapitel des ersten Bandes auf:
»It was on a dreary night in November …«: »Es war eine trostlose Novembernacht […] als ich beim Scheine meiner fast ganz herabgebrannten Kerze das trübe Auge der Kreatur sich öffnen sah. Ein tiefer Atemzug dehnte die Brust und die Glieder zuckten krampfhaft.« (Shelley 69)
Mit welchen Mitteln Frankenstein dieses Wunder genau zuwege brachte, erfahren wir nicht; die späteren Filme sollten expliziter werden. Wir wissen aber, dass er sich mit den ›neuen Wissenschaften‹ beschäftigt hat, und zwar als Student an der damals hochgeachteten jesuitischen Hochschule von Ingolstadt. 1800 wurde die Universität nach Landshut verlegt, später nach München. Was sich also im Roman abspielt, muss vor 1800 geschehen sein.
Ausgerechnet im katholischen Stammland also verabschiedet sich Frankenstein (der übrigens nie einen Doktortitel erlangte) von den alten Systemen der Wissenschaft wie der Alchemie und der Astrologie. Zunächst wird er von einem Professor namens Krempe ausgelacht, dass er sich mit Paracelsus und Agrippa beschäftigt hat. Krempe, der Naturphilosoph, vertritt eine lineare moderne Naturwissenschaft, die das Alte abwirft: »Sie haben ihr Gedächtnis mit explodierten Systemen und nutzlosen Namen belastet!«, ruft er aus. Er müsse seine Studien von Grund auf neu beginnen. Dagegen ist sein zweiter Mentor von anderem Kaliber. Dieser Professor Waldman (sic) hat nicht nur eine angenehme Stimme und strömt etwas Weises aus, er beschränkt sich nicht nur auf die Zerstörung des Alten, sondern bietet mit der modernen Chemie dem Adepten auch eine wirkliche Ansicht der Zukunft – ein klarer Fall für ein heutiges Exzellenzcluster! Seine, die wahre Wissenschaft, so erkennt Frankenstein, besteht nicht in der kleinteiligen Forschung, sondern im großen Überblick, sie ist ohne eine Vision für die Menschheit nichts wert. Darin bestärkt ihn Waldman, der noch einmal das Ethos formuliert, das wir in Bensalem auf einer Insel im Pazifik, in Francis Bacons Nova Atlantis (→4. Die fliegende Insel der Wissenschaft), bereits antreffen:
Die Alten versprachen Unmögliches und leisteten nichts. Die heutigen Gelehrten versprechen nichts; sie wissen, dass die Metalle nicht ineinander verwandelt werden können und dass das Lebenselixir eine Chimäre ist. […]. Sie haben neue, fast unbegrenzte Kräfte entfesselt. Wir haben dem Himmel seine Blitze entrissen und machen uns über die unsichtbare Welt mit ihren Schatten lustig. (Shelley, Kap. 3)
Die Wissenschaft wird im Roman nach der Erschaffung des Monsters nur noch eine untergeordnete Rolle spielen – so etwa, wenn die Kreatur eine weibliche Begleitung wünscht und sich Frankenstein noch einmal an sein Werk machen soll. Ansonsten geht es um die Wiederkehr des Verdrängten. Was hat Frankenstein nicht alles verdrängt, um den Schritt über die Natur hinaus zu tun! Seine familiären Beziehungen, seine Verlobte und seine Freundschaft hat er auf dem Altar der Wissenschaft geopfert, denn diese fördert eine gewisse Asozialität, einen sozialen Autismus. Das Monster, dem er keine Wärme und Vaterschaft entgegenbringt, wird sich rächen. Zahllos sind die Interpretationen. Sie reichen von der Vorstellung, bei dem Ungeheuer handele es sich um eine Verkörperung der Industrialisierung bis hin zu der Deutung von Frankenstein als Mutter, die wie Mary Shelley ambivalente Gefühle gegenüber ihren Kindern haben mochte. Oder spiegeln sich hier gar Familienaufstellungen der Godwins wider? Der strenge Vater, der die Tochter weniger liebt als lehrt, die Mutter, die bei der Geburt Marys stirbt und ihr ein Leben lang fehlen wird? Und natürlich hat man den Roman immer wieder als Kritik an der Arroganz der Wissenschaft gelesen, so dass Frankenstein zu einem kulturkritischen Begriff wurde wie der Golem, als Bild einer unkontrollierbaren Technik, der der Mensch, der sie erschuf, psychologisch und moralisch nicht mehr gewachsen ist. Wie dem auch sei, es bleibt festzuhalten, dass Mary Shelley diesen Roman ohne ihr Interesse an Wissenschaft und Philosophie nicht hätte schreiben können.
Sie wurde von ihren berühmten Eltern intellektuell ebenso gefordert wie gefördert, und so muss ihre Frühreife auf den ebenfalls frühreifen Shelley einen tiefen Eindruck gemacht haben. Ihre Tagebücher zeigen, dass sie eine unermüdliche Leserin war: lange Listen von Büchern, die sie gleichzeitig las, und aus den unterschiedlichsten Gebieten. Miltons Paradise Lost (1665) war ihr durch und durch vertraut, wie der Roman nahelegt, und auch darin geht es um Rebellion, nicht des Prometheus, sondern des anderen Lieblings der Romantik: Satans. Goethes Faust war von Percy B. Shelley 1815 ins Englische übersetzt worden, und Einflüsse sind ohne weiteres festzustellen. Wie der Ingolstädter Student will Faust wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Er verkauft seine Seele an den neuen Mephisto, die Wissenschaft, und auch er will die Natur transzendieren durch Beherrschung ihrer Grundkräfte. Beide arbeiten an einem Projekt, das spätestens seit Paracelsus die europäische Geistesgeschichte beschäftigt: der Homunkulus oder der künstliche Mensch. Das Monster ist allerdings bald selbst ein Leser Goethes und bildet sich schnell ohne lästige Sprachkurse.
Mary Shelley kannte ihre Philosophen von Locke bis Rousseau, aber sie war auch naturwissenschaftlich gebildet und mit den Wissenschaftsdebatten ihrer Zeit vertraut. Themen wie Vivisektion, die Entstehung des Lebens und der Magnetismus wurden in den einschlägigen Zeitschriften diskutiert. Der prometheische Funke lauerte in der Wissenschaft von der Elektrizität, damit konnte man der Metaphysik wieder habhaft werden, die die Aufklärung ja zu Fall gebracht hatte. Professor Waldman macht sich daher auch gar nicht über Paracelsus und Agrippa lustig, er führt in seiner Chemie vielmehr ihren Impuls fort. Deren alchemistisches Projekt ist seines, nur will er es mit anderen Mitteln erreichen: die Herrschaft des Menschen auszuweiten über die Natur, die Natur sozusagen in einem, nun aber modern verstandenen, alchemistischen Werk zu veredeln. Der Roman bringt diesen Herrschaftswillen, der mit Bacons »Wissen ist Macht« einhergeht, gleich zu Anfang zum Ausdruck, und zwar auf eine geographische Weise. Denn die Erzählung ist eingebettet in eine Rahmenhandlung einer Expedition zum Nordpol. Wie Frankenstein, so hat auch schon der Forscher Robert Walton einen Drang zum Nichts, in die eisige Wüste jenseits aller menschlicher Beziehungen, und so schafft diese Landschaft den geeigneten Schauplatz für Anfang und Ende des Romans, jene Verfolgungsjagd im Eis, zu der die wissenschaftliche Neugier geworden ist: kalt, destruktiv und apokalyptisch in einem Feuer aufgehend.
Lord Byron schrieb in diesen Wochen ein Gedicht mit dem Titel »Darkness«. Darin berichtet er von einem Traum, in dem die Dunkelheit regiert. Die Sterne irren im Dunkeln, und es wird so kalt auf der Welt, dass alles Brennbare, Hütten und Paläste, verfeuert wird. Die Welt wird zu Chaos, Kälte und Dunkelheit. Dem Vulkanausbruch in Indonesien entspricht der in der menschlichen Seele, die sich auf eine dunkle Zukunft vorbereitet.
de Boer, Jelle Zeilinga / Donald Theodore Sanders. Das Jahr ohne Sommer. Die großen Vulkanausbrüche der Menschheitsgeschichte und ihre Folgen. Essen: Magnus Verlag 2004.
Behringer, Wolfgang. Tambora und das Jahr ohne Sommer. München: C.H. Beck 2015.
Knellwolf, Christa / Jane Goodall. Frankenstein’s Science. Experimentation and Discovery in Romantic Culture, 1780–1830. Burlington, VT: Ashgate 2008.
Massari, Roberto. Mary Shelleys Frankenstein. Hamburg: Junius 1989.
Mielsch, Hans-Ulrich. Sommer 1816. Lord Byron und die Shelleys am Genfer See. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung 1998.
Shelley, Mary. Frankenstein oder Der moderne Prometheus. Köln: Bastei-Lübbe 2001.
Verweile doch …! Die Suche nach Unsterblichkeit von Gilgamesch bis Čapek und Yeats
Seitdem die Menschen sich ihrer Sterblichkeit bewusst sind – also vielleicht mit Entstehung der Sprache und dem symbolischen Denken –, beschäftigen sie sich mit der Überwindung des Todes. Vielleicht ist dies das treibende Motiv menschlichen Kulturschaffens überhaupt. Der chinesische Kaiser Qin Shi Huang (259–210 v. Chr.) gilt als der Gründer des chinesischen Reiches. Er steht für dessen staatliche Einheit, die sich äußerlich in der Großen Mauer zeigte, zu der er wesentlich beitrug. Zugleich ist er auch derjenige, der sich eine unterirdische Armee für das Jenseits leistete. Beides deutet darauf hin, dass er den Tod überwinden wollte. Es kommt hinzu – wie Borges in seinem Essay »Die Mauer und die Bücher« schreibt –, dass der Kaiser seine Mutter des Landes verwies, angeblich wegen ihres ausschweifenden Lebens, vielleicht aber auch, um die Spuren seiner Herkunft zu tilgen. Er ließ zudem alle kanonischen Bücher verbrennen und vernichtete damit 3000 Jahre chinesischer Geschichte. Nur Literatur, die der Lebensverlängerung diente, durfte erhalten bleiben. Sein Palast war selbst eine Art Kalender, denn er hatte so viele Räume, wie das Jahr Tage zählt. Nicht nur die Bücher fielen ihm zum Opfer. Zwei Alchemisten sollten ihm das Elixier der Unsterblichkeit herstellen, doch sie scheiterten, und er fühlte sich von ihnen betrogen. Dies war der Auslöser für eine Kampagne gegen Gelehrte überhaupt. Über 460, vielleicht weitere 700 Intellektuelle, viele von ihnen Konfuzianer, wurden lebendig begraben. Jeder, der alte historische Beispiele nutzte, um satirisch auf gegenwärtige Zustände aufmerksam zu machen, wurde ebenfalls mit seinen Familienmitgliedern getötet. Wer die Bücherverbrennung nicht mitmachte, wurde zur Zwangsarbeit an der Großen Mauer verpflichtet. In der Gegenwart des Kaisers war es verboten, den Tod zu erwähnen: Wer es tat, dem wurde durch die Todesstrafe klargemacht, dass es den Tod doch gab. Dichter mussten Hymnen auf die Unsterblichkeit schreiben. Die Kampagne erinnert fatal an Mao Tse-tungs Kulturrevolution. Die Mauer, die Armee im Jenseits, der Bücherbrand und die Tötung der Gelehrten deuten auf den Wunsch hin, auf ewig zu überleben, entweder konkret mit einer Armee im Rücken und einem unterirdischen Palast oder, wenn dies nicht möglich sein sollte, im übertragenen Sinn, als unauslöschlicher Name, der mit dem Beginn der chinesischen Geschichtsschreibung zu zitieren wäre. Wer sich für unsterblich hält, muss den Anfang ebenso genau in den Blick nehmen wie die Verhinderung des Endes. Denn war der Anfang menschlich, so wird auch das Ende ein solches sein.
Auch der Gründer der Stadt Uruk, Gilgamesch, baute eine große Mauer und befestigte die Stadt nach außen hin, da die Steppenvölker den Tod bedeuteten. Dieser Held des gleichnamigen Epos, des ältesten, das wir kennen, steht für die Unterwerfung der Natur und der Wildnis. So wie er die Stadt baut, so zähmt er (mit Hilfe einer Frau) den wilden Enkidu und macht sich ihn zum Freund und Kampfgefährten. Gemeinsam besiegen sie das Ungeheuer Humbaba, das die libanesischen Zedernwälder bewacht. Diese wiederum sind notwendig für die großen zivilisatorischen Aufgaben im Zweistromland, für Tempel- und andere Bauten. Doch die Götter sind unzufrieden, es gibt Eifersucht und Liebeshändel. Die Göttin Ischtar wird von Gilgamesch zurückgewiesen und sendet wütend den furchtbaren Himmelsstier, aber die Freunde töten auch ihn. Am Ende muss Enkidu an einer Krankheit sterben – welche Schmach! Denn im Kampfe zu fallen, das war der Traum der Helden. Damit aber wird Gilgamesch erstmals persönlich direkt mit dem Tod konfrontiert, den er selbst zuvor so freigebig austeilte. Er läuft verzweifelt in der Steppe umher, er weiß nun, auch er wird zu Lehm werden. Den einzigen Trost findet er in der Idee der Unsterblichkeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass er zu zwei Dritteln schon göttlich ist, Unsterblichkeit scheint also in Reichweite zu sein.
Und hier kommt das Wissen, kommen frühe Formen der Wissenschaft ins Spiel. In der Wissenschaft seiner Zeit muss der Schlüssel liegen. Das Wissen aber liegt bei dem Menschen, der zusammen mit seiner Frau die Sintflut überlebt hat, dem weisen Utna-napischti, dem sumerischen Noah. So macht Gilgamesch sich auf den Weg zu diesem Menschen der Vorzeit. Er durchquert das finstere Innere der Zwillingsberge, das heißt, er reist der Sonne nach, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, muss sich den schrecklich strahlenden Skorpionenmenschen stellen und erreicht nach zwölf Doppelstunden die andere Seite: einen blühenden Garten, in dem die Edelsteinbäume der Götter stehen. Am Meer wohnt eine Wirtin, von der er den Weg erfährt. Ein Fährmann verspricht, den ersten Menschen überhaupt zu Utna-napischti zu bringen, allerdings muss er ihm dreihundert Stocherstangen bauen. Alle Stocherstangen werden bei der Überfahrt über das Wasser des Todes verbraucht, und am Ende macht der Fährmann ein Segel aus seinen Kleidern, und Gilgameschs Arme müssen als Masten dienen.
Schließlich erreichen sie das Land des Unsterblichen. Utna-napischti erzählt zunächst von den Geheimnissen, die zur Sintflut führten. Gilgamesch will unsterblich werden. Der Alte empfiehlt ihm, sechs Tage und sieben Nächte das Schlafen zu unterlassen. Sieben Brote für sieben Tage backt seine Frau, doch Gilgamesch verschläft alles. Hier werden wissenschaftliche, ja juristische Mittel bemüht, um dem eitlen Helden zu beweisen, dass er die erste Probe nicht bestanden hat. Jedes einzelne, nicht gegessene Brot belegt, dass er geschlafen hat; Gilgamesch kann es nicht leugnen. Dann wird er gewaschen, und Utna-napischti offenbart ihm das Geheimnis einer Pflanze, die Unsterblichkeit verleiht, »wie Bocksdorn ist ihr Wuchs« (man vermutet, dass es sich um eine dornige Koralle handelt). Sie verleiht die ewige Jugend, doch liegt sie am Boden der »Unterirdischen Wasser«. Gleich taucht der Held hinab, mit Steinen beschwert, und reißt sie aus der Erde. Er nimmt sich vor, die Pflanze nach seiner Heimkehr erst an einem Greis zu testen, und gibt ihr den Namen »Der-greise-Mensch-ist-geworden«. Auf der Rückreise geht er in einem Teich baden und lässt die Pflanze unbeachtet liegen. Da riecht eine Schlange ihren Hauch – Gerüche spielen eine große Rolle im Gilgameschepos – und verschlingt sie. Sogleich häutet sie sich, das Elixier der Unsterblichkeit beginnt schon zu wirken. Der Held aber geht blamiert zurück in seine Stadt Uruk, die noch einmal in ihren Maßen beschrieben wird – ähnlich wie Utna-napischti zuvor den Bau der Arche beschrieben hat.
Damit wird angedeutet, dass die Menschen auf andere Weise unsterblich werden können: durch die zivilisatorischen Werke, durch die Gründung einer Stadt und die Bildung eines Namens, der über die Zeiten wirkt. Utna-napischti ist aber auch ein Weisheitslehrer. Er weiß, dass die botanische und biologische Formel für die Unsterblichkeit im Grunde sinnlos ist, da der Mensch gar nicht reif dafür ist. Dieser verschläft die Dinge, er vernachlässigt sie, und es fehlt ihm die moralische Statur. Daher kritisiert der Alte den Helden gleich zu Beginn, er solle nicht den toten Dingen nachstreben, sondern das Atmende, das Lebendige erhalten. Nur so erringe er Unsterblichkeit: durch weises Regieren, die Förderung des Lebens und den Verzicht auf Prunk und Selbstdarstellung. In diesem Sinn ist das älteste bekannte Epos auch die jüngste Nachricht an all jene heute, die ihr Leben verlängern und sich verjüngen wollen, indem sie auf materielle Dinge setzen.
Da den Menschen der Zugang zum Lebensbaum versperrt war, suchten sie die Unsterblichkeit oder zumindest Lebensverlängerung auf dem Weg der Wissenschaft, auch wenn diese zunächst das Gewand von Zauberei und Magie trug, bevor sie ihr eigentliches Zeitalter, unsere Moderne, mitbegründete. Faust wollte den Augenblick anhalten, weil er so schön war, es gelang ihm nicht, auch wenn ihm der Teufel zur Seite stand. Alle nachfolgenden Geschichten zeigen, dass der Schöpfer recht hatte: Haben die Menschen erst einmal ihre Unsterblichkeit erlangt, sind sie nur noch unerträglich.
Das musste schon der große Reisende und Schiffsarzt Gulliver feststellen. Oft wird vergessen, dass seine Fahrten nach dem Besuch bei den Liliputanern und den Riesen noch weitergingen. Den neugierigen Arzt hielt es nicht lange auf der heimatlichen Insel, er musste hinaus, seine Neugier stillen und Abenteuer erleben. Für Jonathan Swift waren Gullivers Abenteuer immer auch gesellschaftlich-philosophischer Art. Auf einer der späteren Reisen (Buch 3) wird ihm im Land Lugnagg von den Unsterblichen erzählt, die dort Struldbrugs heißen. Lugnagg liegt östlich von China, dort, wo die Chinesen einst glaubten, dass ihre Unsterblichen wohnten. Klar, diese Unsterblichen will Gulliver sehen. Und Gulliver ergötzt sich voller Erwartung erst mal an dem Gedanken der Unsterblichkeit. In einer Rede vor den Lugnaggiern preist er die Vorzüge der Langlebigkeit: Er würde mit den Struldbrugs über die Wissenschaften diskutieren. Wenn er unsterblich wäre, so würde er wahrlich ein Schatzhaus des Wissens und der Weisheit werden, das Orakel des Landes! Wie herrlich, wenn man genug Zeit hätte, den Auf- und Niedergang von Reichen, das Anschwellen und Austrocknen von Flüssen, Revolutionen und Barbaren zu sehen und vor allem den unendlichen Fortschritt der Wissenschaften zu bewundern! In der Astronomie könnte man alle Voraussagen verifizieren, man wüsste, wann uns Kometen besuchen und so weiter. Nach dieser Hymne auf die Unsterblichkeit weist man ihn darauf hin, dass diese zwar in China und Japan angestrebt werde, doch nur nicht auf der Insel Lugnagg. Und warum nicht? Weil man hier das traurige Beispiel der Struldbrugs Tag für Tag erlebe. Der Hauptfehler, kritisiert man Gulliver, sei, dass er Unsterblichkeit mit ewiger Jugend verwechselt habe. Diesen Fehler beging im griechischen Mythos schon die Göttin Eos, die für ihren Liebling Tithonus die Unsterblichkeit beantragte, doch dabei vergaß, dass sich diese nur lohnt, wenn man auch jung bleibt. So muss Tithonus ewiglich altern, ohne sterben zu können. Ähnlich diese Struldbrugs. Man wird als ein solcher geboren, und dies ist erkennbar an einem roten Punkt auf der Stirn: ein schlechtes Zeichen! Bis zum dreißigsten Lebensjahr geht alles seinen herkömmlichen Gang, doch dann werden sie melancholisch und fangen an zu grübeln. Der Punkt verändert seine Farbe, sie altern, werden grillenhaft, vergesslich, ja, können keine Freundschaften mehr schließen, weil sie die Gesichter nicht mehr auseinanderhalten. Mit achtzig haben sie die gewöhnlichen Beschwerden, dazu aber noch jene, die mit dem Ausblick auf ein ewiges Leben einhergehen. Der schlägt böse auf die Stimmung und macht sie vollends ungenießbar. Ab achtzig werden alle Ehen aufgelöst, damit sich das Unglück nicht verdopple. Ab diesem Alter sind sie juristisch gesehen tot. Sie dürfen kein Eigentum mehr erwerben, und ihre Erben treten in ihr Recht, so dass sie auch verarmen. Wenn sie Beerdigungen sehen, kommen ihnen die Tränen, nicht aus Mitleid mit anderen, sondern mit sich selbst: Liebend gern würden sie die Stelle des Verstorbenen einnehmen. Ab neunzig schmeckt ihnen nichts mehr, sie haben keine Zähne oder Haare mehr und können nicht mehr lesen; außerdem sind sie extrem geizig. Als Gulliver später ein paar Struldbrugs trifft, ist er schockiert von ihrem jämmerlichen Aussehen. Das Erlebnis gibt seinem Wunsch nach ewigem Leben einen heftigen Stoß. Man diskutiert auch die Möglichkeit, einige Struldbrugs nach Europa zu bringen, um die dortige Bevölkerung vor dem ewigen Leben zu warnen, aber daraus wird nichts. Es muss bei Gullivers Bericht bleiben, er kann diese Funktion übernehmen.
Swift, der kein Blatt vor den Mund nahm, prangert hier den Verfall im Alter ebenso an wie den gesellschaftlichen Umgang damit. Aber insbesondere geht es ihm um eine Utopie. Sie beweist wieder einmal, wie sehr Oscar Wilde recht hatte, als er sagte, dass es zwei Tragödien im Leben gebe. Die erste sei die, dass man etwas nicht bekomme, was man gerne hätte. Die zweite, dass man es bekommt, und die sei die tragischere. Zum Struldbrug wird man geboren, man ist nicht verantwortlich für sein Schicksal. Die Gesellschaft ist aber weder sozial noch biologisch in der Lage, mit einer solchen utopischen Wunscherfüllung umzugehen. Man kann die Struldbrugs nur eingrenzen oder in Quarantäne setzen wie eine gefährliche Seuche. Kein Wunder, dass Gulliver mit der Unsterblichkeit vor allen Dingen Wissenschaft verbindet – Erkenntnisse durch langjähriges Beobachten. Es ist eben mit diesen Unsterblichen so wie mit der Wissenschaft, die Swift in dem benachbarten Laputa, auf der schwebenden Insel Lagoda antrifft: Sie sind auf Dauer unerträglich und unersprießlich. Swifts Satire zielt auf Wissenschaft wie auf das ewige Leben – beide sind Wunscherfüllungen, die in ihr Gegenteil schlagen, wenn sie übermächtig werden. Man muss sie beschränken, lautet die Devise. Wir werden es noch bei unserem Besuch auf der Insel Lagoda sehen (→4. Die fliegende Insel der Wissenschaft).
Anders als Swift ließen sich die Romantiker von der Unsterblichkeit wieder in den Bann schlagen. Sie waren fasziniert von Szenarien der Langlebigkeit. Am Ende aber erschien sie ihnen als Fluch. Mary Shelley hatte schon mit Frankenstein ein Modell der Unsterblichkeit aufgestellt, denn das Monster, zusammengeflickt aus den Teilen von Toten, ist ein Untoter, ein Wiederauferstandener. Die Autorin hat sich mit einem ähnlichen Szenario in der etwas flachen Kurzgeschichte »The Mortal Immortal« (1833) beschäftigt. Hier wird die Unsterblichkeit durch ein Elixier hergestellt und führt zu tragikomischen Erlebnissen. Der Erzähler, zum Zeitpunkt des Berichts im reifen Alter von 303 Jahren, war im 17. Jahrhundert Schüler des berühmten Gelehrten und Alchemisten Agrippa von Nettesheim. Durch das unerlaubte Trinken eines ersten Elixiers verliebt er sich in dessen Tochter Bertha. Es kommt zur Heirat. Als der Meister stirbt, gelingt es dem Erzähler ein zweites Elixier zu sich zu nehmen: das Elixier der Unsterblichkeit. Das führt nach einiger Zeit zu kuriosen Erscheinungen. Während seine Bertha neben ihm unweigerlich altert, wird der Gatte zu ihrem Missfallen immer jünger. Er erinnert sich jedoch, dass er nur die Hälfte getrunken hat – also hat er nur eine halbe Ewigkeit vor sich, wie viel immer dies sein mag.
Solcherlei Komplikationen in Geschichten über die Unsterblichkeit werden gern ausgekostet. Oft verbinden sie sich mit Verbrechen und Unglück, wie in Bulwer-Lyttons A Strange Story (1862). Nicht selten gehen sie ins Komische oder Tragikomische über, insbesondere nachdem die Romantik kritisch-ironisch überholt wird, wie in Nathaniel Hawthornes »Dr. Heidegger’s Experiment« (1837). 1897 erschien The Rejuvenation of Miss Semaphore: A Farcical Novel (Die Verjüngung der Miss Semaphore: Eine Roman-Farce) von Hal Godfrey (Pseudonym für Charlotte O’Conor Eccles, 1860–1911). Hier lockt eine deutsche Scharlatanin namens Sophie Geldheraus mit einer Anzeige für das Elixier der Jugend. Eine ältere Dame kauft ein Fläschchen, trinkt zu viel auf einmal und wird binnen kurzem zum Baby. All diese Geschichten betonen das Jungwerden als Voraussetzung für eine gelingende Unsterblichkeit. Sie wollen also das Tithonus-Problem umgehen, lassen ihre Helden und Heldinnen aber in andere Fallen hineintappen. Karel Čapek, der uns noch als Erfinder des literarischen Roboters begegnen wird (→4. Der Geist in der Maschine), hat mit Die Sache Makropolus (1922) solche Komplikationen im Theater verarbeitet. Von den Unsterblichen lernen heißt, die Sterblichkeit lieben zu lernen. Vor allem zwei Faktoren machen die Unsterblichkeit unerträglich: Zum einen ist es das Gefühl der Vergeblichkeit von Geschichte – man sieht, wie sich jede Trottelei und jeder Fehler der Menschheit regelmäßig wiederholt. Zweitens aber ist die Unsterblichkeit die beste Voraussetzung für Langeweile.
Vielleicht war Čapek von George Bernard Shaw, den er sehr bewunderte, beeinflusst, als er sein Stück schrieb. Von 1918 bis 1921 schrieb der Ire an einem fünfteiligen Theaterstück, in dem es ebenfalls um Langlebigkeit geht. Das Lesestück beginnt mit Adam und Eva und endet im fünften Teil im Jahre 31920. Am Ende sind die Menschen langlebig, sie leben fast ewig und können sich kaum noch in die Kurzatmigkeit der früheren Jahrtausende hineindenken. Shaw nutzt das Thema zur Diskussion von politischen Positionen, die ihn um 1920 umtrieben und die er mit Ideen zum Darwinismus, Lamarckismus und einer vitalen Lebenskraft verbindet, der creative evolution. Diese Kraft kann erworben und vererbt werden, wie es dem Konzept Lamarcks entsprach. Langlebigkeit oder Beinah-Unsterblichkeit ist ein biologisches Faktum mit großen gesellschaftlichen Auswirkungen, die Shaws Figuren so ausführlich diskutieren. Bei Shaw spielte sicherlich eine große Desillusionierung durch den Ersten Weltkrieg eine Rolle, die von einem Rattenschwanz an Heilsvorstellungen, Traumwelten und Utopien, aber auch Albträumen und Dystopien verfolgt wurde. Shaw fand, zeitweise wenigstens, Antworten im Sozialismus und in seinen Ideen zur Evolution. Auch Leo Trotzki befasste sich mit der Frage, ob nicht die richtigen gesellschaftlichen Verhältnisse zur Langlebigkeit führen können. Der Kommunismus war daher auch eine große Verjüngungs- und Ewigkeitsideologie, wie Lucian Boia festgestellt hat.
Sich mit der Frage der Langlebigkeit und der Unsterblichkeit zu beschäftigen scheint für die Zeit symptomatisch gewesen zu sein. In den dreißiger Jahren bemerkte der irische Lyriker und Nobelpreisträger William Butler Yeats, dass Dichtung und Sexualität gleichermaßen nachließen. So beschloss der bald Achtzigjährige, sich einer Verjüngungskur zu unterziehen. Er hatte von dem berühmten Wiener Arzt Dr. Eugen Steinach gehört, der Hunderte Patienten aus der Bildungsschicht erfolgreich behandelt hatte, unter anderem Sigmund Freud. Eine Vasektomie scheint Yeats tatsächlich geholfen zu haben, er fühlte eine zweite Jugend wiederkehren; er wurde noch einmal produktiv und schrieb seine großartigen späten Gedichte. 1928, da war er 63 Jahre alt, hatte er einen seiner berühmtesten Texte veröffentlicht: »Sailing to Byzantium«. Darin stellt er sich vor, wie er den jugendlichen fleischlichen Genüssen entflieht und zu einem goldenen Vogel am Hofe des Kaisers von Byzanz werden möchte. Die Kunst gewährt zwar Ewigkeit, aber auf Kosten des Lebens und der körperlichen Freuden.
Yeats verband zwei Strategien von Unsterblichkeit, wie sie der englische Philosoph Stephen Cave umfassend dargestellt hat: erstens als biologischer Versuch, die Natur zu überlisten und den Körper selbst zu verewigen oder zumindest seine Dauer zu verlängern, und zweitens sich zu ›vergolden‹ durch die Kunst und als Denkmal oder Name fortzuleben. Die dritte Vorstellung von Unsterblichkeit war Yeats nicht fremd: Reinkarnation. Er fühlte sich zu indischen Lehren und zu den Pythagoräern hingezogen, die ebenfalls die Seelenwanderung lehrten. Mit Hilfe der Kontakte, die seine Frau zum Jenseits pflegte, legte er zudem unter dem Titel A Vision seine eigene Geschichtsphilosophie vor, in der die Wiederkehr von Figuren und Zeiten eine große, geradezu geometrische Rolle spielt.
Die vierte Erzählung, die Cave nennt, ist die Auferstehungserzählung, die sich unter anderem das Christentum zu eigen gemacht hat. Alle vier Typen – Weiterlebenserzählung, Auferstehungserzählung, Seelenerzählung und Vermächtniserzählung – sind literarisch verarbeitet worden, da sie fundamentale, in allen Kulturen immer wieder auftretende Narrative darstellen, mit denen Menschen sich von der Last der Sterblichkeit befreien wollen. Religion und Literatur, auch im Sinne der Mythen, sind die großen Zufahrtsstraßen zum Jenseits. Während Religion sich jedoch auf Offenbarung bezieht, nutzt die Literatur zusätzlich das jeweilige Wissen der Zeit und der Gesellschaft. Immer also, wenn sie sich mit der Frage der Unsterblichkeit beschäftigt, wird sie unweigerlich die Obsessionen und Phantasmen, die Phantomgedanken und Schattenwelten aufrufen, die das jeweilige zeitliche Bewusstsein prägen. Die Science-Fiction etwa ist voll von Szenarien und Ideen zur Unsterblichkeit. Ob sie nun Eugenik hervorhebt (Huxley) oder Bluttransfusion (Gunn), genetische Bearbeitung Schlaf/Kryonik (Wells) oder die Flucht in den Weltraum (Vance) – in jedem Fall bringen diese Geschichten neueste oder auch nur erträumte Technologie in Verbindung mit dem uralten Albtraum des Todes.
Vergessen wir auch nicht die zahllosen Vampirphantasien, die noch lange nicht am Ende sind, wie wir heute sehen. Die Grundfrage des Vampirs ist exakt die nach der Überwindung des Todes. Das Blutsaugen sichert Weiterleben, zugleich geht es um die Auferstehung von den Toten. Damit streitet dieser Glaube mit dem christlichen – zumal Blut in beiden Vorstellungsbereichen von großer Bedeutung ist.
Wir sehen, die Frage der Unsterblichkeit ist zentral für einen großen Bereich der Literatur. Sie bedient sich hierbei gern der Wissenschaft und Technik, um auf psychologische und gesellschaftliche Komplikationen aufmerksam zu machen. Aber es gibt auch keinen Zweifel daran, dass die britische Autorin Susan Ertz recht hat, wenn sie schreibt: »Millionen sehnen sich nach Unsterblichkeit und wissen nicht einmal, was sie an einem regnerischen Sonntagnachmittag mit sich anfangen sollen.«
Benecke, Mark. Memento Mori. Der Traum vom ewigen Leben. Rudolstadt: Roter Drache 2011.
Boia, Lucian. Forever Young. A Cultural History of Longevity. London: Reaktion Books 2004.
Borges, Jorge Luis. »Die Mauer und die Bücher«. In: Gesammelte Werke 5/II, Essays 1952–1979. München: Hanser 1981, 7–10.
Čapek, Karel. »Der Fall Makropolus«. In: Dramen. Berlin: Aufbau 1976.
Cave, Stephen. Unsterblich. Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben als Triebkraft unserer Zivilisation. Frankfurt/M.: S. Fischer 2012.
Dunne, John W. The New Immortality. London: Faber 1938.
Ellmann, Richard. Yeats’s Second Puberty.
http://www.nybooks.com/articles/archives/1985/may/09/yeatss-second-puberty/ (9.5.1985, Zugriff 26.10.2015)
Das Gilgamesch-Epos. Neu übersetzt von Stefan M. Maul. München: C.H. Beck 2005.
Godfrey, Hal. The Rejuvenation of Miss Semaphore: A Farcical Novel (Die Verjüngung der Miss Semaphore: Eine Roman-Farce) 1897.
Shaw, George Bernard. Back to Methuselah (1921). Harmondsworth: Penguin 1971.
Swift, Jonathan. Gullivers Reisen. Frankfurt/M.: Insel 2004.
Die Jagd nach dem Gehirn Newton, Einstein und die Zeitmaschine
Wir unterhielten uns über Nahtoderlebnisse. Am nächsten Tag gab mir mein Gesprächspartner einen Artikel aus Scientific American. Darin fand er sich bestätigt: »Siehst du, diese Nahtoderlebnisse werden vom Gehirn produziert. Es ist bloß das Gehirn!« Damit schien alles erklärt und aller Zweifel beruhigt. Aber was heißt eigentlich »bloß das Gehirn«? Wir tun so, als ob wir verstünden, was vor sich ginge, bloß weil wir einen Namen dafür haben. In Wirklichkeit, so versuchte ich, ihm verständlich zu machen, ist das Wunder ebenso groß, ob es nun von einer metaphysischen Zentrale eingerichtet wird oder ob das Gehirn sich im Laufe der Evolution so entwickelt hat, dass es Nahtoderlebnisse erzeugt; wobei man sich fragt, welchen evolutionären Vorteil diese bringen könnten.
Es heißt, dass die Transplantation von Organen und Gliedern nicht grundsätzlich an unserer Identität rührt, solange nicht das Gehirn verpflanzt wird. Dieses, mehr noch als das Herz, stehe für uns selbst, unser Selbst. Und das soll nicht wunderbar sein? Bloß weil uns etwas so nah ist wie nichts anderes, weil es unsere Identität mitbestimmt, soll es nicht wunderbar sein? Dass ich dauernd meinen Arm hebe oder meine Finger bewege, soll nicht ein Wunder sein? Wir lassen uns wie durch Wiederholungen hypnotisieren und übersehen dabei die Wahrheit der einzelnen Äußerung. Die Menschen, sagt Chestertons Pfarrer Brown, glauben die verrücktesten Sachen, nur weil sie eine Serie bilden.
Das Wort Hirn hängt mit Horn und vorn zusammen. Es ist das Vorderste und uns immer voraus. Daran hat auch das Jahrzehnt des Gehirns, das 1990 ausgerufen wurde, nicht viel geändert. Das Gehirn ist allerdings nicht nur ein wissenschaftliches Objekt, es ist auch Teil einer Vielzahl von Geschichten und Bildern, die wiederum zurückwirken auf die wissenschaftliche Fragestellung. Als rätselhafte Masse in unseren Köpfen ist es in Geschichten verstrickt. Die Menschen können sich nicht recht einen Reim auf etwas machen, das ihnen erst jeden Reim ermöglicht. Aufgrund seiner unbestimmbaren Form – Blumenkohl, Qualle, Gelee, Zellhaufen, Walnuss oder Weichkäse – eignet es sich besonders gut für Projektionen und Rorschachtests, die die Menschheit zu ihrer Unterhaltung wie Selbsterkenntnis durchführen kann.
Vor allem interessierte man sich für das außergewöhnliche Gehirn. Im 20. Jahrhundert avancierten die Hirnmassen bestimmter Denker und Lenker zu Kultobjekten. Das Denkorgan Lenins hat mindestens zwei Romane inspiriert. Insbesondere aber ist es Einsteins Gehirn, das eine magnetische Kraft auf die Kultur ausgeübt hat. Roland Barthes hat in einem berühmten Essay die Mythologien entziffert, die dieses Stück Denkmasse in eine sakrale Substanz verwandelt haben. Einsteins Gehirn, so schreibt er, befriedige den Mythos, weil in ihm Magie und Maschine, die Weltformel und die Atombombe eins werden. Es ist sozusagen der (weiche) Stein der Weisen. Nicht nur die Literatur, auch die Wissenschaft kennt ihre Fetische. Der Arzt, der 1955 Einsteins Gehirn sezieren durfte, nahm es nach der Operation mit nach Hause und bewahrte es dort im Stile billiger Science-Fiction-Filme länger als vierzig Jahre auf. Bis der Journalist Michael Paterniti kam und mit dem Vierundachtzigjährigen eine Autotour durch die Vereinigten Staaten unternahm. Im Kofferraum seines Buick führten sie ein Tupperware-Gefäß mit, in welchem das Gehirn des Genies schwappte. Aus der Reise mit dem Gehirn hat Paterniti ein kleines literarisches Meisterwerk geschaffen, das die ganze Absurdität des Einstein-Kultes auf die Spitze treibt (Driving Mr Albert, 2000).
Nach einer Theorie soll die Menschwerdung, das heißt die Vergrößerung und Differenzierung des Großhirns, durch das Essen von Gehirnen in der Vorgeschichte entstanden sein. Der Kannibalismus sei demnach in erster Linie ein Gehirnkannibalismus gewesen. Wer das Gehirn des Feindes verzehrt, eignet sich dessen Seele und Substanz an, die die eigene stärken sollen. Ob diese Praxis einen evolutionären Sprung hervorgebracht hat, wie behauptet wurde, mag dahingestellt sein. Das Gehirn blieb auf jeden Fall ein Faszinosum; noch der mittelalterliche Schädelkult zeugt davon. Ein erster wissenschaftlicher Versuch, dem Gehirn nahezutreten, bestand in der Bestimmung seines Gewichts. Ein alter Glaube, der sich bis heute hält, assoziiert Gedankentiefe mit einem schweren Gehirn. Große Geister wiegen demnach mehr. Das Gehirn Cuviers soll 1861 Gramm gewogen haben, Kant lag bei 1600 Gramm, Gauss bei 1492 Gramm. Als mittleres Gehirngewicht für europäische Männer wurden zwischen 1360 Gramm und 1400 Gramm angegeben. Aber es gab genug verblüffende Gegenbeweise. Anatole France hatte einen kleinen Kopf, Erasmus von Rotterdam trug ein Barett, das ausgestopft gewesen sein soll, um den Kopf zu vergrößern. Auch hier wurden unsere Rechner aktiv. Sie kamen bei dem Humanisten auf läppische 1160 Gramm. Ebenso war man von Voltaires Gehirngröße eher enttäuscht. Der statistische Blick konnte es nicht fassen, dass es Qualitäten jenseits von Größe und Gewicht gab.