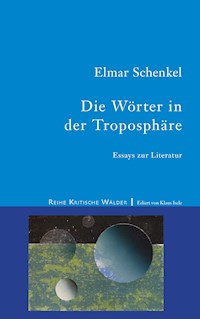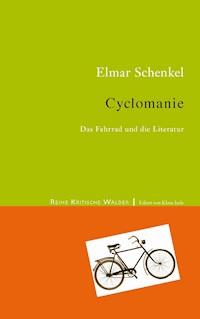22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was haben The Beatles mit Arthur Schopenhauer und Julia Kristeva gemeinsam? Was verbindet Hermann Hesse mit C.G. Jung, Annie Besant oder Victor Segalen? Egal ob auf der Suche nach Inspiration, spiritueller Erleuchtung, wissenschaftlicher Erkenntnis oder aus schlichter Neugier, die Faszination für den "fernen Osten" eint sie alle auf die eine oder andere Weise. Ebenso sind umgekehrt die Besuche Rabindranath Tagores und des Grafen Kuki Shuzos oder die Iwakura-Mission im Westen Bekenntnisse eines gegenseitigen Interesses. Auch in seinem neuen Buch widmet sich der Literaturwissenschaftler Elmar Schenkel den Berührungspunkten und Verbindungen zweier Welten. »Unterwegs nach Xanadu« nimmt er seine Leser*innen mit auf eine spannende und anregende Entdeckungsreise durch die Geschichte des kulturellen Austauschs des Westens mit Ost- und Südostasien. Schenkel erkundet diese Begegnungen in stimmungsvoll erzählten Episoden, als Teil einer wechselseitigen Kulturgeschichte, die bis zurück in das 13. Jahrhundert und weiter reicht. Von Yoga über Haikus bis Zen, Schenkel zeigt auf, dass die Begegnungen von Osten und Westen neben Momenten der Bewunderung und der Befremdung auch durch die Bereitschaft voneinander zu lernen geprägt sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Elmar Schenkel
Unterwegs nach Xanadu
Begegnungen zwischen Ost und West
Über dieses Buch
Xanadu – Asiens Sehnsuchtsort für Forscher, Theosophen und Erlösungssuchende. Er steht für ein geheimnisvolles Etwas, das mit den Göttern und dem Selbst verbindet, für die Begegnung der Weltkulturen. Von den wechselseitigen Blicken auf das Fremde erzählt Elmar Schenkel: vom ersten Aufeinanderprallen westlicher und östlicher Kultur in Japan oder Indien, von der Entdeckung Tibets, chinesischen Denkern oder indischen Gurus im Westen. Welche Rolle spielen Mahatma Gandhi oder Rabindranath Tagore, oder umgekehrt Madame Blavatsky, C. G. Jung oder Hermann Hesse? Wie kam der Taoismus in den Westen, und was haben Zen oder Yoga mit Politik zu tun? In kleinen, funkelnden Prosastücken macht uns Elmar Schenkel bekannt mit der Suche von Kulturen nach dem, was ihre eigenen Defizite aufheben könnte.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Elmar Schenkel, geboren 1953, ist emeritierter Professor für englische Literatur an der Universität Leipzig. Er ist freier Mitarbeiter bei der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« und war Mitherausgeber der Literaturzeitschrift »Nachtcafé«. Neben Reisebücher über Japan und Indien hat er Bücher über das Fahrrad in der Literatur, über Exzentriker der Wissenschaft und Biographien von H.G. Wells und Joseph Conrad sowie Erzählungen und Gedichte veröffentlicht. Für seine literarischen Arbeiten erhielt er u.a. den Förderpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung und den Hermann-Hesse-Förderpreis.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: J. T. Vintage / Bridgeman Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490859-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort: Unterwegs nach Xanadu
Einleitung: Chicago 1893
Das Weltparlament der Religionen tagt
Indien
Einführung: Der deutsche Traum von Indien
Indologie
Theosophie
Das Indien von Hermann Hesse und C.G. Jung
Rabindranath Tagore, Bauhaus, Gandhi
China
Einführung: Die ersten Chinesen (und Mongolen) in Europa
Der Kaiser und die Jesuiten
Chinabilder im 18. und 19. Jahrhundert
Die »Gelbe Gefahr«
Yijing und Dao
Das Yijing im Westen
Von Sinophilen, Sinologen und Kulturvermittlern
Japan
Einführung: Wo liegt Japan?
Gegenseitige Entdeckungen
Lafcadio Hearn und der Japonismus
Amerika entdeckt Japan
Britische Briefe aus Japan: Rudyard Kipling und Isabella Bird
Japan und Europa
Synthesen in der Kunst
Philosophische Teestunde
Bogenschießen, Zen und Politik
Japan als Traumland und Exil
Epilog: Nachrichten über unsichtbare Städte
Abbildungsnachweis
Vorwort: Unterwegs nach Xanadu
Als Marco Polo, wie es heißt, seinem Mitgefangenen Rustichello seinen Reisebericht über China und Asien diktierte, vergaß er, die Große Mauer, Essstäbchen, die Einschnürung der Frauenfüße und die Schrift zu erwähnen. Einige Leser haben daraus geschlossen, dass der venezianische Kaufmann nie in China war. Jahrhunderte später wurde der Portugiese Vasco da Gama, der den Seeweg nach Indien entdeckte, in Kalikut in einen Tempel geführt. Er glaubte, er befände sich in einer katholischen Kirche, denn er entdeckte die Statue einer Frau, die sie »Mari« nannten. Ihr dankte er für seine heil überstandene Fahrt. Dass es sich allerdings um Mari Ama, die Göttin Kali, handelte, sollte er nicht erfahren. Das war vielleicht besser so, denn sie wird unter anderem als die Mutter aller Epidemien angesehen. Als Kolumbus Kuba erreichte, suchte er vergeblich nach den goldenen Tempeln und Palästen, die er bei Marco Polo gefunden hatte, der ein Zipangu oder Japan beschrieb, das er selbst nie gesehen hatte.
Missverständnisse und Auslassungen, vorgefertigte Ansichten, Ausblendungen und Übertreibungen charakterisieren das Verhältnis der Kulturen untereinander, generell, aber insbesondere wohl zwischen Asien und dem Westen. Wie viel wurde hier hineinprojiziert und hineingeträumt, verworfen, kritisiert, bewundert. Ein Traumreich tat sich auf, spätestens seit der Romantik:
In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree
In Xanadu schuf Kubla Khan
Ein Lustschloß, stolz und kuppelschwer (Übers. W. Breitwieser)
So beginnt eines der berühmtesten Gedichte der englischen Romantik, Samuel Taylor Coleridges »Kubla Khan«. Es ist eine Collage verschiedener Bewusstseinszustände zwischen Wildnis, Himalaya, Musik, Paradies und Opiumrausch. Coleridge hatte nach der Einnahme von Laudanum und beeinflusst von Lektüre ein langes Gedicht geträumt. Der Argentinier Borges sollte später berichten, dass Kubla Khan selbst seinen Palast erträumt habe – doch das konnte der Engländer Coleridge 1797 noch nicht wissen. Und natürlich war er nie in Asien. So also entsteht die Phantasie eines Reiches, das sowohl real als auch irreal, sowohl eine politische Größe und historische Wirklichkeit war als auch Halluzination und Orient der westlichen Seele.
Xanadu ist die damals geläufige Umschreibung für Shangdu, die kaiserliche Sommerresidenz und einstweilige Hauptstadt von China, bevor diese ins heutige Beijing verlegt wurde. Wie im Gedicht des englischen Romantikers stoßen wir hier nur noch auf Fragmente: Ruinen, zerbrochene Statuen, Mauerreste. Kubla Khan sah sich zwar als chinesischer Kaiser, lebte aber inmitten seiner Paläste in einer Jurte, als sei es ihm nie gelungen, in seinen Traum einzuziehen. Nehmen wir das als Symbol für die vielen Versuche, die in diesem Buch beschrieben werden, von einer Kultur in die andere überzuwechseln.
Inzwischen steht der Name Xanadu für alles Mögliche: für ein Schloss voller Antiquitäten in Orson Welles’ Citizen Kane, luxuriöses Wohnen in den USA, ein Einkaufszentrum in Madrid, einen Schlager oder eine Disco. Bis zum 20. Jahrhundert aber verband sich mit den klangvollen Silben, die wie ein Vogelruf daherkommen, ein mysteriöser Ort irgendwo in Asien, den man nur unter großen Mühen oder (im Falle Coleridges und seiner Nachfolger Allen Ginsberg, Timothy Leary oder Jack Kerouac) mit Hilfe von Rauschmitteln erreichen konnte. Andere redeten von Shambhala, einem mythischen buddhistischen Königreich in Asien, auch Shangri-la, einem verlorenen Paradies oder dem unterirdischen Agartha. Mit solchen Phantasien wurde eine Asiamanie (Sloterdijk) gefüttert, die sich kolonialistischen Herrschaftsideen ebenso verdankt wie romantischer Sehnsucht. Seit die Religiosität im Abwind war, seit den Erfolgen der Naturwissenschaften und der Rationalisierung aller Lebensverhältnisse befand sich der Westen auf Sinnsuche; Esoteriker, Künstler, Sinnsuchende aller Schattierungen zogen nach Asien oder schrieben zumindest darüber, wie dieses verlorene Paradies wiederzufinden sei.
Im Diskurs des Orientalismus (Edward Said) verkam die Welt jedoch zu einer Dichotomie. Bei der Lektüre von Reiseberichten, anthropologischen und philosophischen Studien über Asien – von Hegel bis zu C.G. Jung oder Jean Gebser – stößt man auf Grundkoordinaten der Stereotypie, die sich bis heute gehalten haben: Der Westen sei materialistisch, der Osten spirituell; der Westen das Bewusstsein und äußerlich, der Osten das Unbewusste und innerlich; der aktive Westen habe Geschichte, der passive Osten sei statisch. Gegensatzpaare wie Yin und Yang, weiblich und männlich werden zur Beschreibung dieser ungleichen Beziehung genutzt. Nicht erst seit der neueren Globalisierung sind diese Kategorien zweifelhaft geworden. Dem »Denken ohne Logik«, das etwa Lily Abegg 1949 in Ostasien denkt anders konstatierte, sollte man Amartya Sens The Argumentative Indian (2005) entgegensetzen – die uralte indische Tradition aufklärenden Denkens und Argumentierens.
Zudem hat »Asien« als Oberbegriff nur eingeschränkten Nutzen; es gilt die Vielzahl von Traditionen und Kulturen zu beachten, die sich untereinander teils völlig fremd sind. Wenn ich trotzdem hier die Interaktion des Westens mit Indien, China und Japan beleuchte, so weil sie aus europäischer Sicht einen Verbund bilden, der allerdings auf unterschiedliche Art und Weise das westliche Bewusstsein erreicht hat. Japan hat durch seine Ästhetik und sein Zen gewirkt, China durch seine Philosophie, Indien durch seine Spiritualität. Die Auseinandersetzung mit diesem Verbund der östlichen Kulturen bleibt ein Thema der Selbstanalyse westlicher Kultur. Wenn ich mich auf diese Aspekte hier beschränke, so ist das meinem Beruf als Literaturwissenschaftler geschuldet. Die großen politischen und ökonomischen Zusammenhänge kann ich nur streifen. Ebenso kann ich die Begegnungen mit der islamischen Welt hier nicht berücksichtigen, weil dies den Rahmen sprengen würde.
Das vorliegende Buch zeichnet einige Wege nach, von Westen nach Osten und umgekehrt. In welcher Form, mit welchen Inhalten und unter welchen Bedingungen fanden Begegnungen zwischen beiden Weltteilen statt? Ich bin mir bewusst, dass es sich um ein essayistisches Unterfangen handelt. »Essay« heißt erst einmal Versuch, sodann bewegt sich das Genre zwischen verschiedenen Annäherungen an historische Realitäten: Dialog ebenso wie Erzählung und Sachbericht.
Dabei sollen auch asiatische Stimmen als Kontrapunkt zu Wort kommen. Was haben aber Japanerinnen oder Inder in Chicago mit Xanadu zu tun? Ich denke, alle Bewegungen zwischen Osten und Westen nähren sich an Idealen, die jeweils auf die andere Kultur projiziert oder von ihr abgelehnt werden. Was für Romantiker ihr Shangri-la ist, ist für Asiaten der westliche Individualismus und der technisch-wissenschaftliche Erfolg, manchmal auch das Christentum, die Menschenrechte und die Demokratie. Manche Asiaten, wie etwa Gandhi, haben ihre eigenen Wurzeln erst durch einen Aufenthalt in Europa kennengelernt; das Gleiche gilt für westliche Yoga-Pilger, Guru-Adepten und Selbstsucher, die durch eine Reise nach Indien auf ihre christlichen oder jüdischen Wurzeln gestoßen wurden. So entdeckte C.G. Jung auf seiner Indienreise die eigenen europäischen Ursprünge. Oft bieten die Fremden einer Kultur patente Formen des Selbstbildes an, wie es etwa Lafcadio Hearn für Japan geschafft hat.
Das vorliegende Buch stellt keine lineare Geschichte der Beziehungen zwischen Asien und dem Westen dar. Dafür gibt es kompetentere Historiker, auf die ich gerne zurückgegriffen habe. Ich wollte lieber Momente dieser Geschichte erzählen, Historie als Geschichten von Begegnungen – weder komplett noch kontinuierlich, eher als aufleuchtende Augenblicke, in denen etwas sichtbar wird, was mit den Mitteln der Historiographie nicht ganz zu fassen ist: das Erlebnis der Begegnung, um es etwas pathetisch zu formulieren. Es ging mir um Überraschung, nicht weil ich diese suchte, sondern weil sie sich immer wieder einstellte bei der Betrachtung von Lebensläufen, die sich miteinander verknoteten. Und es ging mir darum, wie Überraschungen Stereotypen auflösten und in Frage stellten. Eine Französin, die zu einer Halbgöttin in Indien wird? Eine Griechin, die im Sari verkleidet den Faschismus predigt? Ein Franzose, der Formosa erfindet? Ein Japaner, der in London das Radfahren lernen will? Der Ausgräber von Troja an der Großen Mauer? Der niederländische Diplomat, der chinesische Krimis schreibt? Der irisch-griechische Amerikaner, der zu einem Japaner wird und Japans alte Kultur erstehen lässt? Der indische Yogi, der das Weltparlament der Religionen 1893 zum Rocken brachte? Begegnungen zwischen Alexandra David-Néel und Sri Aurobindo, Suzuki und Ginsberg, Madame Blavatsky und den okkulten Meistern des Himalaya, zwischen Tim, Struppi und dem Chinesen Tchang?
Weitere Fragezeichen kamen auf. Die Bibel meines Vaters war Eugen Herrigels Zen in der Kunst des Bogenschießens. Von Heinrich Harrer schenkte er mir ein signiertes Exemplar Sieben Jahre in Tibet. Von Graf Dürckheim stand die Wunderbare Katze in seinem Regal. Wer stand hinter diesen Namen? Und wer war Daisetz T. Suzuki, wer dieser Richard Wilhelm, der so viele chinesische Klassiker übersetzt hatte, wer Okakura, der Autor des Buches vom Tee? Viele Namen in aller Munde, oft bewundernd geraunt, doch niemand wusste etwas über deren Biographien und wie es zu diesen Büchern kam, die doch zeitweise auch Kultobjekte waren. Wie nicht anders zu erwarten, waren die Bücher und die Lebensläufe tief verwoben mit der Geschichte und Politik ihrer Zeit, mit dem Nationalsozialismus vor allem, mit den ideologischen Einstellungen aufseiten der Autoren und mit den gesellschaftlichen Bedingungen, die zum Erfolg dieser Bücher führten, der in vielen Fällen bis heute anhält. Für mich war die historisch-biographisch einbettende Lektüre Teil eines Reifungsprozesses. Es galt sich auseinanderzusetzen mit den Bedingungen und Begründungen der eigenen Ideologie, sich zu distanzieren und zu differenzieren, Ideale aufzugeben und doch durch reflektierte Übernahme wichtige Elemente zu bewahren. Was bleibt weiterhin wertvoll, auch wenn es von politisch fragwürdigen Personen praktiziert oder eingeführt wurde? Muss ich die Politik mit der Lebenstechnik in einem Paket einkaufen? Die Fragen müssen immer wieder gestellt werden zwischen den Generationen.
Kultureller Transfer lebt davon, dass Inhalte aus ihren ursprünglichen Kontexten (die selbst gar nicht so ursprünglich waren) entnommen und mit neuen Bedeutungen aufgeladen werden. Einerseits mag man das bedauern als Verlust des Authentischen, andererseits ist es Teil eines kreativen Prozesses von Aneignungen, für Asien und den Westen in beide Richtungen gültig.
Nehmen wir uns als Vorbild wieder Marco Polo, aber diesmal einen erfundenen, jenen Venezianer nämlich, der in Italo Calvinos Die unsichtbaren Städte (1972) dem neugierigen Kaiser Kubla Khan alles Erdenkliche über die Welten zwischen Asien und Europa erzählt. Auch hier wird deutlich, dass die Geschichte dieser Beziehung keine lineare ist. Sie ist von Brüchen gekennzeichnet, Sprüngen, Rück- und Zufällen, von bornierten Einfältigkeiten bis zu weltfreundlicher Vielfalt – also doch eher ein Mosaik. Ich könnte mir ein ähnliches Buch vorstellen mit den vielen Figuren, die ich hier nicht behandeln konnte, und es würde mindestens genauso dick: Odorich von Portenau wäre darin zu finden, Mutter Teresa, Pol Pot, Mao Tse Tung, Junichiro Tanizaki, Alexandra David-Néel, Mata Hari, Yoko Ono, Somerset Maugham, Ernst Jünger, Ravi Shankar, Steve Jobs oder Ai Weiwei, der Baron von Keyserling und Marguerite Duras. Die hier geschilderten Begegnungen reichen nur bis knapp an das Jahr 2000 – das Bild wird im 21. Jahrhundert wegen der zunehmenden Verflechtung von Ost und West schlicht zu komplex. Da braucht es andere Ansätze als das Prinzip »Begegnung«, denn der Weg geht nicht mehr von A nach B, wenn B schon in A ist und umgekehrt. Diese Ansätze finden sich inzwischen bereits bei Autoren, die Asien und den Westen reflektieren, aber doch von einer umfassenden Gesamtsicht ausgehen, etwa bei Pankaj Mishra, Sam Miller, Sudhir Kakar oder Parag Khanna. Hier wären auch die Erfahrungen von Menschen aufzunehmen, die in der jeweilig anderen Kultur aufgewachsen sind.
Es gibt also noch viel zu schreiben und noch mehr zu vergessen natürlich. Als Coleridge sein nächtlich geträumtes, sehr langes Gedicht von Xanadu morgens aufschreiben wollte, klopfte es an seine Tür; ein Besucher aus dem nächsten Dorf unterbrach ihn (herrliche Ausrede aller, die an Schreibblockaden leiden). So blieb sein Gedicht Fragment. Warum sollte das bei diesem Buch nicht genauso sein? »Wenn ich dir sage«, so Marco Polo in Calvinos Buch, »dass die Stadt, der meine Reise gilt, keine Kontinuität in Raum und Zeit besitzt, einmal lockerer und einmal dichter ist, so darfst du nicht meinen, dass man mit dem Suchen aufhören könnte.«
Bei dieser Suche haben mir mit vielen Gesprächen und Hinweisen so manche Menschen geholfen, Fachleute wie Freunde: indische Dinge betreffend Rangaia Babu (Pondicherry), Poppo und Mona Doctor-Pingel, Martina Ghosh-Schellhorn, Oliver Hahn, Walter Hahn, Martin Kämpchen, Sadananda Das, Claudia Wenner und Harald Wiese (Leipzig).
China: Philip Clart, Dai Xianmei, Gabriele Goldfuß, Jens Krautheim, Minwen Huang und Dirk Vanderbeke.
Japan: Ulrike Döpfner, Bernard Dupas und Finn Harder.
Begleitet haben das Projekt durch Diskussionen und Hinweise Bernadette Bigalke, Stephen Brodsky, Richard Ellguth, Alexander Rauch, Reiner Tetzner und Norbert Weitz.
Ich danke auch den Mitgliedern des Leipziger Eranos-Kreises sowie den Studierenden in meinen Seminaren über East/West, den Teilnehmern an unserer Konferenz »The Guru Challenge« in Leipzig 2016 und den Freunden aus dem Arbeitskreis Vergleichende Mythologie für zahlreiche Anregungen und Gespräche. Da das Buch weit in meine Vergangenheit zurückreicht, möchte ich auch derer gedenken, die mich zu ihren Lebzeiten auf diese Bahn gebracht haben: zuallererst meines Vaters Heinrich Schenkel, weiterhin Dr. Julius Karoff (Oestinghausen), Ursula Bartning, Herbert Geuter, Gladys und Alec Morison (Sunfield/Hagley) sowie Michael Hamburger und Anne Beresford (Saxmundham/Suffolk), schließlich auch des Leipziger Religionsgeschichtlers Heinz Mürmel, der mir immer mit reichhaltigem Material zur Seite stand. Katja Brunsch hat wie schon oft zuvor als erste Leserin und Redakteurin, Theresa von Saldern als Lektorin beste Arbeit geleistet. Daher gilt ihnen mein besonderer Dank. Und natürlich meiner Frau Ulrike Loos, die sich so manche Merkwürdigkeit anhören musste und mich immer wieder ermunterte, noch mehr davon aufzuschreiben.
Ich habe bei der Schreibung indischer, japanischer und chinesischer Namen auf diakritische Zeichen (Längungen usw.) verzichtet, um die Lektüre für ein Laienpublikum zu erleichtern. Für die Romanisierung chinesischer Namen benutze ich die Pinyin-Schreibweise als Standard. Bei Buchtiteln und Zitaten musste ich teilweise die alte Schreibweise beibehalten:
Dschuang Tse für Zhuangzi
Lao Tse für Laozi
»Konfuzius« als latinisierte Form von Kong Fuzi wurde beibehalten, da diese Form schon bei uns Teil des Lexikons geworden ist.
Einleitung: Chicago 1893
Das Weltparlament der Religionen tagt
Auf seinem Weg nach Asien stieß Kolumbus auf einen anderen Kontinent, ohne es zu merken. 400 Jahre später wollte man diesen Zufall auf einer Weltausstellung feiern, der Columbia Exhibition in Chicago. Natürlich sollte damit auch dem rasanten und unvorhersehbaren Aufstieg einer Kultur und politischen Macht gehuldigt werden. Die Beiträge schwarzer Amerikaner und indianischer Ureinwohner ließ man unter den Tisch fallen. Im Mittelpunkt der Ausstellung lag ein Teich, eben der »Große Teich«, über den der Entdecker gekommen war, ein künstlicher See vor neoklassizistischer Architektur. Es war, als sollte eine neue Antike eingeweiht werden, doch diesmal mit der Ausstrahlung der Moderne, der alles möglich war. Auf gut 2,4 Quadratkilometern waren um die 200 Gebäude zu bewundern. In der Mitte prangte White City, eine alabasterweiße, marmorartige Stadt, die möglicherweise den ehemaligen Geflügelzüchter Frank L. Baum zu seiner Phantasie Der Zauberer von Oz (1900) inspirierte. Die Eröffnung war noch 1892 zelebriert worden, um dem Dezimalsystem Genüge zu tun. Erst im folgenden Jahr wurde die Weltausstellung für das Publikum geöffnet, das sich nun sechs Monate lang an den Errungenschaften von Technik, Design, Kultur und Wissenschaft berauschen konnte. 27 Millionen Besucher wurden gezählt. Unter ihnen war Helen Keller, die berühmte Autorin der Autobiographie Die Geschichte meines Lebens (1903). Helen erhielt vom Präsidenten der Weltausstellung die persönliche Erlaubnis, alle Gegenstände zu berühren. Auch der künftige Begründer der modernen Olympischen Spiele, Pierre de Coubertin und der persische Reiseautor Mirza Mohammad Ali Mo’in ol-Saltaneh waren unter den Besuchern, ebenso wie der Serienmörder Herman Mudgett, der mit zweien seiner künftigen Opfer zur Messe anreiste.
Chicago wollte sich mit der Pariser Weltausstellung von 1889 messen. Eiffels Turm wuchs zum Erkennungssymbol einer Weltstadt heran. Wie könnte man den grazil-baumförmigen Stahlturm übertrumpfen? Ein junger Eisenbahningenieur namens Ferris entwickelte für die Ausstellung in Chicago ihr zentrales Symbol: das Ferris-Wheel. Wir nennen es hierzulande »Riesenrad«.
Das Rad könnte sehr wohl als Logo für die gesamte Ausstellung dienen, denn es ging hier nicht allein um die Schau des technischen Fortschritts, sondern auch um etwas, das verschiedene Bestrebungen politischer und sozialer Art in der ganzen Welt zu einem Kreis zu versammeln suchte. Das zeigte sich an den vielen Kongressen, die an die Ausstellung angegliedert wurden, zu den Themen Frauen, Mathematik, Anthropologie und Religion. Für die Begegnung zwischen Ost und West wurde dieser letztere Kongress, das Weltparlament der Religionen, zum entscheidenden Forum. Alle wichtigen Glaubensformen der Welt sollten sich wie in einem Kreis versammeln, jede sollte Gelegenheit haben, sich und ihr Verhältnis zu den anderen Religionen darzustellen. Die Idee eines Dialogs zwischen den Religionen war geboren.
Geleitet und durchgeführt wurde die große und bislang einmalige Veranstaltung von einem amerikanischen Swedenborgianer namens Charles Carroll Bonney (1831–1903), der der New Jerusalem Church angehörte, ebenso wie übrigens auch Helen Keller. Hinter ihm standen amerikanische Protestanten, die einen zunächst ökumenischen Dialog suchten. Zwischen all den Christen traf man jedoch auch eine Reihe von Asiaten. Einige stieß die Idee eines demokratischen Parlamentes für Religionen ab. Religion war für die Gegner des Treffens keine Sache von Diskussionen oder Mehrheitsbeschlüssen. Der Islam wurde nur durch einen amerikanischen Konvertiten vertreten; weil der türkische Sultan sich gegen das Parlament ausgesprochen hatte, gab es keine muslimische Delegation. Auch der Erzbischof von Canterbury war nicht mit von der Partie. Die Japaner wollten ihren Zen-Abt nicht gehen lassen, er sollte sich nicht mit dem unzivilisierten Boden Amerikas beschmutzen. Er ging trotzdem und ein junger Buddhist namens Daisetz T. Suzuki hatte für ihn einen Brief auf Englisch geschrieben, in dem er die Teilnahme zusagte. Dieser Suzuki sollte später einer der größten Vermittler der japanischen Zen-Kultur im Westen werden (Eck 25).
Zur Eröffnung des Parlaments schlug die Liberty Bell zehnmal, einen Schlag für jede vertretene Religion. Die Stimmung war großartig, ein großes Band der Liebe schien die Welt zu umspannen. So lautete auch die Botschaft vieler Ansprachen. Bonney begrüßte die »Worshippers of God and Lovers of Man«. Aber die zweiminütige Ovation von den gut 7000 Hörern war einem Inder vergönnt. Der junge, schöne und durchgeistigte Swami Vivekananda wurde zum Mittelpunkt der gesamten Veranstaltung. Er war es, der zum ersten Mal die Lehren des Hinduismus, insbesondere die Lehre des Wissens und der Befreiung durch Vedanta im Westen vorstellte. Donnernder Beifall galt schon seiner Anrede: »Sisters and Brothers of America!« Damit schien für die Mehrheit der Hörer alles gesagt: Alle Religionen, die des Ostens wie des Westens, stehen geschwisterlich zusammen, sie verfolgen dasselbe Ziel auf verschiedenen Wegen. So lautete auch die Botschaft Vivekanandas. Er hatte diese Erkenntnis für sich gewonnen, nachdem er durch seinen Guru, Sri Ramakrishna, darauf vorbereitet worden war. Für diesen waren Religionen nämlich nur Leitern, um auf denselben Turm zu gelangen. Vivekananda, der Charismatiker, sprach zudem eine Sprache, die ins Halbbewusste zielte, in die Träume der Menschen auf ihrer Suche nach einer spirituellen Heimat.
Vivekananda auf dem Weltparlament der Religionen in Chicago 1893 (vorne, von rechts nach links: Nikola Tesla, Vivekananda, Anagarika Dharmapala)
Er redete von dem einen heiligen Licht, das durch das Prisma der Religionen geht und verschiedene Farben annimmt. Krishna ist überall, der Eine, die Perlenkette, auf die die Glaubensformen dieser Welt gereiht sind: »und wenn immer du das außergewöhnliche Heilige siehst […], dann weißt du: ich bin da.« (Eck 26) Die Mutter aller Religionen aber sei der Hinduismus, sie nehme alle ihre Kinder mit Toleranz und Liebe in sich auf. So ging seine Rede am 11. September 1893, und sie überwältigte das Auditorium. Es sollten noch weitere Reden von ihm folgen, über den Hinduismus, den Buddhismus und die vordringlichen Probleme Indiens. Der Hinduismus sei die einzige vorgeschichtliche Religion, die heute noch praktiziert würde, sagte er. Warum gab es immer die Zwistigkeiten zwischen den Glaubensformen auf dieser Welt? Jede Religion sei überzeugt, die beste zu sein. Den christlichen Missionaren warf er vor, zwar die Seelen der Inder retten zu wollen, sich aber nicht um deren irdisches Wohl zu kümmern. Religion habe man genug im Osten, man brauche vielmehr Brot und Reis.
Einmal unterbrach er seinen Vortrag und forderte diejenigen auf, ihre Hand zu heben, die den Hinduismus aus erster Hand kannten. Aus den vielen Hundert Händen erhoben sich drei. Da wurde er zornig und sagte, wie könnt ihr euch erlauben, bei solcher Ignoranz Urteile über uns zu fällen! Das Christentum ist so wohlhabend geworden, weil es so viele Köpfe abgeschnitten hat, rief er. Doch die Hindus wollen solchen Wohlstand nicht, nicht um diesen Preis. Die Presse war tief beeindruckt. Unter den Hörern und Rednern war auch eine britische Theosophin namens Annie Besant. Sie sah in Vivekananda einen Evangelisten des Ostens, ein leuchtendes Licht für den materialistischen Westen: Ex oriente lux! Was?, sagte ein Hörer, zu diesen Menschen schicken wir Missionare? Die sollten lieber ihre Missionare zu uns schicken!
Ein fulminanter erster Auftritt des Hinduismus im Westen also! Schon als Kind war Vivekananda aufgefallen. Er hatte ein enormes Gedächtnis und konnte ein Buch auswendig, wenn er es nur einmal gelesen hatte, eine Fähigkeit, die man auch Sri Aurobindo zuschrieb. Mathematik war nicht sein Gebiet, dafür Stockfechten (lathi), Reiten, Kochen und Zaubern. Er hielt nichts vom Aberglauben und verabscheute das Kastensystem. Das Singen wurde seine Form des Betens und es brachte ihn zu Sri Ramakrishna, der bis heute weithin als Heiliger verehrt wird.
»Hast Du je den Namen Rama Krishna gehört?« fragt der Briefeschreiber in Hugo von Hofmannsthals Die Briefe des Zurückgekehrten (1901). »Als ich nach Asien kam, war sein Name noch überall lebendig.« (Hofmannsthal 498f.)
Meist werden Vivekananda und Ramakrishna in einem Atemzug genannt. Ramakrishna erkannte bald die besonderen Fähigkeiten seines Schülers und sah ihn als Erlöser von Seelen, als Heilsbringer. Der Schüler war ihm allerdings nicht bedingungslos ergeben, sondern prüfte die Lehre des Meisters mit Vernunft und Herz. Eines Tages erkannte er, dass der Meister Teil der göttlichen Mutter war. Das Mütterliche blieb die wichtigste Komponente in der Lehre Vivekanandas, der auch mit westlicher Philosophie sehr vertraut war. Er konnte Kant und Hegel im Vergleich mit indischen Mystikern diskutieren, auch die moderne Wissenschaft war ihm nicht fremd.
Als Ramakrishna starb, setzte Vivekananda sein Werk fort, reiste jahrelang über den gesamten Subkontinent und wurde allmählich als großer Philosoph und Guru anerkannt, wiewohl der 1863 Geborene noch keine 30 Jahre alt war. Oft kamen Hunderte, ja Tausende zu seinen Vorträgen. Mit großer Ehrfurcht empfing und verabschiedete man den Meister an Bahnhöfen. Da er mit allen west-östlichen Wassern gewaschen und sein Englisch perfekt war, machte er sich Gedanken, wie man den Hinduismus nach Westen tragen könnte. Als er von der geplanten Weltkonferenz der Religionen in Chicago hörte, reifte der Wunsch in ihm, dorthin zu gehen. Aber das war eine Frage des Geldes, wenn auch nicht so sehr für ihn selbst. Ihm war es wichtiger, dass die Reise göttlich abgesegnet, von der heiligen Mutter gewollt war. So lehnte er zunächst große Sponsoren ab und ließ lieber seine Schüler kleine Beiträge von seinen vielen Anhängern einsammeln. Die Graswurzelbewegung war ihm ein sichereres Zeichen, dass die Mutter seine Reise billigte. Aber auch als sehr viel Geld hereinkam, reichte ihm dies nicht als Zeichen. In Haiderabad sprach er über seine Botschaft für den Westen vor den Adligen und Reichen, dem Premierminister und Politikern, auch viele Europäer waren anwesend. Wieder wurde eine große Summe aufgebracht. Immer noch aber wartete er auf ein göttliches Zeichen. Da endlich meldete sich die heilige Mutter selbst und zwar in Gestalt von Sarada Devi (1853–1920), der Witwe von Ramakrishna. Sie hatte nach dem Tod die Ramakrishna Mission geleitet, und wurde schon zu Lebzeiten ihres Gatten hoch verehrt als Holy Mother. Sie war ihm mit fünf Jahren angetraut worden und 34 Jahre lang, bis zu ihrem Tod, verwaltete sie das Werk der Mission. Als Vivekananda ihr von seinen westlichen Plänen schrieb, gab ihm ihren Segen.
Nun konnte das Abenteuer also beginnen. Während seiner Reisen durch Indien hatte er eine Vision verfolgt: die Einheit des Hinduismus und letztlich aller Religionen. Jainismus und Buddhismus, die verschiedenen Formen des Yoga, die Sikh-Religion, der Islam, schließlich Christentum und Judentum, alles war ihm vertraut, er fand mit allen ernsthaften Vertretern dieser Glaubensrichtungen eine gemeinsame Ebene. Zugleich war er sich des sozialen Elends in Indien bewusst, er beklagte das Kastensystem und die Ausbeutung, insbesondere durch die Kolonialherren; er sah sich durchaus als Sozialisten. Mit der Flagge des Friedens und der Liebe kam Vivekananda nach Chicago, schreibt sein Biograph Gautam Ghosh, und als Vertreter seiner Nation und seiner Religion.
Der Abschied von seinen Anhängern im Hafen von Bombay (Mumbai) war überwältigend. Über Penang, Singapur, Hongkong und Kanton ging es nach Nagasaki, Japan, das ihn mit seiner Reinlichkeit und pittoresken Schönheit beeindruckte. Von Yokohama fuhr er nach Vancouver und kam um einige Monate zu früh in Chicago an. Allerdings hatte er keine Empfehlungsschreiben für die Teilnahme an der Konferenz. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als weiterzufahren, diesmal nach Boston. Im Zug dorthin lernte er eine Amerikanerin kennen, Katherine Abbott Sanborn, eine Literaturwissenschaftlerin mit breiten Interessen. Unter anderem hatte sie am berühmten Smith College in New England gelehrt. Die beiden kam ins Gespräch und bald lud sie diesen interessanten Inder zu sich nach Boston ein. Der Swami hatte es goldrichtig getroffen, denn sie war von einem Kreis gebildeter und weltoffener Freunde umgeben, die sich bald um den gestrandeten Inder kümmerten. Ein Professor für Altphilologie an der Harvard Universität lud ihn zu einem Urlaub am Atlantik ein. In einem stillen Ort an der Küste von Massachusetts führten sie lange Gespräche. Dr. John Henry Wright war von Vivekanandas Wissen tief beeindruckt. So schlug er vor, dass er auf dem Weltparlament von Chicago sein Land vertreten solle. Der Swami gab zu bedenken, dass er keinerlei Qualifikationen vorzeigen könne. Von Ihnen Qualifikationen zu verlangen, ist, als ob man die Sonne fragen müsste, ob sie ein Recht zu scheinen vorlegen könne, sagte der Professor. Er verfasste ein Empfehlungsschreiben an das Auswahlkomitee, in dem er kurz und bündig erklärte, es handele sich bei Vivekananda um einen Mann, der eine größere Bildung habe als alle gelehrten Professoren zusammen.
Es ist natürlich kein Zufall, dass gerade New England zum Sprungbrett für den Hindu wurde. Schon lange pflegte man hier, spätestens seit den Transzendentalisten um Ralph Waldo Emerson, eine Liebe zu allem Indischen und zu anderen asiatischen Traditionen. Hier hatte man einige der heiligen Schriften gelesen, die nur bruchstückhaft und in fragwürdigen Übersetzungen zu bekommen waren. Henry David Thoreau, der Autor des berühmten Kultbuches über sein Leben im Wald, Walden, (1854) war vertraut mit der Bhagavadgita und fand Inspiration in den Veden. Einmal schrieb er, er sei selbst manchmal ein Yogi, so entsagend und zurückgezogen lebe er. Ein Jahrhundert später fand Mahatma Gandhi seinen Weg zu Thoreaus Schriften und sie beflügelten seine eigene Philosophie des Verzichts, der Gewaltlosigkeit und des zivilen Ungehorsams. Nimmt man Walt Whitman noch hinzu, dessen mystisch-sinnliche und Menschheit wie Natur umspannende Hymnen nicht nur ein freies und demokratisches Amerika besangen, sondern auch die Einheit von Geist und Materie, dann sehen wir: Der Boden war bereitet für asiatisches Denken und Literatur. Die Transzendentalisten der Neuen Welt speisten sich noch aus europäisch-romantischen Quellen, aus Swedenborg, Goethe, Blake und Novalis, aber sie erblickten schon den Osten jenseits der eigenen Westküste. Wie war etwa Whitman beeindruckt von der ersten japanischen Delegation in den Vereinigten Staaten! Whitman, der wiederum von Tagore, Sri Aurobindo und Vivekananda gepriesen wurde, starb ein Jahr vor der Eröffnung der Columbia Exhibition in Chicago.
Das Geld war schnell beisammen, der Inder wurde vom Komitee angenommen und reiste wieder nach Chicago. Auf dem Weltparlament hatte er mehrere Auftritte. Man legte seine Reden bald ans Ende des Tages, um sicherzustellen, dass die Hörer bis zum Schluss blieben, weil sie den großen Swami hören wollten. In seinen Briefen an indische Freunde und Anhänger schilderte er die Stimmung vor dem ersten Auftritt, der für ihn und die ostwestliche Begegnung so entscheidend war.
Am Morgen der Eröffnung des Parlaments, schreibt er, saßen wir Delegierte im Art Palace, Menschen aus allen Nationen – aus Indien der Brahmo Samaj, d.h. der Bund der liberalen Hindus, und die Jainas unter der Führung eines V. Gandhi. Die Theosophie war vertreten durch Annie Besant, eine inzwischen weit bekannte und wortgewaltige Britin, die von Indien aus die Geschicke der geistigen Gemeinschaft steuerte. Es gab eine große Prozession und man ließ sich auf der Bühne nieder. Musikalische Umrahmung, Eröffnungsreden, Grußworte, schließlich die Vorstellung der Vertreter. Und ich, schreibt er weiter, der nie eine öffentliche Rede gehalten hat! Nervös war ich, die Zunge trocken, das Herz im Hals. Die anderen lasen ihre schönen Reden ab, doch ich, Narr, hatte nichts mitgebracht! (Vivekananda 1998, 53–59). Dann der Moment seiner Ansprache, »Sisters and Brothers of America!« Es erscholl wie ein lautes Mantra, und es kam an: Das Publikum lag ihm zu Füßen, der Applaus dauerte zwei Minuten allein nach dieser Anrede. Warum denn nur? War es die Sehnsucht, zu einer einzigen großen Familie zu gehören? Verwandt zu sein mit diesem charismatischen Redner aus dem Orient? Überwindung jahrhundertealter Vorurteile und Reserviertheiten? Jedenfalls kam die folgende Rede, aus dem Herzen, der HERR hatte sie ihm eingegeben, Krishna selbst. Und Krishna verschmolz mit Christus, alle Propheten wiesen auf ein Ziel hin, einen gemeinsamen Gott, eine gemeinsame göttliche Welt.
Vivekananda griff die Begeisterung auf und bedankte sich im Namen des »ältesten Mönchordens der Welt«, im Namen »der Mutter aller Religionen«, was sicherlich auf große Fragezeichen stieß, denn war nicht das Judentum diese Mutter? Es gab also noch andere Religionen, die älter zu sein vorgaben oder es waren? In seinen Reden in Chicago stellte sich der Inder sehr gekonnt auf sein westliches Publikum ein, er kannte die Werte, an die es hier anzuknüpfen galt, und welche Kritik er an der westlichen Einstellung zum Hinduismus und anderen Religionen üben durfte. Ich bin stolz, sagte er, einer Religion anzugehören, die die Welt sowohl Toleranz als auch universale Wertschätzung gelehrt hat. Wir glauben nicht nur an universale Toleranz, sondern wir erkennen alle Religionen als wahr an. Ich bin stolz, einer Nation anzugehören, die die Verfolgten und Flüchtlinge aller Religionen und aller Nationen der Erde aufgenommen hat: die frühen, verfolgten Juden ebenso wie die Anhänger des Zoroaster aus Persien, die Parsen und viele andere (Vivekananda 2009, 11–12). Möge die Glocke, die heute Morgen die Tagung eröffnet hat, den Fanatismus zu Grabe läuten!
Es sollen um die tausend Ansprachen auf diesem Parlament gehalten worden sein. Doch waren die Reden des Vivekananda, der zur Eröffnung in einer roten Mönchsrobe mit Turban erschien, wohl die eindrücklichsten. Fünfmal sprach er, auch zuletzt im Schlussplenum. In der Stadt wurden derweil große Porträts von ihm aufgestellt, er war der absolute Star. Sein Antlitz zierte sogar die Packungen von Ceylontee (Kämpchen, 194). Davon abgesehen: Er sagte Wichtiges, was alle Zuhörer und was das Zusammenleben der Religionen betraf. Dafür benutzte er das Gleichnis vom Frosch im Brunnen. Der Brunnenfrosch kann den Meerfrosch nicht verstehen. Wie soll er in seinem dunklen Loch wissen, was das große weite Meer ist? Also bezeichnet er den anderen Frosch, der ihm von einem phantastischen Ozean und großen Wasserwelten erzählt, als Lügner. Ebenso gehe es in den Religionen zu. Er sei ein Hindu, sagt Vivekananda. Er sitze in seinem eigenen kleinen Brunnen, die Christen sitzen in ihrem Brunnen, ebenso die Muslime, und jeder denke, es gebe nur jeweils den eigenen Brunnen. Er danke nun den Amerikanern, dass sie mit dem Weltparlament diese Grenzen aufgerissen haben. (Vivekananda 2009, 13)
Der Wandermönch wusste auch, dass er in westlichen Ländern anders sprechen musste als in Indien. Im Westen war es wichtig, die Bedeutung der Frauen hervorzuheben. Ich bin froh, sagte er in einer anderen Rede, dass zu den bedeutendsten Rishis, also den Sehern der Vorzeit, auch Frauen gehörten. Gerne verwies er auf die Parallelen zwischen Glaubensinhalten von östlichen Religionen und den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft – eine Methode, die sich in Zeiten des New Age rasant ausbreiten sollte. Man denke an Fritjof Capras Bestseller The Tao of Physics (1975) oder Gary Zukavs The Dancing Wu Li Masters (1979). So erklärte er, die hinduistische Idee von Schöpfungszyklen stimme mit Erkenntnissen der Naturwissenschaften überein. Vivekananda war der richtige Mann am richtigen Ort: Er kannte die Unterschiede westlicher und östlicher Mentalitäten und konnte sich flexibel darauf einstellen.
Zahlreiche Einladungen führten dazu, dass Vivekananda die nächsten Jahre bis 1896 in den USA und Kanada auf Vortragsreisen verbrachte. Insgesamt blieb er dreieinhalb Jahre im Westen. Oft muss er dem Zusammenbruch nahe gewesen sein; manchmal hielt er 14 Vorträge in einer Woche. Er gründete Vedanta-Zentren und sammelte Geld für Projekte in Indien. Dazu kamen Kurse über Yoga, die begierig von einer spirituell ausgedörrten Welt aufgesogen wurden. Er war der strahlende Stern des Ostens, Frauen machten ihm Heiratsanträge, und John D. Rockefeller wandte sich der Philanthropie zu, nachdem er den Swami getroffen hatte. Derweil griff die endlose Anstrengung Vivekanandas Gesundheit an. Fast jede Nacht war er in Zügen unterwegs, lernte pausenlos neue Menschen kennen und litt extrem an der klimatischen Kälte des Landes. Dazu die Paparazzi, aber auch Verleumder auf seinen Spuren. Seine Gegner waren fundamentalistische Christen, Missionare, die um ihre Einkünfte bangten, da der Inder ihnen die Sympathien der Spender abgrub; aber auch die Theosophen und die liberalen Hindus sahen seinen Erfolg mit Skepsis, ganz zu schweigen von den konservativen Hindus.
Die Amerikaner kamen ihm insgesamt sehr wohlgesonnen vor, er rühmte die Freiheit der Frauen in diesem Land. Oft wurde er auf der Straße wegen seines Mönchsgewands zum Magneten für Neugierige. So begann er, sich auch in der Kleidung anzupassen. 1896 ging es nach Europa, vor allem Großbritannien. Von dort reiste er in die Schweiz, begleitet von einer Miss Henrietta Müller aus London. In Kiel traf er den Indologen Paul Deussen, den Mitschüler und Freund Nietzsches. Mit Deussen fuhr er wieder nach England (Vivekananda 1998, 313). Den berühmten Gelehrten Max Müller besuchte er mindestens zweimal in Oxford und freundete sich mit ihm an. Müller wiederum, der alte Dessauer, schrieb zuerst einen Artikel über Ramakrishna, später auch ein Buch. Wir können davon ausgehen, dass Müller sich über die Berichte über das Weltparlament aus erster Hand sehr freute. Schon 1894 in einem Vortrag in Oxford hatte er die große Bedeutung dieses Treffens der Religionen hervorgehoben, »eines der bedeutendsten Ereignisse der Weltgeschichte«. In ihm sah er seine Ideen verwirklicht, die Suche nach einem gemeinsamen Kern der Weltreligionen, die sich auch in seinen 50 Bänden heiliger Schriften widerspiegelte. Und Indien sah sich durch das Ereignis erstmals auf Augenhöhe mit dem Westen (Kämpchen, 195). Das Weltparlament in Chicago kann man daher als einen Knotenpunkt bezeichnen, aus dem viele weitere Begegnungen zwischen Ost und West folgen sollten.
Eck, Diana L. Encountering God. A Spiritual Journey from Bozeman to Banaras. Boston 1993.
Ghosh, Gautam. The Prophet of Modern India. A Biography of Swami Vivekananda. Delhi: Rupa Publications 2003.
Hofmannsthal, Hugo von. »Die Briefe des Zurückgekehrten«. In Hofmannsthal, Erzählungen und Aufsätze. Ausgewählte Werke in zwei Bänden. Bd. 2. Frankfurt/M.: S. Fischer 1957, 479–501.
Kämpchen, Martin. »Swami Vivekananda und seine Zeit«. In Vivekananda, Swami. Wege des Yoga. 177–215.
Müller, Max. »The Parliament of Religions in Chicago 1893«. In: Seager, 343–352.
Seager, Richard Hughes. The World’s Parliament of Religions. The East/West Encounter, Chicago 1893. Bloomington: Indiana UP 2009.
Stone, Jon R. The Essential Max Müller. On Language, Mythology, and Religion. London: Palgrave Macmillan 2002.
Vivekananda, Swami. Letters of Swami Vivekananda. Delhi: Advaita Ashram 1998.
Vivekananda, Swami. Wege des Yoga. Reden und Schriften. Aus dem Engl. übersetzt und herausgegeben von Martin Kämpchen. Frankfurt/M./Leipzig: Insel. Verlag der Weltreligionen 2009.
Indien
Einführung: Der deutsche Traum von Indien
Seit der Antike wusste man in Europa von Ost- und Südostasien. China war bekannt für seine Seide, in Indien gab es Gewürze und Gold. Ein weiser Skythe, ein Hyperboreer aus dem Nordosten, der auf einem Pfeil fliegen und heilen konnte, soll im 6. Jahrhundert v. Chr. Pythagoras in Sizilien besucht haben. Dieser Abaris, nach dem sich Goethe bei den Illuminaten nannte, war vielleicht ein asiatischer Schamane und brachte sein östliches Wissen zu den Griechen. Alexander der Große versuchte den großen Sprung ins Morgenland durch die Eroberung Asiens und schließlich Indiens. Mit seinem frühen Tod zerfiel jedoch das Reich, und der Traum einer westöstlichen Synthese rückte in die weite Ferne zurück. Der Grieche Megasthenes (350–290 v. Chr.) ging auf Wanderschaft nach Osten und erreichte Indien über das Punjab im Norden und zog dann möglicherweise bis Madurai in Tamil Nadu. Sein Buch Indika ist verloren gegangen und nur aus Zitaten späterer Autoren rekonstruierbar. Immerhin: Er wusste von den Kasten, sah, dass Philosophen von den Göttern geliebt wurden und dass sie sich mit den Dingen des Hades auskannten. Auch fiel ihm auf, dass die Inder keine Kolonien außerhalb ihres Landes gründeten. Dieses Indien zog magisch Geschichten an: Herodot sprach von mörderischen Riesenameisen, die nach Gold graben, von Menschen mit solch großen Ohrlappen, dass sie sich nachts in sie einhüllen konnten. Außerdem war es dort unverzeihlich, seine Eltern nach deren Ableben nicht zu verspeisen. Ein Land, in dem das Gold aus Fontänen sprudelte, ein Land der exotischsten und teuersten Gewürze, kurz: der Traum eines jeden Vasco da Gama oder Kolumbus in Europa. (Miller 4)
Der Kolonialismus der Briten (auch der Franzosen und Portugiesen) machte mit diesen Mythen Schluss. Fortan ging es um Ausbeutung von Ressourcen und Menschen und um die Missionierung für das Christentum. Auf diesem zwielichtigen Boden erwuchs immerhin auch die Philologie. Englische Kolonialbeamte wie William Jones (1746–1794) studierten Sanskrit und erkannten darin eine Ursprache, die verwandt schien mit den europäischen Sprachen. Griechisch und Latein, auch das Keltische und Slawische, die germanischen und romanischen Sprachen waren nun sichtbar als Teil einer riesigen Sprachfamilie, die Europa und Asien verband. Ohnehin war es eine Zeit, in der man auf der Suche nach Ursprüngen und Zusammenhängen war; die Romantik kündigte sich an. 1775 wurde eine der wichtigsten Schriften der indischen Philosophie ins Englische übersetzt: die Bhagavadgita. Der Held Arjuna soll gegen die eigenen Verwandten in die Schlacht ziehen und zögert. Krishna gesellt sich ihm zu und erklärt ihm die Gesetze des Universums, woraufhin Arjuna sich nicht mehr weigert zu kämpfen – ein Buch, das sehr unterschiedlich ausgelegt wurde.
Die Romantik öffnete dem Westen das Tor nach Indien. Griechenland und die Bibel waren kulturell von den vorhergehenden Generationen abgegrast, die Wege führten nun weiter, in die Tiefe der Vergangenheit Indiens und Europas. Man assoziierte das Land mit Blumen, Träumen und Opium, man sah hier die Ursprünge von modernen Institutionen und Ideen. Dies trifft zumindest auf Deutschland zu, wo ja selbst Könige sich in exotische Welten flüchteten – wie etwa Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, der sich ein sagenhaftes Luft-Borneo in einer Buchphantasie erträumte, oder Ludwig II. von Bayern, der gar Luftschlösser baute. Man träumte vom östlichen Anderswo, wo alles unschuldiger, ursprünglicher, verspielter, frömmer sein müsste.
Von Großbritannien aus gesehen erwies sich Indien eher als zu eroberndes und auszubeutendes Gelände. Es war eine Kolonie, mit allen Begleiterscheinungen, wie etwa der Arroganz der Herrschenden. So wischte der große Historiker und Politiker Thomas Babington Macaulay die indische Kultur mit einer Handbewegung weg: Er habe nie daran gezweifelt, dass ein einziges Regal einer guten europäischen Bibliothek die ganze eingeborene Literatur Indiens oder Arabiens aufwöge. Mit solchen Ansichten befand er sich in bester oder eher schlechtester Gesellschaft. Auch der große Hegel sah in Indien nur ein verbrauchtes Morgenland, denn der Weltgeist war seiner Vorstellung nach weiter nach Westen gezogen und hatte soeben den Hegel’schen Lehrstuhl in Jena erreicht. In seiner Vorlesung zur »Philosophie der Weltgeschichte« (1822/23) sieht er Asien nur als Vorspiel an, »Europa ist schlechthin das Ende der Weltgeschichte«. (zit. in Glasenapp 40) In Europa spielte die Musik, Indien war ein verträumtes Gestern, auch wenn es sich aller Ursprünge rühmen durfte, wie Herder vermutete; für ihn war Indien die Urheimat und Wiege der Menschheit (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784ff.).
Das Indienfieber grassierte im idealistischen Deutschland. Friedrich Schlegel lernte 1803 Sanskrit von einem englischen Offizier in Paris. Und schon 1808 bot er der gebildeten Öffentlichkeit ein Standardwerk der Zeit an: Über die Sprache und Weisheit der Indier. Sein Bruder August Wilhelm begann sechs Jahre darauf mit seinem Sanskrit-Studium in Paris und erhielt 1818 in Bonn den ersten Lehrstuhl für Indologie in Deutschland. Er brachte die Zeitschrift Indische Bibliothek heraus und übersetzte aus dem Ramayana und die Bhagavadgita. Zuvor hatte der Weltumsegler und Naturforscher Georg Forster schon aus dem Englischen das berühmteste indische Drama der Antike übersetzt, Sakuntala von Kalidasa (4.–5. Jhdt. n. Chr.). Es machte auf Goethe einen großen Eindruck und möglicherweise hat er den Prolog im Himmel in Faust aus diesem klassischen indischen Stück entlehnt. Ursprünglich in Prakrit und Sanskrit geschrieben, ist es wie die Bhagavadgita aus dem Mahabharataentlehnt. Eine Geschichte um zwei Liebende, einen König und die Tochter einer Nymphe und eines Eremiten. Das Drama erinnert ein wenig an Romeo und Julia, doch endet es glücklich. Nach Chaos und Missverständnissen wird die verlorene Liebe wiedergewonnen – in einer hochpoetischen Sprache. Ebendies schätzte wohl Goethe – die Poesie und Gedanklichkeit. Vom Hinduismus aber war er weniger angetan, er fand die vielköpfigen Götter und Monster abstrus: »In Indien möcht ich selber leben, hätt es nur keine Steinhauer gegeben«, schreibt er im West-Östlichen Diwan (1819). Und:
Nehme sie niemand zum Exempel,
Die Elefanten- und Fratzen-Tempel
Mit heiligen Grillen treiben sie Spott,
Man fühlt weder Natur noch Gott.
Auf ewig hab ich sie vertrieben,
Vielköpfige Götter trifft mein Bann,
So Wischnu, Kama, Brahma, Schiven,
Sogar den Affen Hannemann.
Doch verfiel auch er zeitweise einer romantischen Verzerrung, etwa wenn er die Witwenverbrennung, sati, in »Der Gott und die Bajadere« verklärt, wo die sich verbrennende Tänzerin vom Gott erhoben wird. Ebenso sah Karoline von Günderode in der Witwenverbrennung etwas Hochromantisches (»Die malabarischen Witwen«). Die Dichterin sollte sich selbst nach einer Liebesaffäre umbringen. Auf ihrem Grabstein steht das klassische Abschiedsgedicht der Brahmanen. An diesen Beispielen wird sichtbar, dass die Deutschen keine eigenen Kolonialerfahrungen mit Indien hatten, denn die Briten bemühten sich ab 1829, ein Verbot von sati durchzusetzen. Der Druck gegen die Verbrennung kam übrigens von indischer Seite, nämlich der Hindu-Reformbewegung des Ram Mohan Roy, der Aberglauben und Kastensystem bekämpfte. Vorbild war für ihn Großbritannien, wo er auch 1833 starb. In Bristol steht heute seine Statue.
Doch für die Deutschen war Indien ein Traumreich, ein Blumenhimmel, ein Land, in dem der Wärmestrom der Menschlichkeit, der Kunst und Symbolik ungehindert fließen konnte. Novalis stellte es der Abstraktion entgegen: »dem kalten, toten Spitzbergen jenes Stubenverstandes« (Fragmente). Vielleicht war es gar das Land, wo die Blaue Blume wuchs? Wo Christus und Dionysos eins werden, wie es später Nietzsche halluzinieren wird? Man kann weitergehen und sagen: Für die Deutschen, die Europäer ist Indien das sich artikulierende Unbewusste. Wen es nach Indien zieht, der verdreht das Freud’sche Diktum und will, dass Ich zu Es werde, oder will zumindest eine stärkere Verbindung zwischen Ich und Es. Der indische Blumengott wacht immer wieder auf in der westlichen Geistesgeschichte, deutlicher als sonst wohl in den Blumenkindern der 1960er Jahre.
Alles, was in der westlichen Zivilisation verlorengegangen ist, lebt für die Romantik in Indien wieder auf: »Damit Indien in der Mitte des Erdballs so warm und herrlich sei, muss ein kaltes, starres Meer, tote Klippen, Nebel statt des gestirnvollen Himmels und eine lange Nacht, die beiden Enden unwirtbar machen.« (Novalis, Heinrich von Ofterdingen) Auf den Realismus britischer Indienreisender musste man in Deutschland noch lange warten. Das romantische Bild Indiens lebt im Westen heute weiter in der Verehrung von Gurus oder indischer Spiritualität. Es wird ironisch gebrochen, aber doch anerkannt in Peter Sloterdijks Überlegungen, realistisch durchbrochen und auf soziale Missstände zurückgeführt in Günter Grass’ Reisebericht Zunge zeigen (1988). Indien bleibt Ort der Sehnsucht und Stein des Anstoßes für den Westen.
Glasenapp, Helmuth von. Das Indienbild deutscher Denker. Stuttgart: Köhler 1966.
Kade-Luthra, Verena. Sehnsucht nach Indien. Literarische Annäherungen von Goethe bis Günter Grass. München: Beck 2006.
Miller, Sam. A Strange Kind of Paradise. India through foreign eyes. London: Vintage 2014.
Indologie
Im Jahre 1844 wird ein junger deutscher Gelehrter, knapp 21 Jahre alt ist er in Paris zu einer kleinen Feierlichkeit im Institut de France eingeladen, der Dachorganisation der staatlichen Akademien Frankreichs. Eingeladen hat der berühmte Sanskritprofessor Eugène Burnouf. Dieser will einem hohen indischen Gast eine Ausgabe seiner prächtigen Edition des Bhagavatpurana, jener alten Geschichten über Krishna und andere Götter, überreichen. Der Inder nimmt sie erfreut entgegen und lässt seine Finger über den französischen Text, der neben dem Sanskrittext gedruckt ist, gleiten. Oh, sagt er, wenn ich das nur lesen könnte! Der junge Deutsche ist erstaunt: Der Inder will gar nicht die alten Schriften seines Landes im Original lesen, sondern lieber auf Französisch.
Ihn selbst, Friedrich Max Müller (1823–1900) aus Dessau stammend, drängte dagegen nichts mehr, als die alten indischen Schriften lesen zu können. Der indische Gast, Dwarkanath Tagore (1794–1846), war auch kein Philologe, sondern ein erfolgreicher Unternehmer. Er war dem Westen zugetan, er wollte die Welt seines heimatlichen Bengalen reformieren: Abschaffung der strengen Kastenregeln, der Witwenverbrennung und anderer schrecklicher Antiquiertheiten. Zwei Jahre später sollte er in England sterben, wie sein Vorbild Ranmohan Roy. Als Tagore nach Paris kam, erregte er großes Aufsehen. Max Müller hörte von diesem Besuch und brannte darauf, diesen noblen Inder kennenzulernen, der zudem noch unendlich reich zu sein schien, blendend aussah und die teuerste Hotelsuite der Stadt bewohnte. Müller studierte bei Burnouf, dem er auch bei dem Kopieren von Handschriften half und der ihn darum schätzte. Daher durfte er auch an diesem Treffen teilnehmen. Tagore, schreibt Müller in seinen Memoiren, hatte wenig Wissen über die alten Schriften Indiens. Dennoch schloss er den jungen Deutschen ins Herz, als er erfuhr, dass Müller die Veden für eine erste Edition abschrieb. So lud er ihn zu weiteren Treffen ein, bei denen man sich über Indien und Europa, Frankreich und die Veden und viele andere Themen austauschte. Tagore war ein Liebhaber italienischer und französischer Musik und ließ sich von Müller auf dem Klavier begleiten. Denn Müller hatte eine große musikalische Vergangenheit hinter sich, eigentlich hatte er einmal Musikwissenschaftler, ja, Komponist werden wollen. Doch der große Mendelssohn Bartholdy, zu dessen Bekanntenkreis er in Leipzig gehörte, hatte ihm abgeraten. Vielleicht ahnte dieser, dass Müller es in anderen Fächern noch weiterbringen sollte. Jedenfalls sang Tagore ihm gerne französische und italienische Lieder und Arien vor. Müller bat ihn, einmal indische Musik am Klavier zu spielen und zu singen. Der Deutsche hatte jedoch kein Ohr dafür, es war ihm »ohne Melodie und Rhythmus«. Wo war hier die Harmonie? Ihr seid alle gleich, erwiderte der Inder, alles Fremde stößt euch ab. Ihm sei es allerdings ähnlich gegangen, als er die ersten Klänge italienischer Musik gehört habe. Würden die Europäer nur die indische Musik so ernst nehmen, wie es die Inder mit der europäischen taten, dann würden sie ihre Melodie, ihre Rhythmen und ihre Harmonie entdecken. Das Gleiche gelte für Philosophie, Poesie und Religion. Zumindest in seinen Memoiren konnte Müller nicht anders als beipflichten. George Harrison machte eine ähnliche Erfahrung, als er als erster der Beatles mit indischer Musik konfrontiert wurde und die Sitar wie eine elektrische Gitarre spielte, was seinen Lehrer Ravi Shankar verwunderte.
Die Abschrift der Hymnen des altindischen Rigveda, die Müller von Paris nach London, sodann nach Oxford brachte und die schließlich in einer sechsbändigen Ausgabe gipfelte, wurde von indischen Brahmanen zunächst argwöhnisch betrachtet. Ein Europäer edierte die Heiligen Gesänge, die eigentlich nur in die brahmanische mündliche Tradition gehörten? Auch Tagore war Brahmane, doch hatte er es sich mit seinen reformerischen Ideen bei seiner Kaste verdorben. Allein die Tatsache, dass er Indien verlassen hatte, machte ihn verdächtig. Auslandsaufenthalte waren für einen orthodoxen Hindu problematisch und mussten durch spezielle Reinigungszeremonien ausgebügelt werden. So musste der Verunreinigte etwa fünf Produkte der Kuh (Milchsorten, Ghee-Butter u.a.) schlucken, um wieder rein zu werden. Später erfand man eine Pille dafür, die alle fünf Elemente enthielt. Aber Tagore nahm das nicht ernst.
Friedrich Max Müller
Sein Sohn Debendranath war weitaus stärker an Müllers Arbeiten interessiert als der Vater und engagierte sich intensiv als religiöser Reformer. Die Familie Tagore hatte seit gut zweihundert Jahren das kulturelle und wirtschaftliche Leben Bengalens geprägt, und es sollten noch weitere hochbegabte Menschen aus diesem Stamm hervorgehen. Am bekanntesten wurde Rabindranath Tagore, der als bislang einziger Inder, ja, als erster Nichteuropäer, 1913 den Literaturnobelpreis erhielt und auf seine Weise die Familientradition in Reformdenken, Pädagogik und kulturellem Schaffen fortsetzte.
Die etwa tausend Hymnen des Rigveda sind zwischen 1700 und 1200 v. Chr. verfasst worden und stellen die ältesten Texte indoeuropäischer Sprache dar. Müller glaubte sogar, dass es das älteste Buch der Welt sei (die Keilschriftforschung war zu seiner Zeit noch nicht weit fortgeschritten, sonst hätte er das Gilgamesch-Epos kennen müssen).
Wie kam aber ein junger Deutscher aus der preußischen Provinz dazu, sich mit den alten Schriften Indiens zu beschäftigen? In seinen autobiographischen Essays unter dem Titel Auld Lang Syne erinnert er sich an seine Schulzeit in Dessau. Auf dem Umschlag eines Schreibheftes war die Stadt Benares zu sehen. Da beginnt er, von Indien zu träumen, wo die Menschen groß und schön und geheimnisvoll waren. Wie der Junge so vor sich hinsinnt, kommt der Lehrer und zieht ihm die Ohren stramm. Zur Strafe soll er mehrere Seiten füllen, in denen Wörter wie Benares, Ganges oder Indien vorkommen. So also kam Indien zu ihm: zuerst als Traum und dann als Strafe!
Er wuchs in gebildeten Kreisen auf, in der aufgeklärten Umgebung des Hofes von Dessau. Seine Mutter war eine geborene von Basedow; nach ihrem Bruder Carl wurde die Schilddrüsenerkrankung benannt. Der Vater war einer der berühmtesten Deutschen seiner Zeit, der sogenannte »Griechenmüller«. Wilhelm Müller war ein Griechenlandbegeisterter wie Winckelmann und Byron und zudem ein allseits bewunderter Dichter. Heine schätzte ihn als einen der größten seiner Zeit. Diesem Müller verdanken wir Schuberts Kompositionen wie »Die schöne Müllerin« oder »Die Winterreise«. Dieser wunderbare und vom Sohn sehr geliebte Vater verstarb früh, mit 32 Jahren. Man zog nach Leipzig. Dort ging Max an die renommierte Nikolaischule, wo auch Leibniz, Lessing und Wagner gelernt hatten, und war schnell der Primus. Die altphilologischen Fächer lagen ihm besonders; dazu kamen musikalische Interessen, Begegnungen mit Schumann, Liszt und vor allem Mendelssohn. Er engagierte sich kulturell, sang, spielte Klavier, rezitierte.
Als das junge Genie zu studieren begann, hatte es genug von der Altphilologie, die bald nur noch Denkmalswert hatte: »Ich wurde allmählich ein wenig müde von Griechisch und Latein und all dem aufgewärmten Kohl.« So nahm Müller das Studium des Sanskrit auf, und zwar bei Hermann Brockhaus, dem ersten Inhaber eines indologischen Lehrstuhls in Leipzig, dem Sohn des Verlegers Friedrich Arnold Brockhaus. Der Professor war zugleich Schwager von Richard Wagner (und bei ihm lernte Nietzsche eines Tages den Komponisten kennen). Müller konnte schon ein wenig Arabisch und Persisch, aber Sanskrit erschien ihm damals besonders faszinierend – die Romantiker Schlegel und Novalis etwa hielten es für die Ursprache der Menschheit, während das Hebräische in die zweite Reihe rückte. Die Verdrängung christlich-jüdischer Kultur durch eine vorgeblich »arische«, indogermanische hatte auch einen antisemitischen Beigeschmack, der sich in der deutschen Indologie des 20. Jahrhunderts noch einmal böse entfalten sollte.
Müller studierte aber auch Philosophie. 1844, mit 21 Jahren, promovierte er über die Ethik bei Spinoza. Doch es waren die indologischen Studien, die ihn auf seinen Lebenspfad brachten. Berlin war hierin besser aufgestellt. Mit Schelling gab es dort zudem einen Philosophen, dem Indien und Sanskrit für die Errichtung einer neuen Mythologie viel bedeuteten. Friedrich Rückert, eines der größten Sprachgenies aller Zeiten, Dichter dazu, lehrte in Berlin orientalische Sprachen. Franz Bopp, der für die Untersuchung der Verwandtschaft zwischen den indoeuropäischen Sprachen eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen hatte, war der Dritte im Bunde. Schelling freute sich über den jungen Dessauer, der ihm bei Sanskritübersetzungen helfen konnte. Rückert konnte von Müller sogar dazu bewegt werden, nicht nach Franken zurückzuziehen, sondern ein Kolleg für ihn und zwei andere abzuhalten. Der weitere Weg führte ihn nach Paris, jedoch nicht ohne dem Indienverehrer Schopenhauer in Frankfurt einen Besuch abzustatten. In der französischen Hauptstadt wollte er nun bei dem großen Sanskritforscher Eugène Burnouf am Institut de France arbeiten.
Hier also schrieb er das Rigveda weiter ab, doch war die Quellenlage in jenem Land besser, das über Indien als Kolonialmacht herrschte: Großbritannien. Zunächst in London, dann in Oxford betrieb er seine Studien und konnte hier auf große Ressourcen zurückgreifen. Inzwischen war er zum besten Sanskritkenner der Welt aufgestiegen. Deshalb war er tief verärgert, als ihm die vakante Boden-Professur für Sanskrit in Oxford nicht verliehen wurde.
Es war ein signifikantes Scheitern, doch es hinderte ihn nicht daran, weiter Karriere zu machen. Er sollte nie wieder Sanskrit an der Universität unterrichten, aber man schuf ihm acht Jahre später eine eigene Professur, diesmal mit Ausrichtung auf Vergleichende Religionswissenschaft, ein Novum innerhalb des universitären Fächerkanons. In dieser Zeit hielt er auch um die Hand der Tochter eines reichen Mannes an, der diesem Vorhaben nicht wohlwollend gegenüberstand. Es dauerte Jahre und es brauchte einen Skandal im Konzertsaal, bevor die beiden heiraten konnten. Georgina Grenfell sah Müller nach Jahren der Trennung bei einem Konzert in Oxford. Da fiel sie in Ohnmacht und musste herausgetragen werden. Das Herz ihres Vaters wurde dadurch endlich erweicht. Aber auch diese schwierige Zeit überwand Müller durch Arbeit, diesmal an einem Roman, den er Deutsche Liebe nannte. Hier freit ein junger Mann in Dessau um eine invalide Fürstin, es bleibt bei platonischem Flüstern über die unsterblichen Formen der Anziehung. In Korea sollte dieser Roman eines Tages zu einem Erfolg werden. Ob es an der Übersetzung lag?
Müllers Ruhm wuchs. Königin Viktoria lud ihn ein, weil sie über Sanskrit und Indien hören wollte. Als sie 1876 schließlich zur Kaiserin von Indien ernannt wurde, beauftragte man ihn, die dritte Strophe der englischen Nationalhymne in Sanskrit zu übersetzen, auf dass auch die kolonialen Untertanen mitjubeln könnten. Er wurde in den Privy Council, den Kronrat der Königin, gewählt, erhielt viele bedeutende Orden, unter anderem den Pour le Mérite. Das Oxford English Dictionary wählte zudem den Deutschen als Berater in Fragen, die mit Wörtern indischen Ursprungs zu tun hatten. Seine Reden und Schriften wurden aufmerksam verfolgt, er hielt berühmte Vorlesungen, etwa die Gifford Lectures in Edinburgh zur Religion. Insbesondere wurden seine Arbeiten zur vergleichenden Mythologie diskutiert.