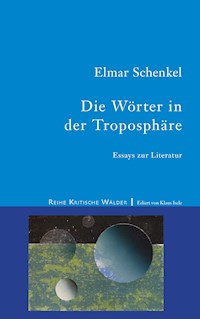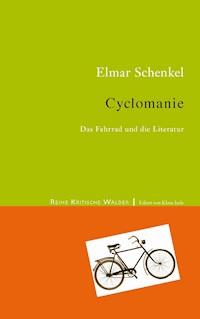18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Mit Werken wie »Herz der Finsternis« oder »Lord Jim« hat Joseph Conrad Klassiker der Weltliteratur geschrieben. In einer neuen Biographie geht Elmar Schenkel den Orten, Menschen und Themen nach, die in Conrads leben und Werk eine Rolle spielen. Wir erfahren von der Kindheit in Polen und der Entscheidung, zur See zu fahren. Wir begleiten ihn auf Reisen durch den Malayischen Archipel und den Kongo, erleben seine ersten Versuche, in einer fremden Sprache zuschreiben, und lernen die Menschen kennen, mit denen er Umgang hatte. Gleichzeitig führt Elmar Schenkel in die wichtigsten Werke ein und beleuchtet die Hintergründe ihrer Entstehung und Themen. Entstanden ist ein lebendiges, stimmungsvolles und literarisches Porträt, das Mensch und Werk anschaulich werden lässt. »Schon auf den ersten Seiten nimmt Schenkels Buch den Leser gefangen. Nicht nur wegen des spannenden Lebens […], sondern wegen des literarischen Tons.« Stuttgarter Zeitung »Was Schenkel ans Licht bringt über diesen lebenslang malariakranken Autor, ist beeindruckend.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung »Mit seinem überaus eleganten Stil gelingt Schenkel der Spagat zwischen Literaturwissenschaft und Feuilleton.« Mare »ein hinreißendes Buch (...) Locker im Ton und dennoch lehrreich, eine Biographie der allerbesten Sorte. (...) Ein ausgezeichnetes, glänzendes Buch.« Lübecker Nachrichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Ähnliche
Elmar Schenkel
Fahrt ins Geheimnis
Joseph Conrad. Eine Biographie
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorwort
Ich kenne keinen Autor, dessen Werke und dessen Leben so oft und von so vielen verschiedenen Menschen neu geschrieben, umgeschrieben, ausgemalt und weitergedichtet wurden. Warum? Joseph Conrad ist ein Rätsel, das immer neue Antworten verlangt. Die vorliegenden biographischen Annäherungen sind Versuche, die Themen Conrads zu umkreisen: die See, die Sprache, das Schreiben. Vielleicht geht es nur um ein Thema, den Sprung nämlich, den Jim von der Patna macht, den er nicht gemacht haben will und für den er ein ganzes Leben lang Rechtfertigungen sucht. Der Sprung, der ihn in einen Archipel führte, ein zweites Leben. Die Geschichten schwingen um ein offenes Zentrum, einen leeren Ort, der im Lesen das Bedürfnis nach einer Ausfüllung verlangt. Ob Welle oder Partikel: was als Licht aus der Erzählung strömt, ist nicht vorauszusagen. Conrad macht den Leser zum Kollaborateur im doppelten Sinn.
Annäherungen und Umkreisungen sind die Bewegungsmuster des vorliegenden Buches, nicht so sehr das lineare Erzählen von der Geburt bis zum Tod. Der Pfeil des Linearen wird manchmal unsichtbar, um andere Blicke zu ermöglichen, zum Beispiel den Rückblick oder den Seitenblick. Das entspricht eher der Methode Conrads, seinen nachgeschobenen Erklärungen, seinen Wendungen in die Vergangenheit wie seinen zeitlichen Sprüngen überhaupt. Wer sich der zeitlichen Linie versichern will, möge in die Chronik am Ende schauen. Zugrunde liegt der Gedanke, daß Biographie nur eine Vorstellung ist, wenn auch nicht unbedingt eine Fiktion. Sie ist eine von vielen Möglichkeiten, ein Leben anzuordnen und zu verstehen. Wenn wir über unser eigenes oder das Leben anderer nachdenken, tun wir dies selten in chronologischer Reihenfolge, so wie man etwa ein Fotoalbum von Anfang bis Ende durchblättern würde. Vielmehr vergleichen und springen wir von hinten nach vorn, verfolgen eine Frage zu ihrem Ursprung oder suchen nach Beziehungen und Mustern. Biographie, so verstanden, ist eine Form des Essays, ein Versuch eben und manchmal ein Gespräch.
In dieser Form liegt ein Unterschied zu den vorhandenen Biographien über Joseph Conrad. Ein weiterer besteht darin, daß die kontinentalen Verbindungen Conrads eine größere Rolle spielen. Ich halte Conrad für einen Vorläufer des neuen Europa, zugleich auch für den ersten Autor, der die Natur der Globalisierung erfaßte – vom Kolonialismus bis zum Terrorismus. Als ich im Juni 2006 auf einer polnischen Konferenz über Conrad in Lublin war, traf ich eine Reihe bedeutender britischer und amerikanischer Conrad-Forscher, denen zum ersten Mal klarwurde, daß Conrad ein großes polnisches und europäisches Erbe verkörperte und nicht nur der in angloamerikanischen Universitäten kanonisierte Engländer ist. Es ist also an der Zeit, stärker auf Conrads polnischen und französischen Hintergrund hinzuweisen; als deutscher Leser will man auch mehr über Conrad und Deutschland erfahren.
Die Tatsache, daß in Conrads meistgelesenen Werken Frauen zumeist unterbelichtet oder abwesend sind, ließ Leser wie Biographen oft glauben, Frauen spielten für Conrad kaum eine Rolle. Das gilt aber weder für sein Werk noch für sein Leben. Man denke nur an Spiel des Zufalls, Der Geheimagent, Der Goldene Pfeil oder »Ein Lächeln des Glücks«. Die Frauen in seinem Leben werden von vielen Biographen entweder als Randfiguren betrachtet oder wie seine Frau Jessie abqualifiziert. Vielleicht helfen die Porträts im vorliegenden Buch zu einer Neubewertung des Verhältnisses, das Conrad zu Frauen hatte und diese zu ihm.
Zu dem Werk eines Autors gehört nicht nur das, was er selbst geschrieben hat, sondern auch alles, was ihm als Echo, Reaktion, Nachahmung oder Ablehnung aus der Um- und Nachwelt entgegentritt und folgt. Kein Werk besteht nur aus sich selbst, sondern nimmt viele der kulturellen Geräusche im Sinne von Resonanz in sich auf, und nur so verstehen wir es erst. Daher verfolgen einige Kapitel auch die Auswirkungen bestimmter Bücher oder zeigen das Weiterleben Conrads an unerwarteten Orten. Zum Schluß sei betont, daß dies kein Buch von Werkinterpretationen ist, sondern sich den Werken Conrads immer unter biographischem Vorzeichen nähert. Für umfassende Studien zu den Romanen und Erzählungen sei auf die ungebremst wachsende Sekundärliteratur verwiesen.
Vielleicht ist es unnötig hinzuzufügen: Biographien sind Brücken, von denen man auf das fließende Wasser hinabschaut. Sie sind nicht zu verwechseln mit der Realität eines Lebens oder der geheimnisvollen Wirklichkeit der Imagination. Um sich dieser zu nähern, hilft nur das Lesen der Werke. Eines Tages schrieb Joseph Roth, der ja nicht weit entfernt von Conrads Heimat geboren wurde, an seinen Onkel: »Lieber Onkel, ich weiß, daß Sie keine Bücher lesen. Trotzdem gebe ich Ihnen einige. Ein Mann hat sie geschrieben, namens Joseph Conrad. Er war ein Pole von Geburt. Er wurde im tiefsten Kontinent geboren, nämlich in Wolhynien … und seine Muttersprache war die polnische, die zu den kontinentalsten Sprachen der Welt gehört. Aber er ging mit 16 Jahren nach Marseille, bestieg ein Schiff, wurde ein Matrose und fuhr durch die Meere und wurde einer der größten Meister der ozeanischen Sprachen: der englischen. Und dies sind seine Bücher. Sie sind bewegt wie das Meer und ruhig wie das Meer und tief wie das Meer … Lesen Sie den Ozean!«
Nicht zuletzt hat jeder Biograph Dank zu sagen. Dankbar bin ich den vielen fleißigen Conrad-Forschern, von denen ich unendlich profitiert habe. Im Anhang verweise ich auf einige grundlegende Nachschlagewerke und Monographien. Die lebenden Conrad-Forscher, die ich auf manchen Konferenzen kennenlernte, waren allesamt hilfreich und interessiert an meinem Projekt, ob Gene Moore, Anne Luyat, Wieslaw Krajka, Stephen Brodsky, Keith Carabine oder viele andere. Christian Trepte half, bei den polnischen Kapiteln die schlimmsten Irrtümer zu vermeiden, Jacqueline Peltier versorgte mich mit Nachrichten aus der Bretagne. Mario Curreli bot mir in Pisa mit der dortigen Conradsammlung viel Unterstützung. Meinen Studentinnen und Studenten bin ich dankbar für manche Diskussion und Hausarbeit in Conrad-Seminaren an der Leipziger Universität, insbesondere Frank Förster für seine mannigfache Unterstützung und seine fleißige Rezeptionssammlung, Birgit Kuch für Hilfe bei ersten Begehungen des polnischen Territoriums, meinen wissenschaftlichen Hilfskräften Britta Awe und Sascha Gruschwitz. Zu danken habe ich der Fondazione Bogliasco bei Genua und der Compagnia di San Paolo Stiftung, die es mir erlaubten, das Buch mit einem Stipendium als »Compagnia di San Paolo-Bogliasco Fellow per la Letteratura« an der herrlichen Küste Liguriens fertigzustellen. Vor allem aber jener Frau, die sich immer wieder meine Berichte aus der Schreibwerkstatt anhören mußte und dennoch aufmunternd sowie lesend zur Seite stand – Ulrike, der ich dieses Buch widme.
Archipel
Er hat im Sinn, sich ganz der Erforschung der Handels-
verhältnisse auf dem Archipel der Sunda-Inseln
zu widmen, deren Schönheit und Reichtum er mit
der größten Begeisterung beschreibt.
Tadeusz Bobrowski in einem Brief
Weit von Europa, und vielleicht in einem gleichen Abstand zu allen anderen Kontinenten, liegt Borneo. Im 19. Jahrhundert jedoch rückt dieses schillernde Inselreich in unsere Geschichte. Die Verlegung von Unterseekabeln für die Telegraphie und überhaupt die Verkabelung der Welt im Zeichen von Nachricht und Information machte die Beschaffung besonderer Materialien notwendig. Man fand sie in der Milch, die aus den Bäumen Borneos floß. Die Eingeborenen nannten sie Guttapercha, Gummibaum. Europa und Amerika brauchten Gummi für Zähne, Knöpfe, Säbelgriffe und Golfbälle, vor allem aber für Abdichtungen aller Art. Am Ende des 19. Jahrhunderts waren ganze Baumarten auf Borneo ausgerottet.
Borneo wurde von den Portugiesen für die westliche Welt entdeckt. 1521 landeten die Gefährten Magellans, der zuvor auf den Philippinen im Kampf mit Eingeborenen gefallen war, an der Küste des heutigen Brunei. Man handelte mit Schildkröteneiern, transportierte Edelhölzer, Orchideen, Diamanten und Gold. Am wichtigsten waren für die Europäer die Gewürze, und das wichtigste unter den Gewürzen war der Pfeffer. Das Land, wo der Pfeffer wächst, hatte damals noch eine ganz andere Bedeutung; es war eine himmlische Versprechung. Dem Eldorado der westlichen Hemisphäre kann man geradezu ein Pfefferland in der östlichen Hemisphäre zuordnen. Das Verlangen nach Pfeffer, heißt es im 22. Kapitel von Joseph Conrads Lord Jim, brannte »heftig wie Liebesglut in der Brust holländischer und englischer Abenteurer. … Kein Land, in dem der Pfeffer wuchs, in das sie nicht gegangen wären.« Diese Liebesglut aber machte die Inseln verwundbar. Gleichzeitig blieben sie politisch unübersichtlich, beherrscht von den verschiedensten Kolonialmächten und einheimischen Fraktionen, verwirrend und hinterhältig wie der Dschungel und die Flüsse in ihm. In seiner Traumvision hatte auch der preußische Kronprinz schon erkannt, daß Borneo sich vor den Europäern und Chinesen versteckte. Eine Luftspiegelung, dieses Inselreich im hinterindischen Osten, zugleich verzerrtes Abbild jener Reiche, in denen Europa im Ausklang der napoleonischen Zeit träumte. Denn das nach-napoleonische Europa, das einen ersten Anlauf auf Einigung verworfen hat, wird verwirrend sein wie ein Archipel.
Etwas Imaginäres ist an Inseln. Viele sind im Laufe der Jahrhunderte auf den Karten so lange verschoben worden, bis sie verschwanden: die Insel des heiligen Brandan, die Insel Buss, die sichelförmige Insel Mayda, die sich mal bei Cape Cod, mal bei den Bermudas aufhielt, Swacy’s Island, die sich auf sowjetischen Karten befindet, Podesta, die von dem italienischen Kapitän Pinocchio entdeckt und nie wieder gesehen ward: All diese Inseln sind Teile eines Mobiles, eines imaginären Reiches, auf das die Menschheit ihre Sehnsüchte, Hoffnungen, Ängste und Strategien projiziert, Teile einer imaginären Geographie, die unter der realen liegt und diese mitbestimmt. Inseln und Archipele sind daher auch Landschaften für Ausgestoßene und Vertriebene, wie James Hamilton-Paterson in seinen Seestücken schreibt. Sie kommen dem Provisorium entgegen, in dem der Exilierte sich aufhält, sie verhelfen zu Flucht und Versteck, es fehlt ihnen die Überwachung durch eine Zentralmacht. Nationale Zuordnungen sind schwierig, Korsika ist italienisch und französisch, korsisch ohnehin, die Kanalinseln sind englisch und französisch, man pflegt Zweisprachigkeit, liegt zwischen den politischen und nationalen Gezeiten. Der Horizont mit seinen Schiffen ist eine Bühne der Beweglichkeit, das Meer, die schwankenden Silhouetten, die vielfältigen Winde und das strahlende Licht sorgen dafür, daß hier Grenzen ganz anderer Art gezogen sind als auf dem Lande und daß hier eine Autonomie herrscht, von der in den trüben Städten nicht einmal geträumt werden kann: Schmuggelei, Seeräuberei, Brauchtümer, Anarchien und Despotien, Verschwörungen und Rebellionen, Tyrannei und Freiheit zugleich. Inseln dienten von jeher dazu, Zukunft in Form von idealen Staatswesen zu bündeln, auch deshalb sind sie Träger von Träumen. Überall, wo etwas Neues entsteht oder experimentiert wird, muß eine Insel in der Gegenwart entstehen, mag sie räumlich oder zeitlich sein. Ein Gebiet muß sich absetzen, wie die Schauspieler einen Kreis um sich ziehen, um als Spieler erkannt zu werden. Die Insel ist der Ort des Spiels, des Traums, der Zukunft, sie ist Utopie, Laboratorium, Experiment. Daher aber ist sie auch der Realität entfremdet. Zukunft wird um den Preis der Entfremdung, des Verlustes an Gegenwart erkauft. Deshalb kann sie auch ganz plötzlich zum Gefängnis werden, zu einem Ort der Verdammten und Gescheiterten. Das ist Conrads Welt: der Archipel als Labyrinth von Lebensläufen, von undurchsichtigen Biographien, von Linien der Schuld und des Schattens, des Versteckten und Verdorbenen, zwischendurch aufgehellt von heroischen Blitzlichtern – so von Tom Lingard, dem Rajah Laut, dem weißen Herrn der fremden Meere. Auf den Inseln zwischen Borneo, Sumatra und Thailand läßt Conrad seine Figuren hindämmern oder unergründlichen Schicksalen nachgehen, an der Liebe zerbrechen, Korruptionen ausleben und Verbrechen planen: ein Almayer, der sich nach Europa zurückträumt, ein Lord Jim, der es nach seinem Scheitern noch einmal versucht, der Schwede Heyst, dem der Sprung über seinen Schatten nicht gelingt, Schomberg, der Schlechtigkeit verbreitet wie eine Krankheit, Lena, das einsame Mädchen aus dem Damenorchester, Freya von den sieben Inseln, zermalmt zwischen den Patriarchen, Lingard selbst zerrissen zwischen Ehre und Gefühl. Zugleich ist diese Inselwelt mit ihren Lagunen und Riffen, den Flüssen und Dschungeln eine kindliche Welt. Sie eignet sich für Versteckspiel und Abenteuer wie keine andere, sie wird für Conrad zu einem idealen Ausdruck der Komplexität des Gefühlslebens und seiner Widerstände.
Borneo und das Gebiet, das heute Teile von Indonesien, Malaysia und Thailand bildet, ist zentraler Bezugspunkt seines Werkes, gut zwölf Romane und Erzählungen hat er hier angesiedelt. Dabei verbrachte er kaum mehr als einen Monat in Borneo. Als zweiter Steuermann des kleinen Dampfers Vidar unternahm er zwischen August 1887 und Januar 1888 vier Fahrten an der Ostküste. Das ist schon alles, sehr wenig, wenn man es vergleicht mit dem literarischen Rang, den er dieser Inselwelt beimessen sollte. »Ich bin Borneo leidenschaftlich zugetan«, schrieb er seiner Verwandten Marguerite Poradowska, als er Der Verdammte der Inseln, seinen zweiten Roman, begann. Aber es entstand keine Dokumentation, sondern Conrad fing vielmehr jene schwebende Existenz zwischen Halluzination und Realität ein: »Schließlich«, schrieb er an den englischen Verlagslektor W.H. Chesson, »haben Fluß und Menschen nichts Wahres an sich – im vulgären Sinn – außer ihren Namen. Jede Art von Literaturkritik, die eine reale Beschreibung von Orten und Ereignissen suchte, wäre eine Katastrophe für jenes Partikel Universum, das niemand und nichts anderes in der Welt ist als ich selbst.«
Doch Borneo scheint nicht nur Träume mobilisieren zu können, gelegentlich ermöglicht es auch deren Verwirklichung. 1839 kam der englische Abenteurer James Brooke (1803–1868) nach Sarawak, wo er half, eine Rebellion zu unterdrücken. Dafür wurde er kurz darauf mit dem Titel Erster Rajah von Sarawak geadelt. Es gelang ihm durch geschickte Politik und Einflußnahme, die untereinander verfeindeten Gruppen von islamischen Malaien und einheimischen Dayaks zu versöhnen oder zumindest in Schach zu halten sowie Piraterie und Sklaverei zu unterbinden. Conrad kannte seine Tagebücher und nutzte sie für lokales Kolorit in Almayers Wahn, Der Verdammte der Inseln, Die Rettung und Lord Jim. Er war glücklich, als er 1887 im Hafen von Singapur das einstige Schiff des Rajahs, die Rainbow, passierte. Persönlich kennengelernt hat er ihn nie, Brooke gehörte vielmehr zu den Idolen seiner Jugend. Hier in der Ferne, in der Unübersichtlichkeit, schien es einem Europäer gelungen zu sein, seine zivilisatorische Mission zu erfüllen – ohne dabei korrumpiert zu werden wie Brookes afrikanisches Gegenbild Kurtz in Herz der Finsternis. Ein anderer hatte Brooke kennengelernt und ihn in einem Werk porträtiert, das eines von Conrads Lieblingsbüchern wurde: A.R. Wallace. Sein naturgeschichtlicher Klassiker The Malay Archipelago: The Land of the Orang-Utan and the Bird of Paradise ist zugleich Wissenschaft und Reisebericht. Er widmete das Buch Charles Darwin, mit dem er bekanntlich die Entdeckung der Evolutionsgesetze teilt: überleben durch Anpassung. Zeitgleich mit Darwin hatte er seine Beobachtungen im Malaiischen Archipel gemacht und ähnliche Schlußfolgerungen gezogen. Wallace vermachte seine 20000 Schmetterlinge und Käfer, seine 3000 Vogelhäute sowie Muscheln und Pflanzen dem Britischen Museum. Auf den Aru-Inseln im Süden von Neu-Guinea gelang es ihm, den Paradiesvogel zu fangen, den kaum ein Europäer bislang gesehen hatte. Am 4. Dezember 1857, einen Tag nach Joseph Conrads Geburt, befindet er sich in Ambon, vier Wochen später in Ternate. Hier wird er ein berühmtes Papier verfassen, in dem er, etwas eher noch als Darwin, seine Evolutionstheorie skizziert.
Von den fernen Inseln her kommt die vielleicht einflußreichste Deutung der biologischen und, in Übertragung, auch menschlichen Geschichte. Darwin hatte bekanntlich auf den Galápagos-Inseln seine wichtigsten Beobachtungen gemacht, die in nuce – in den Schnäbeln der Finken – die künftige Theorie vorwegnahmen. Es scheint, daß Inseln in ihrer Anlage als plurale Welten Geschichte unendlich beschleunigen können und die Gegensätze zwischen alt und jung, zwischen archetypisch und aktuell, die historische und psychologische Ungleichzeitigkeit in einem ganz anderen Maß zeigen können, als dies auf einem kontinuierlichen Landstrich der Fall ist. Inseln versprechen Zukunft, aber sie locken auch zurück in die Vergangenheit. Durch diese Spannung versetzen sie Forscher wie Darwin in die Lage, zugleich rückwärts zu denken und vorauszusehen. Die Insel, schreibt Hamilton-Paterson, wiederholt eine Phantasie menschlicher Anfänge, eine Ursprungsgeschichte des Ich, zugleich aber, so müßte man hinzufügen, die Ursprungsgeschichten der Evolution. Sie sind, folgt man ihm weiter, sexuell aufgeladene Orte ebenso wie exterritoriale Ländereien, die außerhalb des Gesetzes existieren. Ihre Grenzen sind fließend. Conrad ist wie Axel Heyst, sein Protagonist in Sieg, von einem magischen Zirkel verzaubert, »mit einem Radius von achthundert Meilen, gezogen um einen bestimmten Punkt in Nord-Borneo«.
Solche Verzauberung ist uns eigentlich nur geläufig als Erfahrung von Landschaften, in denen wir geboren wurden oder aufwuchsen. Conrad scheint in der Ferne geboren zu sein, aufgewachsen in einer Fremde, die geographisch zu den Antipoden zählt, zur Welt der Gegenfüßler. Die Welt, in die Conrad hineinwächst, jenes nach dem Wiener Kongreß erstarrte Europa, beginnt Züge des Imaginären zu tragen. Projektionen und Hoffnungen, Wünsche, Träume ziehen und zerren an der politischen Decke, manchmal nehmen sie die Gestalt einer Insel an. Der preußische Kronprinz, der später als König Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestieg, träumt sich 1814, nach dem Sieg über Napoleon, in ein Königreich hinein, fern von aller Welt und luftig wie der Sternenhimmel in Schinkels Dekoration zur Zauberflöte, und nennt es Borneo. Victor Hugo bemerkt, Indien sei zu Deutschland geworden, Balzac heiratet eine polnische Gräfin in der tiefsten Ukraine, und während der kleine Nietzsche, der sich später gerne als Abkömmling eines polnischen Adelsgeschlechtes sehen sollte, Klavierspielen lernt, wird in der tiefsten ukrainischen Provinz unter dem Namen Józef Teodor Konrad Korzeniowski ein Mensch geboren, der sich einmal Joseph Conrad nennen wird. Conrads Europa ist geprägt von verschwimmenden Grenzen und flottierenden Inseln und insbesondere von einem Polen, das es nicht mehr gibt und das doch unter der Oberfläche weiterlebt, inkognito, unter einem Pseudonym: ein Archipel, in dem sich die Zukunft viele Namen gibt.
Eine Reise nach Polen im Jahre 1914
Im Juli 1914 machte sich Joseph Conrad mit seiner Familie auf in ein Land, das es nicht gab, wenn wir den damaligen Geschichtsbüchern und Politikern glauben wollen: Polen – ein Land, schrieb er, das auf der Landkarte nicht existiert, aber in der Wirklichkeit. Er hatte seine Heimat seit über zwanzig Jahren nicht mehr gesehen, Krakau schon seit über vierzig Jahren nicht, und im Mai war eine Einladung an ihn ergangen, einige Zeit in einem Landhaus in der Nähe von Krakau, der alten jagellonischen Stadt, zu verbringen. Seiner englischen Frau und seinen Söhnen hatte er schon lange etwas von seiner Heimat zeigen wollen – alles Polnische war für sie fern und fremd. Diese Reise wird zu einer Fahrt durch Raum und Zeit, sie wird den bekannten englisch-polnischen Autor mit einer Vergangenheit konfrontieren, die mit einem Mal in akute Gegenwart umschlägt: ein Moment, der einem seiner Romane entstammen könnte.
In den Jahren zuvor hatten sich die Verbindungen Conrads zu Polen wieder verdichtet. Im Frühjahr 1914 traf er sich des öfteren mit Józef Retinger, der ein polnisches Büro in London leitete und ihm Kontakte zu anderen Polen verschaffte. Retinger vermittelte Conrad auch das einzige Interview, das er auf polnisch für eine polnische Zeitschrift (Tygodnik Ilustrowany) geben sollte. Darin versuchte er, sein polnisches Wesen zu ergründen und dessen Verwurzelung in den Werken der Nationaldichter Mickiewicz und Slowacki. Zwei Dinge, sagt er, erfüllen ihn mit Stolz, »daß ich, als Pole, ein Kapitänspatent der britischen Handelsmarine besitze und daß ich nicht ganz schlecht auf Englisch schreiben kann.« Er hat also seine beiden großen Ziele erreicht, wie sie mehr oder weniger unbewußt in der Kindheit angelegt waren: englischer Seemann und Autor zu werden. Vielleicht ist jetzt der richtige Augenblick, der Vergangenheit ins Auge zu sehen? Conrad geht diesem Augenblick mit gemischten Gefühlen entgegen: einerseits aufgeregt, verstört, alten Gespenstern und Träumen zu begegnen, Überlebenden und Toten, andererseits aber in Vorfreude auf Begegnungen und gemeinsame Erinnerungen. Jedenfalls lädt ihn Retingers Familie nach Krakau und Umgebung ein, weitere Kontakte gibt es nach Zakopane, dem Kurort in Südpolen. Dort leitet eine Kusine eine Pension, in der so manche polnische Berühmtheit Quartier genommen hat, unter anderem der künftige erste Staatspräsident Pilsudski.
Nun packt man also in dem südenglischen Dorf die Koffer und macht sich auf eine Reise über die Nordsee quer durch Deutschland in das österreichisch regierte Krakau. Die Abfahrt findet am 25. Juli statt. An diesem Tag weist Österreich-Ungarn den Kompromißvorschlag Serbiens zurück und hält sein Ultimatum weiter aufrecht. Der Mord an Erzherzog Ferdinand in Sarajewo am 28. Juni hatte diplomatische Unruhe über die Welt gebracht, aber an Krieg wollte noch niemand recht glauben. Was ist ein Erzherzog überhaupt, kann es überhaupt etwas Schattenhafteres und Obskureres geben als solch einen Erzherzog, fragte sich Conrad und sah in Gedanken eine Schar von schattenhaften Erzherzögen, aus deren Mitte bald schon ein neuer heraustreten würde. Vielleicht würde es eine begrenzte Auseinandersetzung geben auf dem Balkan oder Serbien würde bestraft werden, aber die Großmächte würden sich schon zurückhalten.
Liverpool Street Station ist der Bahnhof, von dem die Züge Richtung Nordsee – nach Ipswich, Harwich oder Lowestoft – fahren. 36 Jahre zuvor hatte Conrad auf diesem Bahnhof erstmals London betreten. Die Reise nach Krakau führt in Kreise von Erinnerungen, die selbst wieder kreisförmig angeordnet sind. Denn im Jahre 1878 hatte er aus einem fast abergläubischen Gefühl heraus darauf verzichtet, eine Droschke zu nehmen, die ihn in London an sein Ziel bringen würde, als dürfe man in wichtigen Momenten des Lebens eben keine Wagen mieten. Er sollte einmal um den Globus, nach Australien, segeln müssen, um das erste Mal eine Londoner Droschke besteigen zu können. Zwischen der ersten Ankunft in Liverpool Street und der jetzigen Abfahrt lagen große Veränderungen in seinem Leben, und es kommt ihm vor wie der Abschluß eines Zyklus von 36 Jahren.
Nun geht es von Harwich nach Hamburg über die Nordsee, und das Meer führt ihn zurück in die Zeit, als er erstmals englischen Boden betrat und auf englischen Handelsschiffen arbeitete. Zwischen Lowestoft und Newcastle an der ostenglischen Küste schnappte er von den Seeleuten das erste Englisch auf, in dem er es später zu so großer Meisterschaft bringen sollte. Die Nordsee ist sozusagen sein Klassenzimmer gewesen, für das Handwerk wie für die Sprache, wie er ein Jahr später in seinem Reisebericht schreibt (»Poland Revisited«, 1915).
Aber wenn die Nordsee heftig und finster wird, will ihm scheinen, daß sie nicht zufällig »German Ocean« genannt wird. Deutschland – für dieses Land hatte Conrad zeit seines Lebens wenig übrig. Es war für ihn die Macht, die in ihrer preußischen Form von der Teilung Polens profitiert hatte, ein autokratischer und starrer Staat, eingebildet und wenig kultiviert. An Bord beobachtet er einen Deutschen mit seinen zwei Söhnen, die in einer englischen Privatschule lernten. Was bringt einen arroganten Teutonen wie diesen reichen Deutschen dazu, seine Söhne nicht im »Gelobten Land von Stahl, Chemie und Effizienz« zur Schule zu schicken, sondern in einem dekadenten Land wie Großbritannien? Deutschland, schreibt er 1915, ist derjenige Teil des festen Bodens unseres Planeten, von dem ich am wenigsten weiß. Dazu kommt ein absoluter Mangel an Neugier und Interesse; am liebsten wäre ihm, an der englischen Küste einzuschlafen und hinter Schlesien wieder aufzuwachen. Schlimm auch, daß der englische Kapitän deutschfreundlich ist, aber er ist eine einfache Seele und Conrad weiß, daß der deutsche Geist eine hypnotische Wirkung auf halbgebackene und etwas dämmrige Geister hat. Bei Borkum der erste deutsche Leuchtturm, überhaupt viel Licht auf der Strecke, nachts, von all den Dampfern und Tankern, das ist für Conrad eine völlig neue Welt, die nichts mehr gemein hat mit den Seglern aus seiner Zeit. Immerhin ist er seit gut vierzehn Jahren nicht mehr aktiv zur See gewesen. Die Nordsee glitzert wie eine Einkaufsstraße, Helgoland schickt sein mächtiges Licht in die Nacht, aus der Elbe kommt das Lotsenboot, und auch die Mündung ist mit Lichtern besetzt. Aus dem Blickwinkel des 1915 wütenden Krieges, vor dessen Hintergrund er diese Erinnerungen verfaßte, erscheint ihm der technische Fortschritt als entscheidender Schritt in Richtung Krieg und Zerstörung. Die Menschheit werde zunehmend demoralisiert durch die Herrschaft des Mechanischen. Dann deutscher Boden, der ihn völlig kaltläßt: keine Sympathien hier zu finden, keine Großzügigkeit, statt dessen unendlicher Provinzialismus, Neid und Eitelkeit! Immerhin, an diesem 27. Juli geht die Familie den Hamburger Hafen und Hagenbecks Zoo besichtigen. Mit dem Zug fährt man weiter nach Berlin, wo sie die Nacht verbringen. Um wenige Stunden müssen sich in dieser Stadt zwei große Autoren des Jahrhunderts verpaßt haben. Der andere war Franz Kafka, der am 26. Juli nach einer kurzen Ostseereise über Berlin nach Prag fuhr. Vorausgegangen war die Auflösung seiner Verlobung mit Felice Bauer im Hotel »Askanischer Hof«. Eine Beschreibung dieser polnisch-englischen Familie auf dem Bahnhof Friedrichstraße, angefertigt von der Hand Franz Kafkas, liegt nicht vor, aber wir können sie uns ausmalen. Meines Wissens hat Kafka Joseph Conrad nicht gelesen, aber einen Josef K. hat er sehr wohl auf seine Reise in das Herz der Finsternis geschickt. (Peter Hoeg läßt in seiner Erzählung »Reise in ein dunkles Herz« Conrad als Joseph K. auftreten.)
Es ist nun der 28. Juli und ein Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Serbien bricht aus. An diesem Abend kommen die Conrads in Krakau an. Zwei Tage lang geht Conrad mit seinem älteren Sohn Borys durch die Straßen der alten polnischen Königsstadt. Hier hatte er entscheidende Jahre seiner Kindheit und Jugend verbracht. Sie besuchen die berühmte Jagellonische Bibliothek, und hier zeigt ein Archivar dem englischen Autor Mappen mit Manuskripten und Briefen ganz besonderer Art. Es handelt sich um einen großen Teil der Schriften seines Vaters: Apollo Korzeniowski. Es muß ein bewegender Moment gewesen sein. Der Bibliothekar, der, wie Conrad selbst und wie ein großer polnischer Dichter des 19. Jahrhunderts, den Namen Józef Korzeniowski trägt, zeigt dem Besucher ein Konvolut von Briefen des Vaters an einen Freund: »Darin werden Sie oft erwähnt, obwohl Sie erst vier Jahre alt waren. Ihr Vater muß sehr viel Interesse an seinem Sohn gehabt haben.« Mit seinem Sohn Borys geht er zum Rakowice-Friedhof, und dort, am Grab Apollos, sieht Borys, zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben, seinen Vater niederknien und beten.
Am zweiten Abend trifft Conrad im Hotel einen alten Freund, Konstanty Buszczyn’ski, den Sohn seines ersten Hüters und Vormunds Stefan Buszczyn´ski. Konstanty, einst ein brillanter Altphilologe, ist nun zu einem Erfinder geworden: Er züchtet mit großem Erfolg Rote-Beete-Samen. Er lädt die Conrads für den 31. Juli auf sein Landgut ein, einige Kilometer außerhalb von Krakau. Am Morgen des 31. jedoch liest man in den Zeitungen, daß das Deutsche Reich dem zaristischen Rußland ein Ultimatum gestellt hat. Noch an diesem Tag beginnt eine allgemeine Mobilmachung: Unruhe auf den Straßen, Aufläufe, Versammlungen, Reden, Registrierung von Rekruten und Beschlagnahme von Pferden und Wagen.
Die polnischen Erwartungen zu diesem bevorstehenden Krieg gehen hin und her. Unter der Führung von Pilsudski formiert sich eine polnische Legion, die für ein unabhängiges Polen auf österreichischem Boden kämpfen will. Überhaupt hofft man, daß der Konflikt zwischen den Großmächten, auf die die polnischen Teilungen zurückgehen, die polnische Nation wieder hervorbringen werde, vorausgesetzt, der Krieg weite sich nicht aus. Conrad, der aus dem mächtigen England kommt, wird befragt, wie wohl dieses Land zu einem Krieg stehen würde. In einem Augenblick der Inspiration antwortet er: »Wenn England in den Krieg geht, dann wird es ihn bis zum Ende kämpfen – gleich wer irgendwelche Friedensvorschläge nach sechs Monaten auf Kosten von Recht und Gerechtigkeit machen wird. Darauf könnt ihr rechnen.« Und zwar werde England notfalls auch alleine kämpfen, aber es werde wohl nicht alleine bleiben. Im September 1914 schrieb Conrad ein politisches Memorandum nieder, in dem er sich zur Zukunft Polens Gedanken macht. Zentral ist die Forderung nach einer Anerkennung Polens durch alle Beteiligten am Krieg und einem notwendigen Waffenstillstand. Insbesondere liegt ihm daran, eine gute Beziehung zu Österreich aufzubauen, denn mit Österreich hatte das besetzte Polen im Vergleich zu den von Preußen und Russen besetzten Teilen eindeutig die besseren Erfahrungen gemacht. England solle also Österreichs Bestrebungen gegenüber den polnischen Territorien unterstützen, um damit ein Gleichgewicht gegenüber Preußen/Deutschland und Rußland herzustellen. England solle sich zudem von Rußland fernhalten, denn erstens werde Rußland besiegt werden und zweitens sei es wahrscheinlich, daß Preußen und Rußland in der näheren Zukunft vereinigt würden. Das Memorandum gibt sicherlich einige Argumente wieder, die in den Gesprächen Conrads mit seinen polnischen Landsleuten eine Rolle spielten.
Aus dem Besuch der Saatgutfarm in Górka Narodowa wird also nichts, vielmehr müssen die Conrads jetzt sehen, daß sie so schnell wie möglich aus dem Land kommen. Krakau liegt zu dieser Zeit nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt auf österreichischem Boden, in einem gefährlichen Grenzgebiet also. Statt dessen nimmt Conrad seine Familie, »den unglücklichen Stamm«, wie er an Galsworthy schreibt, mit nach Zakopane in den Karpaten, etwa 100 Kilometer von Krakau entfernt. In dem bekannten Erholungsort bleiben sie bis zum 7. Oktober bei Verwandten, den Zagórskies. Die Tochter Aniela Zagórska, Conrads polnische Übersetzerin, versorgt ihn mit Literatur. Conrad liest viel, unter anderem den großen Autor Boleslaw Prus. In diesen Tagen greift die Schwester von Marie Curie Conrad öffentlich an, er habe sein Mutterland im Stich gelassen, indem er nach England zog – ein alter Vorwurf. Jessie Conrad hat zum ersten Mal das Gefühl, ihren Mann von seinem polnischen Hintergrund her besser zu verstehen. Mit Hilfe des amerikanischen Botschafters in Wien gelingt schließlich im Oktober die Rückreise nach England über Wien und Genua.
Für Conrad jedenfalls war der emotionale Höhepunkt in Krakau erreicht, den er auf entspanntere Weise in Zakopane verarbeiten konnte. Man möchte sich nicht ausmalen, was Conrad in diesen Tagen und Wochen durch den Kopf ging. Da war auf der einen Seite die Bedrohung für sich und die Familie, in einen neuen Krieg hineinzugeraten, auf der anderen strömten die Erinnerungen wie alte Bekannte auf ihn zu, und er erlebte noch einmal am eigenen Leib die Falle, die Polen für seine Eltern und Verwandten immer wieder gewesen war – zerrieben zwischen den Großmächten und immer auf Gedeih und Verderb einem geschichtlich-politischen Druck ausgeliefert. Aber diesmal gelang ihm wieder die Flucht, und er ließ ein Polen zurück, das sich Hoffnungen auf eine Zukunft machen konnte.
Ein solches Polen hatte es immer gegeben, doch war die reale Unterdrückung zu brutal gewesen. Er hatte sie in seiner Kindheit am eigenen Leib und an der eigenen Seele erlebt, als Leidensgenosse seiner Eltern, als überlebendes Waisenkind, das keine feste Bleibe hatte und auf wohltätige Verwandte angewiesen war. Er wurde in ein zerfetztes und imaginäres Polen hineingeboren und stammte von Eltern ab, die eine revolutionäre Vision hatten: die Wiederherstellung des verlorenen Landes gekoppelt mit einer sozialen Reform, zu der eine Landreform und die Abschaffung der Leibeigenschaft gehörten. Dadurch waren sie dem zaristischen Staat in doppelter Hinsicht gefährlich. Welche Eltern eines Autors waren auf derartige Weise in die Geschichte ihres Landes verwickelt, so daß das Private sich überhaupt nicht mehr vom Öffentlichen trennen ließ? Allerdings hat Polen viele ähnliche Schicksale hervorgebracht.
Auf einer Konferenz über Conrad im Juli 2005 stellte eine ukrainische Referentin die Frage zur Diskussion, wo Conrad denn eigentlich geboren sei. Wenn man die Lexika konsultiere, so sei dort meist die Rede von Polen, von der polnischen Ukraine oder sogar Rußland. Für sie sei die Sache jedoch klar, es müsse heißen: Ukraine. Doch ganz so einfach ist es nicht. Heute, aber erst seit der Auflösung der Sowjetunion, gibt es einen Staat namens Ukraine. Zuvor war sie Teil des russischen Imperiums und unterstand dem Zaren, auch wenn es eine sprachliche und kulturelle Ukraine schon gab. Das Territorium, in dem Berdychiv liegt, gehört zum östlichen Wolhynien, das bis zur zweiten Teilung Polens durch die Mächte Rußland, Preußen und Österreich Teil von Polen und Litauen war. Die Bevölkerung war jedoch in der Mehrheit ukrainisch, die Polen bildeten die herrschende Oberschicht. Immerhin war es eine aufgeklärte Oberschicht, denn schon seit Jahrhunderten gab es in der polnischen Aristokratie eine Tradition der Toleranz. Die herrschende szlachta, eine Oberschicht, die nicht deckungsgleich mit unserem Adel ist, prägte die Kultur und Politik des Landes. Es gibt einige Dinge über Polen, die man als Mitteleuropäer, gar Deutscher zur Kenntnis nehmen sollte. Polen war über Jahrhunderte der größte und mächtigste Staat in Europa und neben der Schweiz auch der liberalste. Er ist zugleich der östlichste Staat Europas mit lateinischer Schrift. Die polnische Kultur hat immer wieder die Nähe zu Frankreich gesucht, und in mancher Hinsicht waren Ideale der Französischen Revolution und des Parlamentarismus Errungenschaften in Polen, bevor sie andere Staaten Europas erreichten. Es ist kein Zufall, daß der Begriff inteligencja zunächst, nämlich um 1820, in Polen entstanden ist, bevor er über Rußland den Weg in westliche Sprachen fand. Wenn also von polnischen Nationalisten im 19. Jahrhundert die Rede ist, so dürfen wir nicht die Werte vergessen, die sie mit ihrem Land verbanden und die nicht – oder zumindest nicht allein – mit Machterhalt zu tun hatten: Toleranz, Aufklärung, Beendigung der Leibeigenschaft, Bildung, Ansätze zu demokratischem Denken und Handeln. Sie verbanden sich mit Werten, die ihren aristokratischen Ursprung nicht verleugnen konnten: Ritterlichkeit, Treue, Tapferkeit.
Drei Teilungen mußte Polen erleiden: 1772, 1793 und 1795, dann war es endgültig von der Landkarte verschwunden. Aber nicht aus den Herzen, den Traditionen und Gedanken; aus der Gegenwart vielleicht, doch aus der Zukunft niemals. In den Zeiten der Teilung wurde die Kultur, insbesondere die Literatur, zu einer zweiten, unsichtbaren Heimat der Polen. Literarische Figuren, Heldengedichte und Tragödien, wie sie von den Dichtern Mickiewicz oder Slowacki erschaffen wurden, demonstrierten, wie sehr ein Land als politische Möglichkeit von der Imagination abhängt und eine politische Idee ohne diese zum Tode verurteilt ist. Man sollte hinzufügen, daß die Polen in den von Rußland und Preußen besetzten Gebieten besonders litten. Im preußischen Teil Polens versuchte man nach Unruhen in den 1840er Jahren, eine Germanisierung der Polen durchzusetzen. Jenem preußischen König, nach dem Nietzsches Vater seinen Sohn benannte, Friedrich Wilhelm IV., gelang es nicht, aus den Polen gute Preußen zu machen. Im Gegenteil, der Widerstand wurde durch solche Versuche erst angefacht, wenn auch weniger stark als in den russisch besetzten Gebieten. Im österreichisch besetzten Teil wurde zumindest dem polnischen Adel eine größere Freiheit gewährt.
Der Ort, an dem Conrad als Kind polnischer Eltern am 3. Dezember 1857 geboren wurde, liegt also in der heutigen Ukraine, westlich von Kiew. Er heißt ukrainisch Berdychiv, auf polnisch Berdyczów. Grob gesagt gab es Mitte des 19. Jahrhunderts drei politische Richtungen unter den Polen der besetzten Gebiete. Auf der einen Seite standen die revolutionären Kämpfer, die sogenannten ›Roten‹, die nicht nur Polen, sondern auch die Leibeigenen befreien wollten. Diese republikanische Gruppe, zu der Conrads Vater Apollo Korzeniowski gehörte, tendierte zum bewaffneten Kampf. Apollo hatte in St. Petersburg orientalische Sprachen, Recht und Literatur studiert. Mit der Niederlage im Krimkrieg war die Macht des Zaren geschwächt, und es kam zu Unruhen in der bäuerlichen Bevölkerung der Ukraine. Die Aufständischen wurden 1855 trotz des passiven Widerstands brutal niedergeschlagen. Der polnische Adlige Korzeniowski mußte dies mit ansehen, und sein Herz war auf seiten der Ukrainer. Die zweite Gruppe im politischen Spektrum waren die Opponenten der Revolutionäre, die ›Weißen‹, die das alte polnische Königreich mit den traditionellen Sozialstrukturen und Hierarchien wieder errichten wollten und dabei auf ausländische Unterstützung, vor allem aus Frankreich und Großbritannien hofften. Die dritte Gruppe schließlich waren die Befürworter eines Kompromisses. Sie wollten ihre polnische Identität innerhalb der Grenzen Rußlands pflegen und hielten nichts von antirussischer Propaganda und Gewalt. Zu dieser Gruppe gehörte Conrads Onkel mütterlicherseits Tadeusz Bobrowski. In den Familien von Conrads Eltern Ewa (geb. Bobrowska, 1832–1865) und Apollo Korzeniowski (1820–1869) stießen die antagonistischen Parteiungen der Weißen und Roten aufeinander. Die vorherrschende Stimmung bei den Bobrowskis war eine neutrale Einstellung zur Politik, wie Tadeusz in seinen Briefen und Memoiren immer wieder herausstellte, um sich und seinen Familienzweig von den Korzeniowskis abzugrenzen. Apollo war dieser Unterschied bekannt, er widmete seinem künftigen Schwager ein Gedicht, in dem es heißt: »Dein Steuer ist Vernunft,/Dein Segel Willenskraft.« Es gab allerdings auch Ausnahmen auf der Bobrowski-Seite, etwa den Bruder Stefan, der ein prominenter Roter war.
Der Vater Apollo Korzeniowksi im Jahr 1862
Die Mutter Ewa Korzeniowksa im Jahr 1862
Die Bobrowskis waren insgesamt gegen die Heirat Ewas mit Apollo. Apollo gehörte zur szlachta ebenso wie Ewa, beide entstammten Gutsbesitzerfamilien. Seine Bemühungen um die schöne und intelligente Ewa fruchteten erst nach dem Tod des alten Bobrowski. Am 4. Mai 1856 heirateten sie in Oratów, dem Gut von Ewas Großvater. Apollo pachtete einen Hof, war aber nicht besonders erfolgreich in der Bewirtschaftung. Es fehlte ihm das wirkliche Interesse; das hegte er vielmehr für Politik und Literatur, und zwar mit Leidenschaft. Schließlich wurde den beiden am 3. Dezember 1857 im Hospital von Berdychiv ein Kind geboren. Das Krankenhaus ist heute verschwunden, aber das angrenzende Kino und die Apotheke sind noch zu sehen. Genau an der Stelle, wo Joseph Conrad geboren wurde, steht heute ein aufstrebender Lenin in rotem Stein. Ewa und Apollo tauften ihren Sohn auf den Namen Józef Teodor Konrad Korzeniowski mit dem Wappen der Nałęcz. Namen sind in den Werken von Conrad mindestens genauso wichtig wie in seinem Leben. Seine Vornamen enthalten eine Information, die sein Leben bestimmen sollte. Den Namen Józef gab man ihm, um an den Großvater mütterlicherseits zu erinnern, und damit verbunden waren eine anti-romantische, aufgeklärt-konservative Haltung, Neutralität und Nüchternheit. Der Name Teodor wurde vom Großvater väterlicherseits übernommen, und Teodor stand für Patriotismus und ehrenvollen Dienst in der polnischen Armee, Tapferkeit und Leidenschaft. Der dritte Name, Konrad, hatte für alle gebildeten Polen Signalwirkung. Er war dem Werk des Nationaldichters Adam Mickiewicz entnommen, und zwar der Versdichtung Konrad Wallenrod (1828) sowie dem Versdrama Dziady (Die Totenfeier, 1822/23). In Konrad Wallenrod geht es um die Befreiung der Polen vom Deutschen Ritterorden, wobei der Verrat eine wichtige Rolle spielt. Im Zentrum von Dziady steht ein träumerischer Junge, der sein Leben und auch seinen Namen ändert, als die nationale Pflicht ihn ruft. Es ist, als beträten wir schon vor der Geburt des Autors seine Welt, von ferne her atmet man hier die Atmosphäre Conradscher Romane. Auch die Namen sollten prägen, erinnern, Mut geben, anspornen, gewissermaßen als historische Mantras. Der für Conrad später so wichtige Onkel Tadeusz hieß mit vollem Namen Tadeusz Wilhelm Jerzy Bobrowski, weil sein Vater zur Zeit der Geburt eine Biographie von George Washington las. So ist der erste Vorname Hinweis auf den polnischen Nationalhelden Tadeusz Kos´ciuszko, der im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf seiten der Amerikaner kämpfte, Wilhelm erinnert an Wilhelm Tell, und Jerzy verdankt sich George Washington selbst. Conrads Name sollte in den fremden Umgebungen seiner Zukunft noch mancherlei Transformation und Verballhornung erleben, bis er sich für das einfache Joseph Conrad entschied. Im Tod holte ihn die Verballhornung wieder ein, denn bis heute steht auf seinem Grabstein eine Mischung aus seinem englischen und polnischen Namen einschließlich eines Schreibfehlers: Joseph Teador Conrad Korzeniowski.
Als Conrad getauft wurde, widmete ihm sein Vater ein Gedicht:
»Meinem Sohn, der im 85. Jahr der Moskowitischen Unterdrückung geboren wurde, ein Lied zum Tag seiner Taufe.« Nach sechs Strophen, in denen er dem Sohn Mut zuspricht und die Heiligkeit der Taufe preist, heißt es in den beiden letzten:
Söhnchen, erzähle dir
Daß du ohne Land bist, ohne Liebe,
Ohne Nation, ohne Volk,
Solange Polen – deine Mutter tot liegt in ihrem Grab.
Denn deine einzige Mutter ist tot – und doch
Ist sie dein Glaube, deine Märtyrerpalme.
Schlaf, mein Söhnchen, schlaf!
Söhnlein ohne …
Ohne sie …
Ohne sie …
Und keine Erlösung ohne sie!
Die Zeit wird kommen, die Tage werden vergehn,
Dieser Gedanke wird deinen Mut stärken,
Ihr und dir Unsterblichkeit geben.
Schlaf, mein Söhnchen, schlaf!
Apollo versucht Mut zu machen, aber das dem Söhnchen zugesteckte Bild, von einer Mutter geboren zu sein, die tot in ihrem Grab liegt, verlangt einen lebenslangen Kampf gegen das eigene Fatum. Unsere Vorstellung von Apollo ist stark geprägt von der wichtigsten Quelle, die wir über die frühen Jahre Conrads haben. Es sind die Briefe und Memoiren seines späteren Vormunds Tadeusz Bobrowski, der aus seiner Kritik und fehlenden Sympathie für seinen Schwager keinen Hehl machte. Es gibt jedoch Hinweise, die Korrekturen an diesem negativen Bild ermöglichen. Nach Tadeusz war Apollo ein gescheiterter Mann, ein hoffnungsloser Romantiker wie sein Vater Teodor und sein Bruder Hilary – »Utopisten«, Goldsucher und politische Spinner. Wie diesen Verwandten, schreibt Bobrowski, gelang es Apollo nicht, auf dem Boden der Realität zu bleiben, er konnte sein Gut Derebczynka nicht führen, verschuldete sich und verbrauchte dazu noch die Mitgift seiner Frau. Vielleicht schwingt hier ein Schuldvorwurf mit, nämlich, den Tod der geliebten Schwester Ewa durch seine politischen Irrtümer mitverursacht zu haben. Ewa jedoch war politisch genauso leidenschaftlich beseelt wie ihr Mann. Nach dem Scheitern in der Landwirtschaft zog die Familie nach Zhytomyr (poln. ZŻytomierz), dem kulturellen Mittelpunkt der Provinz, etwa hundert Kilometer westlich von Kiew. Hier war Apollo mit Tadeusz zur selben Schule gegangen, in einem Gebäude, das der Gräfin Ewa Han´ska gehörte. Hier gab es auch ein Theater, das Apollos Stücke brachte. Korzeniowski wollte sich nun ganz der Literatur und Politik widmen, denn als Schriftsteller hatte er sich erste Meriten erworben. Er hatte zwei allgemein gelobte satirische Komödien geschrieben (von denen noch heute eine gelegentlich gespielt wird) und einige patriotische und revolutionäre Gedichte verfaßt, mit denen er sich Gewicht bei seinen ›roten‹ Freunden verschaffte. Außerdem übersetzte er französische Literatur, vor allem Victor Hugo.
Bald aber geht Apollo nach Warschau, denn er weiß, daß sich hier etwas anbahnt. Er kauft eine Zeitschrift auf, die er umwandelt zu einem polnischen Ebenbild der bewunderten Pariser Revue des Deux Mondes, und er bewegt sich in revolutionären Kreisen. Währenddessen wohnt Ewa mit dem kleinen Konradek bei Verwandten in Nowofastów oder bei ihrer Mutter in Terechova bei Berdychiv. Der Kleine ist beliebt bei den Leuten, schreibt sie in Briefen, die auf heimlichen Wegen zu Apollo gelangen, jeder liebt ihn. Wie alle anderen will er schwarze Kleidung anlegen aus Trauer über das Vaterland. In den Kirchen wird immer wieder eine nationale Hymne angestimmt, das ist sehr gefährlich. Ständig werden Mitbürger verhört oder verhaftet und deportiert, ins südrussische Tambow oder nach Sibirien. Der kleine Konradek, schreibt sie weiter, geht mit in die Kirche, und wenn es ihm zu langweilig wird, geht er hinaus, um mit den Armen zu sprechen, die um die Kirche herum lagern und betteln. Ich will mit den Armen reden, sagt er dann, weil ich die sehr gern hab. Konradek selbst legt seinen ersten uns bekannten Brief bei, den er wohl unter Anleitung der Mutter oder Großmutter geschrieben hat. Er ist auf den 23. Mai 1861 datiert:
»Pappa, mir geht es gut hier, ich laufe im Garten herum – aber ich mag nicht, wenn die Mücken stechen. Sobald der Regen aufhört, werde ich zu dir kommen. Olutek hat mir eine schöne kleine Peitsche geschenkt. Bitte Pappa lieber leih mir ein paar Pfennige und kauf was für Olutek in Warschau. Hast du diesen Bozia [Verniedlichung von ›Gott‹, also Göttchen] gesehen, über den Oma [mir erzählt hat]? Konrad.« Es gibt ein Foto von ihm, wie er als Vierjähriger mit dieser kleinen Peitsche vor einem Sitzmöbel steht. Peitschen finden sich heute nur in Randbereichen der Gesellschaft, gehörten aber damals zum Inventar männlicher Erziehung in ganz Europa. Auch der vierjährige Kafka wird dreißig Jahre später noch mit einer Peitsche fotografiert. Wir wissen nicht, wer Olutek ist, und vermuten, daß mit »Bozia« ein berühmtes Kruzifix in der Kathedrale Warschau gemeint ist. Die Mücken aber stechen heute noch in Terechova. Großmutter Teofila liebte ihr Enkelkind sehr, sie ahnte wohl, daß er ein ungewöhnlicher Mensch werden würde.
Währenddessen nimmt Ewa intensiv Anteil an dem, was in Warschau geschieht, reicht Informationen und Warnungen weiter und weiß sich ihrem Mann in tiefster Liebe verbunden. Dann kommt der Schlag: Apollo ist verhaftet worden und sitzt mit vielen anderen Patrioten gefangen in der Warschauer Zitadelle. Nachts sind die russischen Polizisten gekommen und haben Reformer und Revolutionäre verhaftet, unter ihnen dreißig katholische Priester, ein Dutzend Rabbiner, drei protestantische Pfarrer, insgesamt mehrere Hundert. Ewa begibt sich nach Warschau, erhält aber keinen Zutritt zu ihrem Mann. Sie kann ihm ein Gebetbuch schicken und ein Lehrbuch für Englisch. Einmal dürfen die Frauen ihren Männern durch einen Drahtzaun hindurch die heilige Hostie reichen. Im selben Jahr, 1861, wird auch Ewa des Hochverrats angeklagt. Die vier Punkte der Anklageschrift – Kontakte mit Aufständischen, Verfassen von Proklamationen, Verursachung von Aufruhr, Organisation von Gebeten für Opfer der russischen Repressalien – sind im Detail nicht korrekt, doch der zaristische Apparat wußte, welch einen Feind er in den Korzeniowskis hatte, und schickte die Familie in die Verbannung nach Perm in den Ural. Die Reise ins Exil beginnt am 8. Mai 1862.
Ein bewegender Abschied von der Großmutter, die halb blind auf die Scheidenden schaut. Die Kutsche ist merkwürdig geformt. W.G. Sebald, der Conrad in Die Ringe des Saturn einige Seiten widmet, notiert dieses Bild, das durchaus seine eigene Welt darstellt: »Das Kutschengehäuse selbst hängt niedrig zwischen den Rädern wie zwischen zwei für immer auseinandergeratenen Welten.«
Der Gouverneur von Perm war ein Schulkamerad von Apollo und erbat sich eine Verlegung, denn er wollte die Korzeniowskis nicht hier am Ural haben. So war das neue Ziel Wologda, knapp 500?Kilometer nördlich von Moskau, einer der verlassensten und kältesten Orte Rußlands. Der kleine Konrad bekam eine Lungenentzündung auf dem Weg, dann hatte Ewa einen Zusammenbruch, doch wurde die Gruppe der Verbannten mit ihrer Eskorte grausam weitergeschickt. Erst in Nishnij Nowgorod gab es ein paar Tage Pause, in denen sie ein wenig Kräfte sammeln konnten. Am 12. Juni erreichte die kleine Gruppe Wologda, nach einer anstrengenden Schlittenfahrt, die von der warmen Ukraine in den kalten Norden führte. Zum Glück war der dortige Gouverneur – ein Pole – human eingestellt und machte den Korzeniowskis wie auch den anderen Verbannten das Leben nicht zusätzlich schwer. Das Klima war schlimm genug. In Wologda, schrieb Apollo an Freunde, gibt es zwei Jahreszeiten: den weißen Winter und den grünen Winter. Eisige Winde wehen hier vom Weißen Meer, die Kälte sinkt auf minus dreißig Grad. Die Stadt, die an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt liegt, war schon seit Jahrhunderten für Verbannte genutzt worden. Unter anderem wurden Nikolai Berdjajew, Alexei Remisow und Anatoli Lunatscharski nach Wologda geschickt. Noch in Solschenizyns Der Archipel Gulag (1973) wird das Gefängnis der Stadt erwähnt. Aber es gab auch das Gerücht, daß Iwan der Schreckliche sie einst zur Hauptstadt seines Reiches machen wollte. Mit dem Aufstieg von St. Petersburg verfielen jedoch die Macht und der Glanz, der andeutungsweise einmal vorhanden gewesen sein mußte. Sichtbar war dies um 1860 noch an den vielen Kirchen; die Stadt besaß fünfzig Gotteshäuser für etwa 17000 Einwohner. Es gab auch eine römisch-katholische Kapelle, die den zwanzig polnischen Verbannten für die Messe diente. Anfang 1863 durfte die Familie wieder in die Ukraine zurück, in die Nähe von Kiew. Doch die Ereignisse in Warschau spitzten sich zu. Im Januar 1863 erhoben sich Teile der polnischen Bevölkerung gegen die russische Herrschaft, doch nach anfänglichen Erfolgen wurden die Polen brutal niedergeschlagen. Die Repressalien gegen das Volk hörten nun gar nicht mehr auf. Immerhin hatte die Untergrundregierung ein wichtiges Zeichen gesetzt für Demokratie, Freiheit und die eigene Nation. Man hat diesen Aufstand in seiner Bedeutung für die polnische Geschichte mit dem amerikanischen Bürgerkrieg verglichen. Eine ganze Reihe von Verwandten Ewas und Apollos starben in der Folge dieser Kämpfe. Aus dieser Zeit ist ein weiteres Schriftstück erhalten,
in dem wir etwas über den kleinen Konrad erfahren. Auf die Rückseite einer Fotografie hat er eigenhändig geschrieben:
»An meine geliebte Großmutter, die mir half, meinem armen Vater im Gefängnis Kuchen zu schicken – Enkelsohn, Pole, Katholik, Edelmann – 6. Juli 1863 – Konrad.« Das Foto wurde in Wologda von einem polnischen Fotografen gemacht. Wir wissen sehr wenig über Konrad in dieser Zeit, aber diese Zeilen geben den Blick frei in einen Abgrund.
Konrad Korzeniowski im Alter von vier Jahren.
Die Verzweiflung der Verbannten wuchs, und Ewas Tuberkulose wurde schlimmer. Man ließ sie mit ihrem Sohn zu ihrem Bruder Tadeusz nach Nowofastów reisen, beorderte sie aber wenige Wochen später zurück nach Chernichiv. Konrad lernte bei diesem Besuch seinen Großonkel Mikolaj Bobrowski kennen, der auf seiten Napoleons gekämpft hatte, so in der Völkerschlacht bei Leipzig.
In diesen schlimmen Monaten kommt Apollo zumindest mit seinen Übersetzungen von Shakespeare und Victor Hugo weiter. Außerdem schreibt er eine Polemik gegen das Zarenregime: »Polen und Rußland«, in der er Rußland mit einer alles verschlingenden Barbarei gleichsetzt. Der Sohn hat inzwischen Lesen und Schreiben gelernt sowie ein bißchen Französisch. Er beginnt die Literatur zu entdecken, Shakespeare, aber auch Dickens und die polnischen Klassiker, die sein Vater ihm laut vorliest und ihn vorlesen und auswendig lernen läßt.
Am 18. April 1865, im Alter von 32 Jahren, stirbt Ewa Korzeniowska an Tuberkulose. Konrad ist zu diesem Zeitpunkt siebeneinhalb Jahre alt. Apollo erleidet einen Zusammenbruch, und nur der Gedanke an den kleinen Sohn richtet ihn mit der Zeit etwas auf. Gleichzeitig entwickelt er einen mystischen Hang, der sich auf merkwürdige Weise mit seiner bekannten ironisch-sarkastischen Haltung vermischt. Konrad wohnt im Sommer 1866 bei der Großmutter und dem Onkel Tadeusz Bobrowski. In dieser Zeit trifft er vermutlich den legendären Prinz Roman Sanguszko, jenen Veteran aus dem polnischen Aufstand von 1830/31, dem er später die Erzählung »Prinz Roman« widmen sollte. Allerdings ist er in diesen Monaten viel krank. Was wissen wir, was er als Kind in diesen Jahren alles durchgemacht hat – körperlich wie seelisch? Er hat Migräne, nervöse Anfälle und vielleicht Epilepsie, der Vater spricht auch von Blasensteinen. Später erwischen ihn die Masern. Eine ganze Serie der unterschiedlichsten Krankheiten, die ihn sein Leben lang verfolgen werden, hat in dieser Zeit ihren Ursprung. Sie werden ihn in den nächsten Jahren auch daran hindern, eine ordentliche Schule zu besuchen. Mit dem Onkel Tadeusz macht Konrad eine Reise, auf der er zum ersten Mal ein Meer sieht, das Schwarze Meer bei Odessa. Dem Vater geht es währenddessen immer schlechter. Die Ärzte raten zu einem Aufenthalt in Madeira oder Algerien, doch gelingt es Vater und Sohn nur, bis ins damals österreichische Lemberg (poln. Lwów, ukr. Lviv), der Hauptstadt Galiziens, zu kommen. Die Tochter eines Arztes aus Lviv erinnerte sich später an einen fröhlichen Elfjährigen und an dessen Rezitierkunst. Er konnte lange Abschnitte aus Mickiewicz’ Werken aufsagen und zeigte erste Fähigkeiten im Schreiben. Er muß in dieser Zeit patriotische Dramen geschrieben haben, wohl auch kleine Komödien oder Sketche, die er mit anderen Kindern aufführte. Gewaltig konnte er sich ärgern, wenn die Kinder ihre Rollen nicht gelernt hatten. Oft stellte man heroische Schlachten von Polen gegen Russen nach. Apollo wollte allerdings nicht, daß sein Sohn hier zur Schule ging, weil er die starke Germanifizierung des Unterrichts ablehnte, und so wurde er selbst sein wichtigster Hauslehrer. Also zogen sie weiter, nach Przemys´l, schließlich in die kulturelle Hauptstadt des westlichen Galizien, nach Krakau. Apollo arbeitete noch an der neuen Zeitschrift Kraj (Land), doch ging es gesundheitlich immer weiter bergab. Bald war er bettlägerig. Conrad erinnert sich später, daß sein Vater alle seine Manuskripte verbrannt habe, doch das ist nicht der Fall. Apollo übergab sie vielmehr seinem Freund Stefan Buszczyn´ski. Es sind die Manuskripte, die Conrad im Juli 1914 in der Jagellonischen Bibliothek in Krakau von Józef Korzeniowski gezeigt wurden.
Für den nun elfjährigen Konrad bricht ein anderes Leben an, als sein Vater am 23. Mai 1869 stirbt. Doch zunächst muß er durch einen Korridor der Trauer, durch das tiefste Tal, das sich für den Vollwaisen denken läßt. Die Beerdigung wird zu einem inoffiziellen Staatsakt, denn Apollo Korzeniowski steht für Polen, die Verzweiflungen und Hoffnungen eines ganzen Landes. Der Sohn geht an der Spitze einer Prozession von mehreren tausend Trauernden. In der Erinnerung an seinen Besuch von 1914, den er in seinem Essay »Poland Revisited« (1915) beschreibt, finden sich eindrückliche Seiten über diese schlimmen Wochen und Monate. Er sieht sich im Winter 1868 abends zurückkehren von der Schule? – es ist nicht sicher, daß er wirklich eine Schule besuchte in dieser Zeit – und in ein altes geräumiges Haus am Großen Platz eintreten. Dort sitzt er in einem weiten Zimmer bei zwei Kerzen an einem kleinen Tisch und macht die Hausaufgaben. Hinter einer hohen weißen Tür, die manchmal aufgeht, um eine Nonne hindurchzulassen, liegt der todkranke Vater. Es wird wenig gesprochen, alles um mich herum, schreibt Conrad, war Pietät, Resignation und Schweigen. Ich weiß auch nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht ein lesender Junge gewesen wäre.
Das Lesen muß ihn in dieser Zeit gerettet haben, auch wenn die Nonnen sanft versuchen, ihm bestimmte Bücher zu verbieten. Später am Abend dann geht er noch einmal auf Zehenspitzen in das Zimmer hinter der weißen Tür, um dem Vater Gute Nacht zu sagen, auch wenn dieser oft gar nichts mehr wahrnimmt. Meist weint der Junge sich dann in den Schlaf. Als der Vater starb, schreibt Conrad, habe ich wohl keine einzige Träne gefunden, die ich hätte verschütten können. Der Sohn muß wie gelähmt gewesen sein, und während der großen Beerdigung, als alle Blicke auf ihm lasteten, kam ihm immer nur ein kurzer Satz in den Kopf, es ist getan, es ist beendet, und auf polnisch ist er noch kürzer, ein Satz, der umgeben ist von einer riesigen Gefolgschaft, von einem schwarzen schwankenden Gefährt, Gesängen und Geistlichen, Flammen und Kerzen, und an den Straßenseiten steht die halbe Bevölkerung der Stadt in Ehrerbietung und Trauer.
In jener Sommernacht 1914 steht er mit seinem eigenen Sohn auf dieser Straße, der Krieg hat begonnen, es ist wie eine Straße der Katastrophen, und da er das Gefühl hat, von den Schatten der Vergangenheit verschlungen zu werden, sagt er, laß uns zum Hotel zurückgehen, es wird spät, mein Sohn.
Najder, Zdziszlaw (Hg.). Conrad under familial eyes. Cambridge: University Press 1983.
Napoleon und das Hundefleisch
Kein besserer Ort, sich der Geschichte zu entziehen, als Borneo, dieser Archipel fern von England, Polen, Europa. Und doch ist diese Inselwelt ein imaginäres Abbild jener Welt im Schatten Napoleons, in der die zwei Generationen vor Conrad lebten. Noch sein eigenes Leben wird ihm als ein Echo aus dieser Zeit erschienen sein. In seinem letzten, Fragment gebliebenen Roman Spannung – 1925 in fünf verschiedenen Ausgaben erschienen – beschreibt er die Stimmung eines Europas, auf dem ein kaum erträglicher Druck liegt: die Möglichkeit einer Rückkehr Napoleons aus Elba. Ein junger Engländer, der sich die militärischen Sporen im Spanienfeldzug erworben hat, macht nach Aufhebung der Kontinentalsperre seine Grand Tour, die ihn in das österreichisch besetzte Genua führt. Napoleon sitzt auf Elba fest, doch seine Zeit könnte wiederkommen. Das hoffen Italiener, die von einer Republik träumen, und so manche andere, die eine neue Welt ersehnen. Hautnah erlebt dieser Cosmo Latham das schwelende Feuer von Unruhe und Verschwörung in der Hafenstadt. Zudem wird er in eine aufglimmende Liebesgeschichte hineingezogen, die möglicherweise eine unbewußt inzestuöse Note hat. Alles steht hier auf der Kippe: Politik wie Gefühl, Lebenslauf wie Gang der Geschichte. Die Stimmung erinnert an den Vorabend des Ersten Weltkriegs in der k.u.k. Monarchie: Komplikationen, die sich in der Architektur ausdrücken, den Korridoren und Schachtelungen der Paläste, den Geheimtüren und Vorhängen, den Hafenkneipen und Gassen der Stadt, in denen die Gerüchte die Spannung in die Höhe treiben – doch dann bricht das Fragment ab. Ford Madox Ford hat später versucht, eine Fortsetzung mit A Little Less Than Gods – A Napoleonic Tale (1928) zu schreiben. In Conrads Welt liegen Verschwörung und Reaktion miteinander im Kampf, unbekannte oder nur zu ahnende Kräfte und Bestrebungen fördern Intrige, Spionage, Hoffnungen und Ängste und insgesamt eine Unübersichtlichkeit, die den geschichtlichen und individuellen Moment kennzeichnet. Eigentlich ist es ein Moment, der für kurze Zeit aus der Geschichte herausgenommen ist und darauf wartet, wieder in sie hineinzufallen – eine Geschichtspause, in der die historische Dynamik, das Ineinandergreifen der Kräfte ganz plötzlich sichtbar wird, bevor diese sich wieder in einer gefundenen Bahn auflösen. Das alles ist nur möglich, weil ein einziger Mann – Napoleon – einen ungeheuren Druck auf die politische Vorstellungskraft seiner Zeit ausübt.
Im Heer Napoleons, unter der großen polnischen Hoffnung, dem Marschall Poniatowski, kämpfte auch Mikolaj Bobrowski, der erwähnte Großonkel Joseph Conrads mütterlicherseits. Er hatte an Napoleons Rußlandfeldzug gegen Moskau und den anschließenden Kämpfen von 1813–14 teilgenommen und in seinen Erzählungen dem jungen Conrad einen wichtigen Wink gegeben. Mikolaj Bobrowski, das ist für den Jungen eine Persönlichkeit, die mit weißen Haaren und einer edlen Nase aus dem Nebel der Geschichte auftaucht, ordenbehangen: Ritter der Ehrenlegion, Träger des Polnischen Ordens für Tapferkeit Virtuti Militari. Ruhm umgibt ihn, der 1813 Leutnant in der französischen Armee war und dort zeitweilig Ordonnanz-Offizier bei Marschall Marmont, einem der größten Mitstreiter Napoleons. Sicherlich verehrt der Knabe den großen Alten, doch es ist nicht der Ruhm, der den entscheidenden Eindruck macht. Dieser wird vielmehr überlagert von komplizierten Gefühlen, die sozusagen die Epoche, Napoleon und Europa widerspiegeln: Mitleid, Abscheu und Schrecken nennt sie Conrad.
Es ist die Erinnerung daran, daß der Großonkel beim Rückzug Napoleons von Moskau einmal einen Hund gegessen hat. Conrad berichtet ausführlich über diesen Vorfall in seinen Lebenserinnerungen Über mich selbst (1908). Die Ausführlichkeit selbst gibt ihm zu denken, er weiß nicht, warum dieses Thema ihn so beschäftigte und immer noch bedrängt als Schrecken. Mikolaj Bobrowski hatte mit zwei anderen Offizieren in einem Schneesturm den Kontakt zur Truppe verloren. Auf der Suche nach Eßbarem in den unendlichen Wäldern Litauens kam man an ein Dorf, in dem Kosaken lagerten. Ein Hund bellte, sie hieben ihm den Kopf mit dem Säbel ab und flüchteten. In ihrem äußersten Hunger brieten sie abends den Hund, ein krankhaft aufgeblähtes Tier. Aber es ist eben nicht der Ekel, jedenfalls nicht in erster Linie, der den jungen und den gealterten Conrad gleichermaßen bewegt. Zumindest sieht er es so und geht im Geiste die abstrusesten und ekelhaftesten Speisen durch, die er auf seinen Seefahrten zu sich nehmen mußte: Hai, Schlange und vieles andere, ja sogar wahnsinnige Kühe (aber das ist ein französisches Wortspiel: »la vache enragée« ist die Bezeichnung für Schweres, das man durchmacht). Es ist schon auffällig – und hat Psychoanalytiker auf den Plan gerufen? –, wie Conrad sich von diesem Hunde-Essen in einem Maße innerlich angesprochen fühlt, daß er betonen muß, nicht er selbst, sondern sein Großonkel habe den Hund verspeist, und der Verwandte war ein Opfer der historischen Umstände und des Hungers. Das Essen eines tabuisierten Wesens ist möglicherweise ein verschlüsselter Ausdruck für die Versuchung des Kannibalismus, und dazu hat Conrad allerdings einiges zu sagen – oder besser: zu verschweigen.
Denn Conrad ist ein Meister des Verschweigens durch Erzählen. In der Geschichte »Falk« (1901), in der ein Skipper um die Hand einer stillen Deutschen irgendwo in Südostasien anhält, führt er diese Kunst auf wunderbare Weise vor. Bevor Falk die Frau heiraten kann, muß er ein Geständnis ablegen. Er sieht sich dazu gezwungen, auf einen Akt von Kannibalismus hinzuweisen, den er in großer Not begangen hat: eine Andeutung nur, aber sie macht schwindlig.
Abgesehen von der psychologischen Funktion, die das Essen von Hundefleisch für Conrad hatte, wirkt die Vorstellung doch erst ganz im historischen Kontext. Das Auffressen auch des letzten, was einem heilig sein kann, entspricht der Gefräßigkeit des monströsen Napoleon, der ganz Europa, wenn nicht die Welt verschlingen wollte. Der Großonkel ist Teil dieses Freßvorgangs: Er aß, so Conrad, den Hund nicht nur, um seinen persönlichen Hunger zu stillen, sondern aus Hunger nach einem Vaterland, wie er einer unterdrückten Nation zukommt, wie er aber auch irregeleitet werden kann von den falschen Leuchtfeuern eines großen Mannes.
Es gibt noch einen anderen Gefräßigen in Conrads Werk. Das ist Kurtz in Afrika, der am Ende als ein einziger gigantischer Mund gesehen wird. Dieser Kurtz ist ein Napoleon, der in den Kongo gezogen ist, ein Produkt des gesamten Europa, vollgestopft mit Idealen und Philanthropie, der am Ende seinem Machthunger verfällt und an dem sich Macht als eine Form von Gefräßigkeit erweist.
Obsessionen hat Napoleon in einigen Erzählungen von Conrad entfacht: in Spannung sind es die italienischen Verschwörer, die den Stern ihres Schicksals in dem Napoleons sehen – ähnlich wie die Polen. Napoleon ist jedoch schon eine mythische Gestalt, die auf einer Insel lauert, die aber vor allem durch Abwesenheit Macht gewinnt. In der Geschichte »Das Duell« (1908) zeigt sich diese Obsession in einer endlosen Folge von Duellen zwischen zwei Offizieren der glorreichen Armee. Einer von beiden ist sein Leben lang dem Kaiser verschworen. Hinter dieser Zerfleischung zweier Menschen steht die Idee, daß Napoleon ein endloses Duell mit Europa geführt habe. »Die Seele des Kriegers« (1917) zeigt einen Russen und einen Franzosen vor dem Hintergrund des Rückzugs von Moskau. Im Roman Der Freibeuter (1923) stirbt jemand für Dokumente, deren Fälschung von Napoleon beauftragt wurde. Ein großer Mann, der aber die Ideale der Menschen zu Fälschungen verkommen ließ. An den Veröffentlichungsdaten von 1901 bis 1925