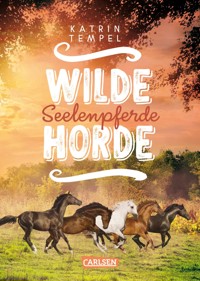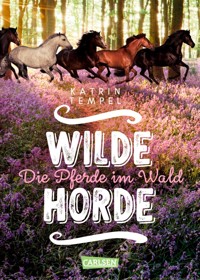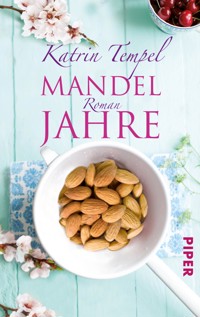9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alte Geheimnisse, neue Hoffnung und der Kampf um Freiheit Berlin, 1945: Nach zehn Jahren kommen die Geschwister wieder in Berlin zusammen. In den Trümmern der Stadt wollen sie eine neue Zeitung gründen. Während Fritjof nach unbelasteten Journalisten sucht, erkennt Vicki, dass es in ihrer Hand liegt, wie sich die neu gegründete Republik entwickelt – und dass ihr Bruder Alexander sein skrupelloses Streben nach Macht nicht verloren hat. In einer Zeit, die von Neuanfängen und alten Lasten geprägt ist, müssen die Geschwister entscheiden, was Vergebung bedeutet und wie sie die Zukunft ihres Landes mitgestalten wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Zeitungsdynastie – Neue Freiheit« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München).
Redaktion: Annika Krummacher
Covergestaltung: t. mutzenbach design, München
Covermotiv: Trevillion Images / Ildiko Neer; ullstein bild / Herbert Maschke; Arcangel (Joanna Czogala; Ildiko Neer); Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
Santa Monica, Juni 1945
Berlin, Juli 1945
In der Nähe von Regensburg, Juli 1945
Berlin, Juli 1945
Berlin, August 1945
Berlin, September 1945
In der Nähe von Regensburg, September 1945
Berlin, September 1945
Berlin, Oktober 1945
Nürnberg, November 1945
In der Nähe von Regensburg, November 1945
Berlin, November 1945
Nürnberg, Dezember 1945
Berlin, Dezember 1945
Berlin, Februar 1946
Nürnberg, März 1946
In der Nähe von Regensburg, Oktober 1946
Berlin, Oktober 1946
Berlin, Dezember 1946
In der Nähe von Regensburg, April 1947
Berlin, April 1947
Berlin, Juni 1947
Berlin, August 1947
Berlin, August 1947
Berlin, August 1947
Berlin, September 1947
Berlin, Oktober 1947
Berlin, November 1947
Berlin, November 1947
Berlin, November 1947
Berlin, Dezember 1947
Berlin, Dezember 1947
Berlin, Dezember 1947
Berlin, Dezember 1947
Berlin, Januar 1948
Berlin, März 1948
Berlin, April 1948
Berlin, Mai 1948
Berlin, Juni 1948
Berlin, Oktober 1948
Hamburg, November 1948
Berlin, Mai 1949
Nachwort
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Georg und Emma
Er atmete tief durch. Es roch schwach nach verbranntem Schwefel. Die Pistole fühlte sich fremd und kalt in seiner Hand an. Langsam ließ er den Arm sinken und sah auf den Boden.
Er hatte den Mann mitten in die Stirn getroffen, als er gerade aufstehen wollte. Jetzt lag er auf dem weichen Teppich, die Augen weit geöffnet. Er wirkte erstaunt. Als hätte er fest damit gerechnet, unsterblich zu sein. Der Täter wartete einige Atemzüge lang, aber sein Opfer rührte sich nicht mehr.
Langsam drehte er sich um, steckte die Pistole in die Tasche seiner dicken Wolljacke, ging durch den Gang, vorbei an gerahmten Bildern, die große Momente im Leben des Toten zeigten. Er schlüpfte durch die Tür und zog sie sachte hinter sich ins Schloss.
Auf der Straße hielt er inne. Er versuchte zu begreifen, was gerade passiert war. Er hatte einen Mann getötet. Als Soldat waren es nicht selten Dutzende an einem einzigen Tag gewesen. Manche Gesichter suchten ihn noch in seinen Träumen heim, ein paar waren so jung gewesen, dass sie eher an Kinder erinnerten … aber von keinem kannte er den Namen.
Das war jetzt anders. Machte ihn das zum Mörder?
Langsam ging er los. Es dauerte eine Weile, bis er merkte, dass er den Weg zum Verlagshaus eingeschlagen hatte. Er blieb stehen. Was sollte er da? Niemand wollte ihn dort sehen, das hatten sie ihm klar und deutlich vermittelt.
Verächtlich schüttelte er den Kopf. Worauf hoffte er? Auf ein Lob, ein anerkennendes Nicken oder gar Dankbarkeit? Das würde nicht passieren, dafür wog die Vergangenheit zu schwer.
Er lief weiter durch die dunklen Straßen, bis er irgendwann vor einem dunklen Gebäude stand. Nur in einem Fenster weiter oben brannte Licht. Er sah eine Frau, die sanft ihr Baby wiegte. In einem anderen Leben war sie seine Verlobte gewesen. Aber jetzt? Das Kind war nicht von ihm, und es war auch nicht seine Wohnung.
Einen ganz kurzen Augenblick blieb er stehen, hoffte auf ein Zeichen, ein Winken oder einen freundlichen Blick, doch vergeblich. Dann machte er sich wieder auf den Weg. Seine Füße schmerzten. Er sah zum Himmel, aber der erschien ihm noch dunkler als sonst.
Es gab keinen Trost für ihn, nirgends.
Keiner wartete auf ihn, niemand.
Als er einen Kanal erreichte, blieb er stehen und sah hinunter. Das dunkle Wasser gluckerte leise.
Auf einmal erschien es ihm verlockend, sich um nichts mehr kümmern zu müssen. Arbeit, Freunde, Frauen oder Essen – was, wenn ihm all das egal war? Wenn er sich endlich erlaubte, nicht mehr zu hoffen, nichts mehr zu wollen, nichts mehr zu denken?
Er hatte niemals schwimmen gelernt. Warum auch? Es war schwierig genug, das Leben zu meistern, wenn man festen Boden unter den Füßen hatte.
Ohne weiter nachzudenken, ließ er sich über die steile Böschung ins Wasser gleiten. Zu seiner Überraschung fanden seine Füße keinen Grund, er rutschte tiefer, und das kalte Nass schlug über seinem Kopf zusammen.
Erst jetzt spürte er die Kälte. Er japste nach Luft und schluckte Wasser. Strampelte, schlug mit den Armen um sich.
Noch einmal kam er nach oben und ging sofort wieder unter. Mit einer Hand spürte er die glitschige Wand, die den Kanal begrenzte. Aber er fand keinen Halt.
Und sank tiefer.
Schließlich hörte er auf, sich zu wehren und zu kämpfen.
War das Friede?
Der Kanal floss weiter, dunkel und kalt.
Santa Monica, Juni 1945
»Hoch sollst du leben,
hoch sollst du leben,
dreimal hoch!«
Das kleine Mädchen lachte entzückt, als ihre Mutter sie singend durch die Luft schwenkte und schließlich wieder auf die bunt bestickte Decke setzte, die sie auf dem Boden der Terrasse ausgebreitet hatte. Ein Schirm schützte sie vor der kalifornischen Sonne, und eine sanfte Brise vom Meer brachte ihnen die nötige Abkühlung.
Vicki nahm ihre Tochter fest in den Arm und genoss einen Augenblick lang den unvergleichlichen Babygeruch. Der Moment währte nur kurz, dann strampelte die Kleine energisch und forderte ihre Freiheit ein. Sie stellte sich auf, machte ein paar Schritte und hielt sich dann am Geländer fest. Aufgeregt zeigte sie auf die Wellen.
»Schon wieder ans Wasser?« Vicki lächelte und drückte Gretchen den blauen Sonnenhut auf die dunklen Locken. »Aber das ist für heute das letzte Mal! Wir müssen schließlich noch dein Geburtstagsessen vorbereiten. Wenn Papa nach Hause kommt, will er bestimmt mit dir feiern!«
Gretchen schien das egal zu sein. Sie griff nach Vickis Hand und machte sich auf den Weg. Ein paar Treppenstufen nach unten, dann standen sie im weichen Sand. Bei jeder kleinen Muschel blieb Gretchen stehen, ließ sich auf ihren windelgeschützten Po fallen und befingerte den Gegenstand. Meistens wollte sie ihn noch probeweise in den Mund schieben, aber das konnte Vicki verhindern.
Sie liebte diese Momente, in denen ihre Tochter ihr Dinge zeigte, an denen die meisten Erwachsenen achtlos vorbeiliefen. Nur mit einem Kind konnte man die kleinen Details neu entdecken. Die Schönheit einer winzigen Muschel, deren perlmuttschimmerndes Inneres dem flüchtigen Betrachter verborgen blieb. Eine Möwenfeder, die sich in zarter Symmetrie entfaltete. Oder ein Stück Tang, der hier überall vor der Küste wuchs. Der Höhepunkt ihres Ausflugs aber waren die Wellen, die sich wenige Meter vom Ufer entfernt aufbäumten, donnernd überschlugen und dann in langen Zungen auf dem Strand ausliefen. Gretchen bohrte ihre Zehen in den nassen Sand, bewunderte ihre eigenen Fußabdrücke, versuchte ärgerlich, sich die Sandkörner von den Fingern zu reiben, und griff doch sofort wieder hinein.
Plötzlich lachte die Kleine auf und deutete mit dem sandverklebten Zeigefinger auf einen Punkt hinter Vicki. Harry winkte und kam über den Sand auf sie zugelaufen. Das weiße Hemd hatte er aufgekrempelt, die Hose umgeschlagen, und er war barfuß. Vickis Herz schlug schneller, als wäre sie frisch verliebt. Dabei waren sie schon seit zwanzig Jahren ein Paar.
Sie breitete die Arme aus. »Du bist zu Gretchens Geburtstag früher nach Hause gekommen! Wie schön!« Sie küssten sich einen winzigen Moment länger, als es in der Öffentlichkeit schicklich war.
Harry nahm Gretchen auf den Arm. Erst jetzt fiel Vicki auf, dass er ernst aussah.
»Was ist los?«, fragte sie vorsichtig.
Ein fast unmerkliches Kopfschütteln war die Antwort. »Jetzt feiern wir Gretchens Geburtstag. Wir reden, wenn sie im Bett ist.«
Auch später, als sie Hamburger aßen, mit Gretchen die Kerze auf dem Kuchen ausbliesen und sie schließlich nach einem Bad ins Bett brachten, schien er nicht richtig bei der Sache zu sein.
»Ich bleibe bei ihr, bis sie einschläft«, erklärte er. »Du kannst mir schon ein Glas Wein einschenken. Immerhin haben wir etwas zu feiern …«
Vicki nickte. »Ich gehe schon mal auf die Terrasse.«
Wenig später saß sie draußen und blickte aufs Meer hinaus. In der Dunkelheit konnte sie die helle Gischt der Wellen sehen, die unablässig an den Strand schlugen. Darüber glitzerten die Sternbilder, die ihr auch nach so langer Zeit in diesem Land immer noch nicht vertraut waren.
Es dauerte nicht lange, da hörte sie Harrys Schritte. Schweigend setzte er sich neben sie und nahm einen langen Schluck vom kalten Weißwein.
Dann holte er tief Luft. »Der Studiochef hat mich heute zu sich gebeten. Das ist noch nie passiert – bis heute wusste ich nicht einmal, dass er meinen Namen kennt. Er hat mir erklärt, dass es den Filmstudios schlecht geht. Dieses Fernsehen sorgt dafür, dass die Menschen immer mehr Filme zu Hause ansehen und nicht mehr in die Kinos gehen. Klar, im Moment sind das noch nicht so viele Geräte. Aber er ist davon überzeugt, dass irgendwann in jedem Haus so ein Empfangsgerät steht.«
»Und was sollst du dagegen tun?«
»Gegen das Fernsehen? Nichts. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich so eine große Sache wird. Nein, meine Aufgabe soll es sein, mich nach neuen Märkten für amerikanische Filme umzusehen. Sein Plan ist erschreckend einfach: Ich soll als Kontrolloffizier der amerikanischen Armee nach Deutschland. Da soll ich verhindern, dass die deutsche Filmindustrie schnell wieder auf die Beine kommt. Stattdessen sollen die Deutschen lieber Filme aus Hollywood schauen.«
»Du sollst nach Deutschland?«
Harry nickte. »Nach Berlin. Nicht für immer, nur für ein paar Monate.« Er zögerte kurz, bevor er weitersprach. »Er hat mir versprochen, dass sich sein Studio erkenntlich zeigen wird. Und ich bekomme die amerikanische Staatsbürgerschaft, wenn ich für die Armee nach Deutschland gehe.«
»Aber Berlin!« Sie schüttelte den Kopf. »Was sollen wir da?«
»Unsere Zukunft in den USA sichern.« Er sah sie zum ersten Mal an. »Wir sind hier nur geduldete Flüchtlinge. Wenn wir der Regierung aus irgendeinem Grund nicht mehr passen, dann müssen wir wieder gehen. Wir dürfen hier nur sein, weil Fritjof die amerikanische Uniform trägt.«
»Es klingt so, als hättest du dich schon entschieden. Was ist, wenn ich da nie wieder hinwill?«
»Dann muss ich die Anfrage ablehnen«, erwiderte Harry mit ernstem Gesicht. »Aber ich bitte dich darum, dir wenigstens einen Augenblick lang zu überlegen, ob das wirklich eine kluge Entscheidung wäre. Es geht nur um ein paar Monate. Wir würden Fritjof wiedertreffen, er hatte dich doch ohnehin schon vor ein paar Wochen gefragt, ob du ihn nicht beim Aufbau einer deutschen Zeitung unterstützen willst. Du könntest also arbeiten!«
»Als wir damals über das Thema gesprochen haben, war es auch für dich undenkbar, nach Berlin zu gehen«, meinte sie vorwurfsvoll.
»Man wird ja wohl seine Meinung ändern dürfen. Und weißt du, es geht mir auch um Gretchen. Sie ist Amerikanerin, aber sie müsste immer fürchten, dass ihre Eltern ausgewiesen werden. Wenn wir Amerikaner werden, dann kann uns nichts passieren. Ist das nicht ein Opfer wert?«
Schweigend griff Vicki nach ihrem Weinglas. Ihr Herz schlug schneller, und das Blut rauschte in ihren Ohren. Schon beim Gedanken an Deutschland fühlte sie sich wieder wie auf der Flucht.
»Hast du denn gar keine Angst?«, fragte sie schließlich. »Du wärst damals fast von Deutschen erschossen worden. Sie haben uns jahrelang auf die Flucht geschickt. Und ausgerechnet jetzt sollen wir wieder zurück und darauf hoffen, dass sie uns mit offenen Armen aufnehmen?«
»Ich glaube nicht, dass jeder in Berlin ein Verbrecher ist. Und ich muss ihnen ja nicht verzeihen, muss nicht einmal ein Bier mit ihnen trinken. Im Gegenteil: Ich kann in der Hotelbar ausschließlich Amerikaner treffen und mich von den Deutschen fernhalten. In Berlin sind jetzt viele Emigranten, wir sind nicht allein.«
Vicki lachte leise auf. »Du meinst, es ist wie in Prag, wie in Marseille, wie in Mexiko: Wir halten zusammen und träumen von besseren Zeiten? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie sind die überhaupt auf dich gekommen? Du bist doch nicht der einzige deutsche Drehbuchautor?«
»Nein, das nicht. Aber viele der anderen haben schon länger den richtigen Pass. Ach, ich habe keine Ahnung, warum sie sich ausgerechnet mich ausgesucht haben.«
»Vielleicht haben alle anderen abgelehnt?«, schlug Vicki mit einem bitteren Unterton vor. »Wer würde diesen Ort schon freiwillig verlassen? Hier sitze ich mit einem Glas Wein in der Hand, sehe auf den Pazifik und freue mich meines Lebens. In Berlin gibt es nur Nazis, Ruinen und nichts zu essen.«
Eine Weile lang schwiegen sie beide. Vicki versuchte, möglichst tief zu atmen und sich zu beruhigen. Als sie endlich wieder redete, klang ihre Stimme müde. »Ich habe Angst. Ich möchte nicht den Geistern der Vergangenheit begegnen. Die alten Straßen, der Verlag, die Villa unserer Familie – all das weckt so viele Erinnerungen in mir … Und ich weiß nicht, was schlimmer wäre: wenn alles noch unverändert stünde oder wenn nur noch Ruinen von der Geschichte meiner Familie zeugen würden. In Berlin würden wir Menschen treffen, Harry. Menschen, die tatenlos zugesehen haben, wie Menschen wie wir durch ganz Europa fliehen mussten …«
»Und anderen, die alles dafür geben, dass so etwas nie wieder passiert. Liebe Vicki, ich bitte dich nur um einen Gefallen: Lass dir ein paar Tage Zeit, bevor wir diese Chance endgültig ausschlagen. Wenn morgen die Sonne scheint, dann sind die Gedanken an Deutschland vielleicht nicht mehr so schwer zu ertragen. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du es wagst. Für unsere Zukunft.« Er legte seine Hand auf die ihre. »Tust du das für mich? Bitte?«
Ganz langsam nickte Vicki. Sie würde ein paar Tage nachdenken, aber sie wusste schon jetzt: Allein der Gedanke an Berlin sorgte für Beklemmungen.
Claire rührte langsam in ihrem Kaffee. »Und ihr seid euch sicher? Berlin?«
»Sicher? Nein. Ich bekomme Herzrasen, wenn ich nur daran denke. Aber es sind nur ein paar Monate – und dann sind wir echte Amerikaner.« Vicki zuckte mit den Achseln. »Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und spätestens zu Weihnachten sind wir wieder hier.«
»Wie ist denn die Bezahlung?«
Überrascht sah Vicki sie an. »Ehrlich? Das ist deine erste Frage? Willst du gar nicht wissen, wo wir wohnen werden? Das ist nämlich noch nicht geklärt. Aber was die Bezahlung angeht, kann ich dich beruhigen. Die Army ist kein schlechter Arbeitgeber. Wenn wir dann noch die versprochene Beförderung hier in Hollywood dazurechnen, dann lohnt sich der Ausflug sogar.«
Nachdenklich sah Claire auf die Straße, die in der Mittagssonne dalag. Ab und zu kam ein Auto vorbei, dann war wieder Ruhe. Sie fuhr mit dem Finger immer wieder über den Rand der Tasse, bis Vicki sich nicht mehr beherrschen konnte. »Was ist denn los, Claire? Du denkst über irgendetwas nach – und ich glaube nicht, dass es mit unserer Entscheidung für Berlin zu tun hat. Dabei musst du dir keine Sorgen machen: Wir kommen wieder zurück. Wahrscheinlich noch bevor du uns wirklich vermisst.«
»Das ist es nicht«, meinte Claire. »Ich überlege mir, ob ich euch nicht begleiten sollte. Meine Tage hier in Hollywood sind gezählt. Kein Mensch braucht eine alternde deutsche Schauspielerin. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mir etwas Seriöses suche. Harry braucht doch sicher eine Sekretärin in Berlin. Was meinst du?«
Vicki konnte ihre Überraschung nicht verbergen. »Du willst das alles aufgeben? Ehrlich? Was ist mit Oskar? Der will doch bestimmt nicht mit!«
»Na, alleine werde ich ihn hier nicht lassen. Der geht doch vor die Hunde! Ein Ortswechsel tut ihm vielleicht gut. In Berlin kann er die Geister der Vergangenheit bekämpfen.«
»Er ist fünfundzwanzig! Andere Männer in seinem Alter sind längst verheiratet und haben selbst Kinder. Du wirst ihn kaum zwingen können, mit dir zu kommen«, entgegnete Vicki.
»Oskar ist nicht wie andere junge Männer, das ist dir sicher schon aufgefallen. Er redet mit niemandem, möchte sein Zimmer nicht verlassen und ist ständig schlecht gelaunt. Wenn ich ihn hier in Kalifornien lasse, dann kommt er unter die Räder.« Sie seufzte. »Mein Sohn ist allein nicht überlebensfähig, das ist die Wahrheit.«
»Hast du ihm das schon gesagt?« Vicki lachte auf. »Es könnte sein, dass er die Sache ganz anders sieht. Aber das Wichtigste ist doch: Braucht die Army Sekretärinnen in Berlin? Gibt es da nicht jede Menge junger Frauen, die froh sind, wenn sie für die Sieger arbeiten können?«
»Ich frage einfach!«, erklärte Claire. »Immerhin kann ich beide Sprachen fließend und bin eine Emigrantin. Ich hoffe doch, die werden beim Wiederaufbau bevorzugt eingesetzt. Bei uns ist immerhin sicher, dass wir keine Nazis waren!«
»Da hast du recht! Wenn unser Lebenslauf irgendetwas beweist außer unserer Überlebensfähigkeit, dann das. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir gemeinsam wieder in Berlin wären …«
»Weißt du, ob er überlebt hat?« Mit einem Schlag war Claire wieder ernst.
Vicki wusste sofort, von wem sie redete. »Nein, da gibt es keine Neuigkeiten. In Berlin wurde er seit der Bombardierung des Zeitungsviertels nicht mehr gesehen, und das war irgendwann im Februar. Wenn er das überlebt hätte, müsste er doch längst wieder aufgetaucht sein. Fritjof wohnt in unserer Villa in Lichterfelde – da würde Alexander doch sicher anklopfen, meinst du nicht?«
»Er ist klug. Sonst wäre er nicht so gefährlich.« Immer wenn Claire über ihren ehemaligen Mann sprach, klang ihre Stimme bitter. »Er steht wahrscheinlich auf der schwarzen Liste der Alliierten und wird gesucht. Da wäre es doch leichtsinnig, einfach in die Manthey-Villa hineinzuspazieren, meinst du nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass er gar nicht mehr in Berlin ist. Was einen Aufenthalt in der Hauptstadt natürlich sehr viel angenehmer machen würde! Auf eine Begegnung mit ihm kann ich gut verzichten.«
Aus dem Kinderwagen, der neben dem Tisch stand, ertönte ein leises Geräusch. Vicki beugte sich nach vorne und warf einen Blick auf das Gesicht ihrer Tochter. »Sie wacht auf. Ich glaube, wir sollten zahlen. Wenn Gretchen erst einmal richtig laut wird, dann machen wir uns hier keine Freunde.«
Claire ließ ihren Blick durch das Diner schweifen. »Ist ja kaum jemand da, mach dir keine Sorgen. Ihr nehmt sie aber mit nach Berlin, oder? Dann lernt sie wenigstens ihren Cousin kennen!« Alexanders Sohn Hajo wohnte seit Kriegsende bei Fritjof in der Manthey-Villa.
Vorsichtig hob Vicki ihre Tochter, die inzwischen wach war, aus dem Wagen und setzte sie sich auf den Schoß. »Noch bevor sie seinen Namen aussprechen kann, sind wir wieder hier.«
Sie winkte nach der Kellnerin mit dem leuchtend rot geschminkten Mund, um nach der Rechnung zu fragen.
»Aber jetzt solltest du erst einmal herausfinden, ob du wirklich mit uns nach Deutschland kannst«, sagte sie. »Und dann machen wir uns Gedanken über diese Familienzusammenführung in Berlin …«
Als Vicki nach Hause kam, fand sie Harry in der Küche vor einem Stapel Formulare. Er sah nur kurz auf. »Sie wollen am liebsten wissen, ob meine Urgroßmutter Linkshänderin war … dabei kann ich mit nichts dienen außer einem alten deutschen Pass!«
Vicki hob Gretchen aus dem Kinderwagen und setzte sie auf eine Decke. Das kleine Mädchen stemmte sich auf Hände und Knie und krabbelte zu ihrem Vater. Der fuhr ihr mit der einen Hand durch die Haare, während er mit der anderen weiter in den Formularen blätterte. »Wie hat Claire die Neuigkeit aufgenommen?«
»Sie will mit«, erklärte Vicki trocken. »Sie hofft auf einen besser bezahlten Job als bei Metro-Goldwyn-Mayer. Offensichtlich hat sie die Hoffnungen auf eine Karriere als Schauspielerin aufgegeben. Sie meint, dass sie allmählich zu alt ist …«
Fassungslos sah Harry sie an. »Und da kommt sie mit nach Berlin? Was will sie da? Hat sie keine Angst vor den Geistern, die dort in den Ruinen hausen?«
»Ich denke, sie hat mehr Angst vor dem Pleitegeier, der über ihr kreist. Übrigens will sie Oskar mitnehmen. Sie behauptet, er käme allein nicht zurecht.«
»Das dürfte sogar stimmen. Aber wer weiß … vielleicht ist es ja richtig, sich der Vergangenheit zu stellen. Womöglich kannst auch du deinen Frieden mit den letzten Jahren erst dann machen, wenn du wieder in der Villa deiner Eltern bist.«
»Willst du mir deinen Ausflug in die Army jetzt als Therapie verkaufen?« Mit hochgezogenen Augenbrauen sah Vicki ihren Mann an. »Ich dachte, wir sind uns einig, dass ich möglichst wenig von Berlin mitbekomme und wir wieder zurück in Kalifornien sind, bevor Gretchen das erste deutsche Wort sagt?«
Harry nickte. »Ja, aber wir haben beide gelernt, dass wir uns besser nicht auf unsere Pläne verlassen sollten. Bis jetzt kam es in unserem Leben immer anders.«
Berlin, Juli 1945
»Das können Sie nicht mitnehmen!« Jupp Birnbaum stellte sich dem russischen Soldaten in den Weg. »Dieses Teil gehört zu der Maschine dort drüben in der Ecke. Die ist jetzt schon kaputt, und ohne dieses Teil wird sie endgültig wertlos. Ich bin hier der Betriebsleiter, Sie müssen auf mich hören!«
Der uniformierte Mann würdigte ihn keines Blickes und drängte sich an dem Drucker vorbei nach draußen, wo er die Metallkurbel mit Getöse auf einen bereitstehenden Laster schmiss. Als er zurückkam, deutete er auf die Druckmaschine in der Ecke. »Kaputt?«
Jupp nickte. »Ja. Wenn nicht durch amerikanische Bomben, dann durch russischen Unverstand.« Gleichzeitig hoffte er, dass dieser Soldat nicht plötzlich doch die deutsche Sprache beherrschte. Aber der winkte nur ein paar andere breitschultrige Männer an seine Seite und fing an, den Rest der Maschine abzumontieren.
Jupp setzte sich auf einen Haufen Schutt und beobachtete die Russen. Sie hatten im Lauf der vergangenen Wochen schon zwei große Maschinen zerlegt und abtransportiert. Ob es ihnen nur um den Schrottwert der Druckmaschinen ging oder ob sie irgendwo im Osten wieder aufgebaut werden sollten, das würde ihm wohl immer verborgen bleiben.
Noch während er überlegte, in welchem Zustand sich wohl die verbliebenen Druckmaschinen unter den Schutthaufen befanden, fuhren vor der Druckerei einige Kübelwagen mit Soldaten vor. Jupp erkannte Gewehre und die Flagge mit den Streifen und den Sternen. Er atmete aus. Darauf hatten sie seit Wochen gewartet: das Eintreffen der westlichen Alliierten in der russisch besetzten Stadt.
Neugierig ging er zu der Lücke in der Wand, wo sich einst ein großes Tor befunden hatte.
Einer der Amerikaner sah auf eine Liste und kam dann zu ihm. »Ist das hier der Verlag Manthey?«, fragte er mit befehlsgewohnter Stimme. Sein Deutsch hatte einen schweren Akzent, war aber gut verständlich.
Jupp nickte. »Ja, das ist richtig.«
»Der ist enteignet. Das Haus gehört jetzt uns.«
»Aber … das kann nicht sein!«, rief Jupp. »Ich muss doch darauf aufpassen!«
Der Mann zog die Augenbrauen zusammen. »Wer sind Sie? Hier wurde die Antwort gedruckt, eine der schlimmsten Zeitungen der Nazis. Wenn Sie damit zu tun hatten, dann muss ich Sie verhaften. Wie ist Ihr Name?«
Unwillkürlich wich Jupp ein wenig zurück. »Mein Name ist Jupp Birnbaum. Und der Chef hat mich gebeten …«
»Ihr Chef ist Alexander Manthey?« Die Stimme des Soldaten wurde schärfer.
Jupp nickte. Zwei weitere Soldaten erhoben ihre Gewehre und richteten sie auf ihn. »Sie kommen mit!«, erklärte der Soldat, der zuerst mit ihm gesprochen hatte.
»Nein, nein.« Jupp schüttelte verzweifelt den Kopf. »Das verstehen Sie falsch, ich …«
Im gleichen Moment wurde er von einem der Soldaten grob am Arm gepackt und in Richtung eines Kübelwagens gestoßen. »Nazi! Get up!«
Jupp wehrte sich. »Ich bin kein Nazi! No Nazi! Ich bin Jude, die wollten mich umbringen!«
Der Anführer, der als Erster mit ihm gesprochen hatte, wurde noch wütender. »Jetzt seid ihr alle Juden! Wir sind doch nicht blöd und fallen auf eine so lächerliche Lüge herein! Können Sie das etwa beweisen?«
»Beweisen?« Jupp hörte selbst, wie verzweifelt seine Stimme klang. »Jahrelang habe ich gehofft, dass es keiner merkt …«
»Dann auf den Wagen! Los!«
Ein dunkelhäutiger Soldat, der sich bisher im Hintergrund gehalten hatte, trat nach vorne. »Pray! If you are a Jew, then pray!«
Jupp zögerte kurz, dann begann er leise: »Schma Jisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad …«
Er spürte, wie sein Herz raste. Mehr als zwölf Jahre war es inzwischen her, dass er diese Worte in der Öffentlichkeit gesprochen hatte. Wie lange hatte er geglaubt, dass er nur möglichst still sein müsste, damit ihn die Häscher der Nazis übersahen? Und jetzt stand er auf der Straße und flüsterte die alten Worte. »Höre Israel, unser Gott ist ewig, unser Gott ist einzig …«
Der Dunkelhäutige bedeutete seinen Kollegen, die Gewehre sinken zu lassen. »He speaks the truth!«
»Ein Jude?« Der Anführer sah ihn immer noch misstrauisch an. »Ein Jude, der die Druckerei der Antwort bewacht? In diesen Zeiten ist es nicht leicht, mich zu überraschen. Aber Ihnen ist es gelungen. Warum sind Sie hier und bewachen den Schrott der Nazis?«
»Alexander Manthey, das ist der Chef dieses Verlags, hat mich und meine Familie beschützt. Er hat uns sogar aus dem Zug nach Theresienstadt geholt. Theresienstadt? Wissen Sie, was das ist?«
Ein Schatten fiel über das Gesicht des Mannes, und er nickte. »Ja. Ich habe die Bilder gesehen.« Er musterte Jupp. »Und der Chef der Antwort hat Ihnen also befohlen, hier auf alles aufzupassen, bis er wieder da ist? Warum ausgerechnet Sie?«
»Ich habe seine Druckerei am Laufen gehalten.« Stolz nickte Jupp. »Ohne mich wäre an so manchen Tagen hier überhaupt nichts in den Verkauf gekommen. So eine Druckmaschine ist wie eine schöne Frau. Wenn man sie falsch anfasst, dann will sie überhaupt nicht mehr …«
»Sie kennen sich mit den Dingern hier aus? Können Sie die auch reparieren?« Zum ersten Mal wirkte der Soldat freundlich.
Eifrig nickte Jupp. »Ja, sicher. Die Russen haben aber die beiden besten Maschinen mitgenommen.«
»Und die anderen? Kann man mit denen drucken?«
»Im Moment gerade nicht. Da muss ja erst einmal der Schutt weg. Dann muss ich sehen, was man tun kann. Aber dann … dann kann man mit den Maschinen arbeiten. Sie sind ziemlich robust … und ich kenne jede Schraube.«
»Sehr gut. Dann fangen Sie an! Wir brauchen Zeitungen, und zwar schnell. Die Russen haben schon acht, wir müssen nachlegen. Sonst glaubt uns keiner, dass wir die besseren Gewinner sind … Was brauchen Sie?«
Jupp konnte kaum fassen, was ihm dieser Amerikaner sagte. Gerade eben noch hatten seine Kameraden die Gewehre auf ihn gerichtet – und jetzt sollte er die Druckerei wieder betriebsfertig machen? »Ich brauche Helfer, die beim Aufräumen helfen. Dann mache ich eine Inventarliste mit allem, was wir haben, und dem, was hier noch fehlt, um eine Zeitung zu drucken.«
»Wie sieht es mit Papier aus?«
Jupp schüttelte den Kopf. »Die Rollen, die hier gelagert wurden, haben bei der Bombardierung des Zeitungsviertels Feuer gefangen. Wir haben die Flammen gelöscht, aber ich glaube nicht, dass man die noch für irgendwas verwenden kann.« Er lachte auf. »Höchstens für ein paar Seiten …«
»Für den Anfang brauchen wir auch nur ein paar Seiten«, erwiderte der Soldat. »Ich schicke Ihnen Helfer, morgen gleich.«
»Und wer soll dann die Zeitung füllen?«, wollte Jupp wissen. »Hier im Haus ist keiner mehr, der einen Artikel schreiben kann!«
»Ach, da kümmern sich die Jungs von der Psychological Warfare drum«, erklärte der Soldat. »Die haben in ganz Deutschland ihre Zeitungen gegründet, die kriegen das auch für Berlin hin. Das ist dann besserer Lesestoff als diese russischen Blättchen, die immer nur erzählen, wie toll es in Moskau ist. Dann sollen die Russen doch dorthin zurück, wenn es da so schön ist …«
Von dieser Abteilung hatte Jupp noch nie gehört, was ihn allerdings nicht verwunderte. Immerhin hatte man im Berlin der letzten Kriegswochen außer den Durchhalteparolen im Panzerbär keine Nachrichten mehr erhalten.
Der Soldat wurde wieder ernst. »Und Sie wissen wirklich nicht, wo der Besitzer von diesem Verlag ist? Alexander Manthey? Den suchen wir nämlich. Wer für so eine Zeitung wie die Antwort verantwortlich war, der muss sich vor Gericht verantworten.«
Jupp hob entschuldigend die Hände. »Ich habe keine Ahnung. Er ist im Februar aus dem Verlag verschwunden, als dieses schreckliche Bombardement war. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört.«
»Falls er hier auftaucht, dann warnen Sie ihn nicht, verstanden? So ein Mann mag ja Sie gerettet haben – aber er ist schuldig am Tod von Tausenden. Das dürfen Sie nicht vergessen!«
Jupp nickte eilfertig. »Da können Sie sich auf mich verlassen. Aber ich glaube wirklich nicht, dass der wieder hier auftaucht.«
Der Soldat nickte. »Dann sehen wir uns morgen. Nicht vergessen: Je schneller wir diesen Laden wieder zum Funktionieren bringen, desto besser. Nicht nur für uns, sondern für die ganze Stadt.«
Damit winkte er seinen Kameraden zu, die wieder in ihre Wagen sprangen und verschwanden. Jupp sah ihnen hinterher. War das jetzt endlich der Beginn von etwas Neuem? Würden die Amerikaner ihn vielleicht auch für seine Dienste bezahlen?
Langsam drehte er sich um und ging über die geländerlose Treppe nach oben in die Büroräume. Einige davon sahen immer noch so aus, als wären die Reporter, Sekretärinnen und der Verleger nur kurz in der Mittagspause. Nur die dicke Staubschicht auf den Schreibtischen erzählte eine andere Geschichte.
Er griff nach einem Blatt Papier, strich es glatt und schrieb fein säuberlich die Adresse darauf: Theo Porter, wohnhaft bei Anna Tuchenreuth.
Der Chef musste schließlich wissen, was in seinem Verlag passierte.
In der Nähe von Regensburg, Juli 1945
Sorgfältig schob Alexander die letzten Kartoffelstückchen auf die Gabel und steckte sie sich in den Mund. Als er aufblickte, sah er, dass Anna ihm aufmerksam zusah. Er lächelte sie an. »Vielen Dank! Das war sehr lecker!«
»Das waren doch einfach nur Kartoffeln mit dicker Milch«, winkte sie ab. »Früher, da hatten wir ganz andere Sachen zum Essen …«
»Aber früher ist lange her. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir im Moment haben. Und uns daran freuen. Die Leute in der Stadt haben weniger zu essen – sonst würden sie nicht an jedem Wochenende mit ihren Rucksäcken hierherkommen und uns ihren Plunder für eine Handvoll Kartoffeln anbieten.«
Anna nickte. Sie stand auf, wischte ihre Hände an der speckigen Schürze ab, nahm seinen Teller und stellte ihn in die Spüle. »Du kannst hart arbeiten«, stellte sie dabei fest.
Alexander war sich nicht sicher, ob sie eine Antwort erwartete. Seit zwei Monaten war er jetzt bei ihr auf dem Hof, verrichtete den ganzen Tag harte Arbeit als Knecht und wohnte dafür in einer kleinen Kammer, hatte jeden Tag ausreichend zu essen und saß Abend für Abend bei der Bäuerin und ihren mürrischen Schwiegereltern am Tisch. Die beiden Alten ließen nach dem letzten Bissen wortlos ihre Löffel fallen und zogen sich in ihr Altenteil zurück – eine kleine Kate neben dem Stall.
Nicht selten saß er dann mit Anna noch ein oder zwei Stunden beisammen. Sie redeten wenig oder überhaupt nicht, bis sie aufstand und sich mit einem »Ich wünsche noch eine gute Nacht« in ihr Schlafzimmer zurückzog. Er blieb dann gerne noch alleine in der Stube sitzen, sah in die letzte Glut des Ofenfeuers und dachte über seine Situation nach. Noch wäre es unklug, sich aus dem Versteck zu wagen. Die Alliierten suchten nach Kriegsverbrechern, und er war davon überzeugt, dass er auf der Liste der gesuchten Personen stand.
»Wartet eigentlich jemand auf dich?«, wollte Anna wissen.
Er schüttelte den Kopf. »Meine Frau ist bei einem Luftangriff ums Leben gekommen. Erschlagen. Die wartet auf niemanden mehr.« Er schaffte es, dass seine Stimme angemessen traurig klang, dabei war Lenis Tod inzwischen so lange her, dass es sich fast anfühlte wie ein anderes Leben.
»Und Kinder?« Heute reichte der Bäuerin das allabendliche Schweigen offensichtlich nicht mehr.
»Ein Sohn. Er ist beim selben Bombenangriff umgekommen. Im Krankenhaus sollte ihm ein Bein abgenommen werden, aber er hat es nicht geschafft …« War die Lüge Verrat an seinem verkrüppelten Sohn, der jetzt auf einem Bein durchs Leben humpeln musste? Vielleicht wäre es ja besser gewesen, wenn er seiner Mutter ins Grab gefolgt wäre. Dann wäre ihm dieses Leben erspart geblieben. Wenigstens war er bei der Familie Birnbaum gut aufgehoben – Juden müsste es nach der Befreiung eigentlich gut gehen, dachte er. Die fragte wenigstens niemand nach ihrer dunklen Vergangenheit während des Nationalsozialismus.
»Das ist traurig mit deiner Familie«, meinte Anna. »Hast du gar keine Sehnsucht?«
»Sehnsucht?« Allmählich dämmerte ihm, worauf die Bäuerin aus war. Er musterte sie genauer. In den dunklen Haaren, die sie immer in einem strengen Knoten trug, zeigten sich schon ein paar graue Strähnen. Die Augen über den hohen Wangenknochen waren von einem undefinierbaren Dunkelgrau. Sie hielt sich fast unnatürlich gerade. Sein Blick glitt nach unten. Anna Tuchenreuths Arme waren sehnig, ihre Hände sahen schwielig aus, unter den kurzen Fingernägeln waren dunkle Ränder.
Sie sah ihn weiter unverwandt an. »Ein bisschen Wärme, meine ich. Der Mensch soll doch nicht allein sein, oder?«
Sie stand auf, stellte sich hinter ihn und legte ihm eine Hand zwischen die Schulterblätter.
Er lehnte sich etwas zurück und legte seine Wange an ihre Brust. Einen Augenblick lang dachte er an die Frauen, die er in den letzten Jahren geküsst hatte. Schauspielerinnen, Sternchen und Schönheiten, die sich einen Vorteil davon erhofften, wenn sie sich mit ihm zeigten. Er hatte sich nicht alle Namen gemerkt, aber ganz bestimmt waren alle miteinander schöner gewesen als diese hagere Bäuerin. Aber die war jetzt mit ihm im Zimmer.
Alexander spürte, wie ihre Hand über seine Schulter nach vorne glitt, ihm über die Brust strich und dann langsam nach unten wanderte. Er stand halb auf und umfasste sie. »Wir sollten uns einen bequemeren Platz suchen«, murmelte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Nicht in meinem Zimmer. Wenn der Albert heimkommt, dann will ich mich nicht schlecht fühlen …«
Sie schob sich vor ihn, setzte sich auf den Tisch und schob ihre Röcke nach oben. »Hier ist es richtig!«, erklärte sie. »Komm, Theo!«
Er stand auf, nestelte an seiner dreckigen Arbeitshose, umfasste die Bäuerin und zog sie etwas näher zu sich hin. Es fühlte sich gut an. Ein zusätzlicher Lohn für die harte Arbeit, die er hier jeden Tag verrichten musste. Und dieser strengen Anna schien es auch noch zu gefallen.
Es dauerte nicht lange, bis er laut aufstöhnte und sich wieder auf den Stuhl fallen ließ. Anna schob die Röcke nach unten und nickte dabei, so als müsste sie sich selbst darin bestärken, nichts Unrechtes getan zu haben.
»Ich habe noch Bier. Magst du eins haben?«, fragte sie ihn.
Alexander nickte.
Vielleicht war es gar nicht so schlimm, wenn er noch ein paar Wochen länger hier auf dem Hof der Anna Tuchenreuth blieb.
Berlin, Juli 1945
»Jupp Birnbaum?« Der Mann mit der amerikanischen Uniform sah sich suchend um.
»Hier bin ich!« Jupp kam hinter einer der alten Maschinen hervor und musterte den Soldaten, der ihn gerufen hatte. Er kam ihm vertraut vor, doch erst als der Mann einen Schritt nach vorne machte und dabei sein Hinken sichtbar wurde, erinnerte sich Jupp wieder. »Herr Manthey?«
»Der bin ich. Schön, Sie wiederzusehen!« Manthey streckte die Hand aus und humpelte auf ihn zu. »Ich soll Grüße von Ihrer Frau ausrichten.«
»Sie waren in der Villa?« Jupp war überrascht. Er hatte seine Frau, die Kinder und Alexander Mantheys Sohn Hajo schon einige Tage nicht mehr gesehen. Es war viel zu mühselig, täglich den Weg nach Lichterfelde auf sich zu nehmen.
»Ganz genau, da wohne ich jetzt nämlich«, erklärte Manthey. »Es ist nicht so leicht, ein gutes Quartier zu finden. Da ist mein eigenes Elternhaus eine gute Wahl – wenigstens fehlen nur eine Wand und ein Stück vom Dach. Aber keine Sorge, ich werde Ihre Familie nicht vertreiben. Es ist ausreichend Platz für alle. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar ein paar Maurer, die diese Wand wieder aufbauen können.«
Jupp senkte beruhigt den Blick, bis ihm etwas einfiel. »Was machen Sie eigentlich hier?«
Manthey lachte und ließ seinen Blick durch den großen Raum wandern. Hier hatten einst die Druckmaschinen gestanden, die viermal am Tag die neuesten Ausgaben der Berliner Bühne ausgespuckt hatten. Jetzt gab es hier nur noch Schutthaufen und Teile von Druckmaschinen, die aussahen, als hätte sie eine Riesenfaust verbogen.
»Ich will eine Zeitung drucken«, erklärte Manthey. »Es wird höchste Zeit, dass die Berliner endlich wieder erfahren, was wirklich in der Welt passiert.«
»Es gibt doch die Russenzeitungen«, widersprach Jupp. »Die werden schon seit ein paar Wochen in der Stadt verteilt.«
»Das ist ja das Problem«, meinte Fritjof Manthey. »Wir wollen nicht nur die Sicht unserer russischen Alliierten zeigen. Die Amerikaner sollten eine eigene Stimme in Berlin haben. Dafür bin ich zuständig – und ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass wir das ausgerechnet hier in der alten Druckerei meiner Familie versuchen. Was meinen Sie, wie schnell können wir hier wieder eine Zeitung drucken?«
»Das hat doch schon gestern Ihr amerikanischer Kollege gefragt.« Jupp sah sich in der Halle um. »Wir hatten zwei Maschinen, an denen kaum etwas gefehlt hat. Aber die haben die Russen mitgenommen. Die anderen sind schlimmer zerstört oder unter dem Schutt begraben …«
»Ich bin im Auftrag des Mannes da, mit dem Sie gestern gesprochen haben«, erklärte Fritjof. »Ich werde Hilfe organisieren, damit der Schutt wegkommt. Und dann müssen Sie sagen, was Sie für die Reparatur benötigen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um Reporter und Setzer, um Papier und Druckerschwärze. Es kann ja nicht alles weg sein …«
»Viel ist nicht übrig«, meinte Jupp. »In der Setzerei müssen wir aufräumen und eine Inventur machen. Und hier unten weiß ich erst Bescheid, wenn der Schutt weg ist. Fenster wären auch nicht schlecht, der Sommer dauert ja nicht ewig.«
Fritjof sah sich die großen Lücken in der Fensterfront an. »Darum müssen wir uns kümmern, wenn der Herbst kommt. Jetzt müssen wir erst einmal die Maschinen wieder in Gang bringen. Können wir wirklich gar nichts drucken? Ein paar Plakate würden mir bei der Suche nach Reportern wirklich helfen …«
Stirnrunzelnd sah Jupp sich um. »Nein, drucken können wir momentan wirklich nichts. Aber wir haben Papier. Vielleicht können wir ein paar Aufrufe aufhängen. Könnte doch sein, dass der eine oder andere Drucker oder Reporter durchs Zeitungsviertel schleicht und auf der Suche nach Arbeit ist.« Er sah Fritjof lauernd an. »Die Amerikaner zahlen doch, oder? Die zwingen niemanden, ohne Geld zu arbeiten?«
Beruhigend nickte Fritjof. »Sicher zahlen die. Wollen Sie für mich die Instandsetzung der Druckerei leiten? Ich kann Sie auch jeden Abend mit nach Lichterfelde nehmen. Wo haben Sie überhaupt die letzten Wochen gewohnt?«
Der Drucker machte eine unbestimmte Handbewegung in Richtung der oberen Stockwerke. »Als keiner mehr hier war, habe ich das Zimmer von Herrn Manthey benutzt. Ich meine, das Zimmer Ihres Bruders. Der hatte dort ein Bett, sogar zwei Betten – eine Zeit lang hat ja auch der kleine Hajo hier in der Druckerei gewohnt. Nach dem Tod seiner Frau hat Herr Manthey es nicht mehr in Lichterfelde ausgehalten, denke ich.«
Fritjof nickte nur. »Und wo ist er jetzt? Mein Bruder?«
Er bemerkte nicht, dass Jupp vor seiner Antwort den Bruchteil einer Sekunde lang zögerte. »Ich weiß es nicht. Er ist direkt nach der Bombardierung geflohen. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen.«
Das war die Wahrheit. Er hatte Alexander Manthey nicht gesehen, das konnte er sogar auf die Heilige Schrift schwören.
»Ich habe dafür gesorgt, dass die Druckerei nicht völlig leer stand – und meine Frau hat sich um unsere Kinder und Hajo gekümmert.«
»Aber Hajo redet kaum ein Wort. War das schon vorher so?«
»Seitdem er seine Mutter verloren hat, ist er ein sehr stiller Junge. Aber das wächst sich schon noch aus. Immerhin ist er mit dem Leben davongekommen.« Jupp Birnbaum sah seinen neuen Chef so aufrichtig wie möglich an.
Der legte seine Hand auf Jupps Schulter. »Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie diesen Wahnsinn hier überlebt haben. Ich habe gehört, dass Alexander Sie sogar von einem Transport in ein KZ gerettet hat? Nicht zu glauben, Alexander war doch so ein überzeugter Nazi …«
»Das täuscht«, widersprach Jupp eifrig. »Das hat er doch nur gemacht, damit er irgendwie durch diese Zeiten kommt.«
Ohne einen weiteren Kommentar ging Fritjof Manthey weiter und begutachtete das, was von dem Verlagshaus seiner Familie übrig geblieben war. »Lassen Sie uns nach oben gehen. Ich hätte gerne einen Überblick über alles, was noch steht, damit ich weiß, was wir neu aufbauen müssen.«
Berlin, August 1945
Fritjof musterte sein Gegenüber, dessen Augen ruhelos hin und her huschten – über die Wände, aus dem Fenster, nach unten auf seine Hände und dann wieder zurück zu ihm. Die dünnen blonden Haare des Mannes wichen schon zurück, und auf der Wange waren die Spuren eines Schmisses zu sehen. Der Mann erinnerte Fritjof an ein verängstigtes Frettchen.
»Sie haben in den letzten Jahren als Reporter gearbeitet. Worüber genau?« Fritjof bemühte sich, seine Stimme möglichst ruhig klingen zu lassen.
»Ach, alles, was gerade anlag. Ich habe den Kaninchenzüchterverein ebenso besucht wie Fußballspiele der Vereine hier in Berlin oder auch mal ein Zeltlager der HJ. Ich bin im Herzen ein Reporter für alles, was hier in Berlin stattfindet.« Er nickte, als müsste er seine eigene Aussage bestätigen, fuhr sich durchs Haar und wischte über den Aufschlag seiner Jacke, als befänden sich dort irgendwelche Fussel.
»Wie sah es mit der Politik aus?«
»Davon habe ich mich ferngehalten. Sicher, man musste hin und wieder eine Veranstaltung besuchen. Nichts Großes, nur die kleinen Bezirkstreffen. Da konnte man sich nicht verweigern, aber das ist Ihnen ja sicher klar.«
Täuschte Fritjof sich, oder wirkte der Mann jetzt noch unruhiger, wie er auf seinem Stuhl herumrutschte? »Was waren das für Treffen, denen Sie sich nicht verweigern konnten?«
»Sportfeste. Mal eine kleine Aktion da und dort. Treffen der Partei …«
»Und was wurde da besprochen oder gemacht?« Fritjof musterte sein Gegenüber mit neuem Interesse.
Der deutete auf die Wand, an der seit ein paar Tagen wieder das Porträt von Theodor Manthey hing. Der Gründer des Verlages, aufrechter Kämpfer für die Demokratie und die freie Presse. Fritjof hatte das Bild am Tag seiner Flucht aus dem Reich von der Wand genommen und es in den letzten Jahren auf allen Reisen mit sich getragen. Jetzt war es wieder hier, fast an seinem ursprünglichen Platz. Der wäre zwei Zimmer weiter gewesen – aber dort fehlten bis heute die Fenster. Der Besucher musterte die Fotografie des spitzbärtigen Mannes. »Ihr Vater? Ist das der berühmte Theodor Manthey?«
»Das ist er. Und ich fühle mich seinem Erbe verpflichtet. Daher wiederhole ich meine Frage: Was genau wurde auf diesen kleinen Treffen besprochen? Es wird nicht immer nur um die Regelung des Verkehrs gegangen sein, oder?«
»Nein. Aber die Aufrufe zu Sammelaktionen, die Warnung vor dem Hören von Feindsendern oder der Schädigung der Volksgesundheit – das hat trotzdem bestimmt nicht den Ausgang des Krieges bestimmt.« Ein kurzes Lächeln huschte über sein nervöses Gesicht.
»Volksgesundheit?« Fritjof runzelte die Stirn. »Verzeihen Sie mir, ich war einige Jahre nicht hier im Land. Was verstehen Sie denn genau unter diesem Begriff?«
»Ach, das war eigentlich nur die Aufforderung, kein minderwertiges Blut mit dem der Arier zu mischen.« Er sah, dass Fritjof mit dieser Antwort nicht zufrieden war, und redete hastig weiter. »Sie wissen schon: Neger, Juden, Kommunisten, Schwachsinnige … das versteht sich ja von selbst.«
»Ich kann Ihnen nicht folgen«, erklärte Fritjof mit eisiger Stimme. »Was erklärt sich von selbst?«
»Na, dass man mit diesen Leuten besser keinen Umgang pflegen sollte. Sind ja doch sehr anders als wir, das werden ja nicht einmal die Amerikaner leugnen.« Er sah Fritjof lauernd an. »Sie sind doch Amerikaner? Dann sind in Ihrer neuen Heimat die Schwarzen ja auch nicht gern gesehen. Sie setzen sich nicht einmal in denselben Bus wie die, oder? Und so ist es bei uns eben mit den Juden. Mit denen will man auch nicht unbedingt zusammen sein. So was gibt es wohl in jedem Teil der Welt – Menschen, mit denen man nichts zu tun haben will.«
Die Selbstverständlichkeit, mit der dieser Mann seine Meinung kundtat, erschreckte Fritjof. »Wir bringen die Schwarzen in unserem Land aber nicht um. Das ist doch ein gewaltiger Unterschied.«
»Nun, weil Sie es nicht können! Ich habe mal einen Bericht gelesen, da ging es um Neger, die aufgeknüpft werden. Ohne Gerichtsurteil. Da sind Sie in Amerika nicht besser als wir.« Kleine Schweißperlen bildeten sich entlang des dünnen Haarkranzes.
Fritjof atmete tief durch. »Und warum wollen Sie für unsere neue Zeitung arbeiten? Das verstehe ich noch nicht ganz.«
»Ich bin Reporter. Wenn mein Chefredakteur mir die Richtung vorgibt, dann schreibe ich nach seinen Anweisungen. Bis jetzt war klar, dass ich für das Deutsche Reich tätig bin. Ich war ja auch Mitglied der Reichspressekammer. Wenn Sie mir jetzt sagen, dass ich für den Wiederaufbau schreiben soll, dann tue ich das.« Er lachte auf. »Für eine eigene Meinung bin ich noch nie bezahlt worden. Was ich wirklich gut kann: Ich schreibe so, wie es mir gesagt wird. Sie müssen keine Angst haben, dass ich irgendwo meine eigene Meinung oder gar die alte Leier der Nazis unterbringen will.«
Nachdenklich betrachtete Fritjof die dünne Akte, die vor ihm lag. Seine Suche nach verlässlichen Reportern war bis jetzt alles andere als erfolgreich. Im Gegenteil: Wer seit zwölf Jahren hier in Berlin als Reporter gearbeitet hatte, der hatte auch irgendwo mit der Politik zu tun gehabt. Die Nazis hatten es geschafft, in alle Bereiche einzudringen, alles zu überwachen und zu regeln. Und deswegen gab es keine Unschuldigen. Zumindest nicht in seinen Augen.
Er hob den Blick und sah seinen unruhigen Bewerber an. »Ich kann Ihnen im Augenblick keine Stelle anbieten. Sollte sich etwas ändern, dann weiß ich, wie ich Sie erreichen kann. Ich wünsche einen angenehmen Tag.«
Der Mann blieb einen Augenblick lang sitzen, so als würde die Botschaft erst mit Verzögerung ankommen. In seinem Gesicht zeigte sich erst Enttäuschung und dann Zorn. »Ihr habt keine Ahnung, was hier passiert ist. Einfach verschwinden und dann über uns urteilen, das ist so einfach. Ihr werdet schon sehen: Ohne uns wird das nichts mit dem neuen Deutschland …« Er deutete auf den Schreibtisch, auf dem eine Packung Zigaretten lag. »Geben Sie mir wenigstens eine Zigarette aus? Oder zwei?«
Müde nickte Fritjof und schob ihm die Packung mit einer nachlässigen Bewegung über den Tisch zu. Besser als jedes Geld, das wusste er längst. Jedem Soldaten standen Zigaretten zu – und für Zigaretten oder Schokolade gab es in diesem Land alles.
Der Bewerber nestelte nervös drei Zigaretten aus der Packung, sprang auf und verließ das Zimmer so hastig, als wäre er besorgt, dass Fritjof sein großzügiges Geschenk noch bereuen würde.
Fritjof stand auf und trat ans Fenster. Wie oft hatte er in den Jahren vor seiner Flucht hier gestanden? Er erinnerte sich an die hell erleuchteten Straßen des Zeitungsviertels in der Nacht. Zeitungsjungen, Boten, Drucker, Setzer, Reporter und mehr oder weniger verlässliche Informanten hatten sich einst die Türklinken in die Hand gegeben.