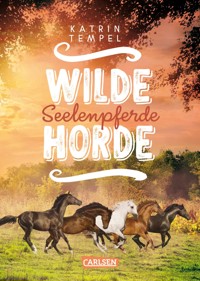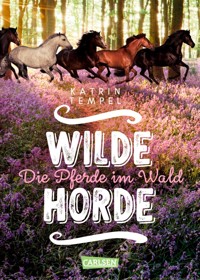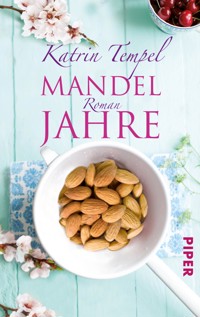9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zerrissene Familienbande: drei Geschwister zwischen Verantwortung, Kollaboration und Flucht 1933: Die drei Manthey-Erben finden sich in einer Welt im Umbruch wieder. Während Vicki als Reporterin im Prager Exil gegen die neuen Machthaber in Deutschland anschreibt, sucht Fritjof in New York nach Möglichkeiten, aus der Ferne gegen das Nazi-Regime zu wirken. Währenddessen steuert Alexander in Berlin das Zeitungsimperium geschickt durch die neuen Machtstrukturen. Zwischen Anpassung und Widerstand entfernen sich die Geschwister immer weiter voneinander, während die Welt um sie herum zusammenbricht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Zeitungsdynastie – Verlorene Heimat (Die Zeitungsdynastie 2)« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur
Gerd F. Rumler (München).
Redaktion: Annika Krummacher
Covergestaltung: t. mutzenbach design, München
Covermotiv: Gettyimages / United Archives / Kontributor; Trevillion Images (Yolande de Kort; Mark Owen; Joanna Czogala); Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
Prag, Oktober 1933
Berlin, Oktober 1933
Prag, Oktober 1933
Berlin, Dezember 1933
Prag, Weihnachten 1933
Berlin, Weihnachten 1933
Berlin, Silvester 1933
Prag, Januar 1934
Prag, Februar 1934
Berlin, März 1934
Berlin, April 1934
Prag, Mai 1934
Berlin, August 1936
Prag, September 1936
Österreichische Alpen, Oktober 1936
Grenze Saarland – Frankreich, Januar 1937
Berlin, Januar 1937
Marseille, Januar 1937
Berlin, März 1937
Madrid, März 1937
Berlin, Mai 1937
In der Nähe von Bilbao, Juni 1937
Marseille, November 1937
Berlin, Februar 1938
Marseille, März 1938
Corbera d’Ebre, August 1938
Marseille, November 1938
Wien, Januar 1939
Auf dem Atlantik, Januar 1939
Mexiko City, April 1939
New York, September 1939
Berlin, Januar 1940
New York, Juli 1940
Mexiko City, November 1940
New York, Dezember 1941
Mexiko City, Mai 1942
Berlin, Juni 1942
Mexiko City, Juli 1942
Maryland, August 1942
New York, November 1942
Berlin, Dezember 1942
New York, Januar 1943
Tunesien, März 1943
Los Angeles, März 1943
Berlin, April 1943
Madison, Juli 1943
Berlin, August 1943
Los Angeles, August 1943
Südlich von Rom, November 1943
Berlin, Januar 1944
Santa Monica, März 1944
Berlin, März 1944
Santa Monica, Juli 1944
Irgendwo im Apennin, Juli 1944
Berlin, Juli 1944
Berlin, Februar 1945
Köln, März 1945
Los Angeles, Mai 1945
Nikolajew, Ukraine, Mai 1945
In der Nähe von Regensburg, Mai 1945
Berlin, Juli 1945
Epilog
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Georg und Emma
Das Haus sah herrschaftlich aus. Breite Auffahrt, schwere Haustür. Die Soldaten sicherten sich mit ihren Gewehren ab. Die letzten Kämpfer des Reiches konnten sich überall versteckt haben.
Aber die Haustür war nur angelehnt, und im Inneren des Hauses war nichts zu hören.
Sie betraten das Gebäude. Von der herrschaftlich großen Diele mit einer breiten Treppe ins obere Stockwerk ging es in ein großes Esszimmer. Ein schwerer Eichentisch, geschwungene Stühle, fein säuberlich aufgestellt. So als würden die Bewohner des Hauses jeden Moment ihre Gäste erwarten.
Einer der Soldaten lachte auf, zog einen Stuhl zurück, setzte sich darauf und legte die Füße auf den Tisch. »Wir sollten feiern! Hier wohnt niemand mehr!«
Sein Kamerad, der mit seinem runden Gesicht wie ein überraschter Junge aussah, kam aus dem Nachbarzimmer, in jeder Hand eine Flasche. »Den Schnaps haben sie extra für uns hiergelassen!«
In einem weiteren Schrank fanden sich unversehrte Gläser aus schwerem Bleikristall. Die Männer schenkten sich ein und prosteten sich zu. »Auf den Sieg!«
Plötzlich hielt einer von ihnen inne.
»Habt ihr nicht auch ein Geräusch gehört? Da ist doch jemand! War das im Keller?«
Sein Kamerad machte eine lässige Handbewegung. »Wer soll da schon sein außer ein paar Ratten?«
»Vielleicht der Weinkeller unseres Gastgebers?«, mutmaßte der Dritte und lachte.
Die anderen stimmten ein.
»Dann sollten wir unbedingt nachsehen«, meinte der Erste. »Ein guter Rotwein ist nicht zu verachten!«
Die Soldaten liefen durch den dunklen Gang nach hinten und fanden sich plötzlich im Freien wieder. Die Rückseite der Villa fehlte, ein umgekippter Eisenofen lag vor ihnen.
Einer der Soldaten trat gegen einen Schrank und schüttelte den Kopf. »Hier gibt es nichts mehr. Und der Eingang zum Keller ist wahrscheinlich verschüttet. Komm, lasst uns lieber Schnaps trinken!«
Damit verschwanden sie wieder im Esszimmer.
Sie sahen nicht die Augen, die aus einem verborgenen Türspalt blickten. Es waren die Augen einer Frau. In ihrer Hand hielt sie ein Gewehr fest umklammert. Sie würde sich wehren, bis zuletzt.
Ihre Familie sollte überleben, egal, was sie dafür tun musste.
Prag, Oktober 1933
Vicki Manthey hatte keine Augen für den traumhaften Herbsttag. Die Blätter an den Bäumen leuchteten golden vor dem strahlend blauen Himmel, selbst die Häuser schienen von innen erhellt zu werden. Gerade so, als wollte die alte Stadt mit aller Macht beweisen, dass sie auch dunkle Zeiten zu überstehen wusste.
Die junge Frau lief durch die Straßen, den grauen Mantel fest um die Schultern gewickelt, den Hut auf die schulterlangen Haare gedrückt. Sie spähte durch das Fenster in eine Gaststätte, eilte weiter und sah in eine weitere – und drückte schließlich die Tür eines kleinen Cafés in einer schmalen Seitenstraße auf.
Ihr schlug der Geruch von feuchter Wolle, ungewaschenen Haaren und bitterem Kaffee entgegen. Die Menschen, die hier saßen, unterhielten sich leise und sahen nur kurz auf, als die Türglocke läutete. Suchend lief Vicki Manthey an den Tischen entlang. Einer der Männer hob die Hand, um sie aufzuhalten. »Was rennst du an mir vorbei wie eine aufgescheuchte Gans? Was ist los mit dir? Was suchst du?«
»Hast du Harry gesehen?« Vicki hielt sich nicht lange mit Vorreden auf.
»Ist er dir entlaufen?« Der Mann lachte über seinen eigenen Scherz, brach jedoch ab, als er sah, dass Vicki keine Miene verzog. Begütigend legte er ihr die Hand auf den Arm. »Keine Sorge, der kommt wieder zu dir zurück. Nach der Zeit im Krankenhaus ist er froh, dass er sich endlich einmal wieder frei bewegen kann.«
Mit einem Kopfschütteln wandte Vicki sich ab. Sie machte sich Sorgen, seit sie am frühen Morgen allein in ihrem Bett aufgewacht war. Harry war erst seit ein paar Tagen wieder zu Hause, aber er schien von einer merkwürdigen Unrast befallen. So, als wäre es ihm unerträglich, länger als ein paar Stunden an einem Ort zu sein.
Forschend sah sie in die vielen Gesichter. Einige erwiderten ihren Blick neugierig oder freundlich. Andere starrten weiterhin in die fast leeren Gläser oder Tassen, die vor ihnen auf dem Tisch standen. Sie warteten darauf, dass der Tag vorbeiging oder andere Zeiten anbrachen. Und beides wollte nicht passieren – zumindest nicht so schnell, wie sie es erhofften. Bis dahin hielten sie sich stundenlang an dem einzigen Getränk fest, das sie sich leisten konnten und das ihnen viel zu oft nicht schmeckte.
Enttäuscht drehte Vicki sich um. Hier war er nicht. Und in den Lokalen, die sie davor besucht hatte, auch nicht. Harry war wie vom Erdboden verschluckt. Mit einem müden Lächeln an den Bekannten, dessen Name ihr nicht einfallen wollte, drehte sie um und verschwand wieder nach draußen in den leuchtenden Prager Herbst.
Sie spürte, wie sich Angst in ihr breitmachte. Reichte der Arm der Nazis bis hierher, bis ins Herz von Prag? War Harry so wichtig, dass sie sich an seine Fersen hefteten? Etwas langsamer ging sie weiter, ratlos, wo sie nach ihm suchen sollte.
Schließlich erreichte sie das Ufer der Moldau, die an dieser Stelle in einem weiten Bogen durch die Stadt floss. Hier wehte der Wind etwas kräftiger als zwischen den Häusern der Altstadt. Fröstelnd zog Vicki ihren Mantel etwas fester um ihre Schultern und sah zum Hradschin hinauf. Sicher, die Stadt war schön. Zauberhaft sogar, vor allem an einem Tag wie heute – aber eben keine Heimat. Hier würde sie sich niemals so zu Hause fühlen wie in den letzten Jahren in ihrem Berlin.
Immerhin drohte hier keine Gefahr, die Regierung tolerierte die vielen Geflüchteten, die hier nach einer sicheren Existenz suchten.
In diesem Augenblick sah sie Harry.
Er lehnte bewegungslos an einer Mauer. Sein Gesicht konnte sie unter dem Hut nicht erkennen – und auch als sie winkte und auf ihn zulief, rührte er sich nicht.
Erst als sie direkt vor ihm stand, hob er seinen Blick.
»Ach, du bist es!«, murmelte er.
Ein Speichelfaden klebte in seinem Mundwinkel, während sein blasses Gesicht von einem dünnen Schweißfilm überzogen war. Er sah so ungesund aus, dass Vicki erschrocken einen Schritt nach hinten machte.
»Harry. Du musst nach Hause! Du sollst dich noch schonen!«
Ein schwaches Kopfschütteln war die Antwort. »Nein. Mach dir keine Sorgen. Es geht mir gut. Ich habe nur nach einem Medikament gesucht … Die Schmerzen haben mich nicht schlafen lassen. Aber jetzt ist alles gut.«
Beruhigend legte Vicki ihre Hand auf seine. »Dann gehen wir jetzt heim. Du solltest noch nicht so lange unterwegs sein, bis vor ein paar Tagen warst du noch im Krankenhaus.«
Folgsam nickte er, hakte sich bei ihr ein, und sie machten sich gemeinsam auf den Nachhauseweg. Die Schussverletzung, die er bei dem Attentat in Marienbad erlitten hatte, belastete ihn offenbar mehr, als er zugeben wollte. Vicki machte sich Vorwürfe, dass sie sich nicht ausreichend um Harry gekümmert hatte. Er war verändert, seitdem auf ihn geschossen worden war. Als wäre ein Feuer in seinem Inneren erloschen.
Seit Jahren lebten und arbeiteten sie zusammen. Mehr als alles andere liebte sie seinen unbezähmbaren Optimismus, seinen Glauben an eine bessere Zukunft und vor allem an sie, die Frau an seiner Seite. Seine Sinne schienen immer auf Empfang ausgerichtet zu sein: Ständig beobachtete er alle und alles um sich herum, registrierte winzigste Veränderungen.
Jetzt hielt er seinen Blick nur noch auf das Pflaster direkt vor seinen Füßen gerichtet. Und trotzdem stolperte er immer wieder und hielt sich an ihr fest. Noch vor einem Monat war es gar nicht sicher gewesen, ob er überleben würde. Und jetzt lief er an ihrer Seite durch Prag. Sie versuchte sich zu beruhigen. Der Harry, den sie kannte, würde schon wieder auftauchen. Sie durfte die Hoffnung nur nicht sinken lassen.
Berlin, Oktober 1933
»Unser Vater ist noch keine Woche unter der Erde. Bist du dir sicher, dass diese Einladung eine gute Idee ist?« Fritjof deutete auf den sorgfältig gedeckten Tisch und sah seinen Bruder fragend an.
Alexander lachte. »So sicher wie das Amen in der Kirche. Fritjof, wir müssen nach dem Tod des Alten zeigen, dass wir das Heft in der Hand haben. Wenn wir das nicht tun, dann wird es uns als Schwäche ausgelegt. Und das können wir uns nicht leisten!«
Kopfschüttelnd nahm Fritjof ein Messer in die Hand und betrachtete das eingravierte geschwungene M. »Niemand wird es uns als Schwäche auslegen, wenn wir direkt nach der Beerdigung unsere gesellschaftlichen Verpflichtungen etwas vernachlässigen. Wen hast du denn eingeladen?«
»Männer, die du kennen solltest. Sie werden in den nächsten Jahren über unsere Zukunft bestimmen … und wir können uns glücklich schätzen, dass sie uns hier in unserem Heim beehren.«
»Früher wären sie wohl stolz gewesen, wenn sie überhaupt einmal die Gelegenheit bekommen hätten, unser Haus zu betreten, meinst du nicht?« Fritjof sprach leise, fast nur für sich selbst, aber sein kleiner Bruder hatte ihn trotzdem verstanden.
»Was hast du vor?« Alexanders Stimme klang hart. »Willst du ewig schmollen, weil nicht die von dir gewünschte Regierung an die Macht gekommen ist? Oder willst du auch über diese Zukunft bestimmen?«
Behutsam legte Fritjof das Messer auf den Tisch und sah seinen Bruder an. Er war größer als er und breitschultrig. Auf seinem Gesicht war nicht der Anflug eines Lächelns zu sehen. Fritjof legte seinen Kopf ein wenig schräg. »Und was würdest du tun, wenn ich deine Gäste nicht mit einem Lächeln und dem besten Wein in meinem Elternhaus empfangen würde?«
»Ich würde dafür sorgen, dass sie dich nicht zu Gesicht bekommen. Erklären, dass du vom Tod unseres Vaters tief getroffen bist und noch einige Zeit benötigst, um dich wieder zu sammeln.« Ein feines Lächeln umspielte seinen Mund. »Und vielleicht würde ich auch andeuten, dass du einfach nicht stark genug bist, um den Druck an der Spitze eines Verlagshauses auszuhalten. Eine kleine Schwäche, womöglich hat sie sich schon gezeigt, als du dich in eine Verletzung geflüchtet hast, um der Front zu entgehen …«
»… während mein kleiner Bruder noch zu unreif war, um überhaupt eine Waffe in die Hand zu nehmen.« Fritjof richtete sich auf. »Keine Sorge, ich werde dich keine Sekunde aus den Augen lassen. Und wenn du anfängst, Unwahrheiten über mich zu verbreiten, dann muss ich wohl ein wenig über deine Ehefrau reden. An Clara erinnert sich doch jeder gerne. Und an ihr Kommunistenkind auch.«
Sollte Alexander von dieser Drohung getroffen sein, dann ließ er es sich zumindest nicht anmerken. Stattdessen breitete er die Hände aus. »Wir sollten wohl besser beschließen, dass wir zusammen auftreten, statt uns gegenseitig das Leben schwer zu machen, meinst du nicht?«
Fritjof nickte. »Und zwar am besten so, dass niemand merkt, dass wir uns ständig gegenseitig die Klinge an den Hals halten. Bleibt nur noch eine Frage zu klären: Wirst du weiter hier in der Villa leben?«
»Sicher. Es sind viel zu viele Räume für dich allein – und zu meinem Ruderclub ist es auch nicht weit. Hier könnte ich mir durchaus vorstellen, mich wieder zu vermählen. Nur für den Fall, dass es deiner Aufmerksamkeit entgangen sein sollte: Ich war nie verheiratet. Meine Ehe mit Clara wurde annulliert, hat nie stattgefunden. Du weißt doch: Mit den richtigen Freunden kann man sogar die Vergangenheit verändern.« Alexander sah seinen Bruder an. »Und wie sieht es bei dir aus? Wirst du mich hier ertragen – mitsamt meinen Gästen?«
Nicht zu vergessen die Geister der Vergangenheit, die in diesen Mauern noch sehr lebendig waren, dachte Fritjof. Wie konnte man hier im Salon sein, ohne ständig die Stimme des Vaters im Ohr zu haben? Der ohne Unterlass die Demokratie verteidigt und gelobt hatte – egal, wie windschief und korrupt sie sich immer wieder zeigte. Genauso oft meinte er, Vickis leichte Schritte auf der Treppe zu hören. Ihr helles Lachen, wenn sie sich wieder einmal über ihn lustig machte – und das Blitzen in ihren Augen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlte.
Fritjof streckte seinem Bruder die Hand entgegen. »Sicher bleibe ich. Warum sollte ich als ältester Sohn der Familie meinen angestammten Platz räumen? Nein, wir sollten einen Waffenstillstand vereinbaren. Aber ich möchte dich doch darum bitten, dass du die Menschen, die die Drecksarbeit für dich erledigen, nicht hier in unsere Villa einlädst.«
Alexander schlug ein und sah ihm in die Augen. »Keine Sorge. Das war noch in den Zeiten des Kampfes für unsere neuen Machthaber. Ab sofort werde ich mich nur mit den Menschen im feinen Zwirn treffen. Die Bewegung wird den Geruch der Gosse verlieren, ganz bestimmt.«
In diesem Augenblick hörten sie auch schon die Glocke an der Tür. Eines der Hausmädchen öffnete, und nur wenig später kam einer der neuen Machthaber in den Raum. Klein, leicht hinkend und mit einem nervösen Blick, mit dem er um sich blickte.
»Seien Sie mir gegrüßt, lieber Reichsminister«, sagte Fritjof. Seine Hand, die schon fast zum Händeschütteln ausgestreckt war, lenkte er in letzter Sekunde zu einem etwas nachlässigen Gruß um. »Heil Hitler!«
Zum Glück schien Goebbels nur Augen für Alexander zu haben, der sehr korrekt seinen Arm hob.
Es blieb keine Zeit für ein weiteres Gespräch. Weitere Parteigenossen trafen ein.
»Mein Beileid zum Tod Ihres Vaters«, erklärte ein beleibter Mann, den Fritjof nicht auf Anhieb erkannte. »Wie beruhigend, dass der Verlag auch künftig in guten Händen ist. Wer weiß – vielleicht war Theodor Manthey ja auch schon etwas zu betagt, um das Unternehmen weiterhin erfolgreich zu führen.«
Befremdet trat Fritjof einen Schritt nach hinten. Was für eine merkwürdige Art, jemandem sein Beileid auszudrücken und gleichzeitig zu erklären, dass der Todesfall der neuen Regierung durchaus entgegenkam.
Zum Glück wurde zu Tisch gebeten, noch bevor er antworten konnte. Hier redete niemand mehr von dem alten Verleger. Stattdessen taten die Herren ihre Begeisterung über den Austritt aus dem Völkerbund und das Ende der Abrüstungskonferenzen kund. Fritjof lehnte sich ein wenig zurück und beobachtete seine Gäste nachdenklich. Warum nur sah keiner, dass sie in den letzten Tagen einem Krieg näher gekommen waren? Seine alte Narbe am Bein juckte, so als wollte sie ihn daran erinnern, was das bedeuten konnte.
Er winkte einem der Hausmädchen. »Geben Sie mir noch ein Glas Wein, bitte.« Vielleicht würde ausreichend Alkohol dafür sorgen, dass er diese Gespräche besser ertragen konnte.
Als sie ihm einschenkte, merkte er, dass sie leicht zitterte. Hatte sie womöglich Angst vor diesen Uniformträgern? Er sah sie von der Seite an. Gerlinde arbeitete seit mehr als einem Jahrzehnt für die Familie Manthey. Warum sie vor diesen Menschen Angst hatte, war ihm nicht klar – aber er nahm sich vor, sie in den nächsten Tagen zu fragen.
»Was sind denn Ihre Pläne für die Berliner Bühne?« Sein Nachbar sah ihn von der Seite her an. »Jetzt, da der Verlag Ihnen gehört und Sie nicht nur der Chefredakteur Ihres Vaters sind, muss sich doch einiges ändern! Oder etwa nicht?«
»So sehr hat mein Vater mich nicht gegängelt«, wehrte Fritjof ab und erkannte im selben Moment am Blick seines Nachbarn, dass diese Antwort offenbar falsch war. »Ich wollte sagen: Die Bühne steht als Zeitung ja eher für die weltoffene Seite der Regierung. Das ist der ausdrückliche Wunsch des Reichsministers, und den werde ich natürlich auch erfüllen.«
»Weltoffen? Was heißt das?« Aus dem Munde seines Nachbarn klang es, als würde er von einem haarigen Insekt sprechen.
»Das ist relativ einfach«, erklärte Fritjof. »Wir haben zum Beispiel schon im März erklärt, warum Japan aus dem Völkerbund ausgetreten ist und was das für Folgen haben kann. Der aufmerksame Leser wusste also genau, dass Deutschland mit seiner Entscheidung nicht allein dasteht, sondern durchaus mit anderen aufgeklärten Völkern an einem Strang zieht.«
Mit einem großen Schluck Wein spülte Fritjof diesen Satz herunter. Man könnte meinen, er würde gut finden, was in der Welt passierte. Doch das tat er keineswegs.
Er sehnte sich nach einer anderen Gesellschaft als dieser hier am Tisch seines Elternhauses. Nach der jungen Reporterin Erika Stoll, die ihm zuletzt wütend erklärt hatte, dass er zu wenig Mut habe. Wichtige Reportagen in seiner Zeitung nicht veröffentlichte, weil er Angst von den Verboten der Machthaber habe. Und sie hatte recht. Ohne Murren war er in die Reichskulturkammer eingetreten, eine kleine Formalität nur. Was kümmerte es ihn, dass so viele gute Journalisten diesen Schritt nicht machen konnten, weil sie dem falschen Glauben angehörten? In seiner Zeitung hatten einige der besten Journalisten ihre Arbeit beenden müssen, weil er sie nicht mehr abdrucken durfte. Hätte er sich vor sie stellen sollen? Hätte das etwas gebracht?
Irgendwo tief in seinem Inneren ahnte er, dass er sich nicht alleine einer Welle entgegenstellen konnte. Doch er musste wenigstens versuchen, möglichst ausgewogen und umfassend in seiner Zeitung zu berichten, was wirklich in Deutschland geschah. Dafür war es wichtig, dass das Blatt nicht verboten wurde. Und deshalb musste er hier an diesem Tisch sitzen.
Er winkte noch einmal nach Gerlinde. Mit einem weiteren Glas Wein würde sein Gewissen sich vielleicht weniger nicht mehr so laut melden. Und er würde die Wut der Reporterin Erika Stoll weniger gerechtfertigt finden.
Prag, Oktober 1933
»Willst du heute nicht mit in die Redaktion kommen? Wenigstens kurz? Ich bin mir sicher, dir würde es guttun, mal etwas anderes zu sehen.«
Harry schüttelte nur den Kopf. Dabei blickte er weiter aus dem Fenster, als gäbe es da etwas Spannendes zu sehen. Aber es war lediglich der Garten ihrer Vermieterin. Er war ein wenig ungepflegt, was ihm im Sommer einen gewissen Charme verlieh. Jetzt, im Winter, sah er schlicht trostlos aus. Nicht einmal die Blätter waren zusammengekehrt, sondern lagen in schmutzigen Haufen, wo der Wind sie zusammengetrieben hatte.
Vorsichtig legte Vicki den Arm um seine Schulter. »Du solltest nicht den ganzen Tag hier sitzen und Trübsal blasen. Wenn du ein paar deiner Kollegen triffst, geht es dir bestimmt gleich viel besser.«
Mit einer unwirschen Bewegung schüttelte er ihren Arm ab. »Und was soll ich deiner Meinung nach mit ihnen reden? Ich bin mir sicher, sie sind nicht interessiert an meiner großartigen Heldengeschichte. Es wäre ehrenwert gewesen, wenn ich Professor Lessing hätte retten können. So habe ich mir bei meinem Versuch eine Kugel eingefangen – und Lessing ist trotzdem gestorben.« Seine Stimme klang bitter.
»Und?« Vicki lachte auf. »Jeder, der sich hierher nach Prag verkrochen hat, ist daran gescheitert, die Nazis zu verhindern. Entweder wir bemitleiden uns jetzt – oder wir versuchen weiterhin, trotzdem die Wahrheit zu veröffentlichen.«
Harry sah weiter aus dem Fenster und winkte nur müde ab. »Dann tu das. Aber ich denke, dass ich erst einmal keine anderen Menschen sehen will.«
»Dann hättest du ja auch in Marienbad bei deinen geliebten Schwestern bleiben können«, erklärte Vicki und ärgerte sich selbst über den bitteren Beigeschmack, den dieser Satz bei ihr hinterließ. Sie war ungerecht. Harry hatte etwas Besseres verdient als eine Freundin, die ihn ankeifte, während er noch erholungsbedürftig war.
Sie strich ihm zur Entschuldigung über den Rücken. »Tut mir leid, das war dumm von mir. Ich freue mich, dass du wieder zu Hause bist. Und ich bringe dir aus der Redaktion die neueste Ausgabe vom Tagblatt mit – vielleicht möchtest du dich ja wenigstens ein bisschen auf dem Laufenden halten.«
Er sah sie an, und sein Blick war merkwürdig leer, während er sich um ein Lächeln bemühte. »Ich werde sicher früh ins Bett gehen. Mach dir also keine Gedanken, wenn es bei dir später wird. Du solltest dich ein wenig amüsieren … Sag den anderen Grüße von mir.«
Damit wanderte sein Blick wieder zurück in den Garten, wo inzwischen eine Amsel energisch unter einem Haufen von Blättern nach Würmern und Insekten fahndete.
Mit einem leisen Achselzucken griff Vicki nach ihrem Mantel und machte sich auf den Weg. Er hatte in gewisser Weise recht, wenn er die Texte im Prager Tagblatt überflüssig fand. In dieser Zeitung schrieben die Feinde des Reiches für andere Feinde des Reiches. Die vielen Andersdenkenden in Deutschland würden sie allerdings nicht erreichen, das war ihr bewusst …
Nach einer knappen halben Stunde erreichte sie die Redaktion in der Altstadt.
Sie öffnete die Tür und hielt einen Augenblick inne. So klangen alle Redaktionen, die sie in ihrem Leben bislang kennengelernt hatte. Das rhythmische Klappern der Schreibmaschinen, ein oder zwei schrillende Telefone und dazu unterschiedlich laut geführte Gespräche. Irgendwo lachte jemand, während ein anderer laut schimpfte. All dies machte das Grundsummen einer Redaktion aus. Und diesem Summen konnte man entnehmen, ob es aufregende Neuigkeiten gab – denn dann wurde es lauter und hektischer. Oder es war wie jetzt: Alle arbeiteten vor sich hin, jeder kannte seine Aufgabe und seinen Platz. Vicki schloss die Augen. Es roch nach zu vielen gerauchten Zigaretten und nach lauwarmem Kaffee.
Es war ihr ein Rätsel, wie Harry es ohne diese einmalige Umgebung aushielt. Er war Reporter, und ein guter dazu. Einer, der mit untrüglichem Instinkt die interessanten Geschichten ausgrub – und die Menschen dazu brachte, mit ihm darüber zu reden.
»Träumst du, Vicki?« Sie öffnete die Augen und sah direkt in das Gesicht eines kräftigen Mannes, der sie ohne viel Umstände in den Arm nahm.
»Erich, wie schön, dich zu sehen!«, rief sie. Den Fotografen kannte sie seit ihrer Anfangszeit hier in der Stadt. Er hatte sie im Prager Tagblatt willkommen geheißen und ihr sogar zu ihrer Wohnung bei der Witwe Lanczová verholfen. Und er war der Fotograf, der zugegen gewesen war, als Harry angeschossen wurde.
Es kam ihr so vor, als könne er ihre Gedanken lesen. Er wurde ernst und sah sie prüfend an. »Du bist aber nicht hier, weil es Harry wieder schlechter geht?«
»Nein, nein!« Sie schüttelte den Kopf. »Harry erholt sich. Das dauert eben seine Zeit – aber ich bin mir sicher, dass er bald wieder hier auftaucht.«
Dass er heute früh noch so gewirkt hatte, als ob er nie wieder seinen Fuß in eine Redaktion setzen würde, verschwieg sie lieber.
Erich Auerbach nickte beruhigt. »Das habe ich mir gedacht. Unkraut vergeht nicht. Und du warst in Berlin?«
Vicki nickte. »Ja, aber nur für wenige Stunden. Ich hatte gehört, dass mein Vater im Sterben liegt. Da wollte ich ihn nicht allein lassen, egal, wie riskant so ein Besuch auch ist.«
»Und?« Forschend sah der Fotograf sie an. »Wie war es?«
»Berlin?« Sie hob die Schultern. »Überall hängen Hakenkreuze.«
»Ich habe nicht nach der Politik gefragt.« Auerbach sah sie aufmerksam an.
Zögernd strich sich Vicki eine Strähne ihres kurzen Bobs hinters Ohr. »Mein Vater? Ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Er ist in der Nacht gestorben, in der ich in Berlin war.«
»Und – wie geht es dir jetzt?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Es tut mir leid, dass er seit Jahren nichts von mir gehört hatte. Er war der festen Meinung, dass ich tot bin. Das hat ihm ein Detektiv eingeredet, den er auf mich angesetzt hatte. Und das hat ihn in seinen letzten Jahren belastet. Immerhin hat er vor seinem Tod erfahren, dass es mir gut geht. Gleichzeitig konnten meine Brüder auch an seinem Sterbebett nicht ihren Zwist beilegen. Ich denke, das hat ihm endgültig das Herz gebrochen.«
»Und jetzt bist du also die Erbin des großen Manthey-Verlages?«
Vicki lachte auf. »Wohl kaum. Wie sollte das auch gehen in einem Land, in dem meine Anwesenheit nicht mehr erwünscht ist? Nein, ich habe mein Erbe meinen Brüdern übertragen. Sollen die beiden sehen, was sie damit in diesen Zeiten anstellen können. Und wenn die Zeiten sich irgendwann ändern, dann muss ich sehen, wie ich zu meinem Recht komme. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Fall schnell eintreten wird.«
Erich nickte nur. »Da hast du wohl recht. Bis der Herr Hitler sich aus der Politik zurückzieht, wird noch reichlich Wasser die Moldau hinunterfließen.« Er sah auf die Uhr. »Es ist gleich Mittagszeit. Wie sieht es aus? Sollen wir im Arco zu Mittag essen? Wie ich dich kenne, hast du noch nicht einmal gefrühstückt.«
»Gerne.« Vicki sah sich um. »Dabei habe ich hier noch gar niemanden begrüßt. Und ich wollte auch nachfragen, ob ihr vielleicht Arbeit für mich habt. Nach den letzten Tagen fällt mir zu Hause ein wenig die Decke auf den Kopf.« Leiser fügte sie hinzu: »Und ein wenig Geld würde unserem Konto guttun. Wenn wir weiter so leben wie jetzt, dann müssen wir irgendwann der Witwe Lanczová unsere letzten Ersparnisse in die Hand drücken.«
Beruhigend lächelte Erich sie an. »Ich bin mir sicher, dass wir etwas für dich finden. Aber erst einmal solltest du etwas essen. Du siehst dünner aus als sonst.« Er musterte ihre schmale Figur. »Und da war schon vorher nicht viel!«
»Dann lass uns gehen!«
An der Seite des Fotografen ging sie durch die Straßen ins Café Arco, das zu den bekanntesten der Stadt zählte. Hier saßen die Flüchtlinge, die alle kannten, berühmte Autoren, Denker und Philosophen. Und rührten ebenso wie alle anderen in ihren Tassen oder stritten über den richtigen Widerstand gegen die Zeiten, in denen zu leben sie gezwungen waren.
Erich führte Vicki in eine ruhige Ecke und winkte nach dem Kellner. »Bitte, Vicki, bestell dir etwas zum Essen!«
Minuten später stand ein Teller mit Knödeln und Gulasch vor ihr. Erst als Vicki den ersten Bissen nahm, merkte sie, wie hungrig sie gewesen war.
Erich sah ihr ein paar Augenblicke beim Essen zu, bevor er anfing zu reden. »Du musst auf dich aufpassen, Vicki. Was ist eigentlich los? Du wirkst ganz anders als zu dem Zeitpunkt, als ich dich kennengelernt habe.«
Sie winkte ab. »Es ist nichts, wirklich. Mein Vater ist gestorben, und mein Freund wäre fast erschossen worden. Wenn das keine Spuren hinterlässt, dann wäre ich wohl ein gefühlskaltes Monster, meinst du nicht? Aber um mich musst du dir keine Sorgen machen.«
»Sondern um Harry?«, fragte Erich vorsichtig nach.
Sie nickte. »Er war immer so voller Energie und hat eine rosige Zukunft gesehen, wo ich nur Dreck und Schutt erkannt habe. Ich habe gar nicht gewusst, wie sehr ich mich auf ihn verlasse. Und diesen Harry vermisse ich jetzt. Wenn ich nur wüsste, dass er zurückkommt, wäre ich geduldiger.« Sie unterbrach sich selbst. »Ich weiß schon, ich sollte so nicht reden, sondern dankbar sein, dass er lebt. Verzeih mir. Es gibt so viel Leid auf der Welt – und ich denke nur an mich.«
»Du musst dich nicht entschuldigen«, murmelte Erich. Er streckte seine Hand aus und strich ihr über den Handrücken.
Vicki zuckte zurück. »Bitte hör auf.«
Erich lächelte ein wenig schief. »Ich weiß schon. An Harry kommt keiner ran. Und ich will ja auch gar nicht dazwischen. Ich beneide ihn nur ein wenig, das ist alles.«
»So toll bin ich gar nicht.« Vicki bemühte sich, dem Gespräch wieder etwas mehr Leichtigkeit zu geben. »Und jetzt erzähl mir, was ich für das Tagblatt schreiben kann. Was braucht ihr?«
Mit einem leisen Seufzen griff Erich nach seinem Notizbuch. »Wir träumen von deiner Mitarbeit bei unserer Rubrik Vor Gericht. Du kennst sie, nehme ich an?«
»Sicher, da geht es doch um Prager Gerichtsskandale. Sehr unterhaltsam.« Vicki zog die Augenbrauen zusammen. »Also weniger ernst als die Reportagen, die ich in Berlin geschrieben habe?«
»So ist es. Aber du kennst dich mit dem Geschehen vor Gericht aus, du wirst dich schnell hineinfinden. Wie sieht es aus? Wir können nicht so viel zahlen wie die Berliner Zeitungen, aber wenigstens bieten wir dir eine wöchentliche Kolumne an.«
Vicki hätte über die neueste Frisur der Prager Ratten geschrieben, wenn es ihr ein regelmäßiges Einkommen gebracht hätte. Sie strahlte den Fotografen an. »Das wäre perfekt. Wann kann es losgehen?«
Auerbach lachte. »Wenn du willst, sofort. Kannst du den ersten Text in einer Woche liefern?«
»Wenn es sein muss, dann hast du morgen schon den ersten auf dem Schreibtisch.« Sie steckte den letzten Happen in den Mund. In diesem Augenblick kam ihr ein Gedanke. »Sag mal, Erich, diese Verhandlungen werden doch auf Tschechisch geführt, oder nicht? Ich werde kein Wort verstehen!«
Sie spürte, wie sich Enttäuschung in ihr breitmachte. Das Angebot von Erich wäre großartig gewesen, aber sie konnte den Pragern schwerlich zum Vorwurf machen, dass sie ihre eigene Sprache benutzten – auch wenn hier in der Stadt viele Deutsch sprachen. »Ich weiß dein Angebot wirklich zu schätzen, Erich. Aber eine Gerichtsreporterin, die nicht einmal die Sprache des Richters spricht …«
»Mach dir keine Sorgen«, entgegnete Erich. »Das haben wir uns in der Redaktion auch überlegt. Aber du könntest doch zu den Terminen einen Fotografen mitnehmen, der für dich dolmetscht? Dann wäre das Problem gelöst.«
Sie sah ihm in die Augen und dachte an die vertrauliche Geste, mit der ihr vor ein paar Minuten über die Hand gestrichen hatte. War er an ihren Qualitäten als Reporterin interessiert – oder war da mehr? Sie wusste es nicht. Und sie konnte es sich auch nicht leisten, ausgerechnet jetzt wählerisch zu sein.
Sie nickte. »Wunderbar. Und ich nehme an, dass du die Rolle des Dolmetschers übernehmen willst?«
»So ist es!« Er musterte sie mit einer hochgezogenen Augenbraue. »Oder wäre dir das unangenehm? Ich kann dir versichern, dass ich dir nur helfen will – egal, wie ich sonst zu dir stehe.«
Er schien es aufrichtig zu meinen. Also rang Vicki sich ein Lächeln ab. »Das weiß ich doch. Also, worum geht es im ersten Fall?«
»Das ist eine echte Gaunerklamotte. Es geht um einen Mann, der verschiedene Frauen von seiner tiefen Liebe überzeugt und dann größere Geldsummen als Geschenk in Empfang genommen hat, bevor er sich wieder aus dem Staub gemacht hat. Eine der Damen hat jetzt geklagt … und der arme Richter muss entscheiden, ob vorgetäuschte Liebe ein Verbrechen ist. Meine Meinung dazu: Wenn das so wäre, dann sind die Hälfte aller Ehefrauen Verbrecherinnen. Sie täuschen Liebe vor und bekommen dafür einen Ring und ein Auskommen. Ist doch auch nicht so schlecht.«
Vicki sah ihn von der Seite her an. »Täusche ich mich, oder klingt da eigene Erfahrung durch?«
»Nun, meine Frau hat es in den letzten Jahren nicht einmal mehr für nötig gehalten, mir ihre Zuneigung vorzugaukeln. Das ist auf die Dauer dann doch ein wenig mühsam.«
»Das tut mir leid«, sagte sie. »Ich denke, jeder hat ein wenig Liebe verdient. Oder wenigstens Achtung.« Sie deutete auf ihre Uhr. »Und wann müssten wir im Gerichtssaal sein, um zu hören, was der Herr Richter zu diesem Dilemma zu sagen hat?«
Erich kramte sein zerfleddertes Notizbuch hervor und blätterte ein wenig herum, bevor er zufrieden nickte. »Bist du spontan? Die Verhandlung beginnt in einer knappen Stunde.«
»Kein Problem. Ich bin dabei.«
Vicki musste sich eingestehen, dass sie sich auf den Nachmittag freute. Endlich würde sie wieder in einem Gerichtssaal sitzen und das tun, was sie am besten konnte: über das schreiben, was die Wirklichkeit war.
Berlin, Dezember 1933
Als die Wände seines Büros anfingen zu vibrieren, sah Fritjof auf die Uhr. Es war kurz vor zehn, und die Druckmaschinen liefen an, um die Nachtausgabe der Berliner Bühne zu produzieren mit den Polizeiberichten, in denen die Leichen noch warm und die Tränen der Opfer noch nicht getrocknet waren. Die Berliner liebten das, was Fritjof oft scherzhaft die Blut-und-Tränen-Ausgabe nannte.
Es war Zeit, endlich den Arbeitstag zu beenden. Aber er konnte sich nicht von einer Reportage lösen, die er morgen veröffentlichen wollte. Es ging eigentlich nur um den Eintopfsonntag, der seit zwei Monaten dafür sorgen sollte, dass die Staatskassen besser gefüllt wurden. Dafür hatte er einen Reporter gebeten, mal nachzufragen. Kochten die Berliner plötzlich wirklich jeden Sonntag ihren staatlich verordneten Eintopf? Und gaben Sie das ersparte Geld tatsächlich weiter? Die Antwort war einfach: Da das angeblich gesparte Geld von den Blockwarten kassiert wurde, spendeten viele bereitwillig – und es war unerheblich, ob sie jetzt am Sonntag Eintopf aßen oder doch lieber einen ordentlichen Braten. Spannend war die Deutung seines Reporters, dass auf diese Art und Weise die Regierung den Opferwillen der Deutschen testen wollte. Wie weit konnten sie gehen? Wenn die Deutschen bereitwillig ihren Schweinebraten aufgaben – was konnte man ihnen noch zumuten?
Er las die Reportage ein letztes Mal aufmerksam durch und legte gerade seinen Bleistift zur Seite, als er energische Schritte auf dem Flur hörte. Es gab nur eine Reporterin der Berliner Bühne, die noch um diese Uhrzeit in die Redaktion kam.
Fritjof stand auf, öffnete die Tür – und sah direkt in das Gesicht von Erika Stoll. Er gab sich keine Mühe, seine Freude zu verbergen.
»Wie schön, Sie zu sehen! Was treibt Sie um diese Uhrzeit in mein Reich?«
Sie lachte. »Ich habe Ihr erleuchtetes Zimmer von der Straße aus gesehen und mir gedacht, dass ich Sie von der Arbeit erlösen muss. Immerhin ist morgen Heiligabend. Da kann man doch auch mal um diese Zeit Feierabend machen.« Sie deutete in die Richtung der dröhnenden Druckmaschine. »Die Nachtausgabe ist offensichtlich fertig. Was machen Sie denn noch hier?«
Er deutete auf seinen Schreibtisch. »Ich habe da eine Reportage, die ich in Ruhe noch einmal durchlesen wollte.«
Ohne ihn um Erlaubnis zu fragen, setzte sie sich auf seinen Stuhl, griff nach dem Text und las ihn mit gerunzelter Stirn durch.
»Den wollen Sie wirklich veröffentlichen?« Sie sah ihn fragend an.
Fritjof nickte. »Die Sache mit dem Eintopfsonntag wird mir wohl kaum den Unmut von Goebbels einbringen.«
Sie legte die Papiere auf den Tisch und schüttelte den Kopf. »Da bin ich mir nicht so sicher. Die Sache bringt Millionen an zusätzlichen Einkünften. Und wenn Ihr Reporter recht hat, steckt dahinter ein viel größeres Ziel … Sie sollten die Geschichte besser verstecken. Am besten garnieren Sie sie mit einem schönen Eintopfrezept am Ende. Damit die beschränkten Köpfe des Propagandaministeriums den kritischen Unterton nicht bemerken.«
Überrascht sah Fritjof sie an. »Was ist denn mit Ihnen passiert? So vorsichtig kenne ich Sie gar nicht!«
»Ach, mir sind da so Geschichten zu Ohren gekommen … Aber ich will Sie nicht mit solchen Dingen belasten. Wir sollten lieber ausgehen! Irgendwo etwas essen, tanzen, Spaß haben!«
Überrascht sah Fritjof sie an. Die junge Reporterin gehörte eigentlich nicht zu den Menschen, die die Nächte durchfeierten. Meistens sah sie unter ihrem akkurat geschnittenen dunklen Bob ernst in die Welt, und die Leichtigkeit vieler ihrer Kollegen war ihr fremd.
Er griff nach seinem Mantel. »Sie haben mich ja schon überzeugt, Fräulein Stoll. Auch wenn es mir immer noch ein Rätsel ist, woher Ihre Unternehmungslust heute Abend kommt. Wo bekommen wir denn um diese Zeit noch etwas zu essen?«
Sie dachte kurz nach. »Im Aschinger gibt es sicher noch etwas. Und wenn wir tanzen wollen, dann sollten wir vielleicht …«
»… hinterher in einen der Tanzsäle gehen. Ich muss Sie aber warnen: Mein Bein sorgt dafür, dass ich beim Tanzen lieber zusehe. Das aber sehr gerne.«
Erika Stoll hakte sich bei ihm ein. »Vielleicht spielen sie ja einen langsamen Walzer. Das geht auch mit steifem Bein, das kann man auf jeder Tanzfläche beobachten.«
Fritjof freute sich über die überraschende Wendung, die dieser Abend genommen hatte. Fast jeden Abend zögerte er die Heimkehr in sein Elternhaus länger hinaus. Alexander bewirtete regelmäßig die verschiedensten Gäste, die nur eines einte: Sie waren die Gewinner in diesem neuen Deutschen Reich. Und sie hatten nicht vor, diese Macht wieder aus der Hand zu geben. Fritjof mied ihre Gesellschaft. So viel Rotwein gab es nicht einmal im Weinkeller seines Vaters, um sich Alexanders Freunde schön oder wenigstens erträglich zu trinken.
Wenig später saßen sie im Wintergarten in der Nähe der Bühne. Die erste Hälfte der Show war schon zu Ende, und sie ließen sich ein hervorragendes Kalbsragout schmecken.
Erika Stoll hob ihr Glas. »Auf das Leben! Danke, dass Sie diesen Abend mit mir verbringen!«
Leise klirrten die Gläser aneinander. Nach einem langen Schluck beugte sich Fritjof etwas nach vorne. »Wollen Sie mir jetzt erklären, warum Sie heute so verändert sind? Ich hätte nie vermutet, dass ich Sie zu einem Abend in einem so oberflächlichen Laden wie dem Wintergarten einladen darf!«
»Na ja, wie könnte ich einer Einladung meines Chefredakteurs widerstehen?«, entgegnete Erika lachend. »Wollen wir denn dann noch weiterziehen und tanzen gehen?«
»Sehr gern. Wie gesagt, ich werde nicht viel auf der Tanzfläche sein, aber ich mag die Stimmung und sehe gern zu.«
Sie einigten sich darauf, noch nach der Show in Clärchens Ballhaus zu gehen.
Noch immer konnte sich Fritjof keinen Reim auf Erika Stolls Verhalten machen. Seit ihrem ersten Auftritt in der Redaktion war sie immer ernst, sehr konzentriert und überkritisch gewesen. Egal, was er in der Bühne veröffentlichte: Es war ihr nicht kämpferisch genug und stand zu wenig im Widerspruch zum herrschenden Geist. Und ausgerechnet diese Reporterin, die im letzten Sommer auch schon einige Monate im Ausland gearbeitet hatte, um den Hakenkreuzen und dem Hitlergruß zu entgehen, verbrachte jetzt einen Abend mit ihm in diversen Vergnügungslokalen?
Als sie eintrafen, spielte das Orchester gerade einen langsamen Walzer.
»Lassen Sie uns gleich tanzen«, meinte Erika Stoll gut gelaunt. »Keine Sorge, Sie müssen sich nicht zu viel bewegen.«
Tatsächlich gelang es Fritjof erstaunlich gut, mit seiner Tanzpartnerin trotz des steifen Beins über die Tanzfläche zu gleiten. Das nächste Stück war ein Quickstepp, der sehr viel mehr Tempo und Sprünge verlangte. Also setzte er sich an einen Tisch, bestellte für sich und seine Begleitung etwas zu trinken und beobachtete das Geschehen als Zuschauer. Auch in diesem Lokal gab es mehr Herren mit Parteiabzeichen als früher. Unklar war nur, seit wann sie schon Mitglied waren. Fritjof machte sich einen Spaß daraus, zu schätzen, wer wohl erst in den letzten Wochen und Monaten eingetreten war – und wer schon seit längerer Zeit von der Idee des Nationalsozialismus überzeugt war. So vertrieb er sich die Zeit, bis Erika Stoll wieder bei ihm auftauchte.
»Jetzt geht es mir schon besser«, erklärte sie und trank einen Schluck aus ihrem Weinglas.
»Das glaube ich Ihnen nicht«, erwiderte Fritjof trocken. »Ich kenne Sie jetzt schon seit einiger Zeit – und ich habe heute das Gefühl, mit einer Fremden am Tisch zu sitzen. Einer sehr schönen und freundlichen Fremden, möchte ich an dieser Stelle betonen. Aber das Fräulein Stoll, das ich zu kennen glaubte, hätte sich nur sehr ungern in dieser Gesellschaft auf der Tanzfläche bewegt. Um ehrlich zu sein: Ich wusste kaum, dass sie tanzen kann. Auch wenn ich das immer vermutet habe.«
Erika Stoll griff erneut nach ihrem Glas und trank einige Schlucke. »Ich bin mir nicht sicher, ob das hier der richtige Rahmen für ein derartiges Gespräch ist. Hier sollten wir nach Ablenkung suchen, so wie alle anderen hier.«
»Um abzulenken, würde ich Ihnen als Erstes das Du anbieten. Ich bin ab sofort Fritjof für Sie oder für dich, wenn Sie mögen.«
»Und ich bin Erika.« Sie prostete ihm lächelnd zu.
»Du bist die am wenigsten ablenkbare Frau, die ich kenne, Erika«, erklärte Fritjof dann. »Also rück endlich mit der Sprache heraus: Was ist los? Wenn du willst, können wir auch ein ruhigeres Ambiente wählen.«
Sie nahm einen weiteren Schluck und nickte. »Lass uns kurz rausgehen.«
Sie sprachen erst wieder miteinander, als sie auf der Straße in der kühlen Nachtluft standen. Es riecht nach Schnee, dachte Fritjof bei sich.
»Es tut mir leid, dass ich heute nicht ehrlich zu dir war«, sagte Erika. »Das hast du nicht verdient. Aber heute Abend wollte ich mich ablenken und auf keinen Fall über Gefahr und Tod reden. Offensichtlich bin ich nicht sehr begabt darin, mal an etwas anderes zu denken.« Sie zögerte und fuhr sich nervös durch die Haare.
»Was ist dir denn widerfahren?«, wollte Fritjof wissen.
»Nun, mir selbst eigentlich nichts, aber ich habe Freunde, die dem Unrecht nicht tatenlos zusehen wollen. Ich habe sie kennengelernt, als ich meine erste Reportage geschrieben habe. Du erinnerst dich? Die Geschichte über die ersten Konzentrationslager, die in der Nähe von Berlin gebaut werden? Da, wo Häftlinge ohne Prozess und Urteil Gefängnisse für andere Häftlinge bauen und dabei schrecklich misshandelt werden?«
»Wie könnte ich mich nicht erinnern?«, erwiderte Fritjof. »Die Geschichte war richtig gut. Aber es wäre lebensgefährlich gewesen, sie abzudrucken. Deswegen habe ich das nicht getan, auch wenn du mich dafür am liebsten getötet hättest.«
»Das Schlimmste ist: Du hattest recht. Einer meiner Freunde wurde verhaftet. Heute wurde er wieder freigelassen. Als Warnung für andere. Sein Gesicht war kaum zu erkennen, seine Finger waren gebrochen, und sein Rücken …« Von einer Sekunde auf die andere verlor sie die Fassung. Tränen strömten über ihr Gesicht. »Er hat gesagt, dass wir trotzdem nicht aufgeben sollen. Wir sollten vorsichtiger sein und immer wieder völlig unverdächtige Dinge tun. So werden die Spitzel vielleicht verwirrt … Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mit dir ausgehen sollte.« Sie versuchte ein Lächeln. »Ich habe mir ausgemalt, wie ein Spitzel uns im Wintergarten beobachtet oder beim Tanzen – und dabei nichts sieht außer einem Chefredakteur, der mit einer jungen Reporterin ein Glas Wein trinkt.«
»Dann sollte ich dich vielleicht darauf hinweisen, dass ich nur begrenzt zur Tarnung tauge«, erklärte Fritjof. »Die Berliner Bühne ist verdächtig, egal, wie vorsichtig ich bin. Um unverdächtig zu sein, hättest du mit meinem kleinen Bruder ausgehen müssen. Der Chefredakteur der Antwort ist garantiert unverdächtig.« Er sah ihr forschend ins Gesicht. »Viel wichtiger ist jetzt allerdings die Frage: Wie geht es deinem Freund? Können wir irgendetwas für ihn tun? Hat er eine Unterkunft gefunden und einen Arzt?«
»Nein.« Die Tränen flossen wieder heftiger. »Er braucht keinen Arzt mehr. Er ist schon nach wenigen Stunden gestorben. Offensichtlich hat man ihn auch in den Bauch getreten, er hatte wohl innere Blutungen. Ein Arzt, der ihn untersucht hat, meinte, er hätte keine Chance gehabt.«
»Und die Täter werden niemals vor Gericht zur Rechenschaft gezogen, das ist mal sicher.« Fritjof ballte die Fäuste. »Wenn ich so etwas höre, würde ich den Gästen, die Alexander beständig in unserem Haus bewirtet, am liebsten den teuren Rotwein ins Gesicht kippen. Vielleicht wäre das auf die Dauer sinnvoller als diese berechnende Vernunft, die mir immer wieder sagt, dass ich nichts riskieren und an die Arbeitsplätze bei unserer Zeitung denken soll. Wenn alle Kritiker des Regimes auf einmal auf der Straße wären, könnten wir wirklich etwas bewegen.«
»Passiert aber nicht«, murmelte Erika. Er wischte ihr vorsichtig die Tränen von der Wange. War das der viele Wein? Oder nur die gemeinsame Hilflosigkeit?
Er versuchte, in Erikas bernsteinfarbenen Augen etwas anderes als Trauer und Zorn zu lesen – aber es misslang ihm. Sie legte ihre Hand über seine. »Was bleibt uns also zu tun?«
»Weitermachen. Wir müssen weiter für ein anderes Deutschland schreiben. Und wenn wir das hier nicht mehr dürfen, dann im Ausland. Aufgeben gilt nicht.«
»Aufgeben gilt nicht«, wiederholte sie langsam und ließ seine Hand los. »Und bis dahin hilft Tanzen und Wein. Lass uns wieder reingehen.«
Fritjof nickte nur und folgte ihr zurück ins Tanzlokal.
Schrilles Kreischen schnitt ihm direkt ins Gehirn. Unerträglich laut. Er öffnete die Augen, sah einen Vorhang, eine Wand, einen Stapel mit Büchern. Nichts davon kam ihm bekannt vor. Er schloss die Augen wieder.
»Kaffee?«
Die Stimme klang verschlafen und kam ihm vertraut vor. Vorsichtig machte er die Augen auf. Sein Blick fiel auf Erika Stoll. Sie trug einen schwarzen Morgenmantel, der ihre schmale Taille noch mehr betonte, und sah so gut aus wie immer. Was tat er hier? Und vor allem: Was war gestern geschehen? Er erinnerte sich an ihren gemeinsamen Ausflug in den Wintergarten und in Clärchens Ballhaus und an ihr Gespräch auf der Straße, als sie ihm von einem Freund erzählt hatte. Von Folter und Tod. Von Ohnmacht und Wut. Und der einzige Ausweg, den sie gesehen hatten, lag in einer Flasche Wein. Oder zwei. Keine Lösung – aber für ein paar Stunden waren die Probleme, die sie umgaben, weniger groß gewesen.
Umso größer war jetzt sein Kopfweh. Fritjof setzte sich mit einem Stöhnen auf, rieb sich die Schläfen und griff dankbar nach der Tasse. »Vielen Dank!« Er sah sich um. »Wie sind wir hier …?«
»Das ist meine Wohnung«, erklärte sie. »Und wir sind hier gelandet, um noch ein letztes Glas Wein zu teilen, nachdem das Tanzlokal geschlossen hatte. Du warst danach eindeutig nicht mehr in der Lage, nach Hause zu kommen.« Sie zog eine kleine Grimasse. »Und wenn ich meinen Kopfschmerz richtig deute, dann war ich auch nicht mehr fähig, dir eine Droschke zu bestellen.«
»Ich habe also nichts vergessen, woran ich mich erinnern müsste?«, fragte er vorsichtig nach.
Sie schüttelte den Kopf. »Du bist einfach nur auf dem Sofa deiner Reporterin aufgewacht, weil du zu viel Wein getrunken hast.«
»Fürs Erste bin ich dankbar, dass du mich nicht auf die Straße gesetzt hast.«
»Auch dazu war ich wahrscheinlich nicht mehr in der Lage«, bekannte sie freimütig und deutete auf seine leere Tasse. »Möchtest du noch etwas Kaffee? Ich habe ihn heute ganz besonders stark gemacht.«
Er lächelte. »Du bist großartig!«
»Danke schön. Leider sagst du so etwas nicht zu meinen Reportagen, sondern nur zu meinem Kaffee.« Da war er wieder, ihr spöttischer Ton, den er so liebte.
»Darf ich dich fragen, was du heute vorhast?«, fragte er. »Immerhin ist heute Heiligabend.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Meine Familie lebt in Hamburg, da werde ich es heute wohl nicht mehr hin schaffen. Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie sich über meine Anwesenheit freuen würden.«
»Wieso? Sie sollten stolz auf dich sein!«
»Das wären sie auch, wenn ich ein etwas konventionelleres Leben führen würde, als Sekretärin oder Mädchen für alles in einem Büro. Aber dass eine Frau als Reporterin tätig ist, noch dazu oft im Ausland – das ist etwas zu viel für einen schlichten Arbeiter in einer Lampenfabrik. Ich denke, er sähe mich am liebsten unter der Haube.« Sie blickte ihn an. »Und du? Familienfeier?«
Fritjof schüttelte den Kopf, was dazu führte, dass seine Kopfschmerzen noch stechender wurden. »Meine einzige Familie hier in der Stadt ist mein Bruder. Ich habe keine Ahnung, was er heute Abend vorhat – aber ich fürchte, er hat mal wieder irgendwelche Würdenträger dieses neuen Deutschlands eingeladen. Da setze ich mich lieber in mein Arbeitszimmer und zünde mir eine Kerze an.«
»Und deine Schwester?«
»Die wird wohl erst einmal keinen Fuß mehr in diese Stadt oder dieses Land setzen. Genau genommen bin ich froh, dass sie nicht hier ist. Eva Porter war bestimmt keine Freundin der Nazis.«
»Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Eva Porter das Pseudonym deiner Schwester ist. Jahrelang habe ich ihre Texte gelesen und bewundert – und nie geahnt, was für eine Verbindung sie zu dir und dem Verlagshaus Manthey hat.«
»Ist ja auch eine lange Geschichte, wie es dazu gekommen ist«, murmelte Fritjof. »Und es war bestimmt besser, dass sie sich auf diese Weise unsichtbar gemacht hat.«
Er sah auf seine Uhr und erhob sich mühsam. Mit einem Stöhnen griff er sich an sein Bein.
»Kann ich dir helfen?« Erika stellte ihre Tasse ab und streckte eine Hand aus.
Abwehrend schüttelte Fritjof den Kopf. »Wenn ich nicht mehr allein aufstehen kann, dann zähle ich endgültig zum alten Eisen. Das möchte ich noch ein Weilchen vermeiden. Besonders dann, wenn ich bei einer so schönen jungen Frau zu Gast bin.«
Erika deutete auf eine Tür hinter sich. »Da ist das Badezimmer, wenn du dich etwas frisch machen möchtest. Aber sei gewarnt: Viel Luxus habe ich nicht zu bieten.«
»Ein Badezimmer in der Wohnung – das ist doch schon einmal ein Anfang«, meinte Fritjof und hinkte zu der schmalen Tür. In der Tat befanden sich im Raum nur ein Waschbecken und eine Toilette. Zum Baden musste Erika offensichtlich in eine der städtischen Badeanstalten.
Er wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser ab, strich sein Hemd und den Anzug glatt und richtete vor dem kleinen Spiegel seine Krawatte. An den Bartstoppeln konnte er nichts ändern – aber heute waren im Verlag ohnehin nur wenige Mitarbeiter. Zu Weihnachten erschien keine Zeitung.
Als er aus dem Badezimmer kam, erwartete ihn eine weitere Tasse heißer Kaffee. Schweigend trank er ein paar Schlucke, dann griff er nach seinem Mantel. »Ich muss jetzt wohl gehen. Vielen Dank, dass du mich gestern nicht hast in der Gosse liegen lassen.«
»Immer wieder gerne«, erklärte sie trocken. Dann sah sie ihn eine Spur zu lange an. »Und wie geht es jetzt weiter?«
Fritjof versuchte sich an einem Lächeln. »Da Rotwein offensichtlich auf Dauer keine Lösung ist, werden wir weiter gegen diese Nazis anschreiben und damit den Gedanken der Demokratie hochhalten. Wir tun, was wir können. Das ist wenig genug.«
»Und wie sieht es mit heute Abend aus?«
Überrascht sah er sie an. »Wie gesagt, ich werde versuchen, meinen Bruder und seine Gesellschaft zu meiden. Weiter ist meine Planung noch nicht gediehen. Und du?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich habe hier in Berlin nicht einmal einen Bruder, den ich nicht treffen möchte. Sollen wir vielleicht unsere Heiligen Abende zusammenlegen? Wir können es ja dieses Mal bei einer Flasche Rotwein belassen.«
»Das ist die beste Idee, die ich seit Langem gehört habe!« Fritjof lächelte ihr zum Abschied zu. »Ich komme heute Abend um sechs vorbei und hole dich ab. Um ein ordentliches Restaurant kümmere ich mich auch!«
»Bis nachher!« Sie winkte ihm zu, die Tür schloss sich hinter ihm – und so beschwingt es ihm sein lahmes Bein und der schwere Kopf erlaubten, lief Fritjof die Treppe nach unten.
Prag, Weihnachten 1933
Vorsichtig hob Vicki den Braten auf eine Platte, schnitt ihn auf und stellte ihn auf den Tisch, dazu eine Schale mit dampfenden Kartoffeln und eine Terrine mit Weißkohl und etwas Soße. Nachdem sie zuletzt noch die Weingläser gefüllt hatte, sah sie zufrieden in die Runde.
»Es mag ein Heiligabend in der Fremde sein, aber ich finde, es sieht richtig festlich aus, oder nicht?« Sie blickte in die Runde, die aus Harry, ihrer Vermieterin und einem Ehepaar bestand, das etwas verloren wirkte. Paul und Henriette Schrader waren erst vor ein paar Wochen in die alte Villa gezogen und hatten sich noch nicht an ihr neues Leben in Prag gewöhnt. Vor allem Frau Schrader wirkte immer noch betrübt darüber, dass sie nicht mehr in ihrer bequemen Wohnung in Charlottenburg lebte. Als sie vor ein paar Tagen bei der Erwähnung der Weihnachtsfeiertage in Tränen ausgebrochen war, hatte Vicki sie kurzerhand eingeladen.
»Sie sind sehr gütig«, murmelte Frau Schrader und sah die Kerzen auf dem Tisch an. Sie flackerten unruhig, rußten zu stark – und doch verbreiteten sie wenigstens ein bisschen Feststimmung.