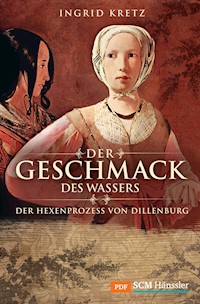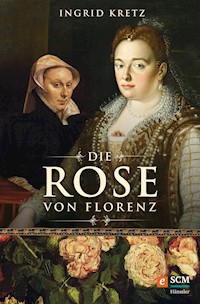Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem dritten historischen Liebes-Roman aus der Regency-Zeit führt die beliebte Autorin Ingrid Kretz in den Südwesten Englands. 1799: Als der junge Lord Richard Clarke von Cold Ashton Manor und die Apothekerstochter Amber Devaney sich verlieben, erscheint eine gemeinsame Zukunft unmöglich. Zu große Standesunterschiede trennen die beiden voneinander, auch wenn ihre Liebe stark ist. So stark, dass Amber bald ein kleines Geheimnis unter dem Herzen trägt. Seinen Eltern zum Trotz versucht Richard nun erst recht, um ihre Hand anzuhalten. Doch plötzlich ist Amber verschwunden. Ihre Familie schweigt sich aus und Richard verzweifelt. Als er auch nach langer Suche keinen Hinweis auf Ihr Verbleiben findet, muss er sich der Frage stellen: Kann er Amber noch irgendwann finden oder soll er die Zweckehe eingehen, die seine Eltern ihm vorgeschlagen haben? Eine packende Geschichte, die immer wieder eine unvorhersehbare Wendung nimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
INGRID KRETZ
Die zweiteBraut
VONCOLD ASHTONMANOR
Die Bibelstellen sind der Übersetzung Bibeltext der Schlachter entnommen.Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft. Wiedergegeben mit freundlicherGenehmigung. Alle Rechte vorbehalten.
© 2021 Brunnen Verlag GmbH, Gießen
Lektorat: Carolin Kotthaus
Umschlagfoto: © Holly Leedham / Trevillion Images
Umschlaggestaltung: Daniela Sprenger
Satz: DTP Brunnen
ISBN Buch: 978-3-7655-3761-5
ISBN E-Book: 978-3-7655-7625-6
www.brunnen-verlag.de
Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzenund verlass dich nicht auf deinen Verstand;erkenne Ihn auf allen deinen Wegen,so wird Er deine Pfade ebnen.
SPRÜCHE 3,5-6
Die vollkommene Liebewird uns nicht auf einmal zuteil,weil wir nicht allesauf einmal hergeben.
TERESA VON ÁVILA (1515–1582)
INHALT
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
PROLOG
FRÜHJAHR 1800, DORF COLD ASHTON
„Wach auf, Amber!“ Die Stimme war ganz nah. Drängend. Fordernd.
Sie lief durch einen Wald, umgeben von riesigen Kräutern und unnatürlich großen Mörsern und Tiegeln, ohne einen Ausweg aus dem grünen Labyrinth zu finden. Es war warm hier, aber sie wusste nicht, vor wem sie auf der Flucht war, wohin sie überhaupt sollte und woher diese Rufe kamen.
Wieder herrschte die weibliche Stimme sie an: „Mach schon! Es wird Zeit.“
Es hallte über sie hinweg. Jemand rüttelte so heftig an ihr, dass ihr Kleid flatterte, als würde es vom Wind bewegt.
Langsam kam sie zu sich. Sie lag zusammengerollt wie eine junge Katze in ihrem Bett, die Decke fest um sich geschlungen, und hatte keine Ahnung, warum irgendjemand neben ihrem Bett stand.
Schattenrisse zerteilten ihr Zimmer und als sie die Silhouette neben sich erkannte, erschrak sie. Ihre Mutter! Was war nur los? Warum stand sie hier im Dunkeln? Und dieser merkwürdige Traum eben? Was hatte das alles zu bedeuten?
Mrs Alice Devaney griff wieder nach ihrer Schulter. „Steh jetzt auf!“, mahnte sie erneut in diesem befehlenden Ton.
Angst stieg in Amber hoch. „Wieso?“ Sie richtete sich auf und stützte sich mit den Armen ab. „Was ist passiert?“, blinzelte sie verschlafen. „Warum weckst du mich mitten in der Nacht?“
„Mitten in der Nacht!“, spottete ihre Mutter und ging zur Tür. „Wann denn sonst? Sollen uns die Nachbarn etwa zuschauen? Hol dir eine Lampe und zieh dich an. Wir müssen gleich los.“ Die Klinke schnappte ins Schloss.
Gleich los? Amber spürte, wie ihr Magen rebellierte und schluckte den aufsteigenden Würgereiz runter. Es war schon immer so gewesen, dass ihr Körper bei zu wenig Schlaf aufbegehrte. Wahrscheinlich tat ihre augenblickliche Lage noch das ihrige hinzu. Abermals stieg es sauer in ihr auf. Sie presste die Lippen zusammen und schwang die Beine aus dem Bett. Für einen Moment verharrte sie sitzend auf der Bettkante.
Bis auf einige wenige Geräusche im Erdgeschoss war es fast totenstill im Haus. Was ging hier vor? Warum holte Mama sie nachts aus dem Schlaf? Und wo um Himmels willen sollten sie hin? Wir müssen gleich los. Warum? Wohin mussten sie?
Langsam kroch Amber aus dem Bett und huschte mit nackten Füßen aus dem Zimmer, ohne sich einen Morgenmantel überzuwerfen. Die Kälte im Haus kroch an ihr hoch. Sie beugte sich über das Geländer und bemerkte einen Lichtstrahl, der aus der Küche in den Flur fiel. Schnell lief sie die Treppe hinunter. Einen Augenblick verharrte sie vor der Tür, bevor sie den Raum betrat. Ihre Mutter stand fertig angezogen da und sah sie ernst an. „Da“, sie wies auf eine Lampe, „und jetzt beeil dich!“
Hinter ihr stand Mary, ihre Dienerin, ebenfalls vollständig bekleidet, mit verschlafenem Blick und Äpfeln in der Hand.
Amber war völlig ratlos. „Würdest du mir bitte erklä-“
„Nein!“ Die Stimme zerschnitt die Nacht. „Dafür ist jetzt keine Zeit! Ich erkläre es dir später.“ Ihre Mutter drehte ihr den Rücken zu und wies Mary an, noch Brot und Wurst in einen Korb zu packen. „Und vergiss den Krug mit Wasser nicht!“
Amber machte keine Anstalten zu gehen und schluckte. Während Tränen ihre Augen fluteten, verschwamm die Küche zu einem düsteren Nebel. Es musste etwas ganz Schlimmes passiert sein. „Was … was ist denn nur los? Ist der Krieg bis hierhin vorgedrungen?“
Ihre Mutter drehte sich um und verzog den Mund, als habe sie in einen säuerlichen Hering gebissen. „Krieg? Bis du noch bei Sinnen? Weißt du wirklich nicht, was los ist?“
„Nein!“ Amber schrie und ahnte Verhängnisvolles. Sie stürzte aus der Küche und rannte nach oben. Warum war Richard gerade nicht da? Wie sollte sie ihm nur sagen, dass sie verreiste? Gab es jetzt keine Möglichkeit mehr, ihm noch eine Nachricht zu schicken? Hoffentlich konnte sie ihm später schreiben. Und warum war Vater nicht aufgestanden? Wusste er überhaupt von den Plänen seiner Ehefrau? Oder war das hier ein Komplott?
„Die Lampe!“, gellte die Stimme ihrer Mutter. Schluchzend stieg Amber wieder zu ihr hinab und nahm die bereitgestellte Öllampe an sich. Zurück in ihrem Zimmer streifte sie eilends ihr Nachtkleid ab, schlüpfte in ihr Mieder und das geblümte himmelblaue Kleid, das sie so gerne mochte, und holte ein Paar Strümpfe aus ihrer Kommode. Nachdem sie sich vollständig angezogen hatte, löste sie ihren Zopf, bürstete grob ihr hüftlanges Haar und steckte es mit geübten schnellen Handgriffen zu einem Dutt im Nacken zusammen. Ihre Schnürstiefel standen noch ungeputzt unterm Fenster. Vater hatte gestern Abend dringend ein paar Salben und Tinkturen in seiner Apotheke zubereiten müssen und sie war ihm bis in die späten Abendstunden zur Hand gegangen.
Endlich stand sie angezogen da und warf einen letzten, gequälten Blick in den Spiegel. Ihre Augen wirkten verquollen und glichen schmalen Schlitzen. Darüber thronten dunkle Augenbrauen gleich eleganten Bögen und hoben sich bestechend dunkel von ihren lichtblonden Haaren ab, als habe sich ein Maler in der Farbe vertan. Sie besaß keine Kraft, wie gewöhnlich frühmorgens ihrem Spiegelbild zuzulächeln. Mit dem noch feuchten Waschlappen vom Abend fuhr sie sich durchs Gesicht. Das musste für jetzt genügen und sie hoffte, ihre Morgentoilette bald wieder gewissenhafter verrichten zu können.
Vorm Haus hörte sie Hufgeklapper. Noch ehe sie sich versah, stand ihre Mutter in Mantel und mit einem monströsen Hut bekleidet in der Haustür, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres, zu nachtschlafender Zeit mit der Kutsche auszufahren. Sie drückte ihr den Wollmantel in die Hand, schob sie in das Wageninnere der Kutsche und stellte ein kleines Gepäckstück neben die Füße. Entschlossen setzte sie sich neben Amber, die die Füße zurückziehen musste, weil Mary sich mit dem vollgepackten Proviantkorb auf die Bank gegenüber zwängte. Als der Kutscher die Tür verschlossen hatte, lehnte ihre Mutter sich zurück und seufzte laut.
Amber warf Mary einen fragenden Blick zu, doch die starrte nur zur Decke und sah nicht aus, als sei sie sonderlich überrascht über diese Fahrt. Wahrscheinlich war das junge Mädchen eingeweiht worden.
Amber senkte den Kopf. Es war düster hier, aber nicht vollständig dunkel und so erkannte sie ihren kleinen Koffer. Ob der Kutscher für Mutter den großen auf dem Dach befestigt hatte? Aufgrund der Eile und ihrer Verwirrung hatte sie ihm keine Beachtung geschenkt. Sie zeigte nach oben. „Dein Koffer ist dort?“, fragte sie zaghaft, als sich das Gefährt in Bewegung setzt. Als Letztes erhaschte sie noch das Schild über der Eingangstür zur Apotheke „Farmacy Jeff Devaney“.
Ihre Mutter schüttelte den Kopf. „Ich brauche keinen.“
„Aber du reist doch mit mir.“ Amber sah sie verständnislos und mit großen Augen an. Sie schluckte, während Kälte und Hitze durch ihren Körper rasten. Augenblicklich war sie hellwach.
Ihre Mutter nestelte an ihren Hutbändern, setzte den Hut ab und spitzte die Lippen. „Nur bis Newport. Dort werden die Pferde gewechselt. Wenn ich Glück habe, bin ich bis abends wieder daheim.“ Sie sah Amber an, die sie mit offenem Mund anstarrte. „Ich hoffe, du verstehst, dass ich Mary das Geld für die Übernachtungen anvertraut habe. Womöglich verlierst du es noch in deiner Verwirrung. Bestimmt müsst ihr ein Gasthaus aufsuchen, denn weder ihr noch die Pferde können unendlich lange fahren.“
Amber hielt die Luft an. Der abweisende Blick ihrer Mutter schmerzte. Sie faltete ihre klammen Hände und schickte ein stummes Bittgebet zu Gott. Herr, ich ahne, dass sie mich fortschafft. Bitte, bitte, hör mein Flehen! Wie viele Gebete habe ich in den letzten Wochen an dich gerichtet, o allmächtiger Gott? Ich kann doch nicht mehr, als mich schuldig zu fühlen. Wie oft habe ich in den letzten Tagen um Verzeihung gefleht? Jetzt darf ich noch nicht mal mehr zu Hause sein. Niemand will mich. Wo bringt man mich hin?
Als habe ihre Mutter ihre Frage gehört, meinte sie: „Du besuchst eine Verwandte von uns.“
„Eine Verwandte?“ Mühsam unterdrückte Amber das Zittern in ihrer Stimme. „Ich möchte aber niemanden besuchen.“
Das interessierte wohl keinen. „Sie freut sich, dich kennenzulernen.“
Ganz gewiss nicht, dachte Amber und starrte aus dem Fenster. Die Cotswolds lagen wie ein dunkel ausgebreitetes Tuch vor ihr. Am Horizont war ein hellgrauer Streifen erkennbar, der den kommenden Morgen erahnen ließ. Sie fror. Im Inneren der Kutsche war es genauso kalt wie draußen, nur dass die Landschaft draußen friedvoll von Morgentau eingehüllt war, während hier drinnen eine stille Unruhe herrschte. Der Mond hing unbeirrt über dem Land und noch war kein Vogelgezwitscher zu hören. Amber griff nach ihrem Mantel und breitete ihn über ihre Knie aus.
„Und wo, bitte, wohnt diese Verwandte?“
„Du fragst zu viel.“
„So kannst du nicht mit mir reden!“
Amber fing Marys ungläubigen Blick auf und jäh stieg Ablehnung in ihr hoch. Mochte doch die Dienerin über ihre Widerworte denken, was sie wollte.
„Ich glaube, da verwechselst du was!“ Ihre Mutter fuhr herum. „Du hast dich in Schlamm gebadet und wunderst dich, dass Dreck hängen bleibt?! Dein Benehmen hat unsere Familie mit Schande bedeckt. Und ich gebe dir den guten Rat, niemandem im Dorf einen Brief zu schreiben, geschweige denn, dein Obdach mitzuteilen!“
Ambers Herzschlag raste und sie schluchzte auf. War diese herzlose Frau tatsächlich ihre Mutter? War sie schon immer so abgestumpft gewesen? Nein, sicher nicht.
Ambers Mutter hatte zwar schon oft eine spitze Zunge gehabt und es beispielweise als Blödsinn abgetan, wenn Amber Interesse für Vaters Apotheke gezeigt hatte, aber mehr auch nicht.
Ihr Vater dagegen hatte sie immer in Schutz genommen, denn er schätzte ihren Wissensdurst und erklärte ihr mit Hingabe die verschiedensten Kräuter, Pflanzen und ihre Wirkung. Oft lobte er sie als große Hilfe.
Doch was war es dann, das ihre Mutter so handeln ließ? Sie war zwar noch nie besonders feinfühlig gewesen, aber auch nicht völlig gefühllos. Natürlich war sie nicht gewohnt, Gefühle zu zeigen. Die Sitte ließ nicht viel Spielraum für romantische Empfindungen. Die gehörten vielmehr hinter verschlossene Türen. Doch ihr jetziges Handeln überstieg alles, was Amber jemals gewohnt gewesen war.
Hatte ihr Fehlverhalten etwa dazu geführt, dass man sie nicht eingeweiht hatte? Hatten ihre Eltern mit ihrem Widerstand gerechnet und deshalb diese nächtliche Aktion gestartet?
Die Angst, ihre Tochter könne ein gefallenes Mädchen werden, hatte von dem Augenblick an wie ein Wetterleuchten über der Familie gehangen, seit es die ersten Zeichen einer körperlichen Veränderung gegeben und Amber nicht mehr wie ein Besenstiel ausgesehen hatte. Ungeachtet welcher Gesellschaftsschicht man angehörte, gab es strenge Regeln für junge Leute, und die betrafen insbesondere das sittliche Verhalten.
Das Gefährt rumpelte über die Landstraße. Mary saß still neben Amber und hielt die Augen geschlossen. Bald sackte ihr Kopf auf die Brust, während ihr gleichmäßiges Atmen einem vernehmbaren Schnarchen wich. Mutter war in Schweigen versunken und hielt sich kerzengerade auf dem Sitz. Bei einem Blick aus dem Fenster bemerkte Amber, dass der Mond hinter Wolken verschwunden war. Am Horizont warf die aufgehende Sonne einen großen Bogen, der von orangenen Farben hinauf bis zu mystischen Violetttönen reichte. Erst allmählich erwachte die Natur. Irgendwo bellte ein Hund und Vogelgezwitscher begleitete ihre einsame Fahrt. Sie durchfuhren Dörfer, die oft nur aus wenigen Häusern und Gehöften bestanden. Hier und da waren Leute zu sehen. Frauen schütteten das Nachtgeschirr auf der Straße aus.
Amber fragte wiederholt nach, wohin die Reise ginge und wie lange sie wegbleiben würde, doch ihre Mutter hüllte sich in Schweigen. Die Fahrt schien kein Ende zu nehmen. Wer war diese Verwandte, von der Mutter gesprochen hatte? Vater hatte eine Schwester, die sie als Kind kennengelernt hatte, aber sie wusste nicht, wo diese lebte. Dann gab es noch einen Onkel, der irgendwo in die Nähe von London gezogen war. Es wurde nicht viel von den Angehörigen erzählt, aber hin und wieder traf man sich doch. Bis heute hatte sie dem keine Bedeutung zugemessen. Ihre Mutter hatte keine Geschwister, nur drei Tanten und einen Onkel. Sie lebten in umliegenden Dörfern. Eine Tante war bereits verstorben. Ob die Reise zu Vaters Verwandten ging? In Gedanken versunken nahm sie die Landschaft, die am Fenster vorüberzog, kaum noch wahr. So bemerkte sie zuerst nicht, dass sie plötzlich zum Stehen gekommen waren.
Als plötzlich die Tür aufgerissen wurde, schreckte sie auf. Es war der Kutscher, der Mutter jetzt beim Aussteigen half. Amber seufzte erleichtert und nahm die entgegengestreckte Hand, um sich ebenfalls heraushelfen zu lassen. Auch Mary war hochgeschreckt. Kein Wunder, hatte sie doch die ganze Zeit geschlafen und wusste jetzt sicher nicht, wo sie sich befanden.
Erst jetzt bemerkte Amber, dass sie vor einer Postkutschenstation standen. Ein großes, nachlässig gemaltes Schild über dem Eingang wies darauf hin. Männer hasteten um Pferde herum, riefen sich Kommandos beim Einschirren zu und versuchten, unruhig gewordene Rösser zu beruhigen. Es roch nach Pferdemist und Ruß, den der Wind von der Straße und von den Schornsteinen naher Häuser herüberwehte. Ihre Mutter sprach mit dem Kutscher, während Mary dicht zu Amber trat und sich zitternd den Mantel umschlang.
„Er muss die Pferde wechseln“, rief Mrs Devaney, „und ihr könnt euch im Gastraum bei einem Tee aufwärmen, bis er die Order zur Abfahrt gibt. Mary, achte auf das Geld! Und du, Amber, richte bei deiner Ankunft meine Grüße aus.“
Mutters Stimme klang entschieden und wenig mitfühlend. Enttäuscht traten Amber Tränen in die Augen und sie schniefte. Was würde nun werden? Wohin sollte die Reise gehen? Würde sie je wieder nach Cold Ashton zurückkehren? So musste es Gefangenen ergehen, die nach ihrer Verurteilung auf Nimmerwiedersehen nach Australien deportiert wurden. Sie hatte gehört, dass nicht wenige bereits auf der Überfahrt starben und selten jemand in die alte Heimat zurückkehrte. Sie schnappte nach Luft. Warum rettete sie niemand vor einer Zukunft, die ungewiss und nur schlimm sein konnte? Ja, sie hatte einen Fehler begangen. Einen schlimmen Fehler. Die Folgen waren gravierend, aber sah so die Hilfe einer liebenden Mutter aus? Noch nicht mal von ihren kleinen Brüdern hatte sie sich verabschieden können. Wie ein Dieb in der Nacht musste sie sich davonstehlen.
Ihre Mutter trat auf sie zu und wollte sie formhalber zum Abschied umarmen, doch Amber wich zurück. Ein Hauch von Beschämung schwelte in ihr. Nur mühsam hielt sie sich auf den Beinen und starrte ihre Mutter wortlos an. Dann schüttelte sie den Kopf, drehte sich um und stürzte auf die Tür der Postkutschenstation zu. Sie riss sie auf, floh in den warmen Aufenthaltsraum und ließ mit einem Krachen die Tür hinter sich ins Schloss fallen.
1
ZEHN MONATE ZUVOR – SOMMER 1799, COLD ASHTON MANOR
Die mächtige, hohe Holztür flog mit einer solchen Wucht auf, dass sie mit Getöse an die Wand krachte und Richard selbst erschrocken innehielt. Es war ein Glück, dass der Diener, der gerade den Salon verlassen wollte, geistesgegenwärtig die Flasche auf dem Tablett festhielt und einen Schritt zurücktrat, sonst wäre er mit ihm zusammengeprallt.
Entgegen seiner Art beachtete er den Diener nicht weiter.
„Du willst sie nicht zum Jahrmarkt gehen lassen?“ Lord Richard Clarke, fünfter Viscount von Landsdown und künftiger Graf von Cold Ashton, stampfte durch den Raum und blieb schnaubend vor seinem Vater stehen, der, ebenso wie seine Mutter, in seinem Sessel erschreckt auffuhr.
„Was …?“, setzte Lord Archibald Clarke an, doch Richard ließ ihn nicht zu Wort kommen.
„Muss ich deine Entscheidung vom Dienstpersonal erfahren? Wie kommst du dazu, ihnen das zu verbieten?“ Er konnte sich nicht mehr erinnern, wann er derart aufgebracht und ungestüm seinem Vater gegenübergetreten war. Dass seine Mutter jetzt alles mitbekam, war ihm egal. „Das hat’s noch nie gegeben!“
„Muss ich dich vorher um Genehmigung ersuchen?“, fragte sein Vater beißend zurück und riss eine Augenbraue hoch. „Noch bin ich Herr über Cold Ashton.“ Sein Weinglas schepperte beim Absetzen.
Richard unterdrückte knirschend einen weiteren Vorwurf und warf einen Seitenblick auf seine Mutter Lady Kathleen, die immer noch kerzengerade im Sessel verharrte und ihn entgeistert anstarrte. Die Abendsonne beleuchtete ihr sanft geschnittenes Gesicht und schenkte ihren lebhaften Augen einen warmen Glanz.
Das köstliche Rebhuhn, das sie gemeinsam vor knapp einer Stunde beim Dinner genossen hatten, und das seiner Meinung nach in den Cotswolds niemand besser zubereitete als ihre Köchin, lag plötzlich wie ein starrer Klumpen in Richards Magen. Er fuhr sich mit der Hand durch seine braunen Haare. „Der Jahrmarkt in Marshfield bietet ihnen endlich mal etwas Abwechslung, findest du nicht?“ Nachdrücklich fügte er hinzu: „Das Vergnügen haben sie nur einmal im Jahr!“
Sein Vater ließ sich zurück in den Sessel sinken und wich seinem Blick aus. „Wozu?“, brummte er vor sich hin und verdrehte die Augen. „Das hat es früher auch nicht gegeben.“ Lustlos griff er nach der Times, die mit roten Sprenkeln versehen neben dem Weinglas lag, und blätterte darin.
Richard hob das Kinn. Noch immer spürte er, wie sein Herz pulsierte und sein Mund vertrocknet wie die Sahara war. Er wandte sich ab, schritt im Stechschritt quer durch den Salon bis zu den Fenstern und drehte sich um. Sein Ton wurde schärfer. „Die Leute freuen sich jedes Jahr auf das Mummenspiel und finden es beeindruckend. Was ist daran verwerflich?“
„Mummenspiel! Mummenspiel!“ Der alte Graf schmiss die Zeitung auf den Boden, fuchtelte mit den Händen durch die Luft und rief: „Ein völlig überflüssiger Zeitvertreib.“
Richard ignorierte den besorgten Blick seiner Mutter und verschränkte die Arme vor der Brust. „Für dich vielleicht, Vater, aber wenn sie Spaß an Schauspiel und Maskeraden haben, warum denn nicht?“
Der Graf lachte trocken auf. „Sie sollen sich lieber bilden und die Mälzerei ansehen. Da können sie noch was lernen. Davon gibt es nur ganz wenige hier in der Gegend.“
„Ich kann mich nicht erinnern, dass mal ein Rummel hier im Dorf stattgefunden hat. Und Marshfield liegt doch nur eine gute halbe Stunde Fußweg entfernt.“ Sein Ton wurde sanfter. „Was hindert dich also, ihnen an ihrem freien halben Tag ein wenig Zerstreuung und Vergnügen zu gönnen?“
Die Gräfin, die dem Gespräch anfänglich schweigend zugehört hatte, beugte sich über den kleinen Tisch, der zwischen ihr und dem Grafen stand, und tätschelte die Hand ihres Gatten. „Mein Lieber“, sagte sie sanft, „die Dienerschaft geht, seit ich denken kann, jedes Jahr dorthin. Warum also neuerdings verbieten? Du willst doch wohl nicht öffentlich eingestehen, dass du plötzlich an Amnesie leidest?“ Dabei zwinkerte sie ihrem Mann schelmisch zu. „Das könnte sich, wenn dein Leiden die Runde macht, widersetzlich auf deinen Sitz im Oberhaus auswirken. Man würde deine Vorschläge und Ideen, die bisher wohlwollende Ohren fanden, kritisch verfolgen. Möglicherweise sogar ganz abtun.“
Der Graf kniff die Augen zusammen. „Ich finde, es ist ein gefährlicher Ort“, belehrte er sie. „Erst letztes Jahr gab es wieder Überfälle. Ich erinnere mich noch genau, dass drei Straßenräuber einen unschuldigen Mann ausgeraubt und dabei seine Kleidung zerschnitten haben. Halunken sind das! Und da wollen unsere Diener hin?“
An den flatterigen Atemzügen seines Vaters bemerkte Richard den Verdruss, was aber nicht an der Luft des Salons liegen konnte, denn jeden Morgen wurde ausgiebig gelüftet. Richards Blick fiel auf den Kamin, der danach immer Stunden brauchte, um die Kühle des großen Zimmers wieder zu vertreiben. Darüber hing ein mächtiges Blumenbild mit Goldrahmen, das von irgendeinem alten Meister geschaffen worden war und nun von Generation zu Generation weitervererbt wurde.
Richard hob beschwörend die Hände. „Es hat schon immer Räuber gegeben und solange sie sich nicht im Herzen ändern, werden sie die Überfälle nicht lassen. Das ist schlimm, wie du zu Recht feststellst und Armut kein Grund, die Gesetze zu übertreten.“ Er fragte sich, was mit seinem Vater los war, und senkte die Stimme. „Aber niemand glaubt dir, dass es dir einzig um das Wohl oder Seelenheil der Dienerschaft geht, oder?“
„Ist ja gut.“ Sein Vater hob die Schultern und setzte ein unschuldiges Lächeln auf. „Trotzdem finde ich, der sonntägliche Kirchgang und die Bibelstunden unter der Woche sind mehr als abwechslungsreich für das Hauspersonal.“ Er trank den restlichen Wein in seinem Glas aus und läutete nach dem Diener. Dann lehnte er sich zufrieden zurück. „Vortrefflich, dieses Rebhuhn eben“, seufzte er. „Wenn es nur nicht so klein gewesen wäre!“
„Du lenkst vom Thema ab“, monierte Richard. Er setzte eine gekränkte Miene auf und seine Augen verengten sich. „Bleibst du dabei? In diesem Jahr kein Jahrmarktbesuch?“
Sein Vater blinzelte. „Macht doch, was ihr wollt. Dann sollen sie eben gehen.“
Richard seufzte erleichtert und wandte sich zur Tür. „Dann will ich ihnen gleich die gute Nachricht verkünden.“
„Warte!“ Sein Vater wies auf einen freien Sessel. „Setz dich einen Moment zu uns.“ Zu dem Diener gewandt, der in diesem Moment den Salon betrat, sagte er: „Nochmals von dem guten Roten und ein Glas für meinen Sohn.“
Richard blieb nichts anderes übrig, als sich zu seinen Eltern zu setzen. Er wartete, bis der Diener alle Gläser gefüllt und den Raum verlassen hatte. Bevor er sich erkundigen konnte, ob es sonst noch etwas zu besprechen gab, griff seine Mutter das vorige Thema wieder auf.
„Ich werde Mrs Robinson dein Lob ausrichten“, sagte sie lächelnd. „Manchmal erstaunt es mich, dass sie in ihrem Alter – ist sie nicht fast siebzig? – noch solche Köstlichkeiten fabrizieren kann. Und die Neue in der Küche scheint zum Glück nicht so unbeholfen zu sein wie die letzten Küchenmädchen. Da gab es kaum eine, die etwas lernen wollte. Ich denke, Mrs Robinson könnte dem Mädchen das Kochen beibringen.“
„Tu das.“ Der Graf tätschelte ihren Handrücken und fuhr sich dann über seinen kahlen Schädel. Über seinen Augen erhoben sich immer noch dunkle Brauen, während der Vollbart fast vollständig mit grauen Haaren durchsetzt war. Für sein Alter hatte der Lord noch eine bemerkenswert schlanke Figur, was er seinen Vorfahren zuschrieb, die allesamt von athletischer Gestalt gewesen waren. Mit wachen Augen musterte er Richard. „Weißt du, worüber ich in letzter Zeit nachdenke?“
Richard schüttelte den Kopf und nippte an seinem Glas. Er hatte da so eine Ahnung. „Hoffentlich nicht über irgendwelche langweiligen Bälle.“ Bei der Erinnerung an einen der letzten Tanzabende wurde ihm mulmig zumute. Seine gute Laune war fast dahin gewesen, als er endlich alle Tänze hinter sich gebracht hatte, die man der Etikette nach von ihm erwartete. Viel lieber hätte er sich um seine Pferde gekümmert oder mit Freunden getroffen. Die offiziellen Einladungen waren, auch wenn es nach außen hin so schien, nicht wirklich seine Welt. Er liebte das Landleben und genoss es, dass er in der glücklichen Lage war, sich mit Pferdezucht beschäftigen zu dürfen. Außerdem war er bisher keiner jungen Dame begegnet, mit der er gerne näher in Kontakt getreten wäre. Es störte ihn, dass die – zugegeben – hinreißend gekleideten jungen Mädchen, die bei ihrem Debüt auf den Bällen alle Blicke auf sich zogen, anscheinend nichts weiter konnten, als albern zu kichern und den jungen, unverheirateten Männern kokette Augenaufschläge zuzuwerfen. Alle Einladungen der Eltern auf ihre Anwesen hatte er bisher erfolgreich abwehren können. Bei solchen Treffen wurden nämlich standesgemäße Arrangements verhandelt, so viel wusste er. Allerdings war es fraglich, wie lange er sich noch davor drücken konnte. Mit jedem Jahr, das er mit seinen inzwischen sechsundzwanzig Jahren ledig verbracht hatte, wurde der Druck seiner Eltern größer.
„Aber Richard, über Bälle zu sprechen ist doch Frauensache“, meinte die Gräfin charmant und schmunzelte, „und wo du es gerade ansprichst: Ich denke tatsächlich darüber nach, im Herbst eine große Gesellschaft zu geben.“
„Du meinst, wenn die Repräsentanten des Oberhauses mit ihren Familien aus London zurückgekehrt sind?“, fragte sein Vater. „Übrigens, ich werde nächste Woche wieder in die Hauptstadt fahren.“
„Schon wieder? Du sollst dich doch noch erholen, hat Doktor Wright gesagt.“
„Ich fühle mich schon wieder bestens. Die Luftnot ist weg.“
„Trotzdem finde ich, dass du sehr oft in der Hauptstadt bist“, beschwerte sich die Gräfin, „so viele Sitzungen kann es doch gar nicht geben.“
Er wich ihrem Blick aus. Stattdessen schnellten nun seine Brauen in die Höhe und sein Ton wurde plötzlich hitziger. „Verehrteste, da widerspreche ich dir. Du stellst dir das alles ziemlich einfach vor. Die häufigen Sitzungen und Beratungen nehmen viel Zeit in Anspruch. Zudem gibt es dort, wie du selbst erlebt hast, Teegesellschaften und Abendeinladungen, bei denen man erscheinen sollte, wenn nicht gar muss.“
Richard spürte eine vage Unruhe bei seinem Vater, doch er konnte seine Zweifel an dessen Beteuerungen an nichts festmachen. Irgendetwas schwang mit der Unterhaltung durch das Zimmer, das nicht mit Händen zu greifen war. Wahrscheinlich war er einfach sehr empfindsam für Worte, selbst für die, die nicht ausgesprochen worden waren.
„Ich nehme lediglich die Aufgabe meines Sitzes im House of Lords ernst. Noch ist es meine Pflicht als Graf von Cold Ashton, das Parlament zu unterstützen.“ Der Graf zog die Stirn in Falten. „Eines Tages wird Richard meinen Platz einnehmen. Und meinen Titel erben.“
Sie hob die Hände. „Schon gut, Archibald. Tut mir leid.“
Trotzdem las Richard in ihren Augen noch einen Schimmer von Misstrauen, was er sonst nicht von ihr kannte. Er schürzte die Lippen und fragte sich, warum ihre Worte einen leicht verzweifelten Unterton hatten. Ob er mit einer lustigen Anekdote die gekippte Stimmung aufhellen sollte? Nein. Es war besser, das Gesprächsthema zu wechseln. Am besten zu etwas, das ihm am Herzen lag. „Morgen will ich mit Young die Schafherden ansehen. Es müssten neue Lämmer dazugekommen sein.“
Sein Vater nickte und wirkte erleichtert. „Mach das. Er wird sich freuen, wenn er nicht alleine rausreiten muss.“
Richard sah zur Standuhr. Auf seinem Schreibtisch wartete noch eine Menge unerledigte Post und wenn er sich nicht beeilte, war es zu spät, heute noch den Dienstboten die gute Botschaft zu verkünden.
Ein paar Tage später war es so weit. Die Dienerschaft war bis auf Mrs Robinson am Samstag nach dem Lunch aufgebrochen, um den Jahrmarkt in Marchfield zu besuchen. Die Köchin hatte sich aufgrund ihres Alters entschuldigt und gemeint, dass sie weder Zuckerwatte noch sonstige Zerstreuung brauchte.
Nachdem Richard mehrere Stunden im Stall und auf der Koppel verbracht hatte, um mit Stallmeister MacCormick ein Fohlen an die Herde zu gewöhnen, beschloss er im Laufe des Nachmittags, ebenfalls nach Marchfield zu fahren. Nachdem er sich umgekleidet hatte, ließ er anschirren.
Die Sonne stand noch hoch am Himmel, der, nur von wenigen Schäfchenwolken bedeckt, ein luftiges Blau über die Felder spannte. Richard genoss das monotone Hufgeklapper und betrachtete die niedrigen Steinmauern, die den größten Teil der Straße säumte und die Felder vom Fahrweg trennten. Ab und zu unterbrach ein Baum die einförmige Ebene. Der flache, fast eigenwillige Landstrich mit Hügeln am Horizont löste in Richard ein wohltuendes Gefühl aus und er dachte dankbar an das Geschenk, in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen zu sein. Das war zwar kein Garant für Glück und ewige Freude, aber die Verantwortung, die damit einherging, gefiel ihm. Er hatte ähnliche Anliegen wie seine Mutter, die mit ihren Wohltätigkeitsveranstaltungen den Blick auf Arme lenkte und um sie besorgt war.
Sein jüngerer Bruder Edward hatte es vorgezogen, dem Land als Soldat zu dienen und war in die Armee eingetreten. Er liebte das Meer, was jeden hier verwunderte, da das Herrenhaus, in dem er groß geworden war, weder an der Küste noch an einem Fluss lag. Und noch weniger verstand man in der Familie, dass er unter dem Befehl von Admiral Duncan gegen Niederländer kämpfte. Es war ein echtes Wunder gewesen, dass er in der Seeschlacht bei Camperduin nicht wie unzählige seiner Kameraden umgekommen, sondern nur verwundet worden war. Mutter hatte sich rührend um ihn gekümmert. Das war vor fast zwei Jahren gewesen und kaum, dass er sich wieder auf den Beinen halten konnte, hatte er Cold Ashton Manor wieder verlassen.
Seitdem war er nicht mehr daheim gewesen und Richard hoffte, dass er bald Heimurlaub bekam. Jill, ihre ältere Schwester, sah er ebenfalls nur selten. Sie war verheiratet mit Sir Walter Leroy und lebte mit Mann und drei kleinen Kindern nahe London.
Richard dagegen fühlte sich in seiner Heimat tief verwurzelt und Dankbarkeit erfüllte ihn, dass er als Erbe von Cold Ashton hier leben durfte.
Die Silhouette von Marshfield rückte immer näher. Bald passierte er die ersten Häuser und fuhr die High Street entlang. Viele Leute tummelten sich auf den Straßen und sein Kutscher bog zur Kneipe The Charles Inn ab, wo er bis zur Rückfahrt warten würde. Schon vor The Charles Inn befanden sich erste Buden. Mitten auf den Straßen standen in marktschreierische Farben gekleidete Gaukler und Artisten, jonglierten mit Bällen, spuckten Feuer und ließen Ringe um Hände und Füße kreisen, um dann im Applaus der Zuschauer Hüte herumgehen zu lassen. Die anschließenden kritischen Blicke der Künstler in die Hüte offenbarten, dass sie mit den Gaben unzufrieden waren.
Richard ging weiter und musste lächeln, als er den Stand eines Zuckerbäckers sah, und erinnerte sich an die alte Köchin. Mrs Robinson saß jetzt bestimmt auf der Treppenstufe, die zum Gemüsegarten hinausführte, wo sie sich gern ausruhte.
Auf einem großen Platz nahe der Kirche hatten Mummenspieler ihre Bühne aufgebaut und unterhielten die Leute. Das Gelächter war groß und spornte die Spieler an, noch mehr Unfug zu treiben. Unter den zahlreichen Zuschauern befanden sich jetzt bestimmt auch die Bediensteten von Cold Ashton Manor. Sie waren dankbar gewesen, als sie doch noch die Erlaubnis für den Jahrmarkt bekommen hatten.
Sein Blick fiel auf eine junge Frau, die in seiner Nähe vor einer Bude stand. Sie war schön! Fasziniert betrachtete er ihr Profil, während sie eine Zuckerwatte entgegennahm. Unter ihrer Haube hatten sich einige Strähnen aus der Frisur gelöst. Ihr Haar flimmerte im Sonnenlicht und ließ ihre helle Haut strahlen, wobei ein paar Sommersprossen auf ihrer kleinen Nase tanzten. Sie machte einen gepflegten Eindruck mit ihrer schlichten weißen Bluse und einem hellgrünen, weiten Rock, der vom leichten Wind um ihre grazile Gestalt flatterte. Jetzt trat sie ein paar Schritte zurück, um anderen Leuten Platz zu machen, die hinter ihr anstanden. Ihre Bewegungen waren fließend und für eine Frau war sie recht groß.
Plötzlich huschte wie aus dem Nichts ein großer, kräftiger Junge auf den Stand zu und riss einer anderen Frau den Geldbeutel aus der Hand, als diese gerade eine Zuckerstange bezahlen wollte. Blitzschnell verschwand er mit dem Diebesgut zwischen den Marktbesuchern. Ein Aufschrei ging durch die Menge und als sie verstanden, dass die Frau beraubt worden war, erhob sich ein Gebrüll.
„Dieb!“ und „Halunke“ waren noch die biedersten Worte. Viele hatten es gesehen, aber niemand bewegte sich, den Räuber einzufangen – bis auf die große Blonde, die Richard fasziniert betrachtet hatte. Sein Blick blieb fest auf sie gerichtet. Sie drückte der jetzt weinenden Frau ihre Zuckerwatte in die Hand und war im Handumdrehen wie vom Erdboden verschluckt. Um die Bestohlene, die nun ungläubig dastand und ihre Zuckerstange in der einen, die Zuckerwatte in der anderen Hand vor sich hielt, hatte sich ein Kreis gebildet. Trostlose Verwünschungen für den Täter und bedauernswerte Worte für das Opfer drangen an Richards Ohr. Noch immer stand er wie angewurzelt da und beobachtete den Menschenauflauf. Schon bald wurde es den Leuten aber zu langweilig und nach und nach wandten sie sich ab.
Als die Bestohlene fast alleine dastand, drängte sich die junge Frau von eben durch die Menge und blieb keuchend vor ihr stehen. Tröstend legte sie einen Arm um sie. „Er ist mir entwischt“, hörte Richard sie erklären. „Ich hab ihn beim Karussell eingeholt, aber als ich ihn festhalten wollte, hat er nach mir geschlagen.“
Die Frau schluchzte laut auf. „Mein ganzer Wochenlohn ist weg. Wie soll ich das daheim erklären? Mein Mann wird mich verprügeln.“ Sie reichte ihr die Zuckerwatte und schnäuzte sich weinend in den Rock.
In Richard regte sich Mitleid und er ging auf sie zu, blieb aber, von Zweifeln geplagt, ob er das Richtige tat, ein paar Meter von ihr entfernt stehen. Noch bevor er sich entscheiden konnte, griff die junge Frau in ihre Tasche, holte ein Geldstück hervor und drückte es der Frau in die Hand. „Das dürfte reichen“, sagte sie mit einem aufmunternden Lächeln, drehte sich um und setzte ihren Weg fort.
Ungläubig schaute die Frau auf das Geldstück in ihrer Hand. „Das ist doch viel zu viel!“ Doch die Blonde war schon fast außer Sichtweite. „Gelobt sei der Herr“, rief sie hinter ihr her, „und gesegnet seiest du.“ Dann reckte sie die gefalteten Hände und den Kopf für einen Moment gen Himmel, bevor sie in eine Seitenstraße abbog und aus Richards Blickwinkel verschwand.
Betreten wagte er nicht, einfach weiterzugehen. Es wäre seine Aufgabe gewesen, der Überfallenen beizustehen und ein Leichtes gewesen, ihr finanziell auszuhelfen. Die junge Frau hatte zwar nicht ärmlich ausgesehen, aber bestimmt fiel es ihr schwerer als ihm, auf Münzen zu verzichten. Mal ganz davon abgesehen, dass er noch nicht mal den Ansatz eines Versuchs gemacht hatte, den Dieb zu verfolgen.
Was hatte ihn daran gehindert? Stolz? Faulheit? Angst? Neugier? Er schüttelte den Kopf und schalt sich, dass er der armen Frau nicht zu Hilfe geeilt war.
Während er nun unschlüssig inmitten der Jahrmarktbesucher dastand, kam in Richard der Wunsch auf, die Wohltäterin wiederzusehen. Sofort schlug er die Richtung ein, in der sie verschwunden war. Er zwängte sich durch die Leute, vorbei an Müttern mit Kindern auf dem Arm, lachenden jungen Burschen und ein paar Alten, die auf einen Plausch beieinanderstanden. Für die Handarbeiten, Spiele und Attraktionen hatte er keine Augen mehr. Ihn interessierten weder der dressierte Hund, der Mann mit dem Guckkasten oder die kleinwüchsigen Männer in Uniformen noch die farbigen Lichter, die ein Kerzenzieher zum Erstaunen der Menschen herstellte.
Aber wie sollte er sie wiederfinden, wo er weder einen Namen noch sonst etwas von ihr wusste? Es waren heute viele Menschen in der Stadt unterwegs und die meisten kamen aus umliegenden Orten. Sein Herz wurde schwer.
Ihr beherztes Beistehen und ihr Geschenk hatten ihn tief berührt. Er rief sich ihr schönes Gesicht ins Gedächtnis und wie sie ohne zu zögern die Verfolgung aufgenommen hatte. Er musste lächeln – zu gern wollte er sie näher kennenlernen! Aber ob er sie je wiedersehen würde?
Eine halbe Stunde später war Richard wieder auf dem Heimweg. Die Farben am Himmel hatten sich verändert und kündigten den Abend an. Die Sonne würde bald verschwunden sein, ihr Licht aber noch bis in die Abendstunden auf die Felder und Hügel werfen.
War es verwerflich, wenn er Gott bat, die Unbekannte seinen Weg kreuzen zu lassen? Hatte er nicht versprochen, Gebete zu erhören? Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.
Aber galt das auch für Bitten, die eher eigennützig waren? Durfte er diese Zusage auch dann wörtlich nehmen? Er war sich nicht sicher. Nur eines wusste er: Die schöne junge Frau ließ ihn nicht mehr los!
An diesem Abend hatte Amber Mühe, die Flickarbeit zu beenden, wie sie es ihrer Mutter versprochen hatte. Sie war unkonzentriert und stach sich in den Finger. Das passierte ihr auch ständig bei Stickarbeiten, und nachdem sie einige Decken und Kissen durch Blutstropfen verschandelt hatte, konnte sie ihre Familie überzeugen, dass sie einfach nicht zum Handarbeiten geboren war.
Überall wachten Mütter mit strenger Miene darüber, dass ihre Töchter ihre Aussteuer mit kunstvollen Motiven versahen, was Amber jetzt erspart blieb. Niemand wollte ihre mit roten Sprenkeln versehenen Werke sehen, und außerdem lag ihr wenig daran, sich mit Freundinnen zum vorgeschobenen Sticken zu treffen, nur um dies als Konversation über Verehrer und mögliche Heiratskandidaten zu nutzen. Würden sie sich bei den an sich netten Treffen stattdessen auch mal über Pflanzen und Heilwirkungen unterhalten, wäre sie gerne dabei.
Abgesehen davon brauchte sie eine Ewigkeit, um den Riss an der Hose ihres zehnjährigen Bruders Todd zu reparieren. Auch Graysons Hose war an den Knien wie Pergament und Amber fragte sich, wie der Neunjährige das hingekriegt hatte, ohne sich die Haut zu verletzen. Jedenfalls hatte er sich nicht beklagt, was er sonst bei jeder noch so kleinen Schramme tat.
Während Amber versuchte, sich auf die Flickarbeit zu konzentrieren, kreisten ihre Gedanken immer wieder um den Diebstahl auf dem Jahrmarkt. Die arme Frau war so verzweifelt gewesen, dass Amber ihr ihr mühsam Erspartes einfach hatte schenken müssen. Eigentlich war es für ein wunderschönes lilafarbenes Retikül gedacht gewesen, das sie letztes Jahr bei einem Händler entdeckt hatte und das in der üblichen fünfeckigen Art geschneidert, mit grüner Seide ausgekleidet und mit Blütenmotiven bestickt gewesen war. In den hiesigen Geschäften hatte sie einen derart entzückenden Pompadour noch nicht entdecken können. Sie seufzte. Jetzt hatte das Gesparte eben einen anderen Sinn bekommen. Je mehr sie darüber nachdachte, desto sicherer war sie, dass sie das Richtige getan hatte.
Erst kürzlich hatte Reverend Horton eine Predigt gehalten, in der er es als groben Undank auslegte, nichts zu spenden, nur weil man dabei nichts zurückerhielt. Gott als Geber aller Gaben sei die Richtschnur. Diesen Gedanken hatte der Reverend mit dem biblischen Zitat „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb“ unterstrichen. Und ergänzend hatte er noch einen anderen Ausspruch des Apostels Paulus vorgestellt: „Wer wenig sät, wird wenig ernten.“ Und umgekehrt. Bedeutete das nicht, dass Gott irgendetwas aus dem machen würde, was sie gespart hatte und sie sich darüber freuen durfte?
Schlimmer wäre gewesen, wenn sie das Geld verloren hätte. Jetzt konnte sich diese arme, unglückliche Frau darüber freuen. Zu dumm, bedauerte Amber, dass sie den diebischen Burschen nicht dingfest machen konnte, aber beruhigend zu wissen, dass das nun Sache von Friedensrichter Bob Shepherd war.
Als Amber am nächsten Morgen wach wurde, freute sie sich über das laute Vogelgezwitscher vor ihrem Fenster. Sie lächelte, sprang gut gelaunt aus dem Bett und stürmte nach der Morgentoilette in die Küche. Ihre Mutter schöpfte mit einer Kelle Porridge in Schüsseln und stellte sie auf den Tisch.
„Du bist spät dran“, begrüßte sie sie, „Vater hat schon nach dir gefragt. Hast du die Sachen gestopft?“
„Ja, alles.“ Ihr Herz machte einen Sprung. Das bedeutete, den ganzen Tag in der Apotheke helfen zu dürfen. Sie griff nach einem Messer und schälte Äpfel, die sie in kleine Stücke schnitt und auf dem Porridge verteilte. Todd und Grayson wollten schon mal probieren, bis Vater hereinkam und sich zu ihnen setzte. Nach dem Tischgebet verlief die Mahlzeit schweigend, bis ihr Vater aufstand und die Küche verließ. Während Mary den Tisch abräumte, huschte Amber in die Apotheke, um ihren Vater beim Trocknen gesammelter Kräuter zu unterstützen.
Einige Minuten später stand sie im Hinterzimmer der Apotheke an einem großen Tisch. Ein Berg von Lungenkraut und Taubnessel lag vor ihr. Taubnessel konnte vielfältig eingesetzt werden und gerade Frauen schätzten ihre beruhigende Wirkung bei Unterleibsbeschwerden. Vater empfahl sie auch gegen Husten, Fieber und Hautausschlägen oder schlecht kurierenden Wunden.
Den Sauerklee hatte sie beiseitegelegt, denn er eignete sich nicht zum Trocknen. Eine daraus zubereitete Limonade war zwar herb, aber sie fand den Geschmack köstlich.
Während Amber die Blätter des Lungenkrautes von den Stängeln pflückte, stand ihr Vater vorne im Laden und verarbeitete die Blätter im Mörser, solange keine Kunden kamen. Plötzlich ertönte ein lautes Krachen und kurz darauf hörte Amber ein Stöhnen. An diesem Morgen hatte noch kein Kunde den Laden betreten, daher wusste Amber gleich, dass etwas mit ihrem Vater geschehen sein musste. Sofort stürzte sie nach vorne und fand ihren Vater auf dem Boden liegend, neben ihm die umgestürzte Leiter, die man benötigte, um an die obersten Bretter der deckenhohen Regale zu gelangen.
„Hast du dir wehgetan?“ Sie kniete neben ihm und half ihm, sich halbwegs aufzurichten. Dabei ächzte er erneut und griff sich ans Bein. „Ich wollte etwas von oben herunterholen, als es mir plötzlich im Bauch stach, ziemlich heftig … ah … es tut immer noch weh …“ Mühsam stützte er sich mit einer Hand am Boden ab, mit der anderen hielt er sich die Seite. Sein Gesicht war schmerzverzerrt, sodass Amber es mit der Angst zu tun bekam. „Mir ist ganz flau geworden, da bin ich von der Leiter abgerutscht.“ Er rieb sich das Knie. „Es hat wohl auch was abbekommen.“
Amber legte die Hand auf seine Schulter. „Wie lange hast du die Beschwerden schon?“ Sie sah ihn aufmerksam an und bemerkte seine gelbliche Gesichtsfarbe.
Er winkte ab. „Ist nichts Schlimmes. Geht schon wieder. Hilf mir mal.“ Er ächzte, als sie ihm aufhalf. Sofort knickte er mit dem wehen Knie ein und ließ sich auf einem Stuhl nieder.
„Ich hole den Arzt“, bestimmte Amber, „und bitte keine Widerrede!“ Auf eigene Faust hing sie das Geschlossen-Schild ins Fenster und versperrte die Eingangstür.
Kurze Zeit später hatte sie Vater mithilfe ihrer Mutter ins Bett gebracht und seinem schmerzenden Bein eine kalte Kompresse verpasst.
Doktor Wright hatte seine Praxis in Marshfield und Amber hoffte, dass sie ihn dort antreffen würde. Wenn sie Pech hatte, war er irgendwo in einem der umliegenden Dörfer auf Hausbesuch. Zum Glück war es sonnig und trocken. Eilig lief sie die High Street entlang und grüßte ein paar Leute auf der Straße. Bald hatte sie die Landstraße erreicht, die eine große Biegung nach links machte, um dann fast schnurgerade nach Marshfield zu führen. Das Haus des Arztes stand direkt an der Ecke zur Sheepfair Lane. Auf ihr Klopfen hin öffnete seine Frau und hörte sich ihr beherztes, wenn auch außer Atem vorgetragenes Anliegen an.
„Mein Mann wurde nach Dyrham Park gerufen, wird aber hoffentlich bis Mittag zurück sein. Ich werde ihm Bescheid geben“, erwiderte sie freundlich. „Alles Gute für deinen Vater.“
Amber bedankte sich und machte sich auf den Heimweg. Sie dachte an ihre Freundin Tessa, die Küchenmädchen auf Dyrham Park war und ihr manchmal von dem erhabenen Anwesen und manchmal auch von der anstrengenden Arbeit dort erzählt hatte.
Ihr Blick schweifte über die Ebene und sie sog tief die Aromen der Blumen und Bäume ein. Mittlerweile war sie sich nicht mehr sicher, ob sie das Richtige getan hatte. Vielleicht hatte Vater nur eine kleine Unpässlichkeit und einen Bluterguss am Knie? Und für diese Kleinigkeit verlangte sie nun den Arzt. Hoffentlich reagierte er nicht verärgert über die vermeintliche Bagatelle. Wann hatte ihr Vater schon mal den Medicus kommen lassen? Sie konnte sich nicht erinnern, dass er seinetwegen jemals da gewesen war. Als Apotheker wusste er ja, wie man Beschwerden mit selbst angefertigten Heilmitteln aus dem Laboratorium linderte.
Ihre Zweifel waren umsonst gewesen. Doktor Wright untersuchte ihren Vater gründlich. „Sein Knie ist tatsächlich nur geprellt und kalte Wickel helfen, dass die Schwellung schnell zurückgeht. Weitaus mehr Sorgen machen mir aber seine Schmerzen im Oberbauch. Wie lange hat er sie bereits?“ Der Arzt betrachtete ihre Mutter aufmerksam durch seine Brille.
„Ich weiß nicht“, sagte diese irritiert, „er hat sich bisher noch nie beschwert.“
„Ungewöhnlich“, konstatierte der Arzt, verschloss seine Tasche und wandte sich an Amber. „Er muss starke Schmerzen gehabt haben. Ist dir auch nichts aufgefallen?“
Sie schüttelte den Kopf und hob die Schultern.
„So sind sie, die Männer“, zwinkerte er daraufhin, „echte Helden.“ Sofort wurde er jedoch wieder gebührlich. „Aber das sollten sie nicht sein, wenn es sich um eine ernsthafte Erkrankung handelt.“ Er sah ihren Vater eindringlich an. „Mr Devaney, der Gallenfluss ist gestört und ich denke, dass Steine den Gallengang blockieren. Eine äußerst qualvolle Angelegenheit, wie Sie sicher bemerkt haben. Deshalb verordne ich ein Schmerzmittel, um die krampfartigen Schmerzen zu lindern.“ Als er Vaters entsetzten Blick sah, beschwichtigte er ihn: „Ich kann Sie beruhigen, meist gehen die Steine von alleine ab. Trotzdem müssen Sie sich zumindest ein paar Tage schonen. Ihr Knie braucht Ruhe und Ihre Galle wird es Ihnen danken.“
Als der Arzt gegangen war, starrte ihr Vater zur Decke empor. „Was passiert jetzt mit der Apotheke?“, grübelte er. „Ich kann unmöglich die Leute vor der geschlossenen Tür stehen lassen.“
Eine Idee schoss Amber durch den Kopf. „Was hältst du davon, wenn ich, solange du krank bist, auf deine Anweisung und unter deiner Anleitung die Tinkturen zubereite? Ich kenne doch schon viele Rezepte und wenn du danebensitzt, natürlich mit hochgelegtem Bein, dürfte das doch möglich sein, oder?“ Verstohlen beobachtete sie ihre Mutter, die zu einer Erwiderung anhob, doch Ambers Vater warf ihr einen ernsten Blick zu und schnitt ihr damit das Wort ab.
Er wandte den Kopf. „Amber“, sagte er voller Enthusiasmus, griff nach ihrer Hand und seine Lippen formten ein Lächeln, „das würdest du tun? Mir fällt ein Stein zwar nicht aus der Galle, aber vom Herzen.“ Er zwinkerte ihr zu. „Es ist ja nicht für lange, nur für ein paar Tage.“
Ihre Mutter rang sich zu einem Kopfnicken durch und schwieg.
Amber schloss die Augen und dankte lautlos Gott, dass ihr Vater nicht ernsthafter krank war und sie ihm nun ganztägig in der Apotheke zur Hand gehen durfte. Sie bat um Gelingen bei den Rezepturen, wobei die Kunden ja weiterhin von ihrem Vater beraten werden konnten. Wie gut zu wissen, dass der allmächtige Gott ihn behüten würde!
Der Oktober zeigte sich von seiner charmantesten Seite und goss goldene Farben über das Land. Das Laub von Bäumen und Blättern entfaltete ein Feuerwerk an Farbschattierungen von Grün bis Braun, dass Richard manchmal ergriffen stehen blieb, wenn er über die Ländereien ritt, die zu Cold Ashton Manor gehörten.
Das alles würde eines Tages einmal ihm gehören. Aber es war nicht Stolz, der in ihm aufkam, nein, eher ein andächtiges Staunen. Mit diesen Feldern, Wiesen und Wäldern, auf denen viele Menschen ihr tägliches Brot verdienten, ging die große Verantwortung für ihr Wohlergehen einher. Übers Land verteilt lebten Schmiede, Stellmacher, Milch- und Gemüsebauern, Schafscherer, Stallburschen und noch viele andere Familien und Handwerker aus dem Dorf. Ebenso der Verwalter und die Dienerschaft, wobei Letztere im Haus untergebracht waren.
Mit Verwirrung beobachtete Richard in diesen Tagen die Aktivitäten seiner Mutter, die tatsächlich wieder einen Ball auf Cold Ashton Manor organisiert hatte. Der Herbst war die ideale Jahreszeit dazu. Die Peers, die üblicherweise den Sommer in London im Parlament verbrachten und meist wegen der wochenlangen Abwesenheit von zu Hause ihre Familien mitnahmen, waren wieder zurückgekehrt.
„Ich könnte dir einen Tanzlehrer empfehlen“, teilte die Gräfin Richard eines Morgens mit, als sie das Frühstück beendet hatten und noch im Esszimmer standen. Freudig schaute sie ihn an und drehte sich dann vor ihm im Kreis, wobei ihr Rock über den Boden schwebte. „Was du in deiner Jugend gelernt hast, das –“
Richard ergriff ihre Hand, sodass sie stehen bleiben musste und sah sie voller Wärme an. Ihre grauen Augen, umrahmt von vielen kleinen Fältchen, strömten eine unglaubliche Lebenskraft aus. Sie hatte vor zwei Jahren eine schwere Erkrankung überstanden und offenbar neue Energie gewonnen. Ihre braunen Locken hatte die Zofe zu einer Hochfrisur getürmt. Trotzdem reichte seine Mutter ihm nur bis zur Schulter. Richard musste lächeln, weil sich trotz diverser Kämme ein paar Strähnen gelöst hatten und jetzt wild abstanden. „Du kannst dich immer noch wundervoll auf dem Parkett bewegen. Vater kann stolz auf dich sein.“ Er zögerte, doch dann wurde sein Herz weich. „Nun ja, einen Nachmittag könnte ich für Tanzunterricht opfern.“
Einige Tage später war es so weit – die ersten Ballgäste reisten an. Bereits vor dem Torhaus waren prächtige Blumenbuketts arrangiert und je mehr man sich dem Herrenhaus näherte, umso üppiger und farbenprächtiger wurden die Verzierungen, gepaart mit brennenden Fackeln, die den Weg beleuchteten und schon vor dem Haus eine festliche Stimmung zauberten.
Die Gräfin hatte von der Dienerschaft zwei Räume herrichten lassen, in denen Mäntel und Gepäck abgestellt werden konnten. Ein paar der aristokratischen Gäste würden mit eigenen Kammerdienerinnen und Lakaien anreisen. Sämtlichen Stallburschen war unter MacCormicks strenger Aufsicht befohlen, den Kutschen einen Platz zuzuweisen und die Pferde der Gäste zu versorgen.
Im großen Saal gab es eine lange Tischreihe mit Köstlichkeiten aus Mrs Robinsons Küche und Erfrischungen. Eine Schar Hausmädchen hatte stundenlang die gleißenden Kronleuchter geputzt, damit der Blickfang des Saales in neuer Würde erschien und genauso prächtig funkelte wie Diademe und Brillantschmuck der Ladies.
Aus den umliegenden Herrenhäusern und Grafschaften waren zahlreiche Adlige eingeladen worden, darunter viele junge Leute – einige der Frauen waren sogar Debütantinnen. Nichts hatte Lady Kathleen Clarke vergessen: Im Eingangsbereich und im Saal wurde man von einem prächtigen Blumenschmuck begrüßt, die Teppiche waren von der Dienerschaft eingerollt und weggeschafft worden, um Platz fürs Tanzen zu schaffen, und es gab Berge von Delikatessen sowie allerlei Erfrischungen, darunter der beliebte Punsch, wobei Wein, Würzbier und Tee zu den bevorzugten Getränken gehörten. Eine Musikkapelle sorgte für beschwingte Melodien.
„Lord John Pomeroy und Lady Anne Pomeroy, ihre Tochter Lady Susan.“ Der Zeremonienmeister klopfte zu jedem Gast mit dem Stab auf. „Lord Albert Mooney, der Graf von Keaton und Lady Olivia Mooney, die Gräfin von Keaton, ihr Sohn Lord Barry Mooney, der Viscount von Larton.“ Wieder hob er den Zeremonienstab. „Sir Samuel Traverton und Lady Kate Traverton, ihre Tochter Lady Julie …“
Der Saal füllte sich, während Richard neben seinem Freund Francis die Gäste betrachtete. Die Gentlemen unterschieden sich in ihrer Kleidung wenig voneinander, meist nur in der Farbe ihrer Halsschleife oder ihrer Hosenfarbe. Ein paar junge Männer waren in Uniform erschienen, vorwiegend Söhne von Aristokraten, die sich als Offiziere in der Pflicht sahen, ihrem Land zu dienen. Bedauerlicherweise war Edward nicht da. Er würde hier nicht nur adäquate Gesprächspartner finden, sondern hätte auch bestimmt Gefallen an den reizenden Debütantinnen. Die jungen Frauen schwebten mit geröteten Wangen, auffällig gelockten Hochsteckfrisuren und mit tausend Rüschen verzierten, bunten Seidenkleidern durch den Saal. Eine ganze Weile ließ Richard die Eindrücke auf sich wirken, aber je länger er dastand, umso enger wurde ihm ums Herz. Das Bild der jungen Frau im schlichten Kleid vom Jahrmarkt drängte sich vor sein geistiges Auge. Beim Gedanken an sie beschleunigte sich sein Herzschlag und er bedauerte es, dass sie nicht anwesend war.
Richard stieß seinem Freund Lord Francis Asbury unauffällig in die Seite. Francis war der Marquess von Salisbury in der Grafschaft Wiltshire und als begnadeter Tänzer bekannt. Er hatte die Einladung angenommen, für ein paar Tage Gast auf Cold Ashton zu sein. Es bedurfte meist keiner großen Worte, wenn sie sich trafen. Eine stille Harmonie lag über ihrer jahrelangen Freundschaft. „Heute hast du eine große Auswahl. Ich bin sicher, es sind unter den Debütantinnen einige, die sich bestens auf die Tänze vorbereitet haben. Ich kann mich an die Zeit erinnern, als ich noch ein Junge war, dass meine Schwester sich wochenlang plagen musste, bis sie die Schrittfolge verinnerlicht hatte.“
„Und? Hat es sich gelohnt?“
„Ich glaube ja, sie hat einen netten Mann gefunden.“
Die Männer lachten und Francis meinte: „Wenn man wie ich das Tanzen liebt, ist es ein Vergnügen.“
Richard hoffte immer noch, es irgendwie vermeiden zu können. Er bediente sich lieber an den mit Schinken und Käse gefüllten Toasts sowie am kalten Braten. Solange er aß, würde er hoffentlich verschont bleiben. Diese Ausrede konnte er jedoch nicht den ganzen Abend lang nutzen und so stellte er schließlich nach einiger Zeit resigniert den Teller beiseite. Sein Vater musste ihn beobachtet haben, denn kurz darauf ergriff er die Chance, ihn vermeintlich unauffällig in ein Gespräch zu verwickeln und ihm Lady Helen Alnwick vorzustellen. Sie war die Tochter eines Marquess von Irgendwo, dessen Name ihm sofort wieder entfallen war. Die junge Frau erinnerte ihn mit den glatten Haaren an das Mädchen von Marshfield, aber ihre Augen hatten einen frostigen Ausdruck, der durch tief liegende Augenbrauen noch verstärkt wurde.
Richard schätzte sie auf Anfang bis Mitte zwanzig. Sie trug ein Seidenkleid, das ein Vermögen gekostet haben musste. Dennoch wirkte sie darin nicht elegant – dazu waren ihre Bewegungen zu krampfhaft, ja, fast schon linkisch. Als ein junger Lakai mit einem Tablett voller gefüllter Gläser etwas zu nahe an ihr vorüberging, tadelte sie ihn in scharfem Ton, woraufhin er zusammenzuckte und das Tablett ins Wanken brachte. Ein Weinglas kippte um und die rote Flüssigkeit ergoss sich über sein Livree. Richard tat der Junge leid und wollte nicht darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn das Glas in Lady Helens Richtung gefallen wäre.
Als Richard sich einige Minuten später aus dem Gespräch verabschiedete, spürte er, dass er beobachtet wurde und schaute sich um, bis er an der gegenüberliegenden Seite des Saales Helens Eltern, Lord Andrew Alnwick mit seiner Gattin Ruth, entdeckte, die ihn mit ernsthaftem Blick und zusammengekniffenen Mündern musterten. Sein Mund wurde trocken, und er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Er verstand nicht, warum sein Vater ihm Lady Helen so ans Herz legte. Bei dem Gedanken daran wurde ihm unwohl.
Es war üblich, dass die jungen Damen und Herren eine Anzahl an Tänzen auswählen durften. Dazu gehörte auch die Wahl eines Tanzpartners. Notgedrungen arbeitete er deshalb nun die Tanzkärtchen ab. Er gab sich große Mühe, der einen oder anderen Lady, die meist mit hochrotem Kopf und verschämtem Augenaufschlag die Reels, Eccosaises und Quadrillen mit ihm drehte, nicht auf die Füße zu treten.
Nach einiger Zeit kam auch Lady Helen an die Reihe. Es war ein schottischer Reel, den die Kapelle spielte. Lord Francis Asbury hatte eine hübsche Rothaarige am Arm, während Richard sich mit Helen und zwei weiteren Paaren aufstellte. Als führendes Paar tanzten Lady Helen und er mit den anderen Tänzern die vorgeschriebenen Figuren – immer mit Blickkontakt, um von unterschiedlichen Standpunkten im Saal irgendwann wieder an die Ausgangsposition zu gelangen. Francis schwebte mit seiner Tanzpartnerin vorbei und zwinkerte ihm aufmunternd zu.
Es fiel Richard schwer, Lady Helen in die Augen zu sehen, doch nicht nur, weil er keine Wärme entdecken konnte. Er musste sich auch sehr auf die Schrittfolge konzentrieren. Trotzdem kam er bald aus dem Takt, worauf er resigniert seufzte und froh war, als die Kapelle endlich eine Pause verkündete. Höflich entschuldigte er sich für seine Fehler, die sie mit einem nervösen Nicken vergab.
Was sollte er nur mit dieser strengen jungen Frau? Glaubte sein Vater tatsächlich, man könne Gefühle erzwingen? Er verbeugte sich formvollendet vor ihr und bedankte sich artig. Dann flüchtete er nach draußen, während im Inneren nach einer Weile die Musik wieder aufspielte und eine Contredanse Anglaise verkündete. Er bedauerte nicht, alleine die frische Nachtluft zu schnuppern und betrachtete die schwarzen Umrisse der Bäume, die vorhin noch in der Abendsonne zimtrot geleuchtet hatten. Bis jetzt konnte er dieser Art des gesellschaftlichen Zusammenseins nichts abgewinnen und er fragte sich, ob sich das jemals ändern würde.
2
DEZEMBER 1799, DORF COLD ASHTON
Richard drückte die Klinke der pechschwarzen Eichentür herunter. Das Glöckchen bimmelte und er musste sich mit Kraft gegen die Tür stemmen, bis sie unter einem Schnarren aufschwang. Wahrscheinlich hatte sich das Holz durch die feuchte Witterung verzogen.
Er betrat die Apotheke und während er die Handschuhe auszog, rieselten Schneeflocken auf den Mosaikboden. Er spürte neugierige Blicke auf sich ruhen. In diesem Moment bedauerte er, den Schnee auf seinen Ärmeln und Stiefeln nicht draußen vor der Tür abgeklopft zu haben.
In einem Anflug von Übermut war er von Cold Ashton Manor mit seinem offenen Landauer gestartet, in der Hoffnung, der befürchtete Schneefall würde erst morgen kommen. Was ihn bewogen hatte, nicht einfach einen Diener zu beauftragen, das Gefährt umzubauen oder wie gewöhnlich in der geschlossenen Kutsche zu fahren, wusste er selbst nicht.
Er lächelte vor sich hin, weil man manchmal Dinge tat, die wider jede Vernunft waren oder weil man sich langweilte oder weil sie einfach amüsant schienen. Jedenfalls hatte es während der Fahrt plötzlich angefangen kräftig zu schneien und es hatte ihm sogar Spaß gemacht, hautnah mitzuerleben, wie die Welt noch leiser wurde, als sie hier in den Cotwolds bereits war. Die weiße Pracht schluckte letzte Töne und wusch die Landschaft in ein überirdisches, fast heiliges Weiß.
Es war warm im Verkaufsraum und als er vortrat, hinterließen seine Stiefel kleine Pfützen. Er blieb vor dem großen Ladentisch stehen, der aus dunklem Holz gearbeitet war und viele Schubladen besaß. Dahinter stand ein großer Wandschrank, links und rechts vollständig eingefasst mit Regalen und gefüllt mit unzähligen Gefäßen, Tiegeln und Behältern in verschiedenen Größen, die alle sorgfältig beschriftet waren. Sulfur.Depurat., Ungt.Zinci., Acid. Salicyl., Rhiz.Rhei., Empl.Canthar.Perpet. und viele andere merkwürdige Bezeichnungen las er. Wann war er das letzte Mal hier gewesen? Es mussten einige Jahre her sein, doch offenbar hatte sich seitdem nichts in der Apotheke verändert, bis auf den Besitzer, denn inzwischen war Mr Devaneys Bart ergraut und er trug eine Brille.
Richard lenkte seine Aufmerksamkeit vom Apotheker auf eine ältere Dame, die er beriet und der er für die Behandlung ihrer Beschwerden eine Kombination aus getrockneter Goldrute und Dornige Hauhechel empfahl. Sie möge allerdings die längere Ziehzeit der Dornigen Hauhechel bei der Zubereitung des Tees beachten, machte Mr Devaney deutlich.
Plötzlich trat aus dem Schatten des Apothekers eine junge Frau hervor. Es brauchte keinen Wimpernschlag, um sie zu erkennen und ihm stockte der Atem. Sein Herz begann zu rasen. Es war die Wohltäterin vom Jahrmarkt!
Endlich hatte er Gelegenheit, sie genauer zu betrachten. Sie war schlank und hatte hellblonde glatte, aufgesteckte Haare, die trotz der trüben Beleuchtung im Geschäft regelrecht wie ein flimmernder Sommertag leuchteten. „Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen?“, fragte sie mit sanfter Stimme und sah ihn aufmerksam an.
Er fand es ungewöhnlich, sie unvermittelt und auf Augenhöhe anzusehen, anstatt wie gewohnt bei jungen Damen den Kopf zu neigen, weil sie ihm meist nur bis an die Schultern reichten. Die Situation hier war irgendwie anders und neu. Er erstarrte, als er in ihre Augen blickte. Sie hatten das lichteste Blau, das er jemals gesehen hatte, umrahmt von dichten Wimpern in etwas dunklerem Ton als ihre Haarfarbe. Sein Blick verharrte fasziniert auf ihr und länger, als es schicklich galt.
Sie ließ es geschehen und wich ihm nicht aus. Die Stimme des Apothekers verwischte im Hintergrund zu einem Summen. In ihren Augen lag etwas Berührendes und gleichzeitig Unschuldiges, das er bisher bei keiner jungen Dame bemerkt hatte, die ihm vorgestellt worden war. Es war, als blicke er in die Weiten des Himmels, in dem er sich gespiegelt wiederfand.
„Alles in Ordnung, mein Herr?“, hörte er Mr Devaney plötzlich ganz nah vor ihm. Sein Kittel verbreitete den Duft einer Würzmischung aus Kräutern, die Richard vage bekannt vorkam. Anscheinend hatte der Apotheker ihn beobachtet. Warum musste er nur den Zauber des Augenblicks zerstören?
Während Richard seine Enttäuschung hinunterschluckte, nahm die Stimme von Mr Devaney einen beflissenen Klang an. „Amber, gibt es hier irgendwelche Unklarheiten?“ Dann wandte er sich wieder Richard zu und schwatzte süffisant: „Mein Herr, vergeben Sie mir, bitte. Ich weiß auch nicht, was heute mit meiner Tochter los ist.“ Er nickte entschuldigend zu seiner Kundin, die vieldeutig lächelte.
Richard räusperte sich und erinnerte sich an seine gute Erziehung. Formvollendet verneigte er sich. „Das war alleine meine Schuld. Verzeihen Sie, ich war unaufmerksam.“
Amber Devaney blinzelte, als sei ihr ein Staubkorn ins Auge geflogen und Richard bemerkte, dass sich ihre Wangen röteten. Sie schlug die Augen nieder. „Mein Vater hat recht“, stammelte sie mit belegter Stimme. „Wie kann ich Ihnen helfen?“
Aha – sie war die Tochter des Apothekers! Richard lächelte entschuldigend. Wie gern hätte er ihr den Tadel ihres Vaters erspart. Ihre hohen Wangenknochen glühten noch immer. Er riss sich zusammen und sagte nun konzentriert: „Meine Mutter plagt sich mit rasenden Kopfschmerzen. Gibt es etwas, was ihr Linderung verschaffen könnte?“
Ambers Gesichtsausdruck wurde ernst. „Natürlich. Hat Ihre Mutter denn auch schon einen Arzt konsultiert?“
„So elend ist ihr nun auch wieder nicht zumute. Sie glaubt, sie könnte es zuerst selbst mit einem Heilmittel ausprobieren.“
„Ich verstehe. Einen Moment bitte.“ Sie wandte sich, ohne ihn nochmals anzusehen, der Regalwand zu, stieg auf einen Schemel und holte aus einem Fach ein Gefäß, dem sie zwei Handvoll Blätter entnahm.
Richard betrachtete sie. Die Bindebänder der Schürze, die sie über einer hellbraunen Bluse und einem karierten Rock trug, waren auf dem Rücken zu einer riesigen Schleife gebunden. Wahrscheinlich waren sie viel zu lang und bestimmt hatte der Kittel zuvor einer kräftigeren Person gehört. Man trug die Kleidung im Allgemeinen, bis sie gänzlich zerschlissen, nicht mehr zu reparieren oder umzuarbeiten war. Er kannte das von den Dienstboten.