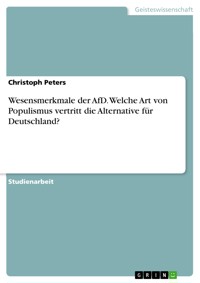11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor mehr als zwanzig Jahren fing alles an, mit der Faszination für die japanische Teezeremonie. Schon als Jugendlicher sammelte Christoph Peters lieber Teegefäße als Schallplatten. Heute verbringt er jede Woche viele Stunden mit der Zubereitung von Tee und stellt fest, dass sich im Nachvollziehen der zugleich reduzierten wie vollendet funktionalen Gesten seine Wahrnehmung verändert hat, er weniger fahrig und unkonzentriert ist. Der Leser erfährt außerdem von ersten Tee-Initiationsriten am Internat,von Begegnungen mit Zollbeamten, die ratlos vor einer antiken Teekanne standen, und davon, wie der Tee für den Autor irgendwann den Genuss von Alkohol ersetzt hat. Humorvoll und entspannt nimmt Christoph Peters uns mit auf eine Reise durch die Teekulturen der Welt, von Ostfriesland bis in die Türkei, von Japan über China zum High Tea nach England.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Christoph Peters
Diese wunderbare Bitterkeit – Leben mit Tee
Mit Zeichnungen von Matthias Beckmann
Für Carla.
1.Die Lage
Tee ist das Getränk der Stunde – so könnte man meinen: Hochwertige Darjeelings, Assams oder auch Earl Greys sind Teil einer Renaissance bürgerlicher, am englischen Geschmack orientierter Lebensart – sozusagen die Fortsetzung von Downton Abbey im heimischen Wohnzimmer, dagegen verbindet sich im Longjing oder Sencha und erst recht im Matcha, dem pulverisierten Grüntee für die japanische Teezeremonie, modernes Gesundheitsbewusstsein mit den Weisheitslehren Asiens. Erlesener Schwarztee in feinem Porzellan steht geradezu sinnbildlich für den westlichen Trend zu »Wertigkeit« und »Entschleunigung«, wohingegen man sich mit grünem Tee, empfindlicher in der Zubereitung und dem Vernehmen nach noch viel gesünder für Körper und Geist, in östlicher »Achtsamkeit« übt. Beides ist mehr denn je vonnöten, damit der von allen Seiten unter Feuer genommene nachpostmoderne Mensch hier und da Momente der Ruhe findet.
Schon das Wort Tee, das wie ein tiefer Atemzug in der Unendlichkeit zu verhallen scheint, hat einen vollständig anderen Ausdruck als Kaffee!, dessen zackiger Anlaut selbst schon fast wie ein Befehl klingt, und genauso schallt es auch allmorgendlich millionenfach durch Verwaltungsgebäude und Produktionsstätten, wenn die ebenso hoch motivierten wie chronisch erschöpften Helden der Arbeit zur Tür hereinkommen. Viele haben auf dem Weg dorthin ihren ersten Coffee to go getrunken und damit sich selbst und allen anderen ihre uneingeschränkte Leistungsbereitschaft demonstriert.
Dagegen klingt die Vorstellung, sich Tea to go zu bestellen, in den Ohren der meisten Teetrinker genauso absurd wie die Idee einer Teemaschine, obwohl dem Fortschritt verpflichtete Produktentwickler sich auch daran versucht haben: Parallel zur Erfindung des industriellen Teebeutels in Deutschland erlangte in Großbritannien und seinen Kolonien ab den frühen 1930er-Jahren eine sonderbare Apparatur namens Teasmade eine gewisse Popularität, in der Wecker, Wasserkocher und Teekanne miteinander kombiniert waren, um dem zunehmend unter Zeitdruck geratenen Gentleman des Morgens einige Handgriffe und Minuten einzusparen. Ich kenne tatsächlich jemanden, der so ein Ding besitzt, allerdings weniger, weil er glaubt, dass man Tee sinnvollerweise auf diese Art zubereitet, als vielmehr, weil er sämtliche Marotten der Briten liebt.
Während Kaffee als einer der wichtigsten Treibstoffe der Leistungsgesellschaft gilt und durch hochpreisige, an die Glanzzeit italienischen Sportwagenbaus erinnernde Maschinen auch repräsentative Aufgaben übernehmen kann, steht der Tee für Zurückgenommenheit und Selbstbesinnung. Er begleitet gedämpfte Unterhaltungen oder die Lektüre eines gebundenen Buchs in vertrauten Räumen, die idealerweise mit gediegenen Möbeln und goldgerahmten Bildern ausgestattet sind.
Um einen guten Tee zuzubereiten, sind aufwendige technische Apparaturen nicht nur nutzlos, sondern regelrecht hinderlich. Manche Tees erweisen sich als ausgemachte Diven und reagieren auf Mangel an persönlicher Zuwendung und Fingerspitzengefühl mit Geschmacksverweigerung oder Verbitterung. Im Grunde braucht es für einen guten Tee lediglich frisches Wasser in der jeweils richtigen Temperatur und passende Gefäße, um ihn aufzugießen beziehungsweise zu trinken. Diese Teegefäße bilden – vor allem in China und Japan – seit anderthalb Jahrtausenden auch ein zentrales Betätigungsfeld für viele kunsthandwerkliche Traditionen, insbesondere im Bereich der Keramik. Die Suche nach dem perfekten Tee hat die dortigen Töpfer immer wieder zu technischen Innovationen und zeitlosen Meisterwerken angetrieben.
In seiner geschmacklichen Vielfalt und Nuanciertheit ist der Tee allenfalls dem Wein vergleichbar, wobei die viel zu grobe Einteilung in Weißwein, Rosé und Rotwein nicht nur farblich eine gewisse Entsprechung in der ebenso oberflächlichen Unterscheidung von grünem, also unfermentiertem Tee, halb fermentiertem Oolong und schwarzem Tee aufweist. Manche Teehandelshäuser bedienen sich bei der Beschreibung ihres Angebots denn auch derselben Küchenpoesie, wie man sie vom Winzerprospekt kennt: Von »fordernd fruchtig«, »rasant animierend« oder »feiner Zitrusnote« ist da die Rede. Selbst was die Preise anlangt, nehmen erstklassige Tees es mühelos mit den besten Weinen auf. So ist es ohne Weiteres möglich, mehrere Hundert Euro für ein Döschen Gyokuro aus einem berühmten japanischen Teegarten zu bezahlen; chinesische Pu-Erh-Ziegel, die noch nach dem traditionellen Reifungsverfahren hergestellt wurden, können auf Auktionen Preise von einigen Tausend Dollar erzielen. 2013 wurde für zwei Kilo Fu Yuan Chang Pu Erh die Rekordsumme von einer Million Britischen Pfund bezahlt.
Im Prinzip gäbe es also auch für den begüterten Teetrinker Möglichkeiten, seine versnobten Freunde zu beeindrucken, wobei er – trotz der gegenwärtigen Teemode – hierzulande wohl noch immer damit rechnen müsste, von besorgten Angehörigen vors Vormundschaftsgericht gezerrt zu werden, würde er sein Geld auf diese Weise anlegen. Nach wie vor ist es so, dass Leute, die locker fünfundzwanzig Euro für eine Flasche Wein ausgeben oder sich einen Espressoautomaten für tausendfünfhundert Euro in die Küche stellen, mich anschauen, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank, wenn ich ihnen erzähle, dass man schon zwanzig Euro für zwanzig Gramm Matcha ausgeben muss, wenn man eine trinkbare Qualität erwerben will, und dass hundert Euro für ein Yixing-Kännchen, wie man es für die Zubereitung eines guten Oolong-Tees benötigt, durchaus normal sind. Bei den Chawan, den großen Schalen für die japanische Teezeremonie, würden Preise wie für ein Van-Gogh-Gemälde aufgerufen, käme zum Beispiel ein Stück des sagenumwobenen Töpfers Chōjirō (1516 – ca. 1592) zur Auktion, der in Zusammenarbeit mit Sen no Rikyū (1522–1591), dem bedeutendsten Meister des japanischen Teewegs, die berühmte Raku-Keramik entwickelt haben soll.
Gleichwohl, und auch wenn es wie ein Widerspruch klingt, gilt für jedwede Form der Teezubereitung, was besagter Sen no Rikyū in einem Lehrgedicht über die Rolle des Teegeräts formulierte:
»Ist es vorhanden: gut,
gibt es keins: dann nicht;
handeln wir gerade so,
wie es ist,
dann ist es die wahre Teekunst.«
Was im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass es zwar immer so, aber eben auch anders geht – vorausgesetzt, derjenige, der den Tee zubereitet, weiß, was er tut.
Allerdings scheint die Teezubereitung bei uns – trotz neuer Bürgerlichkeit und heiligem Krieg gegen freie Radikale und obwohl es seit Langem auch abseits der Ballungsräume gut sortierte Teefachgeschäfte gibt – noch immer etwas für Spezialisten, um nicht zu sagen, Sonderlinge zu sein. Nach wie vor stehen in den Supermarktregalen weitgehend dieselben Teemarken wie vor dreißig Jahren, und anders als beim Kaffee, wo man inzwischen in jeder Kleinstadtbäckerei eine akzeptable Qualität trinken kann, fällt der Teemensch auch in ambitionierten Ausschankstätten für Heißgetränke – die bezeichnenderweise fast immer »Café« heißen – regelmäßig in Zustände depressiver Verstimmung. Selbst wenn neben der Porzellankanne ein frisch befülltes Papiersäckchen oder ein Siebeinsatz mit einem laut Karte »Darjeeling first flush SFTGFOP1 Singbulli« liegt, besteht nur eine geringe Chance, dass daraus noch ein guter Tee wird. Der Grund liegt in einer fatalen Fehlinterpretation der grundsätzlich richtigen Erkenntnis, dass der Teetrinker die Ziehzeit seines Tees lieber selbst bestimmen möchte, je nachdem, ob er ihn anregend oder beruhigend, blumig leicht oder kräftig bitter bevorzugt. Infolge der ersten Grünteewelle vor gut zwanzig Jahren hat sich unter Deutschlands Gastronomen außerdem herumgesprochen, dass dieser nur sehr kurz und keinesfalls in zu heißem Wasser ziehen darf. Da kein Mensch verlangen kann, dass die überlastete und unterbezahlte Tresenkraft mit dem Teethermometer in der Hand am Wasserkocher steht, hat sich als Kompromisslösung lauwarmes Wasser für alle durchgesetzt. Wenn nun aber nicht gerade ein hochwertiger japanischer Gyokuro neben dem Kännchen liegt, der Wassertemperaturen zwischen fünfzig und sechzig Grad bevorzugt, verlasse ich das Lokal am besten gleich wieder, es sei denn, ich bin mit jemandem verabredet und es spielt sowieso keine Rolle, was ich trinke. Meist ist das warme Wasser auch noch für die doppelte Menge Teeblätter bemessen, sodass sich selbst nach zehnminütiger Ziehzeit nur eine gelbliche Flüssigkeit von unspezifischem Geschmack in meiner Tasse befindet. Inzwischen bin ich froh, wenn ich es mit einer gänzlich ahnungslosen Bedienung ohne jede Ambition zu tun habe, die mir einen landläufigen Beutel English Breakfast mit einem zischenden Wasserstrahl direkt aus dem Kaffeevollautomaten überbrüht.
In den meisten Privathaushalten ist die Lage kaum besser. Wenn ich die Frage »Trinkst du einen Kaffee … oder lieber Tee« dummerweise mit »lieber Tee« beantwortet habe, ist die Reaktion für gewöhnlich eine kurze Pause, gefolgt von einem vorsprachlichen Ratlosigkeitslaut, der in den Satz »Mal sehen, was ich da hab« mündet. Irgendwo zwischen Reis, Linsen, Tütensuppen und Gewürzdöschen finden sich schließlich einige Faltkartons mit Beuteltees, von denen die wenigsten Trockenbrösel der echten Teepflanze »Camellia sinensis« enthalten. »Anzubieten hätte ich Pfefferminztee … Fenchel-Anis-Kümmel … Rooibos-Vanille … Ah, warte mal, hier gibt’s noch Earl Grey. Ich weiß aber nicht, wie alt der ist.«
Währenddessen habe ich längst einen verstohlenen Blick durch die Küche geworfen, ob sich dort wohl eine brauchbare Espressomaschine befindet, denn ein guter Espresso ist mir allemal lieber als ein Earl Grey mit feiner Hausstaubnote, und obwohl ich Tee bevorzuge, möchte ich den Gastgeber doch keinesfalls in Verlegenheit bringen, geschweige denn als komplizierter Besuch dastehen.
Tatsächlich ist es mit dem Tee einerseits einfach, andererseits trifft man nur selten Leute, die einem sagen können, was man denn eigentlich tun muss oder auf jeden Fall vermeiden sollte, damit Tee nicht nur eine magenfreundlichere Alternative zum Kaffee bei vergleichbarer Koffeindosis ist, sondern wirklich schmeckt, ja womöglich sogar zu einem herausragenden Geschmackserlebnis wird.
Zwar sind – wenn man Tee von bekannten Marken oder größeren Handelshäusern kauft – meist Angaben zu Mengen, Wassertemperatur und Ziehzeit auf die Packung gedruckt, doch die Standardregel »Ein Löffel pro Tasse und einer für die Kanne« führt gerade bei dunklen Tees zu derart starken Aufgüssen, dass zumindest meinem Gaumen und Magen Zucker oder die Beimischung einer anteiligen Menge heißen Wassers unumgänglich erscheint, wie sie bei Tee aus dem Samowar oder den türkischen Doppelkannen üblich ist. Die Anweisungen, oder sagen wir besser, Zubereitungsvorschläge, die zum grünen Tee kursieren – eine Minute bei zwischen siebzig und achtzig Grad heißem Wasser –, können im Fall eines kostbaren japanischen Senchas bereits zu einem gruselig bitteren Gebräu geführt haben; nehme ich hingegen einen nicht weniger edlen chinesischen Anji Bai Cha, schmeckt er jetzt wahrscheinlich noch nach fast nichts, und wie man das berühmte Gunpowder zubereitet, damit etwas Trinkbares im Becher ist, weiß ich bis heute nicht. Angesichts der extrem unterschiedlichen Blattformen und Schnittgrade, zu denen Tee verarbeitet wird, sind allgemeine Löffelangaben ohnehin sinnlos: Von einem Broken Ceylon oder bestimmten Senchas, die aussehen wie gehäckselt, befinden sich vielleicht fünf oder sechs Gramm eines sehr ergiebigen Tees auf dem Löffel; handelt es sich dagegen um einen weißen Pu Erh Bai Ya oder um einen dunklen Da Hong Pao Oolong, ist der Löffel fast leer, wenn ich ihn aus der Dose hebe. In diesem Fall nehme ich lieber gleich drei Finger, um ihn in die Kanne zu befördern, wie es mir Herr Benjowski, der eines der besten Teegeschäfte in Berlin betreibt, häufig in China unterwegs ist und viele Teebauern persönlich kennt, geraten hat.
Läuft einem tatsächlich einmal ein »richtiger« Teekenner über den Weg, besteht dann auch noch die Gefahr, dass es sich um einen der zahlreichen Fundamentalisten handelt, wie sie sich in allen Gruppen finden, die exklusiv Erlösung durch dieses oder jenes versprechen. Dann habe ich mich als Gesprächspartner womöglich schon komplett disqualifiziert, wenn ich Kaffee nicht grundsätzlich ablehne. Einmal hat mir jemand mit wissenschaftlicher Akribie erklärt, dass meine Geschmacksrezeptoren bereits durch gelegentlichen Espressogenuss so sehr in Mitleidenschaft gezogen seien, dass mir die Feinheiten eines guten Tees auf lange Sicht, wenn nicht sogar für immer verschlossen blieben, von den schweren gesundheitlichen Problemen, die durch die Giftstoffe im Kaffee auf mich zukommen würden, ganz zu schweigen.
Unter den Teefundamentalisten sind aber nicht nur solche, die das Kaffeetrinken für schwere Sünde halten. Manche fühlen sich darüber hinaus einer einzigen und ewigen Wahrheit bei der Zubereitung dieses oder jenes Tees verpflichtet. So ist mir die Verachtung von Anhängern puren Darjeelings sicher, sobald ich Wörter wie »Ceylon« oder gar »Zucker« in den Mund nehme. Bevorzuge ich Milch wie in England, Sahne-Wölkchen wie in Ostfriesland oder gar frische Minzblätter, wie man es im Orient mag, sehe ich schon an der Mischung aus Schmerz und Ekel im Gesicht meines Gegenübers, dass es ihm lieber wäre, ich würde gleich ganz zum Kaffee wechseln und so wenigstens die unschuldigen Teeblätter mit meinen Zumutungen verschonen.
Tatsächlich gibt es – schaut man sich unvoreingenommen um in der teetrinkenden Welt – so viele verschiedene Zubereitungsweisen und gesellschaftliche Rituale rund um den Tee wie Klimazonen, Küchen und Religionen. Aber wie in allen anderen Bereichen werden auch im Hinblick auf den Tee die regionalen und kulturellen Unterschiede häufig nicht als Bereicherung, sondern als Geschmacksverirrung oder gar Frevel wahrgenommen. Einem chinesischen Pu-Erh-Kenner stehen beim Gedanken an den in Nordafrika so beliebten bittersüßen Grüntee mit viel frischer Minze vermutlich ebenso die Haare zu Berge wie dem japanischen Teemeister, wenn der Berliner Hipster »Matcha latte« sagt, oder dem erwähnten Darjeeling-Connaisseur, wenn er sich indischen Masala Chai mit Zimt, Ingwer, Pfeffer und Kardamom vorstellt. Sobald die Rede auf die tibetische Art kommt, Tee mit Yakbutter zu kochen und womöglich noch Gerstenmehl hineinzurühren, schütteln sie sich alle gemeinsam, ganz gleich, was sie ansonsten über China oder den Dalai Lama denken.
Liest man im Cha Ching des Lu Yu (728–804), der ältesten überlieferten Schrift zum Tee, sieht man, dass bereits während der Tang-Dynastie, als der Tee noch zu Ziegeln gepresst, geröstet, im Mörser zerstoßen und mit Salzwasser gekocht wurde, die Ansichten darüber, wie er denn nun am besten zuzubereiten sei, weit auseinandergingen und Meinungsverschiedenheiten in dieser Frage zu tiefen Zerwürfnissen führen konnten. So berichtet Lu Yu, dass dem Tee beispielsweise »Lauch, Ingwer, Jujube, Mandarinenschalen, Kornelkirschen und Pfefferminze« beigemischt würden, und er fasst zusammen: »Leider ist diese schlechte Angewohnheit, Tee zu entwürdigen, heute schon sehr verbreitet.«
Einerseits hat sich daran seither nicht viel geändert, andererseits ist es gerade beim Tee so, dass vermeintliche Widersprüche und Unvereinbarkeiten weder Zeichen für Irrglauben noch für zivilisatorischen Minderwert sein müssen, sondern dass die verschiedenen Traditionen des Tees womöglich allesamt Aspekte und Eigenschaften seiner »Wahrheit« enthüllen, die sich einem öffnen, wenn man neugierig und vorurteilsfrei probiert, was einem hier und dort auf der Welt eingeschenkt wird.
Trotzdem gibt es natürlich besser und schlechter, perfekt und fürchterlich zubereiteten Tee, und leider finden sich auch immer noch Thermoskannen mit heißem Wasser auf Konferenztischen, in denen am Vortag Kaffee gestanden hat. Gegen dessen Nachgeschmack hat nicht einmal der unverwüstliche Earl Grey eine Chance.
Aber vielleicht setzt die aktuelle Teebegeisterung auch hierzulande endlich einen Prozess in Gang, wie ihn Wein und Kaffee längst hinter sich haben: Noch vor dreißig Jahren hätte ein Franzose mit deutschem Wein nicht einmal seine Yucca-Palme gegossen, und südlich von Basel galt deutscher Filterkaffee als schwerste Misshandlung, die den kostbaren Bohnen widerfahren konnte. Heute zählen Rieslinge aus dem Rheingau zu den besten Weinen der Welt, und meine Eltern, die in der tiefsten niederrheinischen Provinz leben, haben sich mit Ende siebzig ihren ersten italienischen Espressoautomaten gekauft.
Der Tee bietet einerseits noch viel mehr Möglichkeiten, ihn zu ruinieren, als Kaffee oder Wein, andererseits erlaubt er den persönlichen Vorlieben aber auch viel größere Freiheiten. Auf die gängigen Fragen – wie viel Tee für wie viel Wasser, und wie lange soll er ziehen? – gibt es tatsächlich für nahezu jeden Tee verschiedene »richtige« Antworten.
Bei mir ist aus schrecklich misslungenen Aufgüssen, Fragen, die mir kein Mensch und kein Buch beantworten konnte, und zufälligen Beobachtungen in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten eine Art fröhlicher Teewissenschaft entstanden, mit immer neuen Experimenten und Versuchsreihen, Thesen und Gegenthesen, wobei ich nach wie vor nichts beweisen kann und endgültige Erkenntnisse selten sind. Letztlich geht es um Moleküle, die in Schwingung versetzt werden, aber wie sie sich bewegen und was diese Bewegungen bedeuten, hängt immer auch vom Betrachterstandpunkt ab – und das heißt in diesem Fall vom persönlichen Geschmack des Teetrinkers.
2.Wie es anfing
Der Tee in meiner Kindheit hatte nichts mit einer bestimmten Pflanze zu tun, die irgendwo im fernen Asien wuchs. Er war weder frisch-grün noch welk-braun, und niemanden interessierte, ob ganze Blätter, Bruch, Stängel oder Knospen verarbeitet worden waren. Beim Tee handelte es sich um etwas eher Medizinartiges von unbestimmter Konsistenz und Herkunft, meist in Beuteln abgefüllt, die bei Bedarf mit kochendem Wasser übergossen wurden: Mein Vater bekam Kamillentee gegen seinen reizbaren Magen; meine Mutter trank an eiskalten Winterabenden, die am Niederrhein schon vor Beginn des Klimawandels äußerst selten waren, Tee mit Rum, weil das drohenden Erkältungen ebenso wirksam vorbeugte wie Grog. Hingegen hatte sie eine tiefe, irgendwie kriegsbedingte Abneigung gegen Pfefferminztee. Meine Oma brachte Gläser mit pulverisiertem Nieren-Blasen-Tee und Erkältungstee aus der Apotheke ins Haus, beide wurden in siedendem Wasser aufgelöst, wenn rohes Ei, verquirlt mit Rotwein, nicht mehr half.
Und dann gab es noch den schwarzen Tee. Ihn umwehte eine unbestimmte Aura des Besonderen. Zumindest in meinen ersten Lebensjahren wurde er nicht im Doppelkammerbeutel