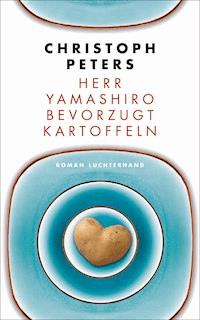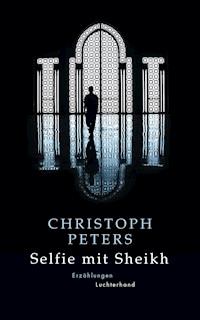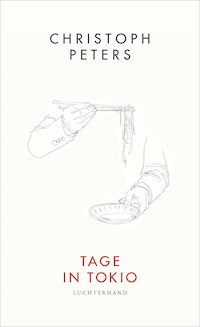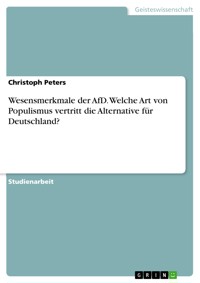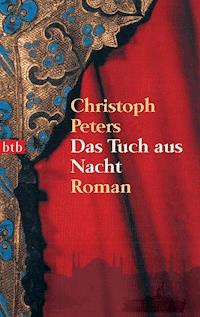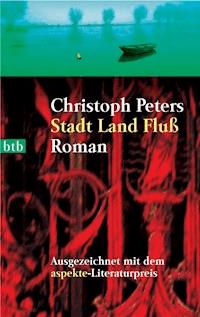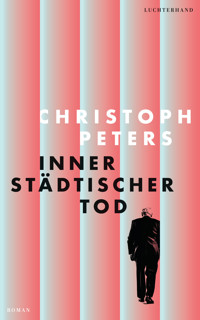
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Familiäre Verwerfungen und politische Radikalisierung: mit bissigem Witz erzählt Christoph Peters von den tiefen Rissen, die unsere Gesellschaft durchziehen. »Einer der besten Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.« Christoph Schröder / SWR 2
Es ist der 9. November 2022. Der russische Angriff auf die Ukraine überschattet das private wie das öffentliche Leben. Am Abend wird die erste Einzelausstellung des aufstrebenden Künstlers Fabian Kolb in der berühmten Berliner Galerie Konrad Raspe eröffnet. Fabians Familie, Eigentümer der letzten Krefelder Krawattenmanufaktur, ist eigens für dieses Ereignis angereist. Sein Onkel, Hermann Carius, alternder Chefideologe der „Neuen Rechten“ im Bundestag, denkt über einen medienwirksamen Auftritt bei der Vernissage nach, während Fabians Vater hofft, die internationalen Kontakte seines Schwagers zu nutzen, um weiterhin Ware nach Russland zu exportieren. Je näher die Ausstellung rückt, desto stärker werden Fabians Zweifel, ob er tatsächlich bereit ist, sich auf all die Kompromisse einzulassen, die eine internationale Karriere als Künstler mit sich bringen, zumal sein Galerist sich plötzlich mit schweren Vorwürfen ehemaliger Mitarbeiterinnen konfrontiert sieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Es ist der 9. November 2022. Der russische Angriff auf die Ukraine überschattet das private wie das öffentliche Leben. Am Abend wird die erste Einzelausstellung des aufstrebenden Künstlers Fabian Kolb in der berühmten Berliner Galerie Konrad Raspe eröffnet. Fabians Familie, Eigentümer der letzten Krefelder Krawattenmanufaktur, ist eigens für dieses Ereignis angereist. Sein Onkel, Hermann Carius, alternder Chefideologe der »Neuen Rechten« im Bundestag, denkt über einen medienwirksamen Auftritt bei der Vernissage nach, während Fabians Vater hofft, die internationalen Kontakte seines Schwagers zu nutzen, um weiterhin Ware nach Russland zu exportieren. Je näher die Ausstellung rückt, desto stärker werden Fabians Zweifel, ob er tatsächlich bereit ist, sich auf all die Kompromisse einzulassen, die eine internationale Karriere als Künstler mit sich bringt, zumal sein Galerist sich plötzlich mit schweren Vorwürfen ehemaliger Mitarbeiterinnen konfrontiert sieht …
Zum Autor
Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Er ist Autor zahlreicher Romane und Erzählungsbände und wurde für seine Bücher vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2018), dem Thomas-Valentin-Literaturpreis der Stadt Lippstadt (2021) sowie dem Niederrheinischen Literaturpreis (1999 und 2022). Christoph Peters lebt heute in Berlin. »Innerstädtischer Tod« ist der dritte, eigenständige Teil einer an Wolfgang Koeppen angelehnten Trilogie, die mit »Der Sandkasten« (2022) und »Krähen im Park« (2023) begann.
Christoph Peters
Innerstädtischer Tod
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Luchterhand Literaturverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign | München unter
Verwendung einer Collage von Ruth Botzenhardt
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30597-0V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Dieses Buch ist ein Roman. Als literarisches Werk knüpft es in vielen Passagen an reales Geschehen und an Personen der Zeitgeschichte an. Es verbindet Anklänge an tatsächliche Vorkommnisse mit künstlerisch gestalteten, fiktiven Schilderungen sowie fiktiven Personen. Dies betrifft auch und insbesondere vermeintlich genaue Schilderungen von privaten Begebenheiten oder persönlichen Motiven und Überlegungen. Sie sollen die Motive und Intentionen der objektivierten Charaktere erhellen und sind deshalb künstlerisch geboten und erforderlich.
Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d’ira voci alte e fioche, e suon di man con elle
facevano un tumulto, il qual s’aggira sempre in quell’aura sanza tempo tinta come la rena quando turbo spira.
DANTE, Inferno
Man war angekommen und war es nicht;
man hatte keine Eile und fühlte sich doch von
Ungeduld getrieben.
THOMAS MANN, Der Tod in Venedig
I.
Nirgends hatte ein Gott seine Spur hinterlassen. Im märkischen Sand wäre sie auch nicht von Dauer gewesen. Kein römischer Tempel, kein Amphitheater, weder Burgruine noch Kathedrale bezeugten mythische Größe. Heiligengräber hätte man vergeblich gesucht, aber wer suchte schon Heiligengräber? Die Hohenzollerngruft war wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Namen und Taten des vormaligen Herrschergeschlechts kannten ohnehin nur noch Spezialisten. O König von Preußen, du großer Potentat / wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig, satt. Hier und da verzierte friderizianisches Rokoko das Stadtbild, Deutscher Dom, Französischer Dom, ein Opernhaus, ein Sommerschloss, recht hübsch geraten, des Weiteren Schinkels Griechenland-Träume, daran anschließend historisierende Prunkbauten im Auftrag des letzten Kaisers. Wilhelm II. starb 1941 nach verlorenem Weltkrieg, Abdankung, Flucht im niederländischen Exil. Das Dritte Reich trauerte ihm nicht nach. Der Führer gestattete lediglich einer Rumpfdelegation die Reise zur Beisetzung ins okkupierte Gebiet. Auf totalen Krieg folgte totale Zerstörung. Wiederaufbau entsprechend den Vorgaben des sozialistischen oder kapitalistischen Realismus, Auferstanden aus Ruinen, Siemens, AEG, VEB, LPG; Paläste für Arbeiter, sozialer Wohnungsbau, die autogerechte Stadt, form follows function. In lockerer Folge schlugen sich Staatsratsvorsitzende und amerikanische Präsidenten Merksätze von mittlerem Ewigkeitswert um die Ohren. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.Ich bin ein Berliner. Mr. Gorbatschow, tear down this wall! Die Friedliche Revolution, ohne dass vorher jemand eine Bahnsteigkarte gekauft hätte. Wir sind das Volk. Wir sind ein Volk. Deutschland einig Vaterland. Jüngst hatte sich das eine Volk ein Schlossimitat genehmigt, sandsteinverblendeter Stahlbeton, YIPPIE-JAJA-YIPPIE-YIPPIE-YEAH!, Adler, Propheten, Helden als Fassadenschmuck, der guten alten Zeit zuliebe. Auf der Kuppel prangte ein Kreuz, darunter das Schriftband: Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Aktuell waren noch 13 Prozent der Bewohner Berlins evangelisch; 7,5 Prozent katholisch; Orthodoxe, Baptisten, Jehovas Zeugen fielen statistisch nicht ins Gewicht. Ankündigungen von Armageddon und der unmittelbar anschließenden Wiederkunft Christi waren nach den Enttäuschungen der Jahrtausendwende nur noch selten zu hören, obwohl am Horizont Krieg herrschte. Es gab Raketeneinschläge in Lwiw, ehemals Lemberg, und nahe der polnischen Grenze. Zwanzig Kilometer weiter westlich würden sie den NATO-Bündnisfall auslösen. Die Drähte zwischen Washington und Moskau seien gekappt, hatte es geheißen, allerdings war vor zwei Tagen die Meldung verbreitet worden, der amerikanische Sicherheitsberater habe regelmäßig Gespräche mit seinem russischen Amtskollegen geführt, um das Risiko einer nuklearen Eskalation zu senken. War die Nachricht durchgesickert, enthüllt oder lanciert worden? Sollte sie beruhigen oder Angst schüren? Wem nützte, wem schadete sie? Wie immer war die Wahrheit das erste Opfer des Krieges, nichtsdestoweniger wurde mit Feuereifer geglaubt, was diese oder jene Seite propagierte: Wenn wir ihm jetzt nicht seine Grenzen aufzeigen, lässt Putin seine Truppen bis zur Elbe vorrücken; amerikanische Agrarkonzerne haben sich längst riesige Territorien in der Ukraine gesichert; ohne die Ukraine als Vasallenstaat schrumpft Russland zur Regionalmacht; natürlich gab es amerikanische Biowaffenlabore in der Ukraine. Hausdächer und Wände hatten ihre Stabilität eingebüßt. Gasmangellagen, Stromausfälle, Sabotageakte auf kritische Infrastruktur wurden befürchtet; weltweite Nahrungsmittelengpässe, Rezession, Inflation. Vielleicht setzte die Reaktorruine in Tschernobyl nach Granatentreffern demnächst wieder gewaltige Mengen Radioaktivität frei, führte die Unterbrechung der Energieversorgung in den Kraftwerken von Saporischschja zum Super-GAU. Dann wäre es vorbei mit Sandburgen auf Kinderspielplätzen, Sommerkonzerten im Tiergarten, Pilzgerichten, Wildfleisch.
Auch nach einer Woche ist mir die Gewalttätigkeit der Architektur schwer erträglich: das harsche Grau der Wände, das gleichgültige Grau des Bodens, darüber das sternengeschmückte Preußischblau des neoromanischen Tonnengewölbes, das Einzige, was die iranische Stararchitektin Sahra Hamid bei ihrem Umbau der Gründerzeitkirche vom wilhelminischen Monumentalkitsch übrig gelassen hat. Unerbittliches Licht. Nirgends Halt. Was dem entgegensetzen, wie sich darin behaupten? Früher haben hier die letzten Katholiken des Viertels auf den Knien gelegen, anschließend evangelikale Erweckungsprediger ihren Gläubigen mit dem Feuer der Hölle gedroht. Vielleicht hätte ich auf die Geschichte des Ortes eingehen müssen? Topografie der Angst: Eine Intervention zu kirchlichem Psychoterror, Missbrauch, Homophobie, Misogynie. Ganz zu schweigen von den Verbrechen christlicher Missionare in Afrika, Südamerika, Ostasien. Als die Kirche gebaut wurde, träumte das Kaiserreich davon, in den Kreis der Kolonialmächte aufzusteigen, sich neuen Reichtum und Glanz durch die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen im globalen Süden zu verschaffen. Die Maßnahmen, die bei der Umwidmung des Gebäudes vom Gotteshaus zur Galerie durchgeführt wurden, haben den Charakter des Ensembles zwar deutlich verändert, auch war es sicher gut, eine iranische Architektin zu beauftragen, aber ein paar Jahre Ausstellungsbetrieb reichen kaum aus, um die historischen Kontaminierungen aus dem Mauerwerk zu lösen. Bislang hat keine*r der Künstler*innen, die hier gezeigt wurden, dazu Stellung genommen, weder in den Arbeiten noch mit einem kritischen Kommentar.
Ich brauche eine Pause, Abstand. Sitzen, eine Zigarette drehen. Der Hocker ist unbequem. Zum Rauchen müsste ich in den Hof gehen. Ich bin zu erschöpft, um mich allein dort draußen hinzustellen.
Diese Ausstellung in der Galerie Konrad Raspe – die erste große Präsentation meiner Arbeit in einer wichtigen Galerie – könnte mich, wenn es gut läuft, vom begabten Newcomer zu einem Künstler von Weltrang machen. Die wenigen Sammler, die während der vergangenen Jahre Objekte von mir gekauft haben, freuen sich wahrscheinlich jetzt schon über den exponentiellen Wertzuwachs ihrer Investments.
Natürlich wusste ich vorher, worauf ich mich einlasse. Theoretisch. Etwas zu wissen, bedeutet nicht, es zu verstehen; etwas zu verstehen, heißt nicht, die emotionalen Folgen abzuschätzen. Ich bin absolut nicht in der Lage zu beurteilen, ob die Installation so, wie ich sie in den vergangenen sechs Tagen hier eingerichtet habe, gut ist, ob sie überhaupt in die Zeit passt, sich womöglich sogar zu sehr der vom Krieg verdunkelten Gegenwart andient, als politisches Statement gelesen wird – in welcher Richtung auch immer.
Ich brauche einen neuen Blick, als sähe ich die Objekte zum ersten Mal: Vor mir liegt ein verlassenes Schlachtfeld aus dem letzten Jahrhundert: Körper aus Holz, Eisen, Leder in Gestalt nachgebauter Turnböcke, Pauschenpferde, Sprungkästen, Sandsäcke. Kadaver, die ihre Extremitäten dem Blau entgegenstrecken, modifiziert durch eingekerbte Wundmale, aufbrechende Geschwulste, wucherndes Narbengewebe. Manche Eingriffe fallen erst auf den zweiten Blick auf, verursachen bei den Betrachter*innen einen kurzen Schock. Das hat zumindest Konrad gesagt und der muss es wissen, sonst kann er die Sachen nicht verkaufen: »Bevor sich Sentimentalität breitmacht, kippt das Vertraute ins Monströse – das ist das Großartige an deiner Arbeit, Fabian.« – Und seine Assistentin, Maren Gerstäcker, hat hinzugefügt: »Ich muss immer an ein Foto denken, das bei uns im Geschichtsbuch war: tote Pferde nach einem Giftgasangriff irgendwo in Frankreich oder Belgien, total aufgequollen, als würden sie platzen. Really disturbing.«
Als wir die Ausstellung vereinbart haben, vor anderthalb Jahren, zwischen der dritten und vierten Corona-Welle, hieß es, mit dem Impfstoff kehre die Normalität zurück. Damals hat mir etwas völlig anderes vorgeschwebt: eine düstere Turnhallenlandschaft, Beschwörung einer Jugend in der Provinz, autofiktionale Erinnerungskammer, postviraler Albtraum aus monumentaler Verlassenheit, darin die Untröstlichkeit der Dinge, die zurückgeblieben sind, isoliert, ihres Sinns beraubt, seit die Menschen das Land verlassen haben.
Alle Objekte sind nach meinen Vorgaben, unter meiner Aufsicht von Handwerkern in Marrakesch gefertigt worden. Dort wissen die Leute, wie man Tierhäute verarbeitet, Leder in jedwede Form bringt. Aber natürlich haben sie sich trotzdem kopfschüttelnd gefragt, weshalb dieser sonderbare Deutsche Unsummen für Dinge ausgibt, die zu nichts nütze sind – reine Materialverschwendung aus ihrer Sicht. Aber sie haben gemacht, was ich von ihnen wollte, und sie haben es sehr gut gemacht. Dagegen hat es mit den Schreinern und Schlossern, die für die Unterkonstruktionen zuständig waren, Beine, Füße, Gelenke herstellen sollten, immer wieder Schwierigkeiten gegeben. Ihnen fehlte ein bestimmter Perfektionismus. Sobald etwas leidlich funktionierte, waren sie zufrieden. Immer und immer wieder habe ich ihnen Fotos von alten Turngeräten gezeigt, um ihnen irgendwie begreiflich zu machen, dass ein Scharnier, eine Teleskopschienenführung, eine Oberfläche nicht einfach nur ihrer Funktion gerecht werden muss, sondern dass es um einen bestimmten Ausdruck geht: Die Metall- und Holzelemente sollten dieses dystopische Element in die Arbeit bringen, eine spezielle Atmosphäre zwischen der rückwärtsgewandten Wertigkeit alten Handwerks und den sadistischen Obsessionen eines totalitären Regimes aus der Zukunft.
Noch immer hängt der Geruch von vegetabiler Gerbung in der Luft, dazu das Lederfett, das ich in die Oberflächen massiere, nachdem ich sie, so rabiat wie es möglich ist, ohne dass das Material ernsthaft Schaden nimmt, mit Stahlwolle, Schleifpapier traktiert habe – eine künstlich beschleunigte Alterung, um eine Geschichtlichkeit zu suggerieren, die es nicht gibt.
»Es ist viel intensiver als das, was du ursprünglich vorhattest«, sagt Konrad. Im selben Moment spüre ich seine Hand auf der Schulter. »Das war auch schon sehr eindrücklich, ich will es gar nicht abwerten. Aber jetzt bleibt das Ganze eben nicht mehr bei deinen privaten Beschwörungen stehen, sondern schlägt eine Brücke ins Heute. Man kann es als Kommentar zur aktuellen Lage lesen, gleichzeitig weist es weit darüber hinaus, ruft beinahe archetypische Bilder auf, die sich über Jahrtausende ins kollektive Unterbewusstsein eingebrannt haben. Im Grunde beginnt das alles bei Kain und Abel. Und dazu dann noch das dunkel erotische Element, das latent mitschwingt.«
Ich vertraue Konrad Raspe – seinem extrem präzisen Blick, seiner Begeisterung und der Genauigkeit, mit der er das, was er sieht oder erspürt, in Worte fassen kann. Zu gerne würde ich ihm glauben, dass meine Arbeit eine besondere, einmalige Qualität hat. Aber das, was in der Galerie aus meiner ursprünglichen Vision geworden ist, gefällt mir einfach nicht. Abschottung, Leere, Stille hätten die bestimmenden Elemente sein sollen. Windhauch, alles ist Windhauch steht auf der Einladungskarte. Die nahezu unmerklichen Bewegungen der Luftmoleküle zwischen den Körpern wollte ich erfahrbar machen, sie lenken, engführen, bündeln, damit im Betrachter das Bedürfnis entsteht, sich niederzulassen, den eigenen Atem zu hören, im Angesicht des Verlusts zur Ruhe zu finden. Die Wahrnehmungen, Empfindungen, Gedanken eines Menschen, der in den totalen Rückzug gegangen ist, innehält, sich sammelt, den Nachtmahren, Ungeheuern aussetzt, die seinem Inneren entsteigen, der darüber Dinge, Verhältnisse, Prozesse, Material und Form zu sich selbst kommen lässt, ein schweigendes »Trotzdem« gegen die Gewissheit, dass nichts dergleichen mehr möglich ist. Sich schließlich vortasten, heraustreten, neu beginnen. Doch das, was während der Pandemie Gültigkeit hatte, zählt nicht mehr, seit von Osten her Tag für Tag das Pfeifen der Raketen im Sinkflug, die Donnerschläge der Bombenexplosionen herüberdröhnen, Maschinengewehrfeuer, Schmerzensschreie, Todesschreie.
Träge umfloss das schwarze Wasser der Spree die Insel im Zentrum der Stadt, Welterbestätte, Touristenhotspot, Dauerbaustelle, einst Lustgarten des Großen Kurfürsten, den sie als Jüngling vor den marodierenden Schweden aus der hinterwäldlerischen Mark Brandenburg ins Arnheim des Goldenen Zeitalters verbracht hatten. Dort lernte er von den zivilisierteren Verwandten, wie es sich darstellte, das höfische Leben des Mannes von Welt – welche Manieren er pflegte, welche Gemälde, Teppiche, Kabinettschränke sich für seine Gemächer ziemten, welche Weine zu welchen Speisen gereicht wurden. Zurück an der Spree ließ er Alleen, Beete, Labyrinthe rund um das Schloss auf der Insel anlegen, geordnet nach Maß und Zahl, entsprechend den Ideen seines Cleve’schen Statthalters, Johann Moritz von Nassau-Siegen, der mit den Schiffen der Westindischen Kompanie unbekannte Pflanzen und Tiere aus Niederländisch-Brasilien nach Europa gebracht hatte, Tomaten, Kartoffeln, Kürbis; Papageien, Affen, Würgeschlangen. Aus südlichen Gefilden kamen Pomeranzen-, Zitronen-, Granatapfelbäume, Palmen und Feigen. Zum Schutz vor Eis und Schnee wurde ihnen ein beheizbares Winterhaus errichtet, wie es die Verwandten weiter westlich längst hatten. Doch der Sinn für Schönheit, Überfeinerung währte nicht lange. Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, setzte auf Sparsamkeit und Truppenstärke. Die exotischen Gewächse wurden fortgeschafft, die Wasserspiele zugeschüttet, er ließ Hecken roden, Bäume fällen, aus bronzenen Göttinnen Kanonen gießen. Fortan sollten die Gartenflächen als Exerzierplatz dienen. Statt weitgereister Wissenschaftler und Gelehrter, die dem Monarchen darlegten, was es auf sich hatte mit all den unerhörten Neuigkeiten aus der bekannten und unbekannten Welt, präsentierten Infanteristen zackig ihre Musketen. Vom Balkon aus konnte er zusehen, wie einer, der die Ehre des Regiments beschmutzt hatte, beim Spießrutenlauf den Tod fand. Die Gebäude des Pomeranzenhauses wurden Packhof, Warenumschlagplatz, Mehlspeicher, Salzlager. Hundert Jahre später begann Schinkel hier mit dem Bau einer Akropolis für die Kunst. Stück für Stück fanden die geraubten Götter aus Pergamon eine neue Heimat, die tönernen Löwen, Stiere, Fabelwesen des Nebukadnezar. Schließlich hielt die geheimnisvollste aller Ägypterinnen Einzug, Nefert-iti – die Schöne ist gekommen, entführt oder rechtmäßig erworben, wie auch immer, sie war da, machtvoll, unnahbar, würdigte seit 3372 Jahren niemanden eines Blickes, während wenige Meter entfernt das kleinwüchsige Malergenie Adolph von Menzel dem Betrachter seinen schwieligen dicken Zeh entgegenstreckte. –
Ein stoppelbärtiger Mann mit wild wuchernden Brauen, verwitterter Gesichtshaut zog einen unter Plastiktüten verschwindenden Einkaufstrolley über die Schlossbrücke. In seiner Linken hielt er eine Angelrute. Athene unterrichtet den Knaben im Waffengebrauch, Nike kürt den Sieger, Iris trägt den gefallenen Helden auf den Olymp. Er bog auf den Vorplatz, postierte sich am Ufergeländer, holte ein Glas Würmer aus dem Seitenfach, spießte eine der sich windenden Larven auf den Haken, ließ den Köder ins Wasser gleiten. Vielleicht hatte er irgendwo in der Nähe sein Zelt aufgeschlagen, würde nachher den Grill anfachen, eine nach Altöl schmeckende Plötze braten. Hinter ihm klopften die Pflasterer zu polnischem Radio-Pop unter den abwesenden Augen indischer, chinesischer, japanischer Buddhas, afrikanischer Könige, drachenköpfiger Waldgeister, federgeschmückter Ahnen Wackersteine in Sandbeeten fest.
Auf der Wiese, wo die Bauakademie wiedererstehen sollte, im Rücken des bronzenen Karl Friedrich Schinkel, der mit entschlossener Miene das Gelände überblickte, hockte ein dunkelbrauner Kater mit grünen Augen. Seine schlanke, langgliedrige Gestalt, der spitze Kopf, die riesigen Ohren erinnerten an die Figuren der altägyptischen Göttin Bastet, Tochter des Sonnengottes Re, die nebenan, in den Kellern des Neuen Museums standen. Der Kater streckte seinen Kopf dem Himmel entgegen und schrie, lief von Schinkel zu Albrecht Thaer, schrie erneut, weiter von Thaer zu Peter Christian Wilhelm Beuth, schrie zum Erbarmen.
Carte blanche, steht in hellblauen Leuchtbuchstaben über der Tür. Ist es ein Café oder doch eine Kneipe? Einfache Holztische und -stühle, nicht zu eng gestellt, an den Wänden Filmplakate, JULES ET JIM, ORPHÉE, TIREZ SUR LE PIANISTE: Vor gelbem Hintergrund hockt ein Mann in schwarzem Anzug auf einem Klavierschemel, die konzentrischen Kreise einer Zielscheibe, acht rote Punkte wie Einschusslöcher auf seinem Rücken. Die Bedienung hat ein schönes Gesicht.
Ich musste etwas anderes sehen, etwas, das nichts mit mir zu tun hat, musste raus aus der Gegenwart Konrad Raspes und seiner übergriffigen Assistentin, Maren Gerstäcker, die ihm dauernd betont beiläufig die Hand auf den Unterarm legt, vertraute Blicke mit ihm tauscht – immer eine Spur zu lang Auge in Auge. Möglich, dass sie mit ihm schläft, im Keller, zwischen bruchsicher verpackten Plastiken, Bildern, Objekten, oder in einem der teuren Hotels der Umgebung, streng geheim, aber alle wissen Bescheid, während Konrads Frau, Eva-Kristin, eine ehemalige Wedding-Planerin, ins Fitnessstudio geht, zur Kosmetikerin oder zur Thai-Massage. Eva-Kristin ist schön, viel schöner als Maren Gerstäcker, obwohl sie mindestens fünfzehn Jahre älter ist – auch deutlich älter als Konrad. Sie mag mich nicht. Vielleicht ist ihr auch einfach meine Arbeit unheimlich, und sie überträgt es auf mich als Person. Sicher nimmt sie an, dass alle Leute in ihrem Umfeld über Konrads Affären spekulieren, versucht, sich mit ihrer abweisenden Art die Demütigung vom Leib zu halten, Souveränität zu demonstrieren. Konrad hat schon lange diesen Ruf. In Köln oder Düsseldorf heißt es, sobald sein Name fällt, »mal sehen, wann die Erste an die Presse geht.« – Dass er Frauen hauptsächlich unter optischen Gesichtspunkten einstellt, ist offensichtlich. Alle Menschen weiblichen Geschlechts, die in der Galerie arbeiten, könnten ebenso gut Models sein. Meistens bleiben sie nicht lange, ein oder zwei Jahre. Aber die Zeiten haben sich geändert. Spätestens seit den Prozessen gegen Harvey Weinstein, Kevin Spacey ist es kein Zeichen von Erfolg, von Größe mehr, wenn einer in dem Ruf steht, mit seinen Mitarbeiter*innen rumzumachen. Vielleicht ist es ein Fehler, dass ich mich von ihm vertreten lasse – genau die Art Opportunismus, die ich immer verabscheut habe: dass man bereit ist, für seine Karriere alles andere auszublenden.
Diese ganze Welt ist mir fremd, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen werde. In Konrad Raspes wilhelminisch bestirntem Betonkäfig kommt meine Arbeit mir vor wie die Arbeit eines anderen, den ich kenne und nicht kenne, der mir Dinge zuflüstert, die mir einleuchten, während ich zugleich weiß, dass sie falsch sind. Ich kann jedem oder jeder, der oder die danach fragt, wortreich die zugrunde liegenden Konzepte erläutern. Niemand wird bezweifeln, dass ästhetische Theorie, kunstgeschichtliche Verweise, Formensprache das Ergebnis meines jahrelangen Nachdenkens sind. Aber je mehr sich die Installation auf der plastischen Ebene einem klaren, kraftvollen Zustand nähert, desto weniger habe ich das Gefühl, dass das Ganze etwas mit mir zu tun hat – dass ich es bin, der die Entscheidungen trifft. Impulse, deren Ursprung ich nicht kenne, gehen auf eine Weise, die ich nicht verstehe, durch mich hindurch, führen mir die Hände. Ich bin ein fremdgesteuerter Automat, der Befehle umsetzt, die eine andere Person programmiert hat.
Vielleicht liegt es auch gar nicht an den Räumlichkeiten, sondern an Konrad Raspe selbst, an dem Druck, den es bedeutet, bei einem Star-Galeristen auszustellen, mit Dependancen in New York, Shanghai, Abu Dhabi. Offensichtlich sieht er etwas in mir, das ihm vielversprechend – gewinnträchtig erscheint. Konrad ist überzeugt, dass ich am internationalen Kunstmarkt eine Position besetzen kann, die es so noch nicht gibt. Ich soll als meine eigene Marke etabliert werden, und diese Marke soll eine Marktlücke füllen. Er hat Unsummen in die Herstellung der Objekte gesteckt. Ohne sein Geld gäbe es nichts davon. Früher hätte ich mir eingeredet, dass es die anderen sind, die mich von mir selbst entfremden, ihre direkten oder unausgesprochenen Forderungen. Ich wäre überzeugt gewesen, dass ich zu mir zurückfinde, sobald man mich allein lässt. Aber so ist es nicht. Auch wenn ich für mich bin, tagelang niemanden treffe, zerfalle ich in Einzelteile, werde ein Gewirr heterogener Empfindungen, unberechenbarer Impulse. Das, was ich glaube, was ich will, meine Hoffnungen, Ziele, Ängste, wechseln sich im Stundentakt ab. Sobald ich aufwache, sind da die Stimmen von Eltern, Freund*innen, Kolleg*innen, Kritiker*innen, der amerikanische Markt, der ostasiatische Markt, der Blick, den die Kunsthistoriker*innen einer fernen Zukunft auf meine Arbeit richten. Wildfremde Menschen, die mir auf der Straße, in der U-Bahn, im Supermarkt begegnen, reden auf mich ein. Dinge, Tiere, Gebäude, Landschaften erklären mir, wer oder was ich ihrer Ansicht nach denken, tun, sein soll.
Bis zu Konrad Raspes Angebot, in seiner Galerie auszustellen, habe ich improvisiert, aus vorgefundenen Materialien etwas zusammengefügt – eine mittellose Kunst, die bei den Betrachter*innen ein Gefühl des Schwindels erzeugt hat, weil sie unerwartet war, Bekanntes, Vertrautes durch Verfremdung, Verschiebung des Kontexts in Irritation verwandelt hat. Das Beiläufige, Nebensächliche hat mich interessiert. Ich wollte, dass es aussieht, als wären die Dinge aus sich heraus entstanden, in einem Prozess völliger Selbstvergessenheit, ohne jedes Kalkül, absichtslos wie Zufallsprodukte. Jetzt stelle ich genau geplante, mit Hilfe eines potenten Geldgebers vorfinanzierte Dinge her, die von einer internationalen, auf den Transport hochpreisiger Kunstobjekte spezialisierten Spedition verpackt, auf dreihunderttausend Euro versichert von Marrakesch nach Berlin gebracht worden sind. Wenn alles so läuft, wie Konrad Raspe es sich überlegt, in zahllosen Gesprächen mit einflussreichen Journalist*innen, Sammler*innen, Museumsleuten vorbereitet hat, werde ich – wird der, der künftig unter meinem Namen, mit meinem Gesicht, meinem Körper auftritt – ab morgen eine dieser Künstler*innendarsteller*innen sein, die um die Welt reisen, sich auf Messen, Biennalen, in von angesagten Kurator*innen arrangierten Ausstellungen präsentieren, Pressekonferenzen abhalten, Interviews geben, fotografiert werden, sich exzentrische Angewohnheiten in Stil und Gebaren leisten, wahnsinnig viel Geld verdienen.
»Ich muss an die frische Luft, um den Kopf freizubekommen«, habe ich zu Konrad gesagt, »im Grunde ist ja auch alles fertig, den Rest können wir später oder morgen einrichten, meinethalben noch letzte Änderungen vornehmen, ruf mich an, wenn dir etwas einfällt.« – An seiner Stelle hat Maren Gerstäcker geantwortet, obwohl ich sie gar nicht angesprochen, bewusst an ihr vorbei geschaut hatte: »Das verstehe ich, du bist ja jetzt auch wirklich extrem tief eingetaucht in diese ganzen unglaublich intensiven Gefühle. Gerade die Konfrontation mit der Gewaltthematik: Das stelle ich mir echt heftig vor. Ich weiß gar nicht, wie du das aushältst. Ich schaue inzwischen nicht mal mehr Nachrichten.«
»Kein Problem«, habe ich gesagt, mich umgedreht, ohne auf Konrad zu achten, ob er konsterniert, verständnisvoll oder ärgerlich wirkte, bin zur Tür hinaus, habe mir im Gehen die Zigarette angesteckt, die seit einer Stunde fertig in meinem Tabakpäckchen war, bin links abgebogen, hätte genauso gut rechts gehen können, ich kenne mich noch immer nicht aus in der Stadt, wollte einfach irgendwohin, wo ich nachdenken kann – ein Ort, der andere Bilder, Empfindungen erlaubt, während es langsam schon wieder dunkel wird. Möglicherweise kommt es mir auch nur so vor, nach den endlosen Stunden in diesem gnadenlos präzise ausgeleuchteten Raum. Oder es hat damit zu tun, dass Berlin so viel weiter im Osten liegt als Köln: Der Krieg ist nah, seine Zerstörungswut überall spürbar, nicht nur, weil die Stadt voller Ukrainer*innen ist.
»Kann ich etwas bestellen?« – »Klar. Was hättest du gern?« – »Vielleicht den frischen Ingwer-Minze-Tee …« – »Vielleicht oder soll ich ihn bringen.« – »Und ein Stück von dem Carrot Cake.«
Der russische Präsident hatte zum wiederholten Mal mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht; der Vizekanzler wollte den Ausverkauf der kritischen Infrastruktur an China verhindern; ein britischer Prinz hatte sich schon als Kind zweitklassig gefühlt, die heimgekehrte Fürstin von Monaco strahlte wieder Lebensfreude aus, während im stacheligen Gras am Rand des Schinkelplatzes ein entlaufener Kater hockte und um sein Leben schrie. Für seine altägyptischen Vorfahren interessierte er sich so wenig wie für barocke Gartengestaltung. Welche Hoffnungen auch immer er mit der Welt jenseits der Wohnungstür verbunden hatte – sie hatten sich nicht erfüllt: Wo waren die Stimmen der saftigen Vögel, die den Sommer über vor dem Fenster gesungen hatten? Amseln, Meisen, eine Nachtigall, die schließlich vor Erschöpfung tot vom Baum fiel. Nacht für Nacht das Liebeswerben, die Kampfschreie der Rivalen um Beute und Katzen; die Katzen selbst, schön und unbegreiflich, begierig, begattet zu werden, eine neue Generation auszutragen, die eines Tages eine Dynastie gründen, den städtischen Raum beherrschen, über reiche Jagdgründe, Lustgärten, warme Schlafstätten gebieten würde. Nichts von alledem fand sich hier, zwischen vergessenen Gerüststreben, Absperrgittern, antikisierten Straßenlaternen, kümmerlichen Bäumen, an denen halb verrottetes Herbstlaub hing. Stattdessen das Dröhnen des Presslufthammers, verstörende Vibrationen aus dem Innern der Erde, Schatten von Geistern. Die Freiheit war kalt und nirgends stand Futter. Eine Ratte rannte vorbei, verschwand zwischen Büschen. Aus den Tiefen einer im Dunkel verborgenen Vergangenheit spürte der Kater den Impuls, ihr nachzulaufen, eine Ratte ist eine Ratte ist eine Ratte. Was hätte er mit ihr anfangen sollen? Von den lebendigen Wesen aus Fleisch und Blut hatte er bislang nur mit Menschen zu tun gehabt.
Eine Mercedes-Limousine aus der Fahrbereitschaft des Deutschen Bundestags rollte im Schritttempo über den Platz. Im Fond saß Dr. Hermann Carius, Abgeordneter der Neuen Rechten. Er war dreiundsiebzig Jahre alt, gesundheitlich angeschlagen, schlecht gelaunt und gab sich Mühe, es niemanden merken zu lassen. Dass sein Kardiologe meinte, er solle einen Gang zurückschalten, weniger fett essen, weniger trinken, ging ihm ebenso auf die Nerven wie die Tatsache, dass mittlerweile mehr als die Hälfte seiner Fahrer einen morgenländischen Migrationshintergrund hatte. So weit, dass sich ein plötzlicher Anfall von Gotteskriegertum hundertprozentig ausschließen ließ, konnte die Sicherheitsüberprüfung doch gar nicht reichen. An den Wurzeln, genetisch und kulturell, änderte im Übrigen auch ein deutscher Pass nichts. Hermann Carius hatte keine Angst um sich persönlich, dafür hing er schon lange nicht mehr genug am Leben. Ihm ging es ums Prinzip und um die Außenwahrnehmung: Welchen Eindruck vermittelte es, wenn die gewählten Vertreter des deutschen Volkes von Türken oder Arabern mit Salafistenbärten chauffiert wurden? Was sollte der Mann auf der Straße denken, wenn er sah, wie Anzugislamisten den Abgeordneten die Wagentür öffneten? Kein Wunder, dass inzwischen viele von einem breitangelegten Bevölkerungsaustausch auf Kosten der echten Deutschen sprachen. Hermann Carius ließ sich jetzt regelmäßig auf Umwegen durch das alte Berlin fahren, sah aus dem Fenster, imaginierte Vergangenheiten, Könige, Generäle, Maler, Dichter und Denker in der Hoffnung, dass sich einer davon vor seinem inneren Auge materialisierte, den Geist des Deutschen Reichs auf eine Weise verkörperte, dass sich eine echte Vision seiner künftigen Gestalt einstellte. So oder so bedurfte es eines grundlegenden und vollständigen Neubeginns des Landes auf allen Ebenen: philosophisch, zivilisatorisch, ökonomisch, militärisch. Dieser Prozess stand erst am Anfang. Mehr als fünfzig Jahre unter der autoaggressiv-antinationalen Agenda von 68 bedeuteten eine gewaltige Last, die sich nicht von heute auf morgen abschütteln ließ. Hermann Carius war einer der wenigen Köpfe der Bewegung, dem als promoviertem Historiker sowohl die Geschichtskenntnisse als auch die intellektuellen Kapazitäten zur Verfügung standen, ein klar umrissenes Bild deutscher Identität auf der Basis einer reichen Vergangenheit für eine blühende Zukunft zu entwerfen. Ohne eine Nation, die sich ihrer selbst stolz bewusst war, wären alle Versuche, die europäisch-abendländische Kultur vor der Auslöschung durch orientalische Wirtschaftsmigranten, amerikanischen Vulgärkapitalismus, chinesische Totalüberwachung zu retten, zum Scheitern verurteilt. Mehr denn je brauchte es Leute wie ihn, egal, was sein Kardiologe Dr. Haubrich ihm riet, was seine Freundin sagte oder sein Sohn Martin, der ein guter Sohn war, allerdings in jeder Hinsicht auf der falschen Seite stand. Immerhin verhinderte das Zölibat, dass er offen als schwuler Aktivist auftrat.
Die letzten Wahlen waren für die Neue Rechte enttäuschend, um nicht zu sagen verheerend ausgegangen. Die verdammte Pandemie hatte die Kernthemen seiner Partei, illegale Einwanderung, Ausländerkriminalität, innere Sicherheit, in den Hintergrund gedrängt, obwohl die Zahl der jährlichen Wohnungseinbrüche noch immer bei über hundertfünfzigtausend lag, von denen ein Großteil auf das Konto südosteuropäischer Banden ging, obwohl regelmäßig Frauen und Mädchen von Flüchtlingen vergewaltigt und umgebracht wurden, afrikanische Drogenhändler, vietnamesische Zigarettenschmuggler an jeder U-Bahnstation herumlungerten. Alle Versuche, mit Kritik an den Corona-Maßnahmen Stimmen zu gewinnen, hatten den gegenteiligen Effekt gehabt – das legten zumindest die Wahlanalysen nahe. Ältere Leute, insbesondere aus dem ehemaligen Westen, die konservativ dachten, aber Angst um ihre Gesundheit hatten, waren durch die Rufe nach einem sofortigen Ende der staatlich verordneten Freiheitsberaubung, durch den Kampf gegen Maskenpflicht und Impfkampagnen eher verschreckt worden. Am Ende hatte sich seine Partei die Stimmen von Virusleugnern, Esoterikern, Verschwörungstheoretikern, deren Anteil ohnehin bei maximal zwanzig Prozent lag, mit den Liberalen und der BASIS teilen müssen.
»Herr – wie war Ihr Name noch gleich, ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen?« – »Brahimi, Rashid Brahimi.« – »Könnten Sie bitte hier anhalten und mich aussteigen lassen.« – »Natürlich.«
Der Fahrer lenkte den Wagen in eine Parkbucht rechts des Schinkel-Denkmals. Hermann Carius wartete mit dem Aussteigen, bis Rashid Brahimi um das Fahrzeug herumgegangen war und ihm die Tür öffnete. Er strich sich das Tweedsakko glatt, rückte die silberblaue Forellen-Krawatte zurecht, sein Markenzeichen seit fast zwanzig Jahren, handgenäht in der Krawattenmanufaktur Leicester, der letzten, die noch in Krefeld produzierte, im Besitz seines Schwagers, Hans-Gerd Kolb, dem er damit beträchtliche Umsatzsteigerungen beschert hatte. Der Schwager beklagte sich trotzdem bei jeder Gelegenheit, weil er fürchtete, in die falsche politische Ecke gerückt zu werden, am Ende mehr Kunden zu verlieren als zu gewinnen, sobald einer von den Pressefritzen auf die Idee kam, ihre familiäre Verbindung an die große Glocke zu hängen.
Hermann Carius überquerte den Platz, der noch immer zur Hälfte eine Baustelle war, trat an die bronzenen Geländer der Balustrade oberhalb des Spreekanals. Die meisten Grünflächen in der Gegend waren in den vergangen Jahren neu angelegt worden. Er atmete schwer, sah hinüber auf das andere Ufer, wo sich das frisch fertiggestellte Portal des unlängst eingeweihten Talmi-Palasts erhob. Auf den Relieftafeln rechts und links des Eingangs wurde der preußischen Könige Friedrichs I. und Friedrichs II. gedacht. Immerhin. Doch statt hier, im Zentrum Berlins, mit Hilfe einer architektonisch und kunsthandwerklich herausragenden historischen Rekonstruktion des von kommunistischen Kulturbanausen gesprengten Schlosses der Stadt ihr Herz zurückzugeben, den Menschen im Land fast achtzig Jahre nach dem Ende des unseligen Krieges eine Versöhnung mit der eigenen Geschichte zu ermöglichen, hatte man eine missratene Hybride aus Rokoko und Brutalismus dorthin gestellt, in der unter großem Trara die Artefakte der Primitiven des gesamten Erdkreises präsentiert wurden, mit dem Ziel, auch die weltgeschichtlich herausragenden Zeiten der deutschen Vergangenheit als Epochen der Unterdrückung, der Kriegstreiberei, des Kolonialismus und des Sklavenhandels zu verunglimpfen. Das sogenannte Humboldt-Forum – eine Schande, den Namen dieser bedeutenden Gelehrten dafür zu missbrauchen – bildete den Ausgangspunkt für die nächste Stufe des deutschen Aufarbeitungswahns. Von hier aus sollte eine kollektive Psychoanalyse sämtlicher Wahnvorstellungen und Gräueltaten des gesamten Westens ihren Ausgang nehmen. Dass die weitaus meisten und grausamsten Kolonialverbrechen auf das Konto von Holländern, Belgiern, Engländern, Franzosen, Spaniern und Portugiesen gingen, wurde dabei umstandslos unter den Teppich gekehrt, schließlich hatten die Deutschen sich nach dem Krieg erst bußfertig zum Weltbösewicht erklären lassen, um sich dann auf ewig der Wiedergutmachungsdiktatur zu unterwerfen. Jetzt, wo kaum noch Holocaust-Opfer übrig waren, kamen die Afrikaner an die Reihe, danach wahrscheinlich Papuas oder Polynesier. Wo auch immer irgendein deutscher Kapitän oder Soldat in den vergangenen dreihundert Jahren seinen Fuß an Land gesetzt hatte, fand sich mit Sicherheit etwas, das nach einer publikumswirksamen Bußübung verlangte. Dabei müsste, realistisch gesehen, ein Großteil der Menschheit ohne den zivilisatorischen, wissenschaftlichen und technologischen Transfer, der im Zuge des sogenannten Kolonialismus den Rest der Welt mit den Segnungen des in Europa entwickelten Fortschritts beschenkt hatte, noch immer auf Elektrizität, Industrieproduktion und moderne Medizin verzichten. Sie würden halbnackt mit Pfeil und Bogen durch den Busch jagen, ihre Hütten mit getrocknetem Kuhdung heizen, böswillige Schnitzfiguren mit ranziger Butter begießen und den Frauen die Genitalien verstümmeln.
Hermann Carius’ Blick blieb an der Gestalt eines älteren Mannes hängen, der schräg gegenüber seine Angel ausgeworfen hatte und dessen Blick den Bewegungen der leuchtend roten Pose im schwarzen Wasser folgte. Im selben Moment hörte er unter sich einen Klageruf. Etwas Weiches schob sich zwischen seine Knöchel: Eine schmale schokoladenbraune Katze presste sich in beinahe waagerechter Schräglage gegen seinen Unterschenkel. Offensichtlich war es kein Streuner, sondern ein äußerst gepflegtes Exemplar einer seltenen, vermutlich kostbaren Rasse. Sicher würden seine Besitzer es vermissen: Warum suchte niemand danach?
Hermann Carius hatte kein Verhältnis zu Katzen, auch nicht zu Hunden. Wenn er sich für ein Haustier hätte entscheiden müssen, wären es Schildkröten gewesen, Landschildkröten – Wesen, die sich durch Ruhe, Zurückhaltung, Beharrlichkeit auszeichneten, mehrere Menschenleben überdauerten und dementsprechend das Bleibende dem Wechsel der Moden vorzogen. Das Tier zu seinen Füßen sah aus seinen großen grünen Augen zu ihm auf, flehentlich, verzweifelt, zu allem entschlossen. Er konnte es weder seinem Schicksal überlassen noch mit nach Hause nehmen – es gehörte ja jemandem. Wobei Anke sich wahrscheinlich sogar darüber freuen würde. Sie klagte ohnehin ständig, dass sie zu viel allein sei, wollte, dass er mit ihr zusammenzog, obwohl er ihr schon ein Dutzend Mal erklärt hatte, dass diese Möglichkeit nicht bestand, solange er mit Irmgard verheiratet war, und er hatte nicht vor, an diesem Status quo in naher Zukunft etwas zu ändern.
Hermann Carius drehte sich um, ging zurück Richtung Wagen. Die Katze, bei der es sich um einen Kater handelte, lief jeweils ein Stück voraus, wartete, bis er nachgekommen war, erreichte vor ihm die geöffnete Hintertür des Mercedes, sprang an Rashid Brahimi vorbei auf die Rückbank, rollte sich schnurrend zusammen.
»Masha Allah. Das ist eine große Ehre«, sagte Rashid Brahimi – »Eure Art Ehre vergessen wir jetzt mal ganz schnell wieder.« – »Soll ich die Katze von Ihnen wegnehmen?« – Hermann Carius lockerte die Krawatte, ohne den obersten Hemdknopf zu öffnen: »Hier draußen kann er ja nicht bleiben.« – »Wussten Sie, dass der Prophet Mohammed Katzen liebte? Einmal war eine Katze mit ihren Jungen auf seinem Mantel eingeschlafen, und als der Prophet aufbrechen wollte, hat er ein Stück des Mantels abgeschnitten, um die Katzen nicht zu stören.«
Einem spontanen Impuls folgend, der vielleicht mit dem Eindruck zusammenhing, den Fabian Kolb bei ihr hinterlassen hatte, betrat Eva-Kristin Raspe die Galerie, sah Konrad, der zwischen den düsteren, geradezu ekelerregenden Lederkörpern stand und auf sein iPhone starrte. Sie hatte sich nicht angekündigt, war froh, ihn allein anzutreffen: keine Assistentin, die an ihm klebte, beim Anblick Eva-Kristins zur Seite sprang, Panik im Gesicht – wie ein Kind, das von der Mutter erwischt wurde, während es einen Geldschein aus ihrem Portemonnaie stahl.
Eva-Kristin war neun Jahre älter als Konrad, was man ihr, nach übereinstimmender Meinung aller Bekannten und Freunde, jedoch nicht ansah. Sie hatte nie Kinder geboren, ihre Figur war makellos. In vier Monaten wurde sie fünfzig, daran ließ sich nichts ändern. Vor zwei Jahren hatte sie zum letzten Mal ihre Tage gehabt. In den Genuss der damit verbundenen Vorteile war sie bislang kaum gekommen. Konrad schlief nur noch selten mit ihr, sie selbst hatte schon lange mit niemand anderem mehr geschlafen. Im Alltag verstanden sie sich gut, hatten Themen, über die sie reden konnten, ähnliche Vorstellungen, wie ihr Leben aussehen sollte. Trotzdem machte sie sich keine Illusionen. Konrad brauchte regelmäßig Bestätigung durch andere Frauen. Sobald er einen prallen Arsch sah, setzte sein Verstand aus. Und er hatte gerade, trotz Pandemie, das finanziell erfolgreichste Jahr seiner Karriere hinter sich. Das Umsatzvolumen der Galerie belief sich auf rund 30 Millionen Euro. Die Leute rissen sich darum, von ihm ausgestellt zu werden. Was auch immer er in seinen Räumen präsentierte, fand binnen vierundzwanzig Stunden einen Käufer – je teurer, desto schneller. Natürlich konnte er jeden Tag eine andere im Bett haben. Eva-Kristin wusste nicht, was Konrad veranstaltete, wenn er unterwegs war, wollte es auch nicht wissen: Art Basel, Miami Beach, The Armory Show, Hong Kong, Seoul, Atelierbesuche bei Künstlern rund um den Globus, dazu musste er an den anderen Galeriestandorten regelmäßig Präsenz zeigen. Auch wenn er sich auf seine Mitarbeiterinnen verlassen konnte: Die wichtigen Sammler wollten von ihm persönlich überzeugt werden. Teure Restaurants, exklusive Clubs, Alkohol, Speed, Koks, ›Kommst du noch mit ins Hotel?‹ So war es eben in der Kunstszene. – »Mir wäre sehr lieb, wenn du dich zumindest hier in dieser Stadt, in der wir beide leben, zusammenreißen könntest«, hatte sie ihm vor Jahren einmal gesagt. »Sonst organisier’ es wenigstens so, dass ich nichts davon mitbekomme.« Spätestens seit der BILD-Chef aufgrund unangemessenen Verhaltens gegenüber Mitarbeiterinnen hatte gehen müssen, was dem Konzern vor allem in den USA enorm geschadet hatte, machte sie sich ernsthaft Sorgen – jenseits ihrer eigenen Befindlichkeiten. Sexuelle Eskapaden, die öffentlich skandalisiert wurden, konnten selbst in der Kunstszene inzwischen dramatische Auswirkungen auf die Verkäufe haben. Amerikanische Sammler und Museumsleute verstanden da überhaupt keinen Spaß mehr. Neulich hatte ihre Freundin Susanne, die mit Fred Kunze, dem Leiter des Feuilletons der Hauptstadtzeitung zusammen war, angedeutet, dass sich hinter den Kulissen etwas zusammenbraute. Was genau, konnte oder wollte sie nicht sagen. – »Du weißt ja, ich mag Konrad, ich glaube auch, dass er dich wirklich liebt, aber die Kunstwelt ist am Ende doch ziemlich klein. Irgendwann stehen zwei Frauen zusammen, und eine erzählt was von Sex auf der Arbeitsplatte in der Küche ... Das kommt dann unter Umständen nicht gut. Sag ich mal so.« – Bei dem Wort »Arbeitsplatte« war Eva-Kristin kreidebleich geworden. – »Oh fuck!«, hatte Susanne gesagt: »Ist nicht dein Ernst!«
Eva-Kristin war sicher, auch in Fabian Kolbs Blick vor drei Tagen diesen halb forschenden, halb mitleidigen Ausdruck wahrgenommen zu haben, den sie über die Maßen hasste.
Jetzt sah Konrad von seinem Telefon auf, lächelte, kam ihr entgegen, küsste sie auf beide Wangen, als wäre sie eine der Frauen, von denen er hoffte, dass sie ihr Vermögen in einen von seinen Künstlern investierten. – »Gewaltig,