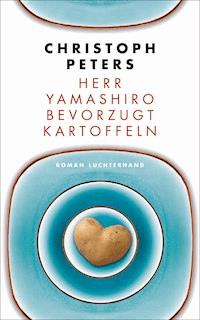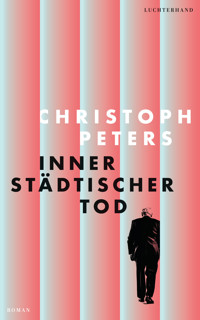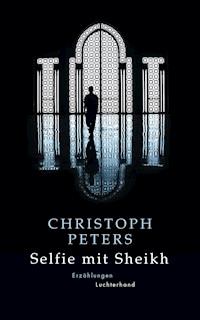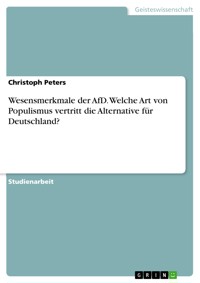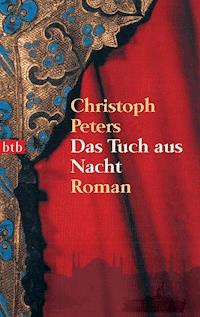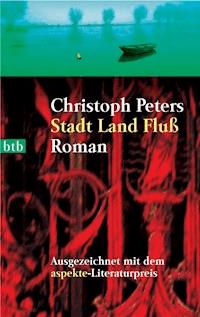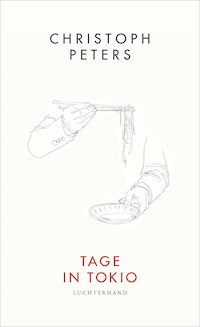
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit 35 Jahren beschäftigt sich Christoph Peters mit Japan. Er hat Romane über Japan geschrieben, sich in der traditionellen Teezeremonie ausgebildet, sammelt japanische Keramiken. Doch in Japan ist er nie gewesen. Die erste Reise nach Tokio muss also zum Abgleich werden zwischen Phantasie und Realität. Christoph Peters streift durch Metro und Seitenstraßen, Sushibars und Museen, besucht Tempelanlagen und einen Boxkampf. Und er ist ein eminent genauer Beobachter: Aus den Blicken der Menschen in der U-Bahn, aus den Regeln der Konversation, aus dem Nuancenreichtum in der Glasur einer Teeschale entsteht das Panorama einer ganzen Kultur. "Tage in Tokio" ist die Liebeserklärung an ein faszinierendes und widersprüchliches Land, das mit jedem Versuch, es zu verstehen, auch etwas über uns erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Seit 35 Jahren beschäftigt sich Christoph Peters mit Japan. Er hat Romane über Japan geschrieben, sich in der traditionellen Teezeremonie ausgebildet, sammelt japanische Keramiken. Doch in Japan ist er nie gewesen. Die erste Reise nach Tokio muss also zum Abgleich werden zwischen Fantasie und Realität. Christoph Peters streift durch Metro und Seitenstraßen, Sushi-Bars und Museen, besucht Tempelanlagen und einen Boxkampf. Und er ist ein eminent genauer Beobachter: Aus den Blicken der Menschen in der U-Bahn, aus den Regeln der Konversation, aus dem Nuancenreichtum in der Glasur einer Teeschale entsteht das Panorama einer ganzen Kultur. »Tage in Tokio« ist die Liebeserklärung an ein faszinierendes und widersprüchliches Land, das mit jedem Versuch, es zu verstehen, auch etwas über uns erzählt.
Zum Autor
Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Er ist Autor zahlreicher Romane und Erzählungsbände und wurde für seine Bücher mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2018) und dem Thomas-Valentin-Literaturpreis der Stadt Lippstadt (2021). Christoph Peters lebt heute in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm bei Luchterhand »Das Jahr der Katze« (2018) und der »Dorfroman« (2020).
Christoph Peters
TAGE IN TOKIO
Mit Zeichnungen von Matthias Beckmann
Luchterhand
I. Ankunft – Landschaft
Die Uhr über dem Ausgang zeigt zwanzig nach neun. Ich bin eine verkürzte Nacht lang geflogen, von Helsinki über Sibirien, dem Sonnenaufgang entgegen. Die weitläufigen Räume der Gepäckausgabe im Flughafen Narita werden renoviert oder umgebaut: nackte Betonböden, mit Plastikfolie abgehängte Wände, offene Decken, aus denen Kabel starren.
Nach zwanzig Minuten, während auf dem Band Koffer für Koffer an mir vorbeizieht, die übliche Sorge, mein Gepäck könnte verlorengegangen sein, unterlegt von der Gewissheit, dass dergleichen in Japan niemals passiert, dem Gegengedanken, dass ich in der Maschine einer finnischen Fluggesellschaft aus Finnland gekommen bin und die Finnen überdurchschnittlich viel trinken. Während ich überlege, ob es H&M in Tokio gibt, dass ich hier vielleicht doch besser zu Uniqlo gehe, um Ersatzunterwäsche zu kaufen, schiebt sich mein zerbeulter Alukoffer durch die grauen Gummilappen der Luke, unmittelbar gefolgt von dem ockerfarbenen, den ich vor einigen Jahren in Lahore gekauft habe.
Die Zöllner schauen an mir vorbei, interessieren sich nicht für das, was ich ins Land bringe.
In der Ankunftshalle erwartet mich Professor Kumekawa. Über seinen Schultern hängen zwei voluminöse, offensichtlich sehr schwere Aktentaschen. Ich verbeuge mich leicht. Es ist nur halb ernst gemeint. Der Neigungswinkel wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht angemessen sein. Ich weiß weder, in welchem Verhältnis ein Universitätsprofessor und ein Schriftsteller innerhalb der komplexen japanischen Hierarchien zueinander stehen, noch, ob die Positionierung möglicherweise dadurch modifiziert wird, dass er älter und der Gastgeber ist, ich sein Gast und geringfügig jünger. Vermutlich ist Kumekawa-san die Frage, wie tief ich mich verbeuge, völlig egal, aber mir missfällt, dass ich es falsch mache – Hunderte Male falsch machen werde in den kommenden Wochen.
Da wir uns bislang immer nur in Deutschland getroffen haben, geben wir uns die Hand.
Mein Blick irrt fahrig und verständnislos umher, zugleich spüre ich eine ungewohnte Nervosität. Mir ist nicht klar, wo sie herrührt. Ich bin dankbar, dass Kumekawa-san mich abholt, obwohl er ab Mittag Seminare halten, später an diversen Fakultätssitzungen teilnehmen muss.
Wir sprechen kurz über den zurückliegenden Flug: Alles ging glatt, der Platz in der Maschine, den er mir gebucht hatte, war angenehm.
Er sagt, dass es vielleicht besser wäre, hier schon Geld zu wechseln.
Ich kenne die Preise für Tee, Keramiken, Rollbilder, Bildbände auf japanischen Internetplattformen und Kunsthändlerseiten, habe jedoch nicht die geringste Ahnung, was eine Portion Sushi oder Tenpura in einem hiesigen Restaurant kostet, wie teuer ein Metrofahrschein oder die Eintrittskarte eines Museums ist, denke, dass ich bestimmt überall mit Kreditkarte zahlen kann, entscheide mich für vierhundert Euro.
Ich muss ein Formular ausfüllen, ehe der ältere Herr am Schalter mir einen akkurat zurechtgestoßenen Stapel druckfrischer Scheine auf einem kleinen roten Tablett herüberschiebt, die ich ohne nachzuzählen in mein Portemonnaie stopfe. Ob ich zu einem guten oder einem schlechten Kurs getauscht habe, kann ich nicht einschätzen.
Die Rolltreppe hinunter zum Tiefbahnhof unterscheidet sich nicht von denen, die ich aus Berlin, Paris oder Istanbul kenne – keine Hightech-Funktionen, die irgendeinen Ablauf optimieren oder die Benutzersicherheit erhöhen, keine Roboterstimme, die Anweisungen erteilt.
Auf dieser Ebene gibt es Zeitungsgeschäfte, Imbissstände, ein Café. Auch hier auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. In den Läden werden dieselben Bedürfnisse befriedigt wie an allen anderen Flughäfen. Ich würde gern eine Zigarette rauchen, doch auf die Schnelle findet sich nirgends ein Rauchplatz. So dringend, dass ich dafür den Zeitplan durcheinanderbringen muss, ist es nicht. Bunte Schilder, Anzeigetafeln, Bildschirme weisen auf Wichtiges und Unwichtiges hin, gelten jedoch nicht mir. Ich weiß, dass im Japanischen Schriftzeichen aus drei verschiedenen Systemen nebeneinander benutzt werden: Kanji, die im Wesentlichen mit den chinesischen Wortzeichen identisch sind; dazu kommen Katakana und Hiragana, die jeweils einzelnen Silben entsprechen. Ich kann sie weder auseinanderhalten noch lesen.
Vielleicht hat meine Verunsicherung auch damit zu tun, dass mein innerer Dechiffriermodus, dessen Aktivität ich normalerweise gar nicht wahrnehme, unter Hochdruck arbeitet, ohne dass meinem Bewusstsein relevante Informationen übermittelt werden.
An den Wänden reihen sich Automaten aneinander, dazwischen die Ticketschalter unterschiedlicher Bahnlinien. Vor keinem hat sich eine Schlange gebildet.
Während Kumekawa-san Fahrkarten für uns kauft, warte ich neben den Koffern, stelle fest, dass unter vielen der japanischen Schriftzüge die englische Übersetzung steht, dass die Zahlen arabische Zahlen sind, und fühle mich trotzdem nicht angesprochen.
Ich denke den Gedanken »Ich bin in Japan«, Wort für Wort. Es ist das erste Mal, obwohl es kein Land, keine Kultur gibt, mit der ich mich in den vergangenen fünfunddreißig Jahren intensiver beschäftigt habe.
Vor einigen Tagen hat meine Nachbarin Anna zu mir gesagt: »Du bist bestimmt sehr aufgeregt, dass du jetzt endlich dorthin fliegst.«
»Nicht besonders«, habe ich geantwortet. »Warum auch?«
»… weil es ja sein kann, dass es ganz anders ist, als du erwartet hast – vielleicht bist du enttäuscht.«
Alex, der als Kurator für japanische Kunst in einem großen Museum arbeitet und schon zu vielen, langen Aufenthalten hier war, sagte bei unserem letzten Treffen: »Ich bin sicher, nachdem du in Japan gewesen bist, willst du nie wieder darüber schreiben.«
Wibke, die für die Japan-Abteilung eines anderen Museums zuständig ist, meinte: »Als weißer Mann wirst du dort eine großartige Zeit haben.«
Mir ist verschiedentlich aufgefallen, dass bei einigen meiner Freunde und Bekannten, die mit Japan befasst sind, eine latente Gereiztheit mitschwingt, sobald die Rede auf das Land kommt, doch die Antworten, wenn ich nach Gründen frage, bleiben jedes Mal vage wie bei einem dunklen Familiengeheimnis.
Kumekawa-san kehrt mit den Fahrkarten zurück. Wir schieben sie in die Schlitze der Kontrollschleuse, die lediglich durch Lichtschranken gesichert ist, nehmen eine weitere Rolltreppe hinunter zu den Gleisen.
Laut Anzeigetafel fährt der Zug in zwölf Minuten.
Auf dem Bahnsteig warten nur wenige Leute. Mich beschleicht ein sonderbares Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Es dauert einen Moment, bis ich den Auslöser der Irritation begreife: Aufgrund von Fernsehberichten, Fotostrecken und Journalistentexten hat sich bei mir im Lauf der Jahrzehnte die Vorstellung verfestigt, dass japanische Nahverkehrszüge notwendigerweise überfüllt sind, von gleichgeschalteten Massen, die sich in die Waggons drängen, notfalls von Bahnhofsaufsehern hineingestopft werden wie Vieh. Dazu die diffuse Idee, dass Japaner durch soziale, vielleicht sogar genetische Besonderheiten in der Lage sind, die unablässige Verletzung des menschlichen Grundbedürfnisses nach Minimaldistanz zu den Artgenossen ergeben hinzunehmen. Auch sonst herrscht eine für Bahnhöfe oder U-Bahn-Stationen ungewohnte Ruhe. Die wenigen, die hier warten, reden nicht miteinander – und wenn, dann nur leise – , niemand spricht in sein Telefon, als wollte er sämtliche Mitreisenden über seine persönliche Lage in Kenntnis setzen.
Ich sage, weil es in der Welt, aus der ich gerade gekommen bin, in dieser Situation peinlich wäre, einfach zu schweigen, wie großartig es ist, endlich hier zu sein, dass ich auf so viele Dinge neugierig bin, keineswegs nur auf Museen, Kunstschätze, Tempel und Gärten, genauso auf das Japan der Gegenwart, Wolkenkratzer, Einkaufszentren, die Metro, auf die berühmten Combini, über die ich erst neulich einen interessanten Roman – Die Ladenhüterin – gelesen habe, auf das Essen und natürlich auch auf die Arbeit mit den Studenten.
Meine Stimme klingt unangemessen laut, das, was ich sage, erscheint mir selbst konfus. Es kann an der Müdigkeit liegen, obwohl ich mich gar nicht müde fühle, trotz der Nacht im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt geschlafen habe, erinnere mich an einen ausgedehnten Zwischenzustand mit geschlossenen Augen, dazwischen ein halb finnisches, halb japanisches Bordmenü, Rindergulasch und kalte Udon-Nudeln; später stumme Schnipsel eurasischer Fantasy-Action auf dem Bildschirm des Sitznachbarn.
»Der Boxkampf wird bestimmt auch interessant«, sagt Kumekawa-san.
»Darauf freue ich mich natürlich besonders. Es ist mein erster Kampf, live am Ring.«
Neben seiner Beschäftigung mit deutscher Gegenwartsliteratur ist Kumekawa-san ein bekannter Experte für Boxsport, außerdem Spezialist für Godzilla-Filme, Jazzenthusiast und Vorsitzender der japanischen Goethe-Gesellschaft. Vor gut einem Jahr, an unserem ersten gemeinsamen Abend in Berlin, haben wir länger über Ali, Foreman, Frazier und die aktuell besten Schwergewichtler Deontay Wilder, Tyson Fury, Luis Ortiz und Anthony Joshua gesprochen als über Kunst oder Literatur. Es ist ihm gelungen, Karten für den – aus japanischer Sicht – bislang wichtigsten Kampf des Jahrhunderts zu besorgen, der zugleich das Finale der World Boxing Super Series ist: Naoya Inoue gegen Nonito Donaire.
Der Zug fährt ein. Von außen ähnelt er einem ICE oder TGV. Innen herrschen gedeckte Farben, mattes Silber, fahles Grün, Brauntöne. Der Sitz ist bequem, aber nicht so, dass man nie wieder aufstehen möchte – ein gewöhnlicher Sitz in einem modernen Hochgeschwindigkeitszug.
Nachdem er sich in Bewegung gesetzt hat, folgt eine längere Ansage, erst Japanisch, dann Englisch. Ich frage mich, welchen Sinn der Satz »All seats are reserved« angesichts der Tatsache hat, dass mehr als die Hälfte der Plätze unbesetzt sind. Zum Schluss Chinesisch. Offenbar kommen so viele Touristen aus China, dass es den Behörden angeraten erscheint, sie direkt anzusprechen, damit sie keine schwerwiegenden Fehler machen und nicht verlorengehen. Ich muss die jüngsten politischen Entwicklungen in Ostasien verpasst oder falsch gedeutet haben, denn bislang war ich wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern angespannt sind, wegen konkurrierender Besitzansprüche auf diverse Inseln im Chinesischen Meer, der Unterstützung Chinas für Nordkorea, nicht zuletzt infolge der schwach ausgeprägten Bereitschaft der Japaner, sich kritisch mit der eigenen Rolle als Kolonialmacht und Kriegspartei auf dem chinesischen Festland während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auseinanderzusetzen.
An den Wänden des Tunnels blitzen in schnellem Rhythmus Neonleuchten auf, unterbrochen von kurzen Ausblicken auf dicht bewachsene Hügel, schmale Waldschluchten, von Efeu überwuchertes Buschwerk. Ein großer Parkplatz für Pendler zieht vorbei. Vielleicht sind es auch Stellflächen für frisch vom Band gelaufene Wagen eines Automobilwerks, wie ich sie von Bahnfahrten rund um Wolfsburg oder Rüsselsheim kenne.
Weitere Tunnel folgen, wechseln sich mit Bergkuppen, Sicherungszäunen, Schallschutzwänden ab, immer längere Ausblicke auf Steilhänge unmittelbar neben der Strecke. Nach einer Weile öffnet sich die Landschaft. Der Horizont ist weit, aber nicht unbegrenzt. Die Sonne steht vor wolkenlosem, durch die leichte Tönung des Fensters tiefblauem Himmel. Ein klarer Sommertag im Herbst, kraftvolle Farben, scharfe Schatten, nicht anders als bei vergleichbarer Wetterlage in Deutschland – warum auch? Es ist dieselbe Sonne, die knapp 9 000 Kilometer westlich von hier auf Berlin oder das Rheinland scheint – acht Stunden später und ganzjährig aus einem anderen Winkel: Tokio liegt auf demselben Breitengrad wie Nikosia auf Zypern oder Tanger in Marokko.
Zwischen bewaldeten Erhebungen erstrecken sich rechteckige Ackerflächen. Ich nehme an, dass es sich um Reisfelder handelt. Sie sind zu allen Seiten von niedrigen Wällen eingefasst, weil sie während einer bestimmten Wachstumsperiode vollständig unter Wasser stehen müssen. Hinter fernen Wipfeln tauchen hier und da die oberen Stockwerke vereinzelter Hochhäuser auf. Eine voluminöse Betonbrücke schlägt eine Schneise in den Wald. Es ist derselbe Typ, den man auch in Deutschland Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gebaut hat. Einzelne Baumgruppen, Haine, satte Grüntöne in unzähligen Abstufungen, dazwischen kleinere Ansiedlungen, vermutlich Bauernhöfe und Handwerksbetriebe, die im weitesten Sinne für die Landwirtschaft tätig sind. Inmitten halbwilder Vegetation Fernwärmerohre, mächtige Strommasten, Überlandleitungen. Einen kurzen Moment lang meine ich, die Spitze einer modernistischen Pagode zu erkennen. Vielleicht ist es auch ein Wasserturm. Dann kleinere Industrieansiedlungen: Wellblechhallen, Containergebirge, ein Parkhaus.
»Die Landschaft ist interessant«, sage ich zu Kumekawa-san, meine aber eigentlich, dass ich mich darüber wundere, wie wenig sie sich von bestimmten Gegenden in Hessen oder dem Weserbergland unterscheidet, nur dass dort Mais, Weizen oder Hafer statt Reis angebaut werden.
Während ich aus dem Fenster schaue, so viel wie möglich aufzunehmen versuche, merke ich, dass meine Augen unablässig auf der Suche nach etwas Bestimmten sind, von dem ich nicht weiß, was es ist, das ich aber sofort erkennen würde, wenn es dort draußen in Sicht käme. Etwas nie Gesehenes, das mir zugleich vollkommen vertraut wäre – der unwiderrufliche Beweis, dass ich tatsächlich in Japan bin. Dazu die unausgesprochene Erwartung, dass daraufhin eine innere Wandlung einsetzen wird, wie man sie sonst erlebt, wenn man den geweihten Bereich einer alten Pilgerstätte betritt. Selbst die Pflanzen müssten eine andere Beschaffenheit, einen anderen Ausdruck haben.
»Du hast großes Glück, die Wettervorhersage ist sehr gut«, sagt Kumekawa-san. »Vorletzte Woche hatten wir noch den schwersten Taifun seit sechzig Jahren. Es gab viele Überschwemmungen überall.«
Ich habe im Radio davon gehört.
Man muss sich nicht mit den Lehren des Zen-Buddhismus beschäftigt haben, um zu wissen, dass Erwartungen grundfalsch sind, insbesondere wenn sie die Wahrnehmung auf den verschwommenen Ebenen unterhalb von Reflexion und kritischem Verstand einfärben. Ganz gleich, ob sie sich als zutreffend oder abwegig erweisen, zerstören sie die Offenheit für das einmalige Erlebnis jedes Augenblicks – in vertrauter Umgebung ebenso wie in der äußersten Fremde. Die einschlägigen Zeitschriften, Ratgeber zu Psychologie, Lebensführung, Glück, veröffentlichen in regelmäßigen Abständen Artikel über die fatalen Folgen von Erwartungen für Liebe, Familie, Beruf und Freizeit. Nur das unvoreingenommene Bewusstsein in seiner fortwährenden Gegenwärtigkeit ermöglicht wirklich authentische Erfahrung, die einen beschenkt, bereichert und dankbar zurücklässt, während Erwartungen alles, was einem begegnet, vergiften.
Kumekawa-san sagt: »Bald beginnt auch die Verfärbung des Herbstlaubs, wahrscheinlich, wenn wir in Kyoto sind. Der November ist eigentlich die beste Zeit, um Japan zu besuchen.«
Natürlich kenne ich unzählige Fotos der zinnoberroten Ahornbäume, leuchtend gelben Ginkgos von Postkarten und Kalendern, doch in meiner inneren Vorstellung japanischer Landschaften kommen sie kaum vor, im Grunde sind sie mir viel zu bunt – wie mich auch die Kirschblüte nie interessiert hat.
Ich weiß nicht mehr genau, woher meine ersten Bilder japanischer Landschaften stammen, wahrscheinlich aus den Kunstbänden der Schulbibliothek: Nebel über den Bergspitzen von Sesson, Tōhakus Kiefern, die wie Geister aus dem Dunst auftauchen, Sesshūs schroff aus dem Meer ragende Felsen, eine Hütte am Hang, Tuschespuren, die zu Bäumen gerinnen, ein verlorener Nachen – all das hingeworfen in einer einzigen Bewegung, so selbstvergessen, als hätte der Wind die Hand des Malers geführt. Später Filmbilder, noch immer schwarzweiß, das tausendfach gebrochene Licht in Kurosawas Wäldern, Regen, der auf die Blätter prasselt und niemals enden will, aber dann von einem Moment auf den anderen doch vorbei ist, so plötzlich, wie er begonnen hat. Während der letzten Jahre schließlich Tausende Stunden virtueller Fahrten am Steuer von Google Streetview, um Romanschauplätze zu finden, die Atmosphären des gegenwärtigen Japan aufzusaugen, Stadtschluchten, verschlafene Vororte, Golfplätze, Shinto-Schreine, stille Bergtäler im Umland. Merkwürdigerweise sind mir selbst die Computerbilder immer weitaus japanischer erschienen als das, was gerade in hohem Tempo an mir vorbeirauscht.
Rechts jetzt leuchtend gelbe Rapsfelder und Birkenwald wie in Brandenburg. Allerdings fehlen die großen Weidetiere. Es scheinen weder Rinder, noch Pferde, noch Schafe gehalten zu werden. Ich staune, wie dünn die Gegend besiedelt ist, hier, zwischen Tokio und seinem zweitwichtigsten Flughafen, mitten im größten und bevölkerungsreichsten Ballungsraum der Welt.
Da, wo sich Firmen angesiedelt haben, sind teilweise japanische Schriftzüge auf den Dächern, an Hallenwänden, viele haben sich allerdings für lateinische Buchstabenlogos und Kürzel entschieden – vermutlich Fabriken, Handelskompanien, die international operieren. Auch auf dem Weg zum Flughafen Tegel leuchten an den Gebäuden chinesischer, vietnamesischer, arabischer oder indischer Import-Export-Unternehmen fremde Zeichen. Schrift beweist schon lange nichts mehr.
Doch dann, auf der linken Seite, plötzlich eine ausgedehnte Wasserfläche zwischen sanft ansteigenden Hängen, wie ich sie von Tuschebildern oder Holzschnitten kenne: Hokusais 36 Ansichten des Berges Fuji oder Hiroshiges Hundert berühmte Ansichten von Edo. Es sind die gleichen scharf geschwungenen Linien, wie sie sich in den abstrahierten Flächen der Drucke finden, wenn Wasserläufe oder Seen dargestellt werden. Die angrenzenden Felder setzen ihre entschlossenen Geometrien in Parallelperspektive dagegen, vor dem Horizont zweidimensionale Wälder. Was mir vor allem ins Auge springt, sind die sonderbaren Käfig- oder Netzkonstruktionen im Wasser: jeweils vier Pfähle, die rechtwinklig, mit vielleicht anderthalb Metern Abstand zueinander, fünfzig oder siebzig Zentimeter über die Oberfläche ragen. Die meisten befinden sich in Ufernähe, einige jedoch sind lose bis in die Mitte des Gewässers verstreut. Von den Pfählen führen Taue in die Tiefe. Manchmal sieht man die Spitze eines gespannten Netzes, das daran befestigt ist, hier und da hängt eins vollständig in der Luft. Sie ordnen die Wasserfläche wie knappe Trommelschläge in einem präzise unregelmäßigen Rhythmus. Trotzdem steht jedes der Gebilde für sich allein und strahlt diesen Abgrund an Einsamkeit aus, der den Anblick alter japanischer Landschaftsbilder ebenso schmerzhaft wie tröstlich macht.
»Was sind das für Netze?«, frage ich.
Obwohl sie mir auf Abbildungen schon oft aufgefallen sind, habe ich nie darüber nachgedacht, um was es sich handelt. Sie waren einfach da, so zweifellos richtig, dass es keine Rolle spielte, ob sie jenseits des Kompositorischen eine Funktion hatten, und falls ja, welche?
Kumekawa-san sagt: »Das ist eine alte Technik, um kleine Fische zu fangen. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Die Fische sind vielleicht so lang wie ein Finger. In die Netze werden Büschel von Zweigen gehängt, wahrscheinlich Weidenzweige. Dann kommen die Fische und verstecken sich dazwischen. Wenn der Fischer später mit seinem Boot zu den Netzen fährt und sie herauszieht, bleiben die Fische zwischen den Büscheln. Man muss sie nur einsammeln. Sie werden in heißem Öl frittiert. Das ist eine Spezialität in dieser Gegend.«
Für einen kurzen Moment falle ich aus der Zeit, in einen anderen Raum am selben Ort. Ich bin nicht einmal sicher, ob er in der Vergangenheit liegt – einer Vergangenheit, die ich weder besucht habe, geschweige denn, dass ich in ihr gelebt hätte. Dennoch erscheint sie vertrauter als der schnurgerade Kanal, der sich für eine Weile parallel zu den Gleisen hinzieht, von Autobahntrassen abgelöst wird (offenbar sind die Autobahnschilder auch in Japan blau), Schallschutzwänden aus Beton, die sich nicht von denen in Deutschland unterscheiden, den Mittelgebirgsausläufern, die jetzt wieder nah an die Strecke heranrücken und ebenso gut in Thüringen auf dem Weg nach München liegen könnten. Durch die Netze im See haben sie einen anderen Ausdruck angenommen. Vermutlich handelt es sich um eine Wahrnehmungsverschiebung mittels Simultankontrast, den es offenbar nicht nur in der Interaktion aneinandergrenzender Farben gibt. Oder es ist etwas ganz anderes: Ebenen kollektiven Unterbewusstseins, die, lange bevor es moderne Kommunikationstechniken gab, Bilder und Wissen rund um die Welt verbreitet und eingelagert haben. Oder Schemen von Eindrücken aus vormaligen Inkarnationen, die ohne Form in eingekapselten Seelenschichten auf welche Weise auch immer überdauert haben und plötzlich eine Reaktion hervorrufen, so wie beim Ausräumen des Elternhauses angesichts eines bestimmten Silbertabletts oder der verrosteten Drehleier im Werkzeugkasten des Vaters plötzlich eine vergessene Empfindung aus den schwarz verhangenen Kammern der Kindheit freigesetzt wird.
Ich denke nicht, dass ich an so etwas glaube, aber eine andere Erklärung habe ich einstweilen nicht.1
Über dem Rand der grauen Mauer gleiten die oberen Stockwerke eines mittelgroßen Wohnhochhauses im Stil der 1960er vorbei. Worin unterscheidet es sich von dem hässlichen Klotz gegenüber der Autobahnbrücke in Mainz, in dem ich vor dreißig Jahren eine Zeitlang mein Leben verbracht habe? Sind die Proportionen vielleicht doch ein wenig anders, tragen zumindest das Echo japanischer Formensprache in sich? Einige der freistehenden Häuser verweisen jedenfalls auf Vorbilder, die nicht dem Kanon der globalisierten Moderne entstammen. Man müsste sie ausmessen: Höhe zu Breite zu Tiefe, das Verhältnis der Dächer zum übrigen Gebäude. An welcher Stelle innerhalb der Wände und in welchem Abstand zueinander befinden sich Türen und Fenster. Vielleicht erhielte man nach diversen Rechenoperationen einen Quotienten, der sich deutlich von dem unterschiede, den westliche Architekturen ergäben. Damals in Mainz, als ich noch geometrische Kunst gemacht habe, war ich über viele Jahre täglich mit solchen Dingen beschäftigt, um etwas über die spezifische Ausdrucksqualität unterschiedlicher Maßverhältnisse zu erfahren – die Zahlwerte der Schönheit zu finden.
Wieder verstellen bepflanzte Lärmschutzwälle den Blick, anschließend nackter Beton, darin die fließend gebrochenen Reliefs der Schalbretter. Wir fahren durch eine Talschlucht aus Grau. Am Rand meines Gesichtsfelds sausen Giebel, Balkone, Strommasten, Laternenspitzen vorbei. Es scheint, als würde die Bebauung dahinter allmählich dichter. Als die Mauern abrücken, sind wir tatsächlich in der Stadt – in den Gebieten, die man »Vorstadt«, »Trabantenstadt«, »Satellitenstadt« nennt. Vielleicht sind das auch die falschen Begriffe für ein urbanes Megagebilde wie Tokio, und es ist sinnlos, in einem zusammenhängenden Siedlungsgebiet von 35 000 Quadratkilometern nach dem einen Zentrum zu suchen, auf das alles andere ausgerichtet wäre wie Eisenspäne auf einen Magneten. Wohnblocks, Mietkasernen, Wellblechhallen wechseln sich mit Vierteln aus niedrigen, teilweise einzeln stehenden Häusern ab. Das unendlich verzweigte, verwirrend chaotische Netz der oberirdischen Stromversorgung ist mir schon auf meinen Bildschirmreisen aufgefallen. Irgendjemand hat mir erklärt, dass man die Kabel hier deshalb nicht unter der Erde verlegt, weil sie dort unten die Stöße der ständigen Erdbeben nicht ausschwingen könnten und deshalb viel eher zerreißen würden.
Ich will eine Bemerkung machen, über Japan, Tokio, das, was ich sehe, doch alle Sätze, die ich durchspiele, sind falsch. Ihre Grundlage wären nicht die Dinge, die dort draußen vor dem Fenster vorbeiziehen, sondern Bildstrecken auf meinem Computer, aus Spielfilmen, Dokumentarfilmen, Büchern. Was immer ich sagen würde, bliebe das Geschwätz eines Hochstaplers, der sich akribisch auf seine neue Rolle als Chefarzt vorbereitet hat und jetzt zum ersten Mal einem echten Patienten gegenübersitzt. Gerade weil ich all diese Ansichten, Panoramen und Details wiedererkenne, habe ich den Eindruck, dass die Wirklichkeit vor meinen Augen eine Imitation virtueller Erfahrungen ist und nicht umgekehrt – wie es in allen Zeiten vor unserer der Fall gewesen wäre.
Wir rasen durch verschlafene Bahnhöfe, wo kaum jemand auf einen Zug wartet, fahren über Brücken, unter Brücken, zwischen Brücken, bewegen uns durch einen Strom aus Linien, die sich unablässig verschieben, nähern, entfernen, über uns hinwegziehen, unter uns verschwinden, Betonkonstruktionen, Stahlkonstruktionen, Seilkonstruktionen. Dann wieder Ausblicke auf die unendlich vielgestaltige Landschaft der Stadt. Sonnenbeschienene Hochhäuser leuchten wie ausgeschnitten vor der makellos blauen Fläche des Himmels.
Damals, im 19. Jahrhundert, als die Holzschnittmeister ihre Ansichten von Edo gezeichnet haben, gab es weder Stahlbeton noch Wolkenkratzer. Die Bebauung ging, abgesehen von Pagoden, Shinto-Schreinen, Tempeln, selten über die Höhe von zwei, drei Stockwerken hinaus. Trotzdem stellt sich angesichts der ineinandergeschachtelten Gebäude eine ähnliche Abstraktion ein wie auf den alten Drucken, als würden die Konturen von ihrer Körperlichkeit abgelöst und in ein Gefüge klar umgrenzter Flächen verwandelt. Ich frage mich, ob es daran liegt, dass sich meine inneren Japan-Bilder durch die jahrzehntelange Betrachtung von Kunst zu unverrückbaren Wahrnehmungsschemata verfestigt haben, die sich jetzt wie eine Folie über die Außenwelt legen? Oder ob es doch eine Eigentümlichkeit des hiesigen Lichts ist, das die Szenerien auf eine besondere Weise beleuchtet, so dass ihre Auflösung in Flächenkompositionen jenseits des illusionistischen Raums als die einzige Möglichkeit erscheint, sie angemessen ins Bild zu setzen?
Kumekawa-san sagt: »Ich hoffe, dass das Ryokan in Ordnung ist, das ich für dich ausgesucht habe. Ich kenne es selbst noch nicht, aber es liegt in einem sehr interessanten Viertel, Ningyōchō. Man könnte es die Altstadt von Tokio nennen. Dort ist es auch gut, um spazieren zu gehen.«
»Ich bin nicht so …« – »anspruchsvoll« will ich sagen, breche aber ab, weil mir der Gedanke durch den Kopf schießt, Kumekawa-san könnte es missverstehen und meinen, ich dächte, dass er mich vielleicht in einer Absteige untergebracht hätte, sage stattdessen: »Es wird bestimmt sehr schön sein.«
Womöglich stelle ich mir Japaner trotz allem immer noch komplizierter vor, als sie in Wirklichkeit sind.
»Die meisten wollen lieber in Hotels mit Businesskomfort wohnen«, sagt er.
»So was habe ich in Deutschland auch und finde es ziemlich langweilig.«
Wir überqueren einen Fluss, der so breit ist wie der Rhein zwischen Köln und Düsseldorf und auf ähnliche Art von weitläufigem Vorflutgelände, hohen Deichen eingefasst wird. Er leuchtet silberblau zwischen ausgedehnten Wiesen und breiten Sandbänken, aus denen die Regenmassen des Taifuns Terrassenprofile mit scharfen, unregelmäßigen Abbrüchen herausgeschnitten haben. Es sind weder Leute beim Picknick noch Hundehalter zu sehen. Einen Augenblick lang weiß ich nicht, woher die Millionen Glitzerpunkte zu beiden Seiten der Brücke stammen, bis ich begreife, dass es sich um riesige Halden angeschwemmter Plastikflaschen handelt – ein Anblick, mit dem ich hier tatsächlich auf keinen Fall gerechnet hätte. Wahrscheinlich sind die Reinigungskräfte noch nicht dazu gekommen, die Außenbezirke aufzuräumen. Das Unwetter liegt erst wenige Tage zurück, in den deutschen Nachrichten war von zahllosen Überschwemmungen im ganzen Land die Rede.
Bis jetzt habe ich nirgends die grellen Werbetafeln, vielfarbig blinkenden Neonlichtbilder, Megabildschirme entdeckt, auf denen schnell geschnittene Spots für Kosmetikprodukte, Fastfood, die neuesten Modelle der Autoindustrie flackern.
Wir fahren über einen weiteren Flusslauf. Auf Gruppen moderner Wohnblocks mit zwanzig oder dreißig Stockwerken folgen immer wieder Bezirke, die wie endlose Kleinstädte wirken: Ziegeldächer in mittleren Rottönen, verschiedenen Abstufungen Grau, gelegentlich sind auch blaue und grüne Glasuren dazwischen. Ihre Neigungswinkel sind tatsächlich flacher als in Deutschland.