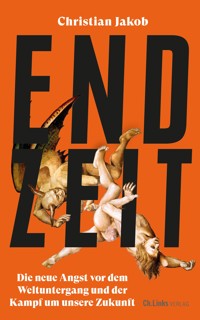9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Politik & Zeitgeschichte
- Sprache: Deutsch
Europa zieht seine Grenzen durch Afrika. Migrationskontrolle ist in der EU zu einer Frage von höchster innenpolitischer Bedeutung geworden. Mit Hochdruck baut sie daher ihre Beziehungen zu den Regierungen auf dem afrikanischen Kontinent aus. Diese sollen ihre Bürger daran hindern, nach Europa zu gelangen. Die EU bietet dafür Militär- und Wirtschaftshilfe in Milliardenhöhe. Sie arbeitet mit Regimen zusammen, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen, und bildet deren Polizei und Armeen aus. Die Bewegungsfreiheit in Afrika wird eingeschränkt, Entwicklungshilfe wird umgewidmet und an Bedingungen geknüpft: Wer Migranten aufhält, bekommt dafür Geld. Am meisten profitieren IT-Unternehmen sowie Rüstungs- und Sicherheitskonzerne in Europa. Seit Jahren recherchieren Simone Schlindwein und Christian Jakob zu diesem Thema. Ihr Buch ist die erste umfassende Darstellung der neuen europäischen Afrikapolitik. »Von geschützten Grenzen und der Öffnung der Märkte träumt die EU. Von geschützten Märkten und offenen Grenzen träumt Afrika. Solange dieses Interessensdilemma nicht gelöst ist, wird es keine echte Partnerschaft geben.« Christian Jakob, Simone Schlindwein
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christian Jakob, Simone Schlindwein
Diktatorenals TürsteherEuropas
Wie die EU ihre Grenzennach Afrika verlagert
»Wir leben in einer globalisierten Welt, alles ist vernetzt:Computer, Geld, Handel, Waren. Nur wir Afrikaner,wir dürfen bei dieser Globalisierung nicht mitmachen.Im Prinzip haben Fische mehr Rechte als wir,denn sie schwimmen frei umher.«
Samir Abi, West African Observatory on Migration,Lomé, Togo, Juli 2017
Die Herstellung dieses Titels wurde gefördertvon der stiftung: do (Hamburg) und medico international (Frankfurt)
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überwww.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, Oktober 2017
entspricht der 1. Druckauflage vom Oktober 2017
© Christoph Links Verlag GmbHSchönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0www.christoph-links-verlag.de; [email protected]: Nadja Caspar, Ch. Links Verlag, unterVerwendung eines Motivs von picture alliance / Westend61Karte: Peter Palm, Berlin
eSBN 978-3-86284-406-7
INHALT
VORWORT: DIE WIEDERENTDECKUNG AFRIKAS
TEIL I: DIE SCHLIESSUNG DER GRENZEN
Unsere Partner: Mutmaßliche Kriegsverbrecher
Rückblick: Eine kleine Geschichte unserer Türsteher
Diplomatie: Monsieur Vimonts letzter Auftrag – die Einigung mit Afrika
TEIL II: DIE VORBILDER
Das Abkommen mit der Türkei: Der Sechs-Milliarden-Euro-Deal
Israels Geschäfte: Die Ware Mensch
Das Abschiebe-Domino: Zurück auf Los!
TEIL III: EIN KONTINENT IN BEWEGUNG
Die Schlepper: Ein staatlich-mafiöser Komplex
Migration: »Karibu Sana« – Willkommenskultur auf Kisuaheli
TEIL IV: EUROPAS NEUE GRENZEN IN AFRIKA
Freizügigkeit: Schengen für uns, Zäune im Sahel
Abschiebungen: Dann ist er eben Nigerianer
Entwicklungshilfe: »Wir schlagen eine Mischung aus positiven und negativen Anreizen vor«
Europas Wärter: Warum Frontex keine Grenzen kennt
Technologie: Neue Grenzanlagen – ein Subventionsprogramm für Europas Waffenschmieden
Das Mittelmeer: Sterben, wo andere Urlaub machen
TEIL V: DIE ÖFFNUNG DER MÄRKTE
Wirtschaftsförderung im Dienste der Migrationskontrolle: Der »Merkel-Plan« mit Afrika
Freihandel: Euro-afrikanischer Milchkaffee
FAZIT: EUROPAS TRÄUME, AFRIKAS TRÄUME
ANHANG
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Namens- und Abkürzungsverzeichnis
Geografisches Register
Karte
Dank
Über Autor und Autorin
VORWORTDIE WIEDERENTDECKUNG AFRIKAS
Der Nachbarkontinent Afrika hat die Europäer lange kaum interessiert. Er stand vor allem für Kriege, Klimawandel, Seuchen wie die tödliche Ebola-Epidemie in Westafrika 2014 oder Katastrophen wie die Hungersnot in Ostafrika 2017. Doch jetzt steht der Kontinent wieder im Fokus der Aufmerksamkeit. Von einer neuen Epoche der Partnerschaft ist zu hören.
Sie nahm ihren Anfang, als die Lage auf der Balkan-Route im Sommer 2015 eskalierte: Hunderttausende Flüchtlinge, unkontrolliert auf dem Weg nach Zentraleuropa. Kurz darauf lud die Europäische Union (EU) 33 Staatschefs aus Afrika zu einem Treffen nach Malta ein. Milliardenschwere neue Programme der Entwicklungshilfe und wirtschaftlichen Zusammenarbeit wurden aufgesetzt. »Eine Situation wie im Sommer 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen«,1 sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Panik in Europa, die die unkontrollierte Flüchtlingsbewegung über die Balkan-Route ausgelöst hatte – sie wurde auf Afrika projiziert. Und eben dort will Europa sein Migrationsproblem jetzt lösen – mit weitreichenden Eingriffen in die Länder südlich des Mittelmeers.
Afrika war schon zu Kolonialzeiten ein Ort, den die Europäer nach ihren Vorstellungen formen wollten. Fünf Meter hoch war die Karte des afrikanischen Kontinents, die im November 1884 im Tagungsraum im Berliner Reichskanzlerpalais an der Wand hing. Vertreter von 13 europäischen Staaten sowie der Vereinigten Staaten (USA) und des Osmanischen Reiches waren der Einladung des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck nach Berlin zur sogenannten Kongokonferenz gefolgt. Es ging darum, die Handelsfreiheit im Einzugsgebiet der Flüsse Kongo und Niger zu regeln.
Als die Konferenz am 26. Februar 1885 zu Ende ging, hatten die Teilnehmer die Grundlagen geschaffen, den Kontinent untereinander aufzuteilen. Zahlreiche afrikanische Grenzen, die heute im Fokus der EU-Migrationskontrolle stehen, wurden damals von den Kolonialherren am Reißbrett gezogen. Jene, die dort lebten, wurden nicht gefragt.
Seitdem hat sich vieles verändert. Geblieben sind die kolonialen Grenzen und die alte, aus der Kolonialzeit stammende Angst vor dem »Schwarzen Mann«. Einst waren es die tödlichen Tropenkrankheiten aus Afrika, die die Europäer fürchteten. Heute ist es die Furcht vor der »Invasion«, der »Umvolkung«, die die Rechtsextremisten befeuern.
Sie geht einher mit der zunehmenden Furcht vor dem Terror, ausgelöst durch die Anschläge in Paris im November 2015, in Brüssel im März 2016 und auf dem Berliner Weihnachtsmarkt Ende 2016. Die Täter bekannten sich zum Islamischen Staat (IS), der heute auch in Libyen und der Sahelzone aktiv ist. Flüchtlinge und Migranten stehen in Europa unter Generalverdacht. Deshalb sind die Mittel, die im Innern gegen den Terrorismus angewandt werden – Überwachung und Kontrolle, Biometrisierung und Datensammlung – jenen so ähnlich, mit denen nach außen die irreguläre Migration bekämpft wird.
Jedes Jahr veröffentlicht die Weltbank, wie viele Menschen in der Welt von einem Land ins andere wandern. »Migrationskorridore« nennt sie dies. Die 30 größten werden erfasst.2 Nur die Bewohner eines einzigen Landes aus Afrika südlich der Sahara sind dabei: Burkinabés, die aus ihrer Heimat Burkina Faso in die Elfenbeinküste auswandern. Afrikaner in Europa – unter den Migranten dieser Welt ist ihre Zahl so gering, dass sie nicht in der Liste der Top 30 auftauchen, obwohl die Kontinente nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen.
181 000 Afrikaner kamen 2016 über das Mittelmeer nach Europa.3 Das sind etwa so viele Menschen, wie in Hamm oder Saarbrücken leben. Keine große Zahl für die EU mit ihrer halben Milliarde Einwohner. Doch seit 2010 hat sich die Zahl der jährlich ankommenden Afrikaner mehr als verdoppelt. Und viele fürchten: So wird es weitergehen.
Bis 2050 wird die Bevölkerung des Kontinents auf mehr als 2,2 Milliarden wachsen, prognostizieren die Vereinten Nationen (UN).4 »Dramatisch zunehmen« könnte die Migration aus Afrika, sagte der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) im Oktober 2016. Im Juni 2017, der Bundestagswahlkampf steht vor der Tür, wird er konkreter: »Bis zu 100 Millionen Menschen«5 könnten sich in Afrika auf den Weg nach Norden machen, wenn der Klimawandel nicht verlangsamt werde. Eine Zahl, monströs, aber bewusst gesetzt, um Ängste zu schüren.
Denn die Menschen, um die es geht, sind schwarz. Carlos Lopes, bis vor Kurzem UN-Chefökonom für Afrika, erinnert daran, dass im vergangenen Jahrzehnt Hunderttausende Arbeitsmigranten aus Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Peru nach Spanien kamen. Es war dieselbe Zeit, in der das südeuropäische Land, das nur wenige Kilometer von Afrika entfernt liegt, mit seinem »Plan África« (→ Kapitel: Rückblick) die Migration aus Westafrika stoppte. Einwanderung aus Lateinamerika dagegen ließ es zu. Eine »kulturelle Wahl«, sagt Lopes zu dieser Entscheidung: »Es gab keine Angst vor Migranten, sondern vor Afrikanern.«6
Diese Angst ist – so wie die vor Muslimen – einer der Nährstoffe für den Rechtsruck, der das politische Gefüge in vielen Ländern Europas erschüttert hat. Die Debatte um Zuzug, offene Grenzen und Flüchtlingsschutz hat die EU als Projekt insgesamt möglicherweise stärker unter Druck gesetzt als selbst die Eurokrise 2010.
Den Deutschen drohe, »in weniger als einer Generation« im erwerbsfähigen Alterssegment »eine Minderheit im eigenen Land« zu werden, sagt der Juraprofessor Ralph Weber. Bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern holte er in seinem Wahlkreis Vorpommern-Greifswald III an der Ostseeküste 35 Prozent7 aller Stimmen – das bis dahin beste AfD-Ergebnis in einem Wahlkreis überhaupt. Weber rechnet vor: Bis 2017 dürften 3,5 Millionen »illegale Zuwanderer« ins Land gekommen sein. Wenn die sich in der »lebensbejahenden Verbreitungsstrategie, die diesen Völkern eigen ist, ausbreiten, also vier bis fünf Kinder in zehn Jahren«, gebe es bald »elf bis zwölf Millionen illegale Zuwanderer und deren Nachfolger«. Eine Argumentation, wie sie unter Rechtsextremen weit verbreitet ist. Doch genau das, behauptet Weber, seien die Dinge, die die Menschen bei seinen vielen Wahlveranstaltungen im äußersten Nordosten der Republik angesprochen hätten.
Die Angst vor den Afrikanern und muslimischen Einwanderern, sie buchstabiert sich selten so offen aus wie im AfD-Wahlkampf von Ralph Weber. Doch ihre Verbreitung nimmt zu. Sie ist der Antrieb für immer weitergehende Versuche, Migration in einer globalisierten Welt wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und zwar vor allem aus und in Afrika. Denn die meisten der teils riesigen Migrationskorridore auf der Weltbank-Liste sind völlig geräuschlos. Niemand nimmt an den Bewegungen der Menschen Anstoß. Dass sie wandern, wird akzeptiert.
Im Jahr 2004 widmete die für Bildung, Wissenschaft und Kultur zuständige UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Afrika eine Tagung. Ihr Titel: »Der vergessene Kontinent«. Damals war das fast ein Synonym für Afrika. Das ist vorbei. Afrika ist in den Mittelpunkt des europäischen Interesses gerückt.
Im Grunde ist dies eine gute Nachricht. Sie könnte, zum Beispiel, dazu führen, dass über die aktuelle, größte Hungerkatastrophe seit Bestehen der UN gesprochen wird, die in Afrika Millionen Menschen bedroht. Oder über die Lage in Uganda, einem kleinen Land, wo zu Beginn 2017 das größte Flüchtlingslager der Welt aus dem Boden gestampft wurde, aber die Mittel fehlen, um die Menschen zu ernähren. Doch diese Dinge sind kein Thema für weite Teile der Öffentlichkeit und viele Politiker in Europa.
Sie interessiert, was getan werden kann, damit keine Flüchtlinge zu uns kommen. Der milliardenschwere EU-Türkei-Deal (→ Kapitel: Das Abkommen mit der Türkei) soll dafür Modell stehen. Das Abkommen hat viele empört. Seine Kritiker klingen dabei häufig so, als habe Europa mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan eine neue, besonders verwerfliche Praxis der Abschottung begonnen. Tatsächlich aber nimmt die EU schon seit langer Zeit Staaten in ihren Dienst, aus denen die Migranten und Flüchtlinge nach Europa kommen – mit »Nachbarschaftsverträgen«, »Arbeitsabkommen« und »Partnerschaftsrahmen«. Anders als die Abmachung mit der Türkei hat dies die Öffentlichkeit nie interessiert. Die einzige Ausnahme war der Vertrag zwischen Italiens damaligem Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und Libyens Diktator Muammar Gaddafi 2008. Berlusconi stellte Gaddafi Milliarden Euro in Aussicht. »Weniger Flüchtlinge – mehr Öl«, sagte Berlusconi damals, das sei der Deal.
Heute ist es die EU, die mit Hochdruck daran arbeitet, solche Abkommen mit vielen Staaten Afrikas abzuschließen. Für Flüchtlinge wird es so immer schwieriger, Schutz zu finden. Und für Arbeitsmigranten wird es immer gefährlicher, an Orte zu gelangen, an denen sie ein Einkommen suchen können. Doch das ist nicht die einzige Folge. Je mehr Europa versucht, die Migration zu kontrollieren, desto schwieriger wird es für viele Afrikaner, sich innerhalb ihres eigenen Kontinents, ja selbst innerhalb ihres eigenen Landes frei zu bewegen.
Dieses Buch handelt von diesem neuen Umgang mit Afrika. Doch das, was darin beschrieben ist, ist europäische Innenpolitik.
Seit die EU sich zusammenschließt, wachsen ihre Grenzen schneller als sie selbst. Zuerst verhielt sie sich wie ein Nationalstaat: Sie kontrollierte die Zugänge zum eigenen Territorium. Doch das reichte irgendwann nicht mehr. Weil sie die Migration von außen im Innern nicht kollektiv zu regeln vermochte, versucht sie jetzt stattdessen, Migrationsbewegungen in ihre Richtung zu verhindern, vor allem in Afrika. Erst sollten die Transit-, dann die Herkunftsregionen dafür sorgen, dass möglichst wenige Menschen zum Schengen-Raum vordringen konnten. Ein Plan voller Hybris.
Die EU bietet dafür immer mehr Geld. Rund zwei Milliarden Euro waren es seit dem Beginn des Jahrtausends bis 2015. Bis 2020 sollen mindestens weitere 14 Milliarden Euro (→ Kapitel: Entwicklungshilfe) hinzukommen. Die EU begleicht die Kosten, die durch die Kontrolle der Migration selbst entstehen: Lebensmittel oder Zelte für aufgehaltene Flüchtlinge, Jeeps oder Schiffe für die Grenzpolizei, Abschiebungen oder den Bau und Betrieb von Internierungslagern. Aber sie gibt noch mehr, gewissermaßen als Prämie: eine Extraportion Entwicklungshilfe für die Koalition der Willigen in Sachen Grenzschutz.
Manche Staaten Afrikas stellen deshalb die Ausreise in Richtung Europa generell unter Strafe. Manche sparen sich ein solches Gesetz und sperren Migranten einfach so ein. Manche errichten Grenzposten, wo bislang keine waren. Manche führen biometrische Pässe ein. Manche nehmen Abgeschobene aus Europa zurück, selbst wenn sie gar nicht ihre eigenen Bürger sind. Manche Staaten blockieren Migrationsrouten mit Soldaten. Manche erlauben europäischen Beamten, dies selbst zu übernehmen. Und manche schließen die Grenzen: nicht nur für Transitmigranten, sondern auch für die eigenen Bürger. Sie tun genau das, was den Staaten des einst kommunistischen Ostmittel- und Osteuropas bis heute, völlig zu Recht, als eine ihrer größten Sünden vorgeworfen wird.
Immer öfter wird das Geld, das als Gegenleistung für die Kontrolle der Migration gezahlt wird, als Official Development Assistance (ODA) – gemeinhin Entwicklungshilfe genannt – verbucht. Es ist eine Zweckentfremdung von Mitteln, die dazu da sind, Armut und Not zu lindern. Es widerspricht dem Sinn von Entwicklungshilfe auch deshalb, weil Arbeitsmigration ein Segen für arme Länder ist. Sie bringt Geld in die Kassen der kleinen Händler und Bauern.
Diese Vermischung von Entwicklungshilfe und Migrationskontrolle wird zunehmen. »Fluchtursachenbekämpfung« ist das neue Paradigma der Entwicklungspolitik. Die afrikanische Zivilgesellschaft bekommt davon nur wenig mit. Die Verhandlungen laufen im Geheimen.
Deutschland ist das Kraftzentrum der neuen EU-Afrika-Politik. Im Herbst 2016 reiste die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum ersten Mal seit Langem wieder nach Afrika. Danach kamen eine ganze Reihe von afrikanischen Staatschefs und Delegationen nach Berlin. Ähnliches spielte sich in Brüssel ab. Der Kontinent bekam plötzlich mehr Aufmerksamkeit als etwa während der Ebola-Krise 2014. Als Kanzlerin Merkel im Dezember 2016 die Präsidentschaft der G20-Staatengruppe übernahm, nannte sie eine Säule ihres Programms: »Verantwortung übernehmen – besonders für Afrika«. Bis zum Sommer 2017 riss die Serie der Afrika-Konferenzen in Berlin nicht ab. Selbst Menschen, die hauptberuflich die Afrika-Politik erforschen, kamen kaum noch mit.
Die Agenda klang teils so, als sei sie im Eine-Welt-Laden geschrieben worden: »Afrika ist nicht arm, sondern wurde von uns arm gemacht« – mit solchen Sätzen wirbt Entwicklungsminister Müller für seinen »Marshallplan mit Afrika«, der die »postkoloniale Ausbeutung stoppen« soll.8
Neu ist diese staatliche Befassung mit Afrika nicht. Ihre »afrikapolitischen Leitlinien« inklusive der Rede vom »Kontinent der Chancen« etwa formulierte die Bundesregierung schon 2014. Auch bei den G8-Gipfeln 2005 im schottischen Gleneagles und 2007 in Heiligendamm an der Ostsee war Afrika ein Thema. Die aktuelle Ballung diplomatischer Betriebsamkeit aber hat zweifellos eine neue Qualität.
In dieser neuen Welt wächst auch die Bereitschaft, militärische Mittel zu wählen. »Die Ereignisse der letzten zwei Jahre waren ein Weckruf, den wir verstanden haben«,9 sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im März 2017 auf einer Konferenz, die sie in Berlin mit Entwicklungsminister Müller ausrichtete. Der Satz war offen auf die Situation auf der Balkan-Route gemünzt. Würden die Probleme Afrikas nicht gelöst, »machen sich die Menschen auf den Weg, wenn sie bedroht sind«, sagte von der Leyen. Das Verteidigungs- und das Entwicklungsministerium hätten sich »in der Vergangenheit oft als Gegensätze verstanden«. Damit müsse Schluss sein. In Afrika gehen jetzt deutsche Verteidigungs- und Entwicklungspolitik Hand in Hand. Müller wies auf den Zusammenhang von Nahrungskrisen und bewaffneten Konflikten hin. In mehr als der Hälfte der weltweit 37 Staaten, in denen aktuell Hungerkrisen drohen oder herrschen, seien Kriege der Hauptgrund. Nigeria etwa habe bald die drittgrößte Bevölkerung der Erde und würde durch ein Erstarken der islamistischen Miliz Boko Haram »in Flammen stehen«, sagte Müller. »Stellen Sie sich vor, welche dramatischen Auswirkungen das für uns alle hätte«, so der Minister: »Afrikas Zukunft bestimmt auch unsere Zukunft.«
Migration aber ist nicht auf bewaffnete Konflikte, Armut oder Erderwärmung reduzierbar. Sie ist eine anthropologische Konstante und eine Normalität der Globalisierung. Unter der Migrationsabwehr leiden in erster Linie die Migranten. Die EU aber fühlt sich als Opfer. Hier heißt es: Das Boot ist voll. In Afrika wird Migration dagegen als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet. Aus der Sicht der afrikanischen Staaten ist jeder zurückgenommene Flüchtling oder Migrant ein schlechtes Geschäft.
Nur wenige Länder Afrikas lassen sich deshalb bislang von Europa vereinnahmen. Zu wichtig ist Migration für sie.
Afrika hat eigene Vorstellungen von seiner Zukunft formuliert, vor allem im Kontext der Afrikanischen Union (AU) und ihres 50-Jahr-Plans, der sogenannten Agenda 2063, die sie im Jahr 2013 als Zukunftsvision formuliert hat.
Sie will mehr Integration und mehr Migration: Alle Afrikaner sollen innerhalb des Kontinents visumfrei reisen und arbeiten können. Es soll einen gemeinsamen afrikanischen Reisepass geben. Gerade hier fallen europäische und afrikanische Interessen auseinander: Der Wunsch nach mehr Grenzkontrollen ist mit dem Wunsch nach echter innerafrikanischer Freizügigkeit unverträglich. Europa ignoriert das – und formt Afrika so einmal mehr nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen.
In den Monaten, in denen dieses Buch fertiggestellt wurde, hat sich die Entwicklung stark beschleunigt. Die Krise im Mittelmeer spitzte sich zu und fast wöchentlich fassten die EU oder europäische Staaten neue Beschlüsse, um die Ankunft von Flüchtlingen und Migranten einzuschränken. Die in diesem Buch beschriebenen Prozesse haben sie so weitergetrieben, die von uns aufgezeigten grundlegenden Probleme, vor allem die unterschiedlichen Auffassungen von europäischer und afrikanischer Seite zur Zukunft von Migration, bleiben bestehen.
Berlin, Kampala, August 2017
TEIL IDIE SCHLIESSUNG DER GRENZEN
Unsere Partner
Mutmaßliche Kriegsverbrecher
»Ich sage es ganz klar: Wir sind von den Flüchtlingen nicht gefährdet, denn die Menschen wollen ja nach Europa«,1 erklärt der Kommandant von Sudans Spezialeinheiten RSF (Rapid Support Forces) im August 2016 auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Khartoum. Stolz präsentiert er der Presse über 800 verhaftete »illegale Migranten«: Eritreer, Äthiopier und Sudanesen; darunter Frauen und Kinder. Wie Vieh sind sie auf der Ladefläche von Lastwagen vom Gefängnis zur Pressekonferenz gekarrt worden. Sie waren auf dem Weg nach Europa, als die RSF sie aufgriff. »Also arbeiten wir stellvertretend für Europa«, erklärt Generalmajor Mohammed Hamdan Daglo in die Kameras.
Berühmt und berüchtigt ist Daglo unter dem Kriegsnamen »Hametti«. Sudans oberster Grenzschützer ist mutmaßlicher Kriegsverbrecher mit blutiger Vergangenheit. Hamettis Onkel ist Chef eines der Clans in der Bürgerkriegsregion Ost-Darfur, die traditionell als Kamelhirten und Händler bewaffnet in den Grenzgebieten der Wüste umherziehen. Seine Reitermiliz wurde 2003 von Sudans Regime als Stoßtrupp aufgestellt, um die Rebellen in Ost-Darfur zu bekämpfen. Bekannt als Janjaweed, wird Hamettis Miliz von internationalen Menschenrechtsorganisationen für grausame Verbrechen verantwortlich gemacht.2 Ihr Name ist Programm: Übersetzt bedeutet er »berittene Teufel«. UN-Ermittler präsentierten Beweise für Folter, Vergewaltigungen und Massenhinrichtungen.3
Im Sudan selbst gilt Hametti als Held. Erst im April 2016, kurz vor den Wahlen, befördert Sudans Präsident Omar al-Bashir ihn zum Generalmajor und verteilt Tapferkeitsmedaillen an dessen Kämpfer. Hametti hatte im Bürgerkrieg in Darfur den entscheidenden Sieg erzielt: die Zerschlagung der Rebellengruppe JEM (Justice and Equality Movement). Während Bashir von der Ladefläche eines Pick-ups herab seine Lobrede auf Hametti hielt, verrotteten im Hintergrund aufgedunsene Leichen im Wüstensand.4 Amnesty International schreibt im Darfur-Bericht 2016 von Giftgasanschlägen der Regierung gegen die eigene Bevölkerung – vergleichbar mit dem Regime in Syrien.5 Bereits 2009 stellte der Internationale Strafgerichtshof gegen Präsident Bashir einen ersten Haftbefehl aus, der zweite folgte ein Jahr später. Der Vorwurf: Völkermord in Darfur.6
Hametti erledigt auch in den anderen Bürgerkriegsgebieten Süd-Kordofan und Blue Nile für Bashir die Drecksarbeit. 2013 gingen seine Einheiten in der Hauptstadt brutal gegen Demonstranten vor. Er gilt als persönlicher Garant von Bashirs Macht und brüstet sich damit. 2014 stellt er sich in seinem Hauptquartier in Darfur vor die Kameras des australischen TV-Senders ABC.7 Seine Kämpfer präsentieren schwere Waffen. Gegenüber der im Sudan geborenen ABC-Journalistin Nima Elbagir rühmt er sich, er habe 2006 Präsident Bashir persönlich getroffen. Von ihm empfange er seitdem direkt seine Befehle. 2013 wurde seine Miliz als Grenzwächtereinheit vom Geheimdienst NISS (National Intelligence and Security Service) übernommen, der sich bemühte, die Grenzen zwischen Darfur und dem Nachbarland Tschad unter Kontrolle zu bekommen, um den JEM-Rebellen die Rückzugswege abzuschneiden. Hametti heuerte dazu seine Verwandten an. Dafür fordert er Pfründe: Macht, Einfluss und vor allem Ausrüstung.8
Sudans Geheimdienst NISS darf seit der jüngsten Verfassungsänderung 2015 eigene Truppen unterhalten. Laut Artikel 151 ist er jetzt nicht mehr nur für die »Überwachung der Grenzen und Bekämpfung von Schmugglern« durch das »Sammeln von Informationen« zuständig, sondern wird als eigenständiges Organ der Armee gleichgestellt.9 Im Januar 2017 verabschiedete Sudans Parlament ein Gesetz, das die mittlerweile 30 000 RSF-Soldaten unter direkten Befehl von Präsident Bashir stellt und die Truppen offiziell in die Armee integriert.10 Hametti wird so auch formell zum persönlichen Handlanger Bashirs. Seine RSF ist besser ausgestattet als die regulären Streitkräfte. Sie ist für die Überwachung der strategisch wichtigen Grenzen zu Libyen, Ägypten und dem Tschad zuständig.11 Dazu gehört auch der Feldzug gegen die Migranten. Im Januar 2017 verhaftete er erneut 1500 Menschen bei ihrer Flucht über die Grenzen.12
Aus der Sicht des Regimes sind vor allem Flüchtlinge aus Darfur Staatsfeinde. Denn das Chaos in Sudans nördlichem Nachbarland Libyen hat auch Rebellen aus Darfur angelockt. Der Handel mit Gold aus ihrer Heimat hat sie reich gemacht. Sie rekrutieren jetzt zunehmend Flüchtlinge aus Darfur, die auf dem Weg nach Europa Libyen passieren, und rüsten sich entlang der Grenze gegen Sudans Regierung. Dagegen soll Hametti einen Puffer errichten und versuchen, die Flüchtlinge einzufangen, bevor sie dem Feind als Rekruten in die Hände fallen. Dafür versucht er, im Grenzgebiet eine Koalition mit der libyschen Miliz Libya Dawn einzugehen, die im Übergangsrat in der libyschen Hauptstadt Tripolis sitzt und vom Sudan und Katar unterstützt wird.
In der erwähnten Pressekonferenz im August 2016 erklärt Hametti vor internationalen Reportern: Bei der Festnahme der 800 Migranten wurden 25 seiner Soldaten getötet, 315 verletzt, und 151 Autos habe er verloren. »Bei unserem Kampf gegen illegale Migration haben wir schwere Verluste hinnehmen müssen, unsere Fahrzeuge wurden zerstört, während wir durch die libysche Wüste Jagd gemacht haben, dennoch hat uns bislang niemand dafür gedankt«,13 beklagt er sich. Adressiert ist diese Äußerung an die EU, von der er mehr Dankbarkeit in Form von Ausrüstung erwarte.
Merkel entdeckt Afrika
»Das Wohl Afrikas liegt im deutschen Interesse«, verkündet Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2016, bevor sie ins Flugzeug steigt. Auf ihrem Reiseprogramm standen Mali, Niger, Äthiopien – drei Länder in drei Tagen. Der Auftakt zu einer neuen Afrika-Politik.
Als Merkel am 9. Oktober 2016 zum ersten Mal für wenige Stunden malischen Boden betrat und dem dortigen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta auf dem Rollfeld des Flughafens der Hauptstadt Bamako die Hand schüttelte, betonte sie neben Sicherheit und Stabilität den »Schutz der Grenzen« als gemeinsames Ziel.14 Am Tag darauf, im benachbarten Niger, besucht sie ein Auffanglager der UN-Agentur IOM (International Organization for Migration) nahe der Hauptstadt Niamey. Durch den Wüstenstaat führt die wichtigste Route für Migranten aus den west- und den zentralafrikanischen Ländern in Richtung Mittelmeer. Für viele endet die Reise nach Europa in diesem Camp, das mit europäischen Geldern unterhalten wird. Merkel hat eine Botschaft an die Afrikaner. Sie warnte vor falschen Vorstellungen: »Oft nehmen besonders junge Menschen einen lebensgefährlichen Weg in Kauf, ohne zu wissen, was sie erwartet und ob sie überhaupt bleiben können«,15 sagt sie am Tag darauf in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, kurz nachdem sie feierlich das neue Gebäude des AU-Sicherheitsrates eröffnete hatte, das mit deutschen Geldern finanziert worden war.
Fünf Jahre lang war die Kanzlerin nicht in Afrika gewesen. So wirkte es im Jahr 2016, als habe die Bundesregierung den südlichen Nachbarkontinent neu entdeckt. In den Monaten zuvor hatte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) Eritrea, Ruanda, Senegal, Benin und Togo besucht und afrikanische Partner nach Berlin geladen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) war im April 2016 nach Mali aufgebrochen und hatte deutsche Soldaten in der UN-Friedensmission MINUSMA besucht. Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reiste 2016 vermehrt nach Afrika, im Oktober 2016 war er in Nigeria.
Kurz nach ihrer Rückkehr empfängt Merkel zwei weitere afrikanische Staatschefs im Kanzleramt: Idriss Déby, als erster Präsident Tschads in Deutschland zu Gast, sagt: »Ich hoffe, dass die Tür jetzt offen ist und wir oft nach Berlin kommen werden.«16 Wenige Tage darauf heißt Merkel Muhammadu Buhari willkommen, den Präsidenten Nigerias. Das bevölkerungsreichste Land Afrikas zählt zu den engsten Partnern auf dem Kontinent. Nigerianer stellen innerhalb der EU fast die meisten Asylanträge, direkt nach den Eritreern. Deutschland wolle für junge Nigerianer »vor Ort Zukunftsperspektiven schaffen«, betont Merkel. Gemeint sind Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten und mehr Engagement deutscher Unternehmen in Nigeria – heute ist das Fluchtursachenbekämpfung. Wer auswandert, werde es hingegen schwerer haben, warnt die Kanzlerin. In diesem Monat begännen Verhandlungen zwischen Nigeria und der EU-Kommission über ein Rückführungsabkommen für illegal eingereiste Nigerianer.17
So viel Afrika in Berlin – das ist kein Zufall. Nur knapp zehn Tage nach Merkels Reise tagten in Brüssel die EU-Mitgliedstaaten. Ihr Hauptdiskussionspunkt: Migration, der Schutz der EU-Außengrenzen sowie die Reform des EU-Asylrechts. Im Fokus stehen die neu konzipierten »Migrationspartnerschaften« zwischen der EU und afrikanischen Ländern. Dafür hat die Europäische Kommission zunächst fünf Partnerländer ausgesucht: »Zusammen mit Niger, Nigeria, Senegal, Mali und Äthiopien will die EU die Fluchtursachen bekämpfen. Nach vier Monaten der Umsetzung sind erste operative Ergebnisse vor Ort sichtbar«, heißt es in einer EU-Pressemitteilung: »Zudem konnte der Nothilfefonds für Afrika mit der Umsetzung von 24 Projekten erste Erfolge verzeichnen, sodass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten eine Aufstockung um 500 Millionen Euro vorgeschlagen hat.«18
Die Migrationspartnerschaften sind nur der nächste Schritt in einer breit angelegten EU-Politik gegenüber Afrika, bei der kaum mehr jemand durchblickt: Agenda für Migration, Afrika-EU-Partnerschaftsrahmen, Aktionsplan für Migration, Aktionsplan Rückkehr, Marshallplan mit Afrika, Compacts mit Afrika, Valletta-, Khartoum-, Rabat-Prozess. Es ist ein Labyrinth bedruckter Seiten, doch die Konzepte haben im Wesentlichen ein gemeinsames Ziel: die Migration vom südlichen Nachbarkontinent zu stoppen.
Mit ihrem Aktionismus verpasste Merkel der neuen EU-Afrika-Politik von vornherein eine deutsche Handschrift, genauer: ihre Handschrift. Die Dringlichkeit hat auch mit dem anstehenden Wahlkampf zur Bundestagswahl im Herbst 2017 zu tun. Niedrige Flüchtlingszahlen helfen der Bundeskanzlerin bei der Wiederwahl. Die Willkommenskultur hatte gerade einmal ein Jahr lang gehalten.
Die Abkommen zwischen der EU und afrikanischen Staaten zielen vor allem auf eine bessere Kontrolle der afrikanischen Grenzen, die im 19. Jahrhundert von den europäischen Großmächten auf dem Reißbrett gezogen wurden. So sollen Migranten erst gar nicht mehr bis ans Mittelmeer vorstoßen. Die EU kauft sich Afrikas Staatschefs als Türsteher ein. Wer es trotzdem nach Europa schafft, soll sofort wieder abgeschoben werden können – selbst in Länder wie dem Sudan, Eritrea oder Äthiopien, wo autoritäre Regime an der Macht sind.
In einem Drahtbericht des Auswärtigen Amtes ist von »maßgeschneiderten Länderpaketen« die Rede, »die unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit gelangen dürften«. Der Grund: »Der Ruf der EU stehe auf dem Spiel, wenn sie sich zu stark mit dem Land engagiere.«19
Ob Äthiopien, Eritrea, Sudan, Somalia, Niger, Tschad, Mali, Gambia, Senegal, Ghana, Elfenbeinküste, Tunesien, Algerien, Marokko und Nigeria – für all diese Regierungen hat die EU seit 2016 solche »maßgeschneiderte Länderpakete« in der Schublade. Es sind Strategiepapiere für Rückführungsabkommen, die die EU mit ihren afrikanischen Partnern verhandelt. Ziel ist es, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen. Erleichterungen im Bereich Arbeitsmigration für Afrikaner könne man nicht anbieten – dafür sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu angespannt, heißt es in einem Drahtbericht des Auswärtigen Amtes.20 Damit wird das Versprechen der Kanzlerin auf den Kopf gestellt: Das Wohl Deutschlands liegt vielmehr in Afrikas Interesse.
Wenige Tage bevor die Bundeskanzlerin von West- nach Ostafrika jettete, versammeln sich vor dem Gebäude der EU-Kommission am Brandenburger Tor in Berlin einige Dutzend Äthiopier, Eritreer, Sudanesen, Malier und Nigerianer, um gegen Merkels neue Afrika-Offensive zu demonstrieren. Ein Schlauchboot wird aufgepumpt, theatralisch aus Ziegelsteinen eine Mauer gebaut. »EU: kein Pakt mit Kriegsverbrechern!« steht auf einem Spruchband mit dem Logo der Gesellschaft für bedrohte Völker, die die Demonstration organisiert hat.21 »Stoppt den Völkermord in Äthiopien und im Sudan«, ist auf einem weiteren Plakat zu lesen, das zwei Äthiopier von der Ethnie der Oromo hochhielten. Nur einen Tag vor Merkels Äthiopien-Reise verhängt die dortige Regierung den Ausnahmezustand und schaltet das Internet ab. Beim traditionellen Erntedankfest der Oromo-Volksgruppe war es zu Protesten gekommen, die von Polizei und Militär brutal niedergeschlagen wurden. Zahlreiche Menschen starben: 52 nach Regierungsangaben, über 500 nach Angaben von Oppositionellen.
»Die Unterstützung von Diktatoren in Äthiopien führt nicht zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen, sondern fördert Flucht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit«, mahnt Seyoum Habtemariam, Vorsitzender des Äthiopischen Menschenrechtskomitees in Deutschland, durch ein Megafon. Die Demonstranten zollen Beifall. Einige haben Masken gebastelt: mit den Gesichtern der Bundeskanzlerin sowie von Sudans Präsident Bashir. Beide Maskierte schütteln sich die Hand: »Kein Pakt mit Kriegsverbrechern!«, skandieren die Demonstranten.
Ein Kriegsverbrecher erpresst die EU
In ihrer neuen Migrationspolitik gegenüber Afrika hat sich die EU ausgerechnet den Sudan als zentrales Partnerland ausgeguckt. Der Grund: Es ist das »Haupttransitland« für Migranten, die vom Horn von Afrika gen Mittelmeer ziehen, so ein internes Dokument des Auswärtigen Amtes.22 Dabei ist Präsident Bashir der einzige Staatschef weltweit, gegen den ein Haftbefehl verhängt wurde – auch auf europäische und vor allem deutsche Initiative hin. Seitdem war der Sudan gleichsam isoliert. Doch in der neuen EU-Migrationspolitik wird jetzt ausgerechnet Hametti zum entscheidenden Player.
2016 wird nach jahrelanger Funkstille zwischen Khartoum, Brüssel und Berlin wieder viel hin- und hergeflogen. Anfang Oktober, kurz vor Merkels Afrika-Reise, treffen deutsche Parlamentarier in Sudans Hauptstadt mit dem dortigen Innenminister, Leutnant Esmat Abdul-Rahman, zusammen. Neben den Mitgliedern des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sitzen zwei NISS-Agenten am Tisch und hören alles mit. Am Vortag hatten die Deutschen ohne Geheimdienstler Bashirs Berater Ibrahim Mahmoud Hamid getroffen, ein enger Vertrauter des Präsidenten, der für ihn die Kontakte zum Westen pflegt, die er aufgrund des internationalen Haftbefehls nicht persönlich führen kann.23
Hamid ist der offizielle sudanesische Ansprechpartner im Khartoum-Prozess (→ Kapitel: Diplomatie), einer Dialogrunde, in der die EU mit Staaten verhandelt, durch die Migranten vom Horn von Afrika aus nach Europa ziehen. Sowohl Deutschland als auch der Sudan sitzen im Lenkungsausschuss. Für Westafrika wurde parallel der sogenannte Rabat-Prozess ins Leben gerufen. Ziel soll es jeweils sein: »Menschenhandel und Schleusertum einzudämmen«, heißt es im Khartoum-Abkommen.24 Den Opfern soll »besserer Schutz vor Ausbeutung und Misshandlungen« gewährt und nicht zuletzt die unkontrollierten Migrationsströme auf dem Kontinent eingedämmt werden, die laut der neuen EU-Verteidigungsstrategie die Sicherheit der EU gefährden.25
Um dies zu erreichen, will die EU Afrikas Grenzbehörden unterstützen: in Form von »Training, technischer Hilfe und Lieferung von angemessener Ausrüstung, um die Migrationspolitik umzusetzen«, heißt es in der Beschreibung des Projekts Better Migration Management (BBM), das im Rahmen des Khartoum-Prozesses umgesetzt werden soll. Europäische Trainer sollen ihre afrikanischen Kollegen ausbilden, um die Migration nach Europa zu stoppen.26
Auch in anderen Ländern Afrikas, etwa Tunesien oder Mali, sind deutsche Grenzschützer in »Ertüchtigungsprojekten« in diesem Sinne tätig. In der Projektbeschreibung des Bundesverteidigungsministeriums für Tunesien etwa steht »Beschaffung von elektronischen Überwachungsanlagen« zur Grenzsicherung aufgeführt.27 Diese Grenzbehörden sind Sicherheitskräfte, die in der Regel der Polizei, Armee oder auch dem Geheimdienst unterstehen.
Sudans Innenminister schickte den Europäern eine Wunschliste, mit alldem, was er zur Kapazitätsbildung benötige. Darauf standen: »Ausrüstung, Internierungszellen, Zäune und Kampfhubschrauber für die Grenzpolizei«.28
Deutschland – Sudan: eine historische Beziehung
In der deutschen Entwicklungszusammenarbeit war der Sudan lange Zeit Hauptempfängerland in Afrika. In den 1980er Jahren unterhielt das Bundesland Niedersachsen mit dem Sudan eine Partnerschaft. Bis heute nimmt Niedersachsen innerhalb der Bundesrepublik schwerpunktmäßig Asylsuchende aus dem Sudan auf. Die Beziehungen wurden offiziell beendet, als sich 1989 der heutige Staatschef Bashir an die Macht putschte. Tatsächlich blieben aber viele persönliche Kontakte nach Khartoum bestehen, die bis heute die offizielle Wahrnehmung des flächenmäßig größten Landes Afrikas in Berlin prägen.
Im Sudan-Referat des Auswärtigen Amtes wurde das Land wegen seiner Amtssprache und der islamischen Religion dem arabischen Raum zugeordnet. Dementsprechend wurden die inneren Auseinandersetzungen des Sudans in Berlin als kulturelle oder religiöse Konflikte interpretiert: »arabisch« und »muslimisch« gegen »christlich« oder auch »schwarzafrikanisch«. Unter Bashirs Herrschaft entwickelte sich daraus eine völkermörderische, rassistische Ideologie, die zumindest in Darfur und anderen Konfliktgebieten des Sudans Teile der Bevölkerung getötet und vertrieben hat und nicht zuletzt zur Unabhängigkeitserklärung des Südens 2011 geführt hatte.
Die Bundesregierung half dabei, die rassistische Polizei- und Militärdiktatur, die jene Minderheit unterdrückt, aufzurüsten. Bereits vor Bashirs Machtergreifung in den 1980er Jahren setzte die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Sudan auf die Ausbildung der Sicherheitskräfte. So wurden damals die ersten sudanesischen Polizisten beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden geschult. Der baden-württembergische Waffenhersteller Heckler & Koch lieferte passend dazu das G3-Sturmgewehr, Daimler-Benz verkaufte Militär-Unimogs, und die einst bundeseigene Firma Fritz Werner baute den Sudanesen eine Munitionsfabrik.29
Erst als die EU 1994 ein Waffenembargo über den Sudan verhängte, wurden die deutschen Rüstungslieferungen eingestellt. Dank deutscher Hilfe ist der Sudan seither der drittgrößte Waffenproduzent des Kontinents, und nach wie vor fahren Sudans Soldaten deutsche Armeelastwagen. In den Jahren 2011 und 2012 exportierte Deutschland über 3000 Militär-Lkws in die Niederlande und nach Belgien, von dort aus wurden sie weiter in den Sudan geliefert, wo sie in Kriegsgebieten gesichtet wurden.30 Bis heute werden mit dem Standardgewehr der deutschen Bundeswehr im Bürgerkriegsgebiet Darfur Menschen getötet. Beweise dazu fanden auch die Ermittler, als sie den Haftbefehl gegen Bashir formulierten.31 Sudans Minderheiten fliehen also auch vor deutschen Waffen.
Für Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker sind demnach Partnerschaften mit Regimen wie dem im Sudan ein »untaugliches Mittel, weil diese Staaten durch ihre eigene Politik zunehmend mehr Flüchtlinge selbst produzieren«.32 Bei der Demonstration am Brandenburger Tor im Oktober 2016 wollte er auf dieses Problem aufmerksam machen.
Auf dieser Kundgebung hielt auch ein junger Flüchtling aus Darfur eine Rede. Der 22-jährige Abdulman, der aus Angst vor dem weltweiten Netzwerk von Sudans Geheimdienst seinen Nachnamen nicht nennen will, lebt seit einem Jahr in Deutschland, geht in Niedersachsen auf die Berufsschule, spricht recht gut Deutsch. »Meine Flucht nach Europa war sehr teuer, kompliziert und gefährlich«, berichtet er.33 Nachdem Mutter, Vater und seine Brüder im Bürgerkrieg von Hamettis Reitermiliz getötet worden seien, sei er zuerst nach Khartoum geflüchtet. Dort habe er Demonstrationen gegen das Regime organisiert und sei mehrfach festgenommen worden. Um zu fliehen, habe er sich einen Reisepass auf einen falschen Namen besorgt. Der Grund: »In unseren Pässen ist die Herkunft verzeichnet – und wer bei den Behörden angibt, er stamme aus Darfur, oder einen typischen darfurischen Namen hat, der bekommt keinen Pass«, so Abdulman. Mit dem Reisedokument habe er unter einem arabischen Decknamen die Grenze nach Ägypten passiert. Von Kairo aus war er dann mit Turkish Airlines nach Istanbul geflogen und hatte dort ein Boot nach Griechenland genommen. Gemeinsam mit Hunderttausenden Syrern, Afghanen und anderen Nationalitäten war er 2015 über die Balkan-Route zu Fuß nach Deutschland marschiert. Über 2500 Euro habe seine Reise gekostet. Das Geld habe er sich von einem Onkel geliehen, er kam völlig verschuldet in Europa an. »Es wäre so viel billiger gewesen, in Khartoum eine Maschine bis nach Frankfurt zu nehmen, aber wie hätte ich mit einem gefälschten Pass in der deutschen Botschaft ein Visum bekommen können?«, fragt er.
Mittlerweile fliehen immer mehr Sudanesen wie der Darfuri Abdulman vor der Diktatur Bashirs nach Europa: Über 11 000 waren es 2015. Doch nur die Hälfte wurde von den EU-Mitgliedstaaten unter Schutz gestellt. Die übrigen sollen abgeschoben werden. Die Rückführungsrate sei im Fall des Sudans jedoch »besonders niedrig«, so das EU-Strategiepapier für das geplante Rückführungsabkommen vom März 2016.34 Sie liege bei nur zwölf Prozent. Bei anderen Ländern seien es hingegen 40 Prozent. Der Grund, so das Papier: »ein kompletter Mangel an Kooperation von Sudans Seite«. Um die Kooperationsbereitschaft auszubauen, verspricht die EU im nächsten Satz Maßnahmen zur »Kapazitätsbildung« und unterbreitete dem geächteten Regime ein Angebot, das es kaum ausschlagen kann: die Wiederaufnahme in die Weltgemeinschaft, als »Partner«.35 Zudem erwägt die EU die Erlassung aller Schulden des Sudans bei EU-Staaten und will sich bei den USA dafür einsetzen, den Sudan von der Liste derjenigen Staaten zu streichen, die Terrorismus fördern, sowie sich bei der Welthandelsorganisation WTO (World Trade Organization) für neue Gespräche starkmachen.
Das finanzielle Engagement der EU ist gewaltig: Die EU sagt dem Sudan im Rahmen des Khartoum-Prozesses anteilig Gelder aus dem 40-Millionen-Euro-Topf für das Horn-von-Afrika-Projekt Better Migration Management zu, wozu Deutschland weitere sechs Millionen zuschießt. Der Sudan ist eines von neun unterstützten Ländern. Im Rahmen des EU-Afrika-Migrations- und Mobilitäts-Dialogs fließen weitere 17,5 Millionen Euro anteilig in den Sudan. Weitere 35 Millionen Euro Hilfe für Flüchtlinge sicherte die Bundesregierung als Einzelmaßnahme zu. Das größte EU-Paket umfasst 100 Millionen Euro aus dem Nothilfefonds für Afrika für zwei Jahre, um den Herausforderungen von »Klimawandel, Armut oder Vernachlässigung« zu begegnen. Dieser Fonds war 2015 vor dem Migrationsgipfel in Maltas Hauptstadt Valletta (→ Kapitel: Diplomatie) für die afrikanischen Partner aufgesetzt worden, um Fluchtursachen zu bekämpfen.36
Italien, das von Migranten und Flüchtlingen am meisten betroffen ist, gehen die Verhandlungen der EU nicht schnell genug. Die italienische Polizei unterzeichnet mit dem Sudan im August 2016 eine bilaterale Absichtserklärung. Darin geht es unter anderem um Kooperation der Sicherheitskräfte bei Grenzkontrollen, Kampf gegen Drogenhandel, Terrorismus und Migration sowie eine bessere Zusammenarbeit bei Rückführungen.37 Drei Wochen später hebt eine Maschine vom Flughafen in Turin in Richtung Khartoum ab. An Bord: 48 abgeschobene Sudanesen.38 Wenige Tage später stellt sich General Hametti vor die Kameras und verlangt die versprochene Ausrüstung. Italien zeigt sich flexibel: Im Auftrag der italienischen Entwicklungsagentur trainiert seitdem IOM sudanesische Polizisten im Grenzmanagement.39
Auch die Bundesregierung geht jetzt auf Khartoum zu. Nur knapp eine Woche nach Merkels Rückkehr aus Afrika im Herbst 2016 reist eine sudanesische Polizeidelegation nach Berlin. Der Chef von Sudans Immigrationsbehörde, Generalleutnant Awad Dahiya, will biometrische Reisepässe und Ausweise einführen – so lässt sich der Wunsch der EU, Migration zu kontrollieren, besser erfüllen. Dazu besichtigte er die Bundesdruckerei in Berlin. Danach werden im Präsidium der Bundespolizei Hände geschüttelt. Ein »Kennenlerngespräch«, so die Auskunft der Pressestelle. Sie betont: »Vereinbarungen zwischen der sudanesischen Polizei und der Bundespolizei wurden mithin im Rahmen des Besuchs nicht getroffen.«40 Sudans Innenministerium sagt: Man habe in Berlin über technische und logistische Ausrüstung sowie Trainings geredet, und der Chef der deutschen Bundespolizei habe die Einladung, nach Khartoum zu reisen, gern angenommen.41
Kurz nach Unterbreitung des 100-Millionen-Euro-Angebots kam auch Sudans Außenminister Ibrahim Ghandour nach Berlin und Brüssel. Der ARD sagte er: »Wir haben schon lange nach Ausrüstung wie GPS und anderem Grenzschutzequipment gefragt«. Darüber sei mit Deutschland und der EU gesprochen worden, und er erwarte »ein gegenseitiges Einvernehmen«. Auf die Frage, ob der Sudan bereit sei, Flüchtlinge zurückzunehmen, sagte er: »Der Migrationskommissar in Brüssel hat mir gesagt: ›Wir haben 12 000 illegale Migranten aus dem Sudan in der EU. Sind Sie bereit, die zurückzunehmen?‹ Ich sagte ihm: ›Sofort. Steht zu euren Versprechen, und sie sind herzlich willkommen.‹«42
»Es ist eine Schande«
»Die EU sollte das Reputationsrisiko sorgfältig abwägen, sich mit dem Sudan einzulassen«, heißt es im Strategiepapier zum Sudan. Deswegen erfolge das direkte Engagement der EU über Nichtregierungsorganisationen (NGOs).43 So ist unter anderem die deutsche GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) für die Projekt-Umsetzung zuständig. »Nach der Diskussion mit der EU haben wir sehr klare Menschenrechtsprinzipien festgelegt«, sagt Martin Weiß, der in der GIZ für das Projekt zuständig ist. Diese seien in die Präambel als Bestandteil des Projekts aufgenommen worden. »Die Maßnahmen werden ausgeführt mit vollem Respekt gegenüber den Menschenrechten von Migranten«, heißt es darin.44
Ein Training für Sudans Grenzbeamten sei »denkbar«, so Weiß, »weil Flüchtlinge dort kriminalisiert werden«. Dieses Training würde allerdings nicht im Sudan, sondern in Äthiopien stattfinden, wozu auch Sudanesen eingeladen wären. EU-Ausbilder würden den menschengerechten Umgang mit Migranten lehren – »normale Polizei, in menschenrechtskonformer Ermittlungsarbeit«, heißt es bei der GIZ. Die RSF seien dabei von der Teilnahme ausdrücklich ausgeschlossen. Weiß unterstreicht: »Wir werden nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die wegen Menschenrechtsverbrechen auf Sanktionslisten stehen«, und »wir werden keine Ausrüstung liefern, die auf geltenden Sanktionslisten aufgeführt ist.« Die einzige Ausnahme: Büromaterialien bis zum Laptop.
Im Jahr 2016 war auch Weiß viel in Afrika unterwegs. Es mussten Gespräche mit den neun Regierungen geführt werden, die am Khartoum-Prozess teilnehmen, sowie mit Partnern wie der IOM oder dem UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). In Kenia, Äthiopien und dem Sudan wurden Büros angemietet und Mitarbeiter angestellt. Im Oktober 2016 findet ein Treffen mit allen Projektpartnern statt, auch mit italienischen, französischen, britischen, berichtet Weiß. Fünf bis zehn Maßnahmen sollen pro Land stattfinden. Für Äthiopien sei eine »Fortbildung für Richter und Staatsanwälte in Hinsicht auf die Verfolgung von Menschenhandel mit Fokus auf den menschenrechtlichen Umgang mit Opfern« konzipiert. Im Sudan sollen sogenannte »Safe Houses«, Schutzhäuser, eingerichtet werden, in denen Opfer von Menschenhändlern Zuflucht und Beratung finden. »Im Sudan sind die Gefängnisse voller Migranten, unser Auftrag ist hier, Verständnis für deren Lage herzustellen.« Flüchtlinge und Migranten würden verurteilt, wenn sie keine Papiere haben, heißt es bei der GIZ. Deshalb sollen Grenzbeamte und Polizei, die dem Innenministerium, nicht dem Militär unterstellt seien, trainiert werden.
»Es ist eine Schande, dass sich die GIZ auf so etwas einlässt«, kritisiert der ehemalige Sudan-Ermittler der UN, Jerome Tubiana, der mittlerweile für die NGO Small Arms Survey recherchiert und regelmäßig die Grenze des Sudans bereist: »Oft ist nicht klar, wer hier wer ist – selbst wenn jemand eine Uniform trägt«, so Tubiana und warnt vor einer Zusammenarbeit mit dortigen Sicherheitsbehörden, vor allem mit Hametti: »Der ist ganz klar ein Kriegsverbrecher«, so Tubiana.
Das Better Migration Management ist nicht die einzige europäische Trainingsmaßnahme für Sudans Grenzschützer. An der Polizeischule in Khartoum wird auf Kosten der EU das Regionale Operationszentrum ROCK eingerichtet, in dem die Staaten Ostafrikas ihre Informationen über Schmuggelnetzwerke und Migrationsrouten sammeln und austauschen sollen.45 In der Antwort auf eine Kleine Anfrage teilt die Bundesregierung mit: Die Bundespolizei habe im Januar und Februar 2016 Grundlehrgänge in Dokumenten- und Urkundensicherheit mit sudanesischen Grenzpolizisten durchgeführt, die für die Passkontrollen an Flughäfen zuständig sind. Der Schulungsort war jeweils die Trainingsakademie der sudanesischen Polizei in Khartoum.46
Eritrea: weltweit einer der größten Flüchtlingsproduzenten
Die Nachrichten über die Ausbildungshilfe aus der EU haben sich in Afrika herumgesprochen. Eritreische Flüchtlinge, die im Sommer 2016 aus ihrer Heimat über die Grenze in den Sudan geflohen sind, berichteten der eritreischen Exilorganisation EIRR (Eritrean Initiative on Refugee Rights), sie hätten auf deutschen Armee-Lastwagen hochgerüstete Spezialeinheiten patrouillieren sehen. »Sie erzählen, Sudans Einheiten seien von Deutschen ausgerüstet worden, deswegen wagen sie sich nicht mehr über die Grenze«, sagt die EIRR-Direktorin und Journalistin Meron Estefanos.47 Die Eritreerin im Exil in Schweden vermutet, dies seien Gerüchte, nachdem in den Medien die Zusammenarbeit von Sudans Grenzeinheiten mit Deutschland publik wurde. Doch bereits solche Gerüchte führten dazu, dass Eritreer vermehrt nach Äthiopien flüchten statt in den Sudan. »Seitdem Sudans Grenzeinheiten gezielt Flüchtlinge verhaften, fühlt sich da niemand mehr sicher.«48
Sudans Nachbar Eritrea ist mit 5,4 Millionen Einwohnern eines der kleinsten, aber auch eines der ärmsten Länder des Kontinents – und weltweit einer der größten Produzenten von Flüchtlingen. Die Weltbank geht davon aus, dass mehr Eritreer im Ausland leben als in ihrer Heimat. Der Grund ist das Regime von Präsident Isayas Afewerki, das seit der Unabhängigkeit von Äthiopien 1991 an der Macht ist. Seine Herrschaft wurde zunehmend autokratischer: 2005 ging er besonders brutal gegen Oppositionelle vor. Die EU kürzte die Entwicklungshilfe daraufhin um 70 Prozent, das Regime verlor fast 190 Millionen Euro im Jahr. Deutschland stellte die Zusammenarbeit offiziell 2007 ein. Der UN-Sicherheitsrat beschloss 2009 unter anderem ein Waffenembargo, Regimemitglieder wurden mit Reiseverboten belegt. 2011 warfen die UN Afewerki vor, mit Steuermitteln die islamistische Miliz al-Shabaab in Somalia zu finanzieren, die dem weltweiten Terrornetzwerk al-Qaida nahesteht. UN-Ermittler appellierten 2015 an alle Staaten, eritreische Asylsuchende nicht zur Rückkehr zu zwingen. Das Regime bestrafe »jeden, der versucht, das Land ohne Genehmigung zu verlassen«.49
Gleichzeitig profitiert die Diktatur in Asmara von ihrer gewaltigen Diaspora: Zwei Prozent ihres im Ausland erwirtschafteten Einkommens müssen alle Eritreer laut Gesetz an den Staat zu Hause abführen – die sogenannte Wiederaufbausteuer. Egal, ob sie irgendwo Sozialhilfe bekommen oder einen Job haben, selbst wenn sie eine andere Nationalität angenommen haben – bis 2011 mussten Eritreer in Deutschland diese Steuer monatlich in der Botschaft im Prenzlauer Berg in Berlin oder beim Konsulat in Frankfurt abgeben. Die Bundesregierung hat dies 2011 verboten. Seitdem treiben Afewerkis Beamten die Steuer bei den Verwandten in der Heimat ein. Eritreas Regierung, die keinen Haushalt veröffentlicht, finanziert sich wohl zu einem Großteil von den Devisen, die die Flüchtlinge von überall auf der Welt nach Hause schicken.50
Afewerkis Herrschaft stützt sich auf einen gewaltigen Sicherheits- und Geheimdienstapparat, der weltweit tätig ist. »Die Informationen, die dieses alles durchdringende Kontrollsystem sammelt, werden in absoluter Willkür verwendet, um die Bevölkerung in ständiger Angst zu halten«, so die UN in ihrem jüngsten Untersuchungsbericht zur Menschenrechtslage. »In Eritrea herrscht nicht das Recht, sondern die Angst«, schlossen die Ermittler unter Leitung des australischen Experten Mike Smith.51
Die eritreische Regierung hatte ihnen die Zusammenarbeit verweigert und sie nicht einreisen lassen. Der Grund: Die UN-Ermittler beschuldigen die Armee, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, Frauen systematisch sexuell zu missbrauchen und die eigene Bevölkerung als Zwangsarbeiter auszubeuten.52 Die Verbrechen des Regimes, so auch die eritreische Menschenrechtsorganisation EIRR, sind der Hauptgrund, weshalb Eritreer in Massen fliehen.53
Einer der schlimmsten Diktaturen der Welt werden Hilfszahlungen lange Zeit aus guten Gründen weitgehend verweigert. Dies wird sich jetzt ändern. Der Grund: Bei der Einwohnerzahl liegt Eritrea an 43. Stelle in Afrika, aber bei den Asylanträgen in Europa belegt es den Spitzenplatz auf dem Kontinent. Monatlich flüchten rund 5000 Menschen aus dem Land. Die meisten suchen sich in Afrika eine neue Bleibe: in Äthiopien, Kenia, Uganda, im Sudan oder gar im Bürgerkriegsgebiet Südsudan. Nach Deutschland flohen 2016 nur 20 000.54 In Frankfurt am Main gibt es seit den 1980er-Jahren eine große eritreische Exilgemeinde, sogar eine orthodoxe Kirche – ein Anziehungspunkt für viele, die bereits Verwandte in Deutschland haben.
Bundesentwicklungsminister Müller reiste im Dezember 2015, als erster deutscher Minister nach 20 Jahren, in die Hauptstadt Asmara und traf Präsident Afewerki: »Wir können Eritrea unterstützen, den Exodus der Jugend zu stoppen«, sagte er, »indem wir die Lebenssituation vor Ort verbessern und möglichst auch Rückkehrperspektiven eröffnen.« Müller »sondierte Hilfe« – zum Beispiel in der beruflichen Ausbildung und in der Energieversorgung. Die Bedingung: Eritreas Regierung müsse wirtschaftliche und politische Reformen einleiten und die Menschenrechtslage verbessern.55
Müllers Besuch in Asmara war der Anfang vom Ende der Isolation des Regimes. Nur wenige Wochen später besuchte eine eritreische Regierungsdelegation Berlin und Brüssel. Am 28. Januar 2016 unterzeichneten Eritrea und die EU ein Abkommen. Glatte 200 Millionen Euro aus dem 11. Europäischen Entwicklungsfonds EDF (European Development Fund) sagte die EU dem Land bis 2020 zu. Dieser Topf war im Juni 2013 aufgesetzt und mit einem Etat von rund 30 Milliarden Euro ausgestattet worden, aus dem bis 2020 Entwicklungsprojekte in Afrika finanziert werden sollen. Hinzu kommen weitere 13 Millionen Euro für die Energieversorgung von Kleinunternehmern – so sollen Jobs entstehen, damit die Menschen im Land bleiben.56
Der Hauptgrund der Massenflucht der Jugend ist der sogenannte National Service, im Prinzip der Wehrdienst bei der Armee, zu dem alle Männer und Frauen nach ihrem Schulabschluss automatisch eingezogen werden. Laut Verfassung soll er nur zwei Jahre dauern, tatsächlich kann ein halbes Leben daraus werden. Die Menschen arbeiten als Soldaten an der langen Grenze zum Nachbarland Äthiopien, auf Baustellen entlang der Straßen, in Steinbrüchen oder an Megaprojekten wie den Staudämmen, die derzeit entstehen. Sie leisten schwere körperliche Arbeit für umgerechnet 25 Euro im Monat – Sklavenarbeit.57
In einem Strategiepapier zu einem geplanten Rückführungsabkommen mit Eritrea vom März 2016 notiert die EU als ihr »Schlüsselinteresse« die Reform des National Service, des Zwangsdienstes, der die jungen Menschen aus dem Land treibt. Dies sei Bedingung für die Auszahlung der 200 Millionen Euro aus ihrem Entwicklungsetat.58 Einen Monat später erklärt die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage: »Die eritreische Regierung erscheint bestrebt, die Dauer des Nationalen Dienstes auf die offiziellen 18 Monate zu beschränken, kann den Jugendlichen aber im Anschluss keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Arbeitsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten sind für die Regierung daher zentrale Voraussetzung für eine flächendeckende Senkung der tatsächlichen Dienstzeit. Deutschland kann über Unterstützung in den Bereichen berufliche Bildung und Beschäftigungsförderung dazu einen wichtigen Beitrag leisten.«59
In Berlin und Brüssel ist man offenbar willig, dem Regime diese Zusagen abzunehmen und auf positive Wendungen zu hoffen. Der EU-Delegationsleiter in Asmara, Christian Manahl, sagt: Die EU habe Afewerkis Regime keine Vorbedingungen gesetzt, man erhoffe sich jedoch durch eine Kooperation eine »Verbesserung der Regierungsführung«. Als Beispiel nennt auch er die Reform des National Service. Die EU übe »Druck« aus, diese Reform auch »umzusetzen«.60
Die deutschen Behörden hoffen offenbar, dass mit einer Liberalisierung der Lage in Eritrea bald auch dessen Staatsangehörige kein Recht mehr auf Asyl genießen. Mit dem Schweizer Staatssekretariat für Migration hat das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im ersten Halbjahr 2016 eine Delegationsreise nach Asmara unternommen. Die Beamten wollten herausfinden, wie gefährlich es in Eritrea tatsächlich ist. Im Abschlussbericht heißt es: »An der Grenze wird nicht systematisch auf illegal Ausreisende geschossen, Schüsse können aber vorkommen.«61
»Die Regierung tut das Äußerste, was sie tun kann, unter den gegebenen Umständen«, sagt Informationsminister Ye-mane Ghebremeskel am 25. Februar 2016 der Nachrichtenagentur Reuters: Die »Gehälter« für den Dienst würden steigen, »aber es gab keine Pläne, den nationalen Dienst zu beenden oder zu verkürzen«. Eine »Demobilisierung« sei nur möglich, wenn die Bedrohung durch Äthiopien entfalle.62