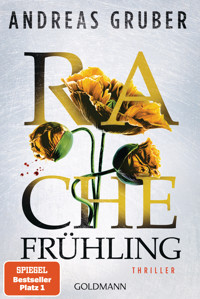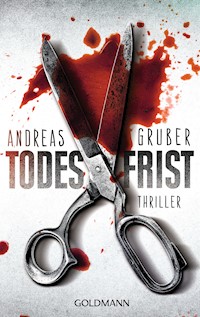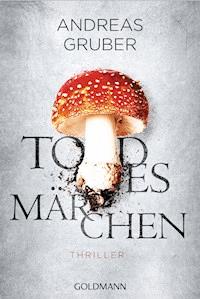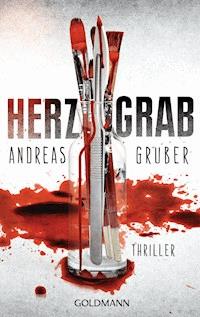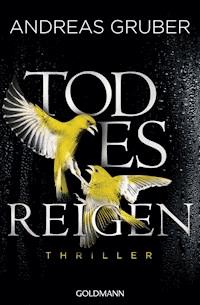Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Andreas Gruber Erzählbände
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Gruber erzählt Geschichten über die gefährliche Diskette eines russischen Wissenschaftlers, abartigen Sex für einen guten Zweck und den Plan eines raffinierten Auftragskillers, der selbst zum Opfer wird. Entdecken Sie eine James-Bond-Hommage und den ersten Kurz-Krimi mit dem niederländischen Profiler Maarten S. Sneijder. Gruber entführt Sie außerdem in die Wüste Nevadas, ins Wien des Jahres 1953 und nach Miami an Bord des größten Kreuzfahrtschiffs aller Zeiten. 18 CRIME STORYS, VON KRIMI-SATIRE BIS PSYCHO-THRILLER. "Andreas Gruber kann absurd, finster, charmant, humorvoll und nervenzerfetzend schreiben – und das alles in einem Buch." [Marc Elsberg]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
ANDREAS
GRUBER
DINNER
IN THE
DARK
ACHTZEHN CRIME-STORYS
Copyright © 2019 by Andreas Gruber
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München
Deutsche Erstausgabe
© 2019 LUZIFER-Verlag
www.luzifer.press
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Michael Schubert | Luzifer-Verlag
ISBN: 978-3-95835-406-7
eISBN: 978-3-95835-407-4
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2019) lektoriert.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Dagmar Kern,als Dank und zur Erinnerungfür die vielen langen nächtlichen Telefonate
»Die Nacht hat ihre Kerzen ausgebrannt.«
William Shakespeare
INHALT
Vorwort
Wir vom Sicherheitsdienst
Das tapfere Schneiderlein
Ein blöder Zufall
Katzenaugen
Rasputins Fluch
Gefrierender Bodennebel
Auf der Waschmaschine liegt ein Zettel
Zwei Tickets nach Sulina
Die Kinder des Triestingtals
Die Simulationsmaschine
Sonntagabend am Kanal
Hagens älteste Lustgrotte
Harte Zeiten für Legastheniker
Jakob
Letzter Vorhang - Shakespeare einmal anders
Dinner in the Dark
Die Bücher des Professor Krux
Mein Name ist Baxter … Ian Baxter
Quellenverzeichis
Vorwort
Im Januar dieses Jahres fuhr ich mit dem Zug nach Berlin zur 21. Internationalen Tattoo-Convention. Ich selbst habe keine Tätowierungen, dafür bin ich viel zu feige, aber ich musste beruflich dorthin.
In der Arena Berlin tagte eine Messe wie jede andere, nur dass hier schrillere Vögel als sonst herumliefen, mit Brandings am Körper, Piercings in den Schläfen und bunten Tattoos auf Schultern und Schädeln. Dort sollte ich meinen jüngsten Erzählband Die letzte Fahrt der Enora Time präsentieren. Das war der sechste Band meiner Werkausgabe mit sämtlichen Kurzgeschichten aus dem Luzifer Verlag. Der Raum, in dem ich die Lesung hielt, die mir der Luzifer-Verlagsleiter Steffen Janssen organisiert hatte, lag über eine enge Treppe erreichbar im Keller, war klein und bot gerade mal Platz für zwanzig Personen. Anwesend waren jedoch nur drei.
Toll, dachte ich.
Im Stock darüber barst die große Halle förmlich unter dem Zustrom der Besucher. Vermutlich lag es daran, dass meine Lesung nirgends angekündigt worden war und mein Podest nur aus einer wackeligen Holzpalette bestand, über die bloß ein schwarzes Samttuch gelegt worden war. Dank des schmalen Oberlichts war es so dunkel wie in einem Bärenarsch, und das einzig Funktionierende an dem Mikrofon waren die Rückkopplungen.
Honorar für die Lesung gab es wie üblich keines – im Gegenteil, die Veranstalter hatten mir sogar vierzig Euro für den Eintritt abgeknöpft! Das kannte ich bereits seit Jahren. Also nichts, was mich sonderlich schockierte.
Während ich aus der Titelstory Die letzte Fahrt der Enora Time las und das Publikum meine Bemühungen mit stoischer Miene honorierte, kam ein vierter Besucher die Treppe herunter und betrat den Raum. Ich schielte kurz zur Tür.
Scheiße!
Es war Steffen Janssen höchstpersönlich!
Er zog den schwarzen Hut vom kahl geschorenen Schädel und strich sich den Schnee von den Schultern seines bodenlangen Ledermantels. Murmelnd in ein Selbstgespräch vertieft ging er mit schweren Stiefeln und einem Stock mit weißem verknöchertem Knauf, der einem Totenschädel ähnelte, nach vorne. Plötzlich roch es nach Tod. Als er sich in der ersten Reihe in einen Sitz fallen ließ, erhoben sich die anderen drei Besucher und verließen den Raum. Profi, der ich war, las ich unbeirrt weiter. Zwar innerlich verkrampft, aber vielleicht würden die drei Zuhörer ja wiederkommen.
Ein Irrtum!
Steffen Janssen führte seinen etwas merkwürdigen Verlag in Schleswig-Holstein. Merkwürdig deshalb, weil die Cover seiner Bücher allesamt aussahen, als hätte sie ein Geisteskranker in einer psychiatrischen Anstalt nach einer Elektroschock-Therapie entworfen. Und sein Lektor und Setzer war ein verrückter Tattergreis, der offenbar direkt aus der Hölle entsprungen war – zumindest klangen die E-Mails danach.
Steffen zahlte seine Honorare an die Autoren bar in abgegriffenen Banknoten, die nach Moder rochen, als hortete er sie bündelweise, umgeben von Nebel und Sumpf, in einer tiefen Gruft. Außerdem ließ er seine Bücher in einer Druckerei in den rumänischen Karpaten auf seltsam ledrigem Papier drucken, sodass die Seiten beim Umblättern ein erschrecktes Quäken von sich gaben.
Er brachte jedes Jahr nur genau 13 Bücher heraus. All diese Werke erschienen stets am 6. Juni und wurden pünktlich um 6 Uhr früh ausgeliefert. Ein magisches Datum, wie er behauptete.
Er signierte seine E-Mails stets mit »Der Lord« und seine Webseite lag auf einem Server des Darknets. Soviel hatte ich bereits herausgefunden. Außerdem schrieb er wöchentlich Kommentare in diversen Internet-Foren, die man besser nicht aufsuchte. Einer Person wie Steffen ging man sowieso lieber aus dem Weg, es sei denn, man wollte in einen dunklen Abgrund gezogen werden.
Aber nun saß er hier vor mir!
Warum ich meine gesamten Kurzgeschichten in einer sechsbändigen Werkausgabe ausgerechnet in seinem Verlag veröffentlicht habe, wollen Sie wissen? Nun, das frage ich mich mittlerweile auch. Dummerweise hatte ich vor einigen Jahren auf einem Literaturfestival in Karlsburg in Siebenbürgen nach einer durchzechten Nacht mit zu vielen Bechern Absinth diese Verträge von ihm unterzeichnet. Aus dem Deal konnte ich nicht aussteigen, denn Steffen besaß kompromittierende Fotos von mir und einer lebenden schwarzen Katze, mit der ich … na ja, Schwamm drüber! Wie auch immer. Die Storys waren überarbeitet, die Bücher waren erschienen, ich hatte die Lesung gehalten und danach konnte er mich kreuzweise. Ich hatte aus meinen Fehlern gelernt und würde in Zukunft besser aufpassen, bei wem ich was unterschrieb.
Nach der Lesung kam Steffen zu mir ans Pult, setzte sich auf den Tisch, sein Ledermantel knirschte, und er schlug ein Bein über das andere. »Tagchen«, knurrte er. Seine Miene blieb ernst.
»Hallo«, sagte ich. »Wie hat dir die Lesung gefallen?«
»Hab schon wesentlich besseres gehört, zwar nicht von dir, aber von anderen Autoren.«
Wow! Was für ein Kompliment.
»Danke«, nuschelte ich.
»So, mein Lieber«, säuselte er nun und schlug seinen Stock auf den Boden. »Hast du die nächsten Storys für meinen Verlag schon fertig?«
Verlag! Dass ich nicht lache. Schreckenskabinett trifft es wohl eher.
»Die nächsten?«, wiederholte ich plötzlich verwirrt.
»Die nächsten achtzehn Storys!«
Mir wurde heiß. Anscheinend machte er keine Witze. »Welche achtzehn Storys?«, fragte ich.
»Welche achtzehn Storys?«, äffte er mich nach und rollte mit den Augen, sodass die Pupillen für einen Moment verschwanden. »Andreas, du bist doch nicht etwa nervös?«
»Nervös? Ich? Warum?« Ich verbarg meine Hände unter dem Tisch.
»Warum? Weil du nur noch eine Woche bis zum Abgabetermin hast.«
»Welcher Abgabetermin?« Panik breitete sich in meiner Stimme aus.
Steffens Gesichtszüge veränderten sich. »Du blöder Hund schuldest mir noch achtzehn Texte.« Er tätschelte meine Wange mit der rechten Hand, an der sich an jedem Finger ein schwerer Ring befand. Dann zog er einen abgegriffenen Vertrag aus seiner Tasche und warf ihn mir hin.
Ich starrte auf das Papier.
Es war ein Exemplar jenes Vertrages, den ich vor einigen Jahren auf dem Karlsburger Festival nach dem siebten Becher Absinth leichtfertig unterschrieben hatte.
»Und? Ich habe die sechs Bücher doch abgeliefert.«
Er verdrehte die Augen und wandte den Kopf zur Seite.
»Der Idiot hat keine Ahnung«, sagte er zu sich selbst, als wäre ich nicht anwesend.
Die Situation, in der ich mich plötzlich befand, kam mir wie ein schlechter Scherz vor, zumal wir nie über weitere Storys gesprochen hatten.
Schließlich blätterte er zur letzten Seite. Am unteren Rand gab es eine klein gedruckte Fußnote, auf die Steffen mit seinem langen gekrümmten Fingernagel pochte – und ich schwöre bei Gott, an jenem Nachmittag sah ich diese Klausel zum ersten Mal. Dort stand, dass ich innerhalb eines Jahres einen siebten Story-Band mit achtzehn Kurzgeschichten abzuliefern hatte.
»In sieben Tagen ist Abgabetermin. Ich brauche deine achtzehn Texte. Klemm dich dahinter und schreib sie – irgendwie! Aber streng dich an, damit sie nicht so mies werden wie beim letzten Mal.«
Meine Kehle wurde trocken. »Ich habe keine achtzehn Storys«, krächzte ich. Mir wurde schwindlig. »In dieser Zeit schaffe ich höchstens einen neuen Text, und der wäre nicht einmal gut.«
»Keiner deiner Texte war jemals wirklich gut.« Er machte einen Schmollmund. »Außerdem ist das nicht mein Problem.«
Ja, es war mein Problem, ein ziemlich schlimmes noch dazu, denn mit meiner derzeitigen Schreibblockade würde ich in sieben Tagen nicht mal die Eröffnungsszene einer Story schaffen.
»Das bekomme ich nicht hin«, krächzte ich.
»Warum nicht?«
»Schreibblockade«, presste ich hervor und packte mein Buch, aus dem ich gelesen hatte, in die Tasche.
Schreibblockade war noch freundlich untertrieben. Totales inneres Embargo kam der Sache schon deutlich näher. Angelangt am Kreativen Ground Zero traf es wohl am besten. Seit ich den letzten Luzifer-Band abgeliefert hatte, lähmte mich eine Sperre und ich war nicht einmal in der Lage, eines meiner Bücher zu signieren.
»So, so, der Herr Autor hat plötzlich eine Blockade.«
»Steffen, ich schätze dich wirklich als großartigen Verleger«, log ich und versuchte dabei zu lächeln. »Aber …«
Er verzog keine Miene. »Gib dir keine Mühe. Ich weiß, was du hinter meinem Rücken über mich erzählst, und dass du versucht hast, Sanktionen gegen meinen Verlag bei der Katholischen Kirche zu erwirken.« Er spuckte auf den Boden.
Meine Kehle wurde trocken. Da hatte ich plötzlich eine Idee. »Okay, ich werde versuchen, die Texte rechtzeitig zusammenzustellen.«
»Möchte ich dir auch raten. Ich sage nur … Miauuuuu!«
Verdammt! Die Fotos! Ich war mir sicher, er würde sie veröffentlichen, falls ich nicht nach seiner Pfeife tanzte.
Ich versuchte zu schlucken. »Steffen, ich habe nur noch Texte aus alten Anthologien. Doch daran besitze ich keine Rechte – die fallen erst in ein paar Jahren wieder …«
»Dein Problem!«
»Aber ich könnte sie besorgen.«
»Mach das!« Er schnappte sich den Vertrag und wedelte mir damit vor der Nase herum. »Besorg die Storys – egal wie.« Er machte ein Gesicht, so freundlich wie eine Gefängnistür. »Sonst veröffentlichen wir nicht nur die Fotos, sondern holen auch deine Frau und deine fünf Katzen nach Schleswig-Holstein.«
Schleswig-Holstein! In den hohen Norden, in die Nähe von Kiel. Die Ostsee! Dort war der Sitz seines Verlages. Ich kannte den Keller seiner Villa. O Gott!
Ich schluckte.
»Du hast sieben Tage Zeit.«
Sieben Tage! Das erinnerte mich an einen schlechten Film.
Er erhob sich vom Tisch und verließ den Raum. Durch das Oberlicht sah ich, dass es heftig zu schneien begonnen hatte.
Statt mit dem Zug zurück nach Wien zu fahren, blieb ich in Berlin und löste ein Ticket für die U-Bahn. Das war der erste spontane Gedanke, der mir in den Sinn kam: Ich musste meinen Autorenkollegen Boris Koch besuchen. Er hatte in den letzten Jahren zwei Anthologien herausgebracht, in denen ich mit je einer Story vertreten war. Er würde mir garantiert helfen – befreundete Künstler in Not unterstützten sich ohne Wenn und Aber.
Am südlichen Stadtrand von Berlin musste ich in einen Bummelzug umsteigen, der mich an die Grenze zu Brandenburg in den Spreewald brachte, wo das Büro von Boris Kochs Medusenblut-Verlag lag.
Der kleine Bahnhof mitten im Wald war nett und heimelig. Der Ort lag direkt an der Kuckol, einem reißenden Bächlein, und erinnerte mich mit den vielen Giebeln und Türmchen an die Stimmung aus Grimms Märchenwelt. Schnee lag auf den spitzen Hausdächern, fette Krähen saßen auf den Schornsteinen, bleigrauer Nebel kroch vom Bachbett herauf.
»Ich suche Boris Koch vom Medusenblut-Verlag«, sagte ich zu einem Schafhirten, der Pfeife rauchend vor dem Wartehäuschen des Bahnhofs stand.
»Den Markgraf Koch?«, hustete er.
Der Markgraf? Was war das denn für ein Idiot?
»Ja, wahrscheinlich …«, murmelte ich verunsichert.
»Bist du dir absolut sicher?«, fragte er mich.
»Ja, ich denke schon …«
»Dann komm mit, Junge.«
Er brachte mich mit seinem Holzwägelchen, das von zwei fetten großen Schafen gezogen wurde, auf eine Anhöhe im Wald. Die anderen Tiere trotteten hinterher. Vor einer einsamen Schlosskapelle hielt er. »Wir sind da«, knurrte er.
Ich stieg aus und ging zu der mächtigen Holzpforte. Äußerlich glich das Gebäude, in dem angeblich der Markgraf hauste, einem verfallenen Zisterzienserkloster. Es musste sich um eine Verwechslung handeln. Noch bevor ich sagen konnte, dass hier wohl kaum mein Autorenkollege wohne, war der Hirte mit dem Wagen und seinen Schafen auch schon im Wald verschwunden. Zurück blieb der Gestank nach Lammkot, der mir an den Schuhen klebte.
Ich musste den Hausherren wohl bitten, ob er mich zurück in den Ort bringen konnte, also pochte ich mit dem eisernen Klopfer. Er hatte die Form eines … Medusenhauptes.
Ein hagerer Mann mit kantigen Gesichtszügen, schlohweißem Haar, einem Mantel aus weinrotem Samt mit hohem Kragen und einem schlanken Raben auf der Schulter öffnete mir die Tür. Herrgott! Das musste Boris Koch sein, der Verlagsleiter. Ich kannte ihn zwar nicht persönlich, aber zumindest glaubte ich, ihn aufgrund von Pressefotos zu erkennen. Seine Augen lagen tief, sein aschfahler Teint wirkte ungesund, als litt er unter einer seltenen Blutkrankheit.
»Bist du …?« Ich stockte. »Sind Sie Boris Koch?«
»Der Markgraf, ja«, wisperte er heiser, ohne die Lippen zu öffnen.
»Äh, guten Abend …«, stammelte ich. »Ich komme …«
»Aus Wien«, unterbrach er mich mit leiser Stimme. »Das hört man. Kommt herein, seid mein Gast. Doch bitte ich Euch, leise zu sein … mein Gehör ist empfindlich. Ich hörte Euer Keuchen bereits von weitem.«
Er rümpfte die Nase und trat zur Seite. Hinter ihm lag ein unendlich langer Korridor, der viel tiefer in das Gebäude reichte, als ich es von außen für möglich gehalten hatte.
»Schuhe abtreten«, befahl Boris Koch.
Ich gehorchte, danach führte er mich im wahrsten Sinn des Wortes in sein Reich. Im Gang lag ein schwerer Brokatteppich, der jedes Geräusch dämpfte. Dennoch versuchte ich, leise aufzutreten. Im Spiegelsaal brannten Hunderte rote Kerzen. Es roch nach Weihrauch. Aus einer Grube drang das Zischen von Schlangen und über einem Ungetüm von einem Sofa aus rotem Satin schwang ein mächtiges, lautloses Pendel wie von einer gigantischen Uhr.
»Was führt Euch zu mir?«
Ich erklärte ihm, was ich wollte. Er lächelte gnädig und ließ sich mit einem Glas Wein der Länge nach auf dem Sofa nieder. Allerdings trank er nicht. Stattdessen nippte der Rabe regelmäßig an dem Wein.
Zweifelsohne bemerkte Boris Koch meinen verwirrten Blick. »Ein guter Tropfen Amontillado, Jahrgang 1849«, erklärte er.
»Was ist nun mit den Rechten?«, fragte ich nach einer Weile.
»Wisst Ihr, meine Bücher entstehen nicht einfach in einer Druckerei. Es bedarf einer gewissen Handfertigkeit, edlen Pergaments und einer speziellen Druckertinte.«
Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach.
»Legt Euch doch zu mir.« Er klopfte auf die schmale freie Stelle neben sich. Staub flog vom Sofa auf.
Ich blieb stehen.
»Wie viel sind Euch die Rechte an einer Geschichte wert? Wie viel seid Ihr bereit, zu geben, mein teurer Freund? Hundert Milliliter? Oder zweihundert?«
»Milliliter wovon?«, krächzte ich.
Der Rabe blickte kurz auf.
Statt zu antworten, betätigte Boris Koch einen Hebel neben dem Sofa. Augenblicklich stoppte die Bewegung des Pendels. Es begann sich zu senken. Nun erkannte ich, woraus die Spitze des Pendels bestand. Eine hauchdünne Injektionsnadel, von der ein weinroter Schlauch ins Innere des Pendelarms verschwand.
»Sagt es mir«, forderte er mich auf.
Selbst der Rabe, der mich mit kohlschwarzen Augen fixierte, schien auf eine Antwort zu warten.
Als ich die Schlosskapelle verließ, klebte ein dickes Heftpflaster mit einem Druckverband an meiner Halsschlagader. Außerdem war ich etwas wackelig und schwach auf den Beinen. Aber ich besaß die Rechte an den ersten zwei Storys.
Wieder auf dem Bahnhof im Spreewald angekommen, betrat ich sogleich die einzige altertümliche Telefonzelle, die es gab, und wählte die Nummer von Hardy Kettlitz. Er und Hans- Peter Neumann wohnten in Berlin und führten den Shayol-Verlag. Alte, gute Kumpels von mir, die bereits drei Anthologien mit je einem Beitrag von mir rausgebracht hatten. Es waren Kollegen, die im selben künstlerischen Geist wie ich Bücher veröffentlichten. Sie würden Verständnis für meine Lage haben. Als ich Hardy am Telefon hatte, sprudelte ich freudig drauflos.
»He, Hardy, schön, dich mal wieder zu hören. He, ich bin zufällig in Berlin. Wir könnten uns treffen, was meinst du? Ein paar Projekte besprechen und … ähm … über die Rechte älterer Texte plaudern.«
»So, so«, antwortete er nur. »Über Rechte plaudern …« Er schwieg eine Weile. Dann sagte er: »In fünf Stunden, im Norden Berlins, am Zabel-Krüger-Damm, in einer Kneipe, die sich Zum Eisernen Anus nennt. Sei pünktlich.« Danach legte er auf.
Ich war pünktlich. Hardy Kettlitz und Hans-Peter Neumann erwarteten mich bereits in einer dunklen Nische mit Rundbogen aus Backsteinziegeln. Sie saßen bei einer teuren Flasche Côtes du Rhone.
»He, hallo Jungs«, begrüßte ich sie. »Schön euch zu …«
»Lass das Gefasel und komm zum Punkt!«, unterbrach Hardy mich.
»Okay, also ich …« Ich setzte mich an den Tisch. »… brauche die Rechte an meinen drei Storys.«
Hardy verzog keine Miene. Er warf Hans-Peter einen Blick zu. »Kaum ist er halbwegs erfolgreich mit seinen Scheiß-Krimis, kommt er an und will die Rechte an seinen Storys zurück.«
Hans-Peter saß geduckt da, den Blick auf das Tischtuch gerichtet. »Ich hab dir gleich gesagt, dass er so ist«, flüsterte er.
Ich war wie vor den Kopf gestoßen. »Also, nein, ich …«
»Und du glaubst, mit einem Kleinverlag, wie wir ihn führen, können wir es uns leisten, die Kosten für den Druck der Bücher aus der eigenen Tasche vorzufinanzieren und noch bevor sich die Ausgaben wieder eingespielt haben, die Rechte rauszurücken?«
»Also, ich wusste nicht, dass es …«, stammelte ich.
»Ich hab dir gleich gesagt, der kapiert das nicht«, flüsterte Hans-Peter.
Ich atmete tief durch. »Okay, was verlangt ihr?«
Hardy goss etwas Wein in ein leeres Glas. »Nur zu«, forderte er mich auf. »Geht auf Kosten des Verlages«, sagte er sarkastisch. »Wir haben es ja ziemlich dicke!«
Ich nippte aus Höflichkeit daran, verzog aber das Gesicht. Der Wein schmeckte grässlich.
»Hast du Amalgamplomben?«, fragte Hardy.
Ich lächelte. »Nein, natürlich nicht.«
»Keramik-Inlays?«
»Nein, Goldfüllungen.«
Hardy hob eine Augenbraue.
»Ich hab dir gleich gesagt, der ist stinkreich«, flüsterte Hans-Peter.
Stinkreich? Ich? Mir wurde plötzlich etwas heiß und schwummrig. Ich blickte zu dem Weinglas. Erst jetzt bemerkte ich, dass weder Hardy noch Hans-Peter von dem Wein getrunken hatten.
»Der Verlagsjob wirft finanziell ja nicht so viel ab. Hans-Peter ist hauptberuflich Tierarzt«, erklärte Hardy und deutete mit einer Kopfbewegung zur Ziegeldecke. »Führt seine Praxis oben. Weil er Hunde und Kater kastriert, hat er einen kleinen chirurgischen OP.« Bevor ich ohnmächtig vom Stuhl fiel, sah ich noch, wie Hardy dem stämmigen Kellner zuwinkte, der herbeieilte und mich auffing.
Als ich wieder auf der Straße stand, herrschte finstere Nacht. Schnee fiel. Es war ein sternenklarer Himmel. Mein Mund fühlte sich so dick an, dass man problemlos ein Fass darin hätte verstecken können.
Hans-Peter hatte mir vier Goldplomben entfernt und durch schreckliche Amalgamgebilde ersetzt. Drei für die Rechte an drei Storys – die vierte als Entschädigung dafür, dass er seine Praxis wegen der OP für die Dauer von einer Stunde hatte schließen müssen. Jedenfalls war ich froh, dass er mit mir nicht das Gleiche getan hatte wie mit den Hunden.
Die Typen aus der Kleinverlags-Szene konnten mich mal! Wegen der Rechte an den nächsten drei Storys würde ich mit einem Profi verhandeln. Ich wusste auch schon, wer das sein sollte. Frank Festa vom Festa-Verlag! Er war ein Mann, auf dessen Wort man sich verlassen konnte, der seinen Verlag professionell führte. Er würde mir helfen können – auch ohne seltsame Bedingungen.
Ich fuhr mit dem Nachtzug nach Leipzig. Während der Fahrt telefonierte ich mit meiner Frau in Wien, die mich bereits seit Stunden aus Berlin zurückerwartete. Ich erklärte ihr, dass meine Reise unerwartet länger dauern würde. Von den Komplikationen erwähnte ich nichts, wollte ich sie doch nicht unnötig beunruhigen. Außerdem hatte sie mich stets gemahnt, immer das Kleingedruckte zu lesen, bevor ich einen Vertrag unterschrieb.
»Du klingst so merkwürdig«, sagte sie.
»Alles in Ordnung«, nuschelte ich mit geschwollener Wange.
Ich wollte bereits auflegen, da berichtete sie mir, zwei grobe, hoch gewachsene Männer mit ruppigem, deutschem Dialekt aus der Nähe von Kiel in Begleitung von zwei sabbernden Rottweilern seien in unserem Haus zu Besuch gewesen. O Gott, die kamen bestimmt vom Verlag! Sie hatten sich erkundigt, ob alles nach Plan verlaufen würde. Die Stimme meiner Frau klang nicht gerade entspannt.
»Ich soll dir von den beiden Kerlen ausrichten, dass sie mich und unsere fünf Katzen im Auge behalten würden. Außerdem wollten sie wissen, ob wir noch weitere Haustiere haben. Andreas, was meinen die damit?«
»Ich versichere dir, es ist alles in Ordnung. Ich liebe dich.«
»Wer waren die Kerle? Kennst du die?«
»Der Zug fährt gerade in einen Tunnel … die Verbindung …« Ich rieb das Mikrofon des Handys an meinen Jeans, danach unterbrach ich das Gespräch und schaltete das Telefon aus. Je weniger sie wusste, desto besser.
Schweiß stand mir auf der Stirn. Alles im grünen Bereich, sagte ich mir. Ich würde die Rechte an den restlichen Storys noch auftreiben. Kein Problem. Frank Festa war ein guter, alter Kumpel von mir.
Am nächsten Morgen starrte ich unausgeschlafen und komplett verspannt aus dem schmalen, vorsintflutlichen Zugabteil in die graue Landschaft. Eine halbe Stunde später kam der Zug in Rammelfangen an, einer winzigen Gemeinde westlich von Leipzig.
An jenem kalten, nebeligen Dezembermorgen, als ich einsam am Bahnhof stand, erinnerte die Gegend mit ihrer Pfarrei, den engen menschenleeren Gässchen, dicht gedrängten Häusern, schwarzen Holztüren und Kellerabgängen, aus denen scharfer Kalkgeruch empordrang, an ein mittelalterliches Kaff, dessen Einwohner von der Pest dahingerafft worden waren. Auf dem Hügel hinter dem Ort hockte die Silhouette einer windschiefen Burg.
Ich versuchte ein Taxi zu finden, entdeckte jedoch nur eine Kutsche mit zwei Gäulen und einem Schild auf dem Dach, das auf eine sächsische Sehenswürdigkeiten-Rundfahrt hinwies.
»Ich suche einen gewissen Frank Festa vom Festa-Verlag«, rief ich durch den Nebel zum Kutscher hinauf, der in einen dicken Mantel gehüllt auf dem Bock saß.
»Festa-Verlag«, murrte er und schlug hastig ein Kreuzzeichen.
»Können Sie mich hinbringen?«, fragte ich.
Der Kutscher hob den Blick zu den Bergen. »Natürlich … es ist ja noch hell. Dafür verlange ich aber den doppelten Lohn. Allerdings fahre ich Sie nicht direkt bis zur Burg. Die Pferde scheuen leicht … Gott stehe uns bei.«
Burg?
Ich war einverstanden und stieg ein. Die Fahrt ging raus aus dem Ort, führte durch ein dichtes Waldstück und danach über einen schmalen felsigen Pfad in die Berge. Nach etwa einer Stunde schälte sich ein dunkles Gemäuer aus den Nebelfetzen, die wie eine Dunstglocke im Gebirge festhingen. Der Kutscher hielt und ließ mich aussteigen. Den Rest des Weges lief ich zu Fuß.
Ich erinnerte mich an die Schmerzen in meiner rechten und linken Wange. Schlimmer konnte es nicht mehr werden … dachte ich zumindest.
Nachdem ich an die Tür geklopft hatte, dauerte es eine Weile, bis Frank Festa höchstpersönlich öffnete. Ich kannte ihn von diversen Fotos und hatte bereits mehrmals mit ihm telefoniert. Er hatte sich stets als eloquenter und sympathischer Geschäftsmann präsentiert. Dennoch war ich überrascht, wie groß der Mann tatsächlich war. Er überragte mich gut und gern um einen Kopf, war breit gebaut, mit einer Gestalt, die mich an den Prager Golem erinnerte. Darüber hinaus trug er einen schwarzen Umhang, an dessen Innenseite kopfüber tote Fledermäuse hingen. Wie er so dastand, bemerkte ich, dass er darauf achtete, stets im Schatten des Torbogens zu bleiben, sodass ihn das milde, durch die Nebelfetzen fallende Sonnenlicht nicht berührte.
Ich stellte mich vor und fragte ihn geradewegs heraus nach den Rechten meiner drei Kurzgeschichten, die ich bislang in Anthologien seines Verlags veröffentlicht hatte.
Offensichtlich wusste er bereits, während ich sprach, worauf ich hinauswollte, da er mich sanft unterbrach. »Normalerweise regeln solche Fälle meine Anwälte beim Amtsgericht Leipzig«, sagte er bedächtig mit sonorer Stimme. Die riesigen Fingerknöchel seiner Hände knackten. »Doch in Ihrem Fall, Herrr Grrruber, werden wir bestimmt eine andere Lösung finden.« Er ließ das rrr wie Boris Karloff bei einem seiner gruseligsten Auftritte rollen.
»Vielen Dank«, nuschelte ich.
»Was ist mit Ihrem Mund geschehen?«, fragte er.
»Wie bitte?«
»Ihr Mund!«
»Ach nichts«, presste ich hervor.
»Sie sollten den Zahnarzt wechseln.« Der Anflug eines Schmunzelns huschte über sein Gesicht. Dann legte er mir seinen langen Arm mit der großen Pranke auf die Schulter und zog mich in sein Haus. Da erst bemerkte ich die enorme Länge seiner gekrümmten gelben Fingernägel. Hinter mir fiel die schwere Tür ins Schloss. In seinem Salon bot er mir eine Schale Schwarztee an, der nach bitterer Galle schmeckte. Daraufhin führte er mich über eine lange, schmale, gewundene Marmortreppe in den Keller. Es war feucht, roch nach Moder, und aus den Rissen in der Mauer drang das Quieken von Getier.
»In meinem Büro«, erklärte er lächelnd, »bewahre ich seit 1766 alle Verträge auf.«
Seit 1766?
In den Wandregalen neben den Hunderten Folianten standen Dutzende Vitrinen, gefüllt mit Glasbehältern, in denen merkwürdige Objekte in einer gelblichen Lauge aus Alkohol schwammen.
Festa führte mich zu einem Holzregal, das schief in einer Wandnische hing. Vor jedem Glas stand ein handgeschriebenes Kärtchen mit einem Namen darauf: Poe, Shelley, Byron und Stoker. In jedem Behälter schwamm ein Finger. Abgetrennt am Handwurzelknochen. Wenn das Kerzenlicht darauf fiel, konnte man sogar den weißen Knochen erkennen. Am anderen Ende des Regals standen weitere Gläser, in denen Augen, Ohren und Nasen schwammen. Auf den Kärtchen standen Namen wie Lovecraft, Bierce, Bloch, Blackwood, Campbell, Howard oder Hodgson.
»Rückgabe von Rechten besiegle ich gern mit einem persönlichen Vertrag.« Er schmunzelte. »In Ihrem Fall handelt es sich um drei textliche Elaborate, Herrr Grrruber.« Das rrr rollte wieder, und es klang wie aus der Gurgel eines Wahnsinnigen. »Allerdings würde ich mich …« Er lächelte sanftmütig. »… mit einem Fingerrr begnügen.«
»Einverstanden«, sagte ich.
»Pro Story.«
»Oh!«
Ich wusste, er machte keinen Scherz! Ich wollte so rasch wie möglich aus diesem Panoptikum des Grauens verschwinden, doch in diesem Moment merkte ich, wie der Tee zu wirken begann. Nicht schon wieder! Der Raum fing an, sich um mich zu drehen, und Frank Festa schob mir mit dem Fuß einen Stuhl unter den Hintern …
Nachdem ich das KunstStoff-Magazin, die Verlage Aarachne, Ars Vivendi, Falter, Obelisk, Capricorn, Grafit und den Club Bertelsmann abgeklappert hatte, trug ich weitere Narben am Rücken, auf der Brust und an den Schultern. Mein linker Arm war nicht mehr zu hundert Prozent beweglich, die große rechte Zehe fehlte mir, ein Auge schmerzte wie von Säure verätzt, und an einer Stelle an meinem Hintern würden wohl nie wieder Haare wachsen. Außerdem war ein Teil meines Gehirns unwiederbringlich entfernt worden. Als Folge davon konnte ich statt eines L nur mehr ein N sagen. Mir fehlten zwar immer noch die Rechte an zwei Texten, um die achtzehn voll zu haben, aber ich hatte bereits eine Idee, woher ich die bekommen würde. Ich saß im Zug, auf dem Weg zum Münchner Flughafen, wo ich einen Flug nach Mallorca gebucht hatte. Während der Fahrt telefonierte ich mit meiner Frau, damit sie sich keine Sorgen machen brauchte. Schließlich war ich in der Zwischenzeit kein einziges Mal zu Hause gewesen.
»Schatz, ist alles in Ordnung bei dir?«, fragte sie mich besorgt.
»Annes bestens, mein Niebning.«
»Ich mache mir Sorgen.«
»Wozu? Das ist doch nächernich!«
»Wann wirst du zurückkommen?«
»Ich muss nur noch rasch geschäftnich nach Mannorca fniegen. In Windeseine bin ich wieder zurück.«
»Nach Menorca?«, fragte sie.
»Nein, nach Mannorca«, korrigierte ich sie.
»Was? Du klingst so anders. Du meinst wohl Menorca?«
»Ja«, sagte ich schließlich und legte auf.
Der Mann an der Passkontrolle warf einen Blick auf meine mit Mullbinde bandagierte linke Hand, wo mir Frank Festa drei Finger mit einer extra stumpfen Zange abgezwickt hatte.
»Sind Sie beruflich oder privat unterwegs?«, fragte mich der Mann.
»Ich fniege berufnich nach Mannorca«, flüsterte ich.
Er sah mich merkwürdig an. »Gut, Sie können passieren!«, rief er schließlich.
»Nicht so naut«, flüsterte ich. Die höllischen Kopfschmerzen brachten mich um. Die Nähte an meinem Hinterkopf waren ja noch frisch.
Auf Mallorca gelandet, nahm ich mir ein Taxi, das mich in einer stundenlangen Fahrt über eine staubige Straße ans andere Ende der Insel brachte. Es war ein prächtiger Tag. Die Sonne schien, der azurblaue Himmel war wolkenfrei, die Möwen glitten kreischend übers Meer und die Fischkutter tuckerten vor den Klippen auf und ab.
Alisha Bionda lebte in einer Finca am Strand. Die Oberfläche des Swimmingpools spiegelte sich auf den sandfarbenen Mauern. Die braunen Fensterläden standen offen, Vorhänge wehten im Wind. Auf dem Balkon erschien Alisha und lehnte sich elegant an die Holzbalustrade. Ich kannte sie von Fotos – und von hunderten E-Mails, die ich im Lauf der Zeit mit ihr gewechselt hatte. Sie war total nett und brachte es gewiss nicht übers Herz, auch nur einer Fliege ein Haar zu krümmen. Langbeinig, mit wallendem braunen Haar und einem bunten Sari bekleidet, winkte sie mich mit einer graziösen Handbewegung zum Pool. Ich nahm unter einem Sonnenschirm zwischen zwei Palmen in einem Korbstuhl Platz.
Minuten später erschien Alisha in Begleitung eines hoch gewachsenen jungen Mannes mit Sonnenbrille. Er trug einen schwarzen Bart, hatte das lange pechfarbene Haar zu einem Zopf geflochten. Sein Teint war blass und er trug einen langen dunklen Mantel.
»Mi casa es su casa«, strahlte Alisha. Sie deutete zu mir. »Andreas Gruber«, stellte sie mich ihrem Begleiter vor. »Ein begnadeter Schriftsteller mit dem unverkennbaren göttlichen Talent eines jungen Goethe … Marc-Alastor.«
Ich erhob mich. Ihre lobenden Worte waren mir ein wenig peinlich. »Aber bitte, das ist zu vien der Ehre …«, sagte ich und blickte geschmeichelt zu Boden.
»Ich meinte damit natürlich Marc-Alastor«, entgegnete Alisha.
»Oh … natürnich.« Nun blickte ich erst recht zu Boden.
»Sei er willkommen auf der dunklen Seite der Insel, mein Bester«, murmelte Marc-Alastor und hielt mir seine mit schweren Silberringen bestückte Hand entgegen, wie ein Baron, der es gewohnt war, dass man seine Hand küsste.
Ich zögerte.
Alisha hob auffordernd eine Augenbraue, und schließlich küsste ich die Ringe an Marc-Alastors Hand.
»Nun denn, nehmt Platz!«
Auf dem Holztisch stand eine Obstschüssel. Marc-Alastor füllte ein Glas mit schwarzem Traubensaft. »Greift zu!«
Das wollte ich bereits, doch in letzter Sekunde zögerte ich. Ein drittes Mal würde ich nicht auf denselben Trick hereinfallen. »Ich bin nicht durstig«, krächzte ich.
»Wie es euch beliebt«, antwortete Marc-Alastor. »Wird er uns wohl verraten, was sein Begehr ist?«
»Nun, ähm …«, hüstelte ich. »Ich wonnte dich fragen, ob ich die Rechte an einer Novenne zurück haben dürfte, die in einer deiner Anthonogien erschienen ist?«
Die beiden sagten lange Zeit kein Wort. Das Lächeln verschwand aus Alishas Gesicht und Marc-Alastors düstere Züge wurden noch finsterer, als schob sich eine schwarze Wolke vor den Mond.
Schließlich lächelte Alisha. Ihr Blick fiel auf meine bandagierte Hand. »Du warst doch kürzlich bei Frank Festa, nicht wahr?«, fragte sie.
»Nein«, log ich und spürte, wie das eine mir verbliebene Ohr zu glühen begann.
»Die Verletzung an deiner Hand?«
»Ein Unfann im Fnieger. Ich habe mir die Finger in der Bordnuke eingeknemmt.«
»Wie tollpatschig, mein lieber Andreas.« Sie lächelte erneut, und es schien, als kannte sie die Wahrheit nur zu gut. »Und die Narben an deinem Kopf? Dein Sprachfehler? Dein Ohr? Du warst kürzlich nicht zufällig bei …?
»Nein!«, log ich.
Da kam ein langhaariger afghanischer Windhund aus der Finca, der sich vor Alishas Beinen zusammenrollte. »Sagt er die Wahrheit, mein Lieber?«, fragte Alisha und kraulte das Fell des Tieres.
Der Afghane wackelte einmal mit dem linken Ohr.
»Ich denke auch, dass er lügt«, murmelte Marc-Alastor.
»Wie sieht es nun mit den Rechten aus?«, fragte ich.
»Natürlich bekommst du die«, antwortete Alisha.
»Wir sind nicht so barbarisch wie Frank Festa, Boris Koch oder andere Kollegen aus der Branche.«
Irgendwie glaubte ich ihr nicht.
»Zweifelst du?«, fragte sie.
»Natürnich gnaube ich dir«, sagte ich rasch.
Alisha warf ihrem Begleiter einen wissenden Blick zu. Dieser nickte kaum merklich, erhob sich und begab sich ins Haus.
»Weißt du, warum das gebundene Buch im Vergleich zu einem E-Book-Reader so perfekt ist?«, fragte sie mich.
Ich schüttelte den Kopf.
»Weil es keine Ladezeit braucht. Es piept nicht im Restaurant und verbraucht keinen Strom.«
»Aha, keine Nadezeit«, wiederholte ich.
»Weißt du, wie wir hier auf den Balearen Bücher binden?«
»Nein, aber vermutnich …«
»Vermutlich hast du keine Ahnung«, fiel sie mir ins Wort. »Wir verwenden weder geringwertigen Leim noch billige Maschinen mit Klebebindung wie andere Verlage. Hier versteht man sich noch auf gutes solides Handwerk, das von Generation zu Generation überliefert wird. Manuelle Fadenheftung mit echten Sehnen und stabilem Pergament von höchster Qualität. Unsere Bücher haben Seele.«
Mir wurde übel – ich ahnte, worauf es hinauslief.
»Du kannst dir sicher vorstellen, dass wir nicht gern Rechte von Texten zurückgeben. Unser Buchdruck hier ist zu aufwendig, die Rohstoffe zu kostbar, um etwas vom Markt zu nehmen.«
Marc-Alastor trat wieder aus dem Haus. Er trug eine in schwarzen Samt gehüllte Ledermappe, die er aufschlug. In Dutzenden Schlaufen steckte chirurgisches Besteck.
»Natürlich bekommst du die Rechte an deiner Novelle zurück.« Alisha lächelte. »Als Gegenleistung genügen uns ein halber Liter Blut, drei Meter Sehnen und vierzig Quadratzentimeter deiner Haut.«
Dank zahlreicher Schmerzmittel verlief der Flug von Mallorca zurück aufs Festland ziemlich erträglich. Immerhin – ich war erfolgreich gewesen. Ich hatte noch einen Tag Zeit, mir fehlten nur noch die Rechte an der letzten Story – und ich wusste auch schon, woher ich sie bekommen sollte. Ich musste noch einmal zurück nach Deutschland.
In die Höhle des Löwen!
Ein letztes Mal!
Die Reise führte mich mit dem Zug und einem öffentlichen Bus in den Rheingau, wo ich die Herausgeber des Nocturno-Magazins besuchen wollte. Alte Freunde von mir aus jener Zeit, als meine Texte erstmals in Magazinen veröffentlicht wurden. Markus Kastenholz und Timo Kümmel waren mir bestimmt wohl gesonnen. Kameraden aus alten Tagen. Da war ich sicher.
Ein Pilger mit einem Wolfshund an der Leine brachte mich zwischen Walluf und Lorchhausen in den Wald des Taunusgebirges und zeigte mir den Weg zur Kalten Herberge. Dort lagen angeblich Büro und Lagerraum des Nocturno-Magazins. Da mittlerweile ein Bein kürzer war als das andere, konnte ich nicht mehr so schnell laufen. Außerdem sah ich nicht mehr besonders gut im Dunklen. Erst als ich näherkam, erkannte ich die Herberge. Sie lag gut verborgen unter dem verästelten Dach mächtiger Schwarzföhren. Als ich die Tür erreichte und das Schild sah, zuckte ich unwillkürlich zusammen. Es verhieß nichts Gutes.
WILLKOMMEN BEI NOCTURNO WIR BEISSEN NUR MANCHMAL!
Aus der Hütte klangen Klirren und dumpfes Pochen, als wurde ein Stein mit Hammer und Meißel bearbeitet. »Hanno!«, rief ich und klopfte.
Markus Kastenholz öffnete die Tür. Feiner Steinstaub lag auf den Gläsern seiner Brille. Er trug einen braunen Lederschurz und hielt einen schweren Hammer in der Hand.
Mit dem Finger wischte er sich den Schmutz von einem Brillenglas, sodass er wie ein einsamer Gebirgs-Eremit mit einer Augenklappe wirkte. Als er mich erkannte hoben sich seine Augenbrauen. »Timo!«, rief er. »Der Andreas ist da!«
Eine hölzerne Bodenluke in der Mitte des Raums wurde aufgestoßen. Timo Kümmel kletterte aus dem Keller, mit einer schweren Steinskulptur auf den Schultern.
»Tach!«, grüßte er. Dann erkannte auch er mich. »Mensch, Andreas. Komm rein, Alter, was für eine Freude. Was führt dich hierher?«
Die ersten wahrhaft freundlichen Worte, die mir seit sechs Tagen begegneten. Kein pseudo-freundschaftliches Gelabere von sogenannten Kollegen. Nein, diese beiden Kumpels waren in Ordnung. Ich trat ein. Abgesehen von dem Gips, der herumlag, roch es nach Kaffee und Muffins.
Timo ließ die wuchtige Skulptur in Form eines kriechenden dreibeinigen Esels von seinen Schultern auf den Boden gleiten. Für einen Augenblick glaubte ich ein Stöhnen aus der Figur zu hören, das ich mir aber sicher nur eingebildet hatte.
Ich blickte mich in der Hütte um. »Was veranstantet ihr hier? Ist das für das Coverbind des neuen Nocturno-Magazins?«
»Ne, wir arbeiten gerade an den Exponaten einer Ausstellung für das Berliner Pergamonmuseum«, erklärte Markus. »Freaks – Versteinerte Körper. Sie beginnt in wenigen Tagen.«
Er machte einen Schritt zur Seite und eröffnete mir den Blick auf eine lebensgroße, hässliche Marmorskulptur, an der er gerade arbeitete. Der Form nach handelte es sich um eine Metamorphose aus Fledermaus und buckligem Greis. Es schien, als wollte blasses menschliches Fleisch aus den Ritzen des Gesteins hervorquellen.
»Sehr schön …«, sagte ich. »Eigentnich bin ich gekommen, um nach den Rechten einer Kurzgeschichte zu fragen, die vor nicht annzunanger Zeit in eurem Niteraturmagazin …«
»Aber sicher«, antwortete Timo großzügig. »Was ist eigentlich mit deinem Auge passiert?«
»Och, annes in Ordnung.«
»Du könntest uns bei der Ausstellung helfen«, schlug Markus vor.
»… falls du die Rechte zurückhaben möchtest«, fügte Timo hinzu.
»Natürnich«, krächzte ich. »Kein Probnem.«
»Aber das hat Zeit.« Markus öffnete einen Schrank, nahm Servietten, Kaffeetassen und eine Zuckerdose heraus. »Siehst hungrig und durstig aus.« Er stellte alles auf einen Tisch zu einer Thermoskanne und einem Tablett mit Schoko-Muffins.
»Trinken wir erst mal einen Schluck Kaffee.« Er füllte die Tassen mit der Flüssigkeit aus der Thermoskanne. »Dann leg dich dort rein.« Er deutete ans andere Ende des Raums, wo eine mannsgroße Kiste stand, deren Bretter wie bei einer Holzverschalung von Zwingen zusammengehalten wurden.
Ich rührte die Tasse nicht an. Keine zehn Pferde würden mich je wieder dazu bringen, etwas zu trinken, das nicht original verschlossen war.
»Mann, zier dich nicht so«, drängte Timo. »Den Kaffee habe ich erst vorgestern frisch gebrüht.«
»Nieber nicht, danke.«
»Sei relaxt, Alter«, pflichtete Markus ihm bei. Er bemerkte, wie ich gierig auf die Muffins starrte. »Hat meine Mutter gebacken. Altes Rheingäuer Rezept mit Kokos, Krokant und Schokostücken.«
Ich stopfte mir einen Muffin in den Mund und legte mich in den Holzsarg. Vier Schläuche ragten in Kopf- und Hüfthöhe aus der Kiste. »Richtig so?«
»Klar doch, einfach entspannen, Alter.«
Eingetrocknete Betonstücke hafteten am Holz. Es roch nach Zement. Etwas klebte an der Innenseite der Bretter. Ich zupfte daran und glaubte, ein Stück Haut zu erkennen.
»Hast du frischen Zement angerührt?«, fragte Markus.
»Schon fertig …«, antwortete Timo.
»Ich habe es mir doch anders übernegt«, stammelte ich und wollte wieder aus der Kiste klettern, doch meine Bewegungen wurden langsam, meine Gelenke weich wie Gummi.
Der Muffin!
»Verfnuchte Scheiße, was ist …?« Im nächsten Moment fielen mir die Augen zu.
Ich erwachte in einem dunklen Raum. Es dauerte einige Tage, bis ich erkannte, was die beiden mit mir gemacht hatten. Doch zumindest war ich am Leben.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt leben nennen kann?
Ich habe gelernt, nicht wahnsinnig zu werden und mit der völligen Bewegungslosigkeit umzugehen. Auch habe ich mir angeeignet, flach zu atmen, da mein Brustkorb wie von einem Steinkorsett eingeengt ist. Der scharfe Beton brennt wie die Hölle auf der Haut. Oder ist es mittlerweile mein eigener Schweiß? Meine Augen brennen, meine Lippen sind aufgesprungen. Von den Schmerzen im Mund gar nicht zu reden. Vermutlich hat sich die Haut an manchen Stellen schon gelöst. Noch dazu kann ich mich nicht kratzen. Das treibt mich in den Wahnsinn! Der gesamte Körper juckt wie eine einzige offene Wunde, in der sich immer wieder neue Bakterien bilden und Pilze einnisten. Aber die höllischsten Schmerzen von allen würden erst in ein paar Wochen kommen, wenn sich meine Fingernägel nicht ausbreiten können und zurück in den Körper wachsen.
In der Dunkelheit habe ich erkannt, dass mich die vier Schläuche am Leben erhalten. Durch den Sprachtrichter bekomme ich Luft, durch den zweiten flüssige Nahrung, durch die beiden anderen Schläuche in Hüfthöhe kann ich … na ja, Sie können es sich bestimmt denken.
Falls Ihnen nicht zu sehr davor graut, können Sie die Ausstellung Freaks – Versteinerte Körper noch bis Ende nächsten Jahres im Berliner Pergamonmuseum besuchen. Mich können Sie als Exponat Nr. 13 betrachten, die Lebende Säule. Ich stehe ganz hinten, links in der Ecke des letzten Ausstellungsraums. Die zwei Meter hohe Betonsäule, aus der vier Schläuche ragen. An der Digitalanzeige an der Wand können sie Puls, Herzfrequenz und Lungenfunktion ablesen.
Das Gute an meiner Situation ist, dass ich mich nicht mehr am Kreativen Ground Zero befinde. Ich könnte wieder schreiben, allerdings hat der Begriff Schreibblockade für mich eine neue Bedeutung gewonnen. Meine handwerkliche Fähigkeit wurde im wahrsten Sinn des Wortes in Zement gegossen. Dafür habe ich allerdings die Rechte an achtzehn Storys zurückerhalten und meinen Vertrag erfüllt.
Ich hoffe, Ihnen gefällt Dinner in the Dark, und die Mühe hat sich gelohnt. Dafür habe ich mein Fleisch und Blut gegeben. Außerdem hoffe ich, dass es meiner Frau und unseren fünf Katzen gutgeht. Bis jetzt hat sie mich noch nicht besucht.
Aber falls Sie mich besuchen wollen, bringen Sie mein neuestes Buch bitte nicht mit. Ich habe bis Ende nächsten Jahres keine Möglichkeit, es zu signieren.
Diese Story kam mit dem Einverständnis folgender Personen zustande, bei denen ich mich zugleich für ihren Gastauftritt bedanke: Steffen Janssen, Boris Koch, Hardy Kettlitz, Hans-Peter Neumann, Frank Festa, Alisha Bionda, Marc-Alastor, Timo Kümmel und Markus Kastenholz Ich kann Ihnen versichern, dass beim Schreiben dieser Geschichte niemand wirklich ernsthaft verletzt wurde.
WIR VOM SICHERHEITSDIENST
Diese Story entstand für die so genannte Verwandtenhasser-Anthologie des Wiener Aarachne Verlags. Ich möchte nicht von mir behaupten, ich sei paranoid, doch seit ich diese Geschichte geschrieben habe, achte ich peinlich genau darauf, wie die Klopapierrolle bei mir zu Hause eingelegt wurde.
Sie wissen nicht, worauf ich hinauswill?
Lesen Sie selbst …
Da wir vom Sicherheitsdienst der Deltacom Technologies wegen eventueller Betriebsspionage rund um die Uhr eine Herzattacken-Situation nach der anderen zu bewältigen hatten, praktizierte jeder von uns eine andere Methode, um sich im Berufsalltag fit zu halten: Iko flirtete mit der scharfen Sekretärin des Chefs, Kriga gönnte sich bereits zum Frühstück an der Imbissbude zwei Wodkas mit einer fetten Currywurst, die er während seiner Firmenrunde mit einer Riesenportion Senf vertilgte, Talmann löste in der Mittagspause die Kreuzworträtsel der Pornozeitschriften, ich zerlegte und reinigte meine silber-aluminium-glänzende Sig Sauer, 9mm … und mein kleiner Cousin Sammy meditierte auf dem Scheißhaus!
Dabei hatte er einen besonderen Trick drauf, wenn er auf der Toilette, die sich in der Nische zwischen dem Bürotrakt und der Küche befand, die Klopapierrolle wechselte. Nicht nur, dass er die Rolle ständig so einlegte, dass das Papier an der Wandseite hinunterhing – wodurch sich der ganze Mist nicht mehr drehen ließ, was jeden von uns zur Weißglut brachte – er nervte uns auch noch mit einer ziemlich dämlichen Angewohnheit: Er riss den Karton der alten Rolle auseinander, strich ihn glatt und bastelte Skulpturen daraus. Das trieb uns in den Wahnsinn!
Überall traten wir auf seine Boote, Flieger oder Häuser, mit denen er die Korridore der Firma verschönerte. Danach waren seine Meisterwerke nur noch schwer als solche zu erkennen, vor allem, wenn sie an der Unterseite der Stiefel klebten. Doch Sammy produzierte ohnehin ständig neue. Sie glichen allem anderen als japanischen Origami-Werken; er wollte damit auch keineswegs diesem Fernost-Schnickschnack Konkurrenz machen, sondern vielmehr, wie er es nannte, meditativ abschalten, um Energie zu tanken … wie auch immer das zu verstehen war.
Eigentlich wollte ich Sammy bereits vor Jahren aus dem Team werfen, weil wir im Sicherheitsdienst nur zähe Burschen brauchen konnten, wie sich unser Chef ausdrückte, doch Sammy war ein Sonderfall: Nicht nur, dass er mein Cousin war und mein Vater seinerzeit ein gutes Wort bei unserem Chef für ihn eingelegt hatte, Sammy war auch ein charakterloser, schleimiger … aber lassen wir das! Wozu unnötig aufregen? Das obligatorische Chris-halt-den-Mund-Sammy-bleibt-im-Team-und-Basta! meines Chefs war unumstößlich, selbst wenn ich ihm Dutzende Gründe für ein schlagkräftigeres Sicherheitsteam aufzählte. Pfeif auf die Familienbande – wie sich Kriga bei unserer Firmenrunde auszudrücken pflegte – eines Tages legen wir die kleine Ratte bei einem Probealarm um! Vielleicht zerfetzen ihn sogar die Dobermänner.
Im Grunde genommen war Sammy aber harmlos, richtete nur begrenzten Schaden an, und seine Gebilde aus Klopapierrollen störten mich nicht weiter – zumindest nicht bis zu jenem Dienstag im Mai, an dem wir während der Änderung des Sicherheits-Codes ein Computervirus einschleppten, das einen Stromausfall verursachte und unser Netzwerk zum Absturz brachte, was einen falschen Feueralarm auslöste – und schon waren wir voll im Einsatz. Unsere Begeisterung hielt sich in Grenzen! Alle anderen, bis auf Kriga und mich, waren bereits heimgegangen, weshalb ich erst nach 20.30 Uhr das Firmengelände verließ und mit meinem Dienstwagen, dem blauen Pajero, das Donauufer entlang, Richtung Wiener Innenstadt preschte. Wie immer zu dieser Zeit war die Straße nahezu leer, und ich hatte Zeit nachzudenken, meist über Margit, die stocksauer in der Küche hocken und mich völlig ignorieren würde, wenn ich heimkam und durch die Diele marschierte.
Eine halbe Stunde später sperrte ich die Wohnungstür auf, spähte nach Margit, bemerkte sie wie üblich in der Küche, warf den Autoschlüssel auf die Kommode und ging schnurstracks auf die Toilette. Dort sah ich es dann. Unschuldig lag es auf dem Spülkasten, zwischen dem Duftspray und den Ölpflegetüchern … eines von Sammys Booten!
Ich hielt das Gebilde lange in der Hand, drehte es zwischen den Fingern herum und betrachtete es genau. Das Boot war gar nicht so schlecht, mit etwas Fantasie konnte man sogar eine Sitzbank und die Einkerbungen der Ruder erkennen. Die neu eingelegte Klopapierrolle lief an der Wandseite hinunter! Was will mir das sagen? Ein kurzer Blick ins Schlafzimmer überzeugte mich davon, dass das Fenster gekippt und das Bett mit frischen Laken überzogen war – alle Spuren beseitigt.
Hast du meditativ abgeschaltet, Sammy, und mit Margit Energie getankt, und sie ordentlich durchgevögelt, bevor oder nachdem du dein Scheißboot gebastelt hast?
Ich zerknüllte das Kunstwerk in der Faust, stopfte es in die Hosentasche, nahm im Vorraum einen Apfel aus der Obstschale, schlenderte in die Küche und lehnte mich an den Türstock.
»Schatz?«, fragte ich kauend. »Hattest du heute Besuch?«
Margit blickte erstaunt auf, versuchte zu lächeln und zupfte an den Bändern ihrer Schürze – gelbes Blumenmuster auf blauem Stoff. Ein Träger war über ihre Schulter gerutscht, blonde Strähnen hingen ihr wirr in die Stirn – frisch gewaschen, noch ein bisschen feucht –, und auf den Wangen war ein roter Flush … niedlich sah sie aus! Gar nicht so sauer wie sonst!