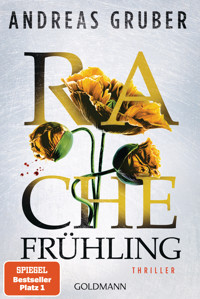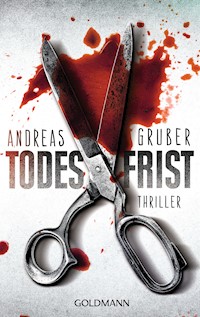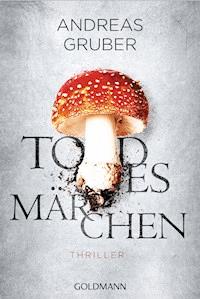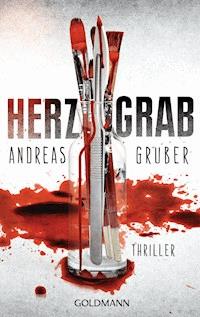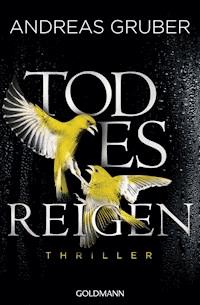Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Andreas Gruber Erzählbände
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Diesmal entführt Andreas Gruber Sie mit seinen Horrorgeschichten in das Leipzig des Jahres 1840, nach New Orleans um 1908 und in das Wien des Jahres 1945. Wir treffen auf elektronische Spinnen, einen krimineller Zahnarzt, einen verrückter Erfinder in einem Kellerlabor und ein ungewöhnliches Brüderpaar, das an einer seltenen Krankheit leidet. Erfahren Sie mehr über einen erschreckenden archäologischen Fund bei Athen, eine Lovecraft-Hommage über die Miskatonic-Universität in Arkham, sowie eine teuflische Weihnachtsgeschichte direkt aus der Hölle. Und freuen Sie sich nicht zuletzt auf ein Wiedersehen mit Edgar Allan Poe und Jack the Ripper. "Andreas Grubers Kurzgeschichten sind schräg, bizarr, dunkel – und unwiderstehlich." [Ursula Poznanski]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ghost Writer
neunzehn unheimliche Geschichten
Andreas Gruber
für Günter Suda,
ich weiß, es ist immer viel zu tun,
darum danke für deine jahrelange verlässliche Unterstützung
»Gerade wenn man so weit ist,
anfangen zu können,
muss man sterben.«
– Immanuel Kant –
Impressum
Copyright © 2018 by Andreas Gruber
Copyright Gesamtausgabe © 2018 LUZIFER-Verlag Dieses Werk wurde vermittelt durch die
AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2018) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-310-7
Du liest gern spannende Bücher? Dann folge dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Google+ | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen und senden dir kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
Am 31. Dezember 1999 ist die Welt nicht untergegangen. Ich weiß es ganz genau, denn im Sommer 2000 habe ich mit meiner Frau einen Phantastik-Kongress in Passau besucht. Veranstalter war der EDFC, der erste Deutsche Fantasy Club. Meine Frau und ich mischten uns unters Publikum und lauschten den diversen Vorträgen der üblichen Verdächtigen. Unter anderem referierten Franz Rottensteiner, Hermann Urbanek und Karlheinz Steinmüller über Fantasy-Filme und Science-Fiction-Literatur, aber auch über die Verlags- und Fandom-Szene in der Phantastik.
Als meine Frau sah, wie viele berühmte Autoren sich dort tummelten, die Lesungen hielten und Autogramme gaben, beugte sie sich plötzlich zu mir und flüsterte mir ins Ohr: »Schatz, das hat doch keinen Sinn, was du tust. Hör endlich auf, Kurzgeschichten zu schreiben. Das bringt nichts. Du musst auch an Romanen arbeiten. So wie der dort!«
Sie meinte Herbert Rosendorfer, den Autor des genialen Zeitreise-Episodenromans Briefe in die chinesische Vergangenheit.
Einige andere wie Wolfgang Jeschke, der Herausgeber der Science-Fiction-Reihe bei Heyne, oder Klaus N. Frick, der Chefredakteur bei Perry Rhodan, gaben mir ebenfalls den symbolischen Tritt in den Hintern, endlich einen Roman zu schreiben. Sogar meine Testleser und guten Freunde lagen mir damit in den Ohren, Storys bleiben zu lassen und auf Romane umzusatteln. Es wäre übertrieben zu behaupten, Leser hätten mich mit ähnlichen Aufforderungen bombardiert … aber immerhin bekam ich zweimal im Jahr einen Brief mit einer derartigen Bitte.
Schließlich beugte ich mich, wie immer, dem Drängen meiner Frau und begann damit, Romane zu schreiben. Für den Blitz-, den Festa- und später für den Goldmann-Verlag. Somit gab es seit dem Phantastik-Kongress in Passau lange Zeit keinen weiteren Erzählband mehr von mir. Und meine Kurzgeschichten, die ich trotzdem ab und zu heimlich in meinem Arbeitszimmer schrieb – natürlich ohne meiner Frau großartig davon zu erzählen, denn ich bin ja nicht lebensmüde – kursierten in Magazinen und Anthologien verschiedenster Phantastik-Kleinverlage. Übrigens war es gar nicht so einfach, die Pakete mit den Belegexemplaren, die ich von den Verlagen bekam, ungesehen vom Briefkasten in mein Arbeitszimmer zu schaffen, ohne dass es meiner Frau auffiel. Sie ist nämlich eine Füchsin und bemerkt alles.
»Schatz, ist das etwa schon wieder ein Belegexemplar hinter deinem Rücken?«, rief sie vom Balkon herunter, als ich mich mit einem Paket ins Haus schleichen wollte.
»Nein, bloß Clever-und-Smart-Hefte.«
»Aber die hattest du doch schon gestern bekommen.«
»Nein, das gestern waren MAD-Hefte.«
Einmal musste ich sogar behaupten, ich hätte mir Busen-Magazine aus Berlin, Bravo-Hefte aus Frankfurt oder einen Beate-Uhse-Katalog aus München schicken lassen, nur damit sie nicht stutzig wurde. Es ist schon sehr grenzwertig, was man als Schriftsteller alles auf sich nimmt, nur um ein paar Storys zu veröffentlichen!
Mittlerweile sind aber die meisten dieser Magazine und Anthologien vergriffen und die Rechte an den Geschichten wieder an mich zurückgefallen. Daher möchte ich Steffen Janssen danken, der mir die Möglichkeit gab, meine Kurzgeschichten im Luzifer Verlag neu aufzulegen und in dieser Sammlung zu präsentieren. Für diese Ausgabe wurden sämtliche Texte überarbeitet, erweitert und teilweise umgeschrieben, sofern es der Handlung diente. Lediglich Welt aus den Fugen und Der Puppenmacher von Leipzig sind die einzigen bisher unveröffentlichten Geschichten in diesem Band. Letztere musste ich mir nach einem Besuch in Leipzig einfach von der Seele schreiben. Sie trägt autobiografische Züge, aber damit das niemand merkt, habe ich die Handlung ins Jahr 1840 verlegt.
An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei den Österreichischen Bundesbahnen, die vor Jahren in den zweistöckigen Wiesel-Zügen nach Wien einen herunterklappbaren Tisch in die Vordersitze einbauen ließen. Die eignen sich hervorragend, um Manuskripte zu überarbeiten, wenn ich nach Wien fahre oder manchmal quer durch Österreich auf Lesereisen unterwegs bin … sofern man in dem Gedränge zwischen Schülern und Pendlern einen Sitzplatz findet!
»Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich mich setzen? Ich bin Schriftsteller und würde gern …«
»Hau ab, du alter Knacker!«
»Aber ich möchte gern …«
»He, Künstler! Hättest besser einen anständigen Beruf lernen sollen.«
»Hab ich ja, aber ich wollte …«
»Das hättest du dir früher überlegen müssen!«
Ja, so ist sie, die heutige Jugend. Aber die Rentner sind um keinen Deut besser.
»Dürfte ich mich hierhin setzen? Sie müssten nur Ihren Dackel und Ihren Stock etwas zur Seite …«
»Hau ab, Sozialschmarotzer!«
»Aber ich müsste im Zug wirklich dringend arbeiten und …«
»Verzieh dich, Stipendienschnorrer!«
Seitdem habe ich mir angewöhnt, morgens eine Stunde früher wegzufahren, bevor das Gedränge im Zug losgeht.
»Schatz, warum stehst du in letzter Zeit immer so zeitig auf, wenn du zu Lesungen fährst?«
»Äh … ich muss dort noch was erledigen.«
»Was ist denn so verdammt wichtig?«
»Bücher in den Buchhandlungen signieren, Presseinterviews geben, ein Interview im Landesstudio fürs Radio aufzeichnen und im Veranstaltungsraum Mikrofon, Tisch und Lautsprecher aufbauen.«
»Das musst du selbst machen?«
»Äh … ja, leider.«
Die Buchhändler, Bibliothekare, Techniker und Veranstalter der Literaturfestivals waren natürlich von Beginn an in das Kurzgeschichten-Buchprojekt eingeweiht und gaben mir Rückendeckung – sonst wäre meine Frau noch auf die Idee gekommen, ich hätte irgendwo ein Verhältnis. Wie gesagt, es ist schon kurios, was man als Schriftsteller nicht alles auf sich nimmt!
Trotz aller Widrigkeiten wurden die Storys also heimlich geschrieben und ebenso heimlich überarbeitet. Ich hoffe, Sie werden sich beim Lesen gleichermaßen amüsieren und gruseln. Die Themen sind breit gestreut, und ich hoffe, mir ist über die Jahre ein abwechslungsreicher Mix gelungen.
An dieser Stelle vielleicht noch ein Geständnis: Ich liebe Vorwörter, Danksagungen und autobiografische Vignetten, die Kurzgeschichten vorangestellt werden. Manchmal kaufe ich allein deshalb einen Storyband, weil die Einführungen zu einigen Geschichten länger sind als die Storys selbst. Darum habe ich mir erlaubt, schon seit Jahren den Storys meiner Erzählbände eine persönliche Einleitung voranzustellen. Falls Sie die nicht interessiert, sehen Sie bitte großzügig darüber hinweg. Ich bin Zwangsneurotiker – ich muss es tun!
Ach ja, eine Sache noch: Hin und wieder werde ich gefragt, woher ich meine Ideen nehme. Wie bei fast allen Autoren, die ich kenne, habe auch ich das meiste selbst erlebt – Tatsache! Aber dieser unmerklich kleine Rest, der der Fantasie entspringt – woher kommt der?
Nun, wenn ich antworte, ich wäre mir nicht sicher, ist das schon gelogen. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht! Die Ideen sind einfach da und verschwinden erst wieder, nachdem die Story niedergeschrieben wurde.
Mein Psychiater, Doktor Fink in Wien, zu dem ich regelmäßig mit dem Zug fahre, meint, ich solle endlich aufhören, Bücher von Stephen King, Richard Laymon, Jack Ketchum, Clive Barker, Dean Koontz und Tim Curran zu lesen. Habe ich getan! Mittlerweile schaue ich nur noch Filme von David Cronenberg, John Carpenter, Sam Raimi und Night M. Shyamalan und Serien wie Hannibal, Bates Motel oder The Walking Dead … aber ich sage Ihnen, das hat auch nichts genutzt! Die Albträume sind trotzdem da! Und solange sie da sind, werde ich sie mir weiterhin von der Seele schreiben … also schicken Sie mir bloß keinen Brief mit der Bitte, ich solle endlich einen Liebesroman schreiben! Ich bin ein Zwangsneurotiker – ich muss diesen Mist schreiben, ob ich will oder nicht.
Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit den vorliegenden neunzehn Geschichten … und unter uns … erzählen Sie meiner Frau nicht, dass es dieses Buch gibt! Sonst ergeht es mir wie Norman Bates.
Ihr Andreas Gruber
All-Inclusive-Tours
Diese Story ist eine meiner ältesten und wurde für eine Ausgabe des österreichischen Literatur-Magazins DUM zum Thema »Fleisch« geschrieben. Österreichische Literatur-Magazine tendieren ja in eine intellektuelle, experimentelle und literarisch anspruchsvolle Richtung, die sich mir bisher immer verschlossen hat. Umso mehr war es mir ein Bedürfnis, etwas un-literarisch Satirisches zu schreiben.
Von der intellektuellen Crème de la Crème der österreichischen Literaten gab es wie üblich keine Reaktion darauf – doch bei meinen Lesungen ist All Inclusive-Tours immer ein Renner, vor allem zu Beginn, wenn das Publikum etwas zum Schmunzeln braucht, bevor es später ans Eingemachte geht.
Klaus stand bis zum Nabel im trüben Wasser. Er rümpfte die Nase, es roch nach Zwiebel und Paprika. Mit den Handflächen kreiste er über den Wellen und schaukelte die Flüssigkeit auf, sodass sie über den Rand des Kessels schwappte. Er schielte zu dem Schwarzen, der barfuß, mit einem Baströckchen bekleidet, zum Kessel trottete und einige Scheite Holz nachlegte. Das Feuer prasselte, die ausgedorrten Äste knisterten und knackten.
Klaus bemerkte die leuchtenden Augen des Farbigen und tänzelte von einem Zehenballen auf den anderen. Allmählich wurde der Kesselboden heiß. »Ich möchte raus!«
»Mugu basala!« Der Schwarze deutete mit der Hand in den Kessel. An seinen Unterarmen schepperten goldene Armreifen. Er lächelte verschmitzt und rieb sich die Hände über der Glut des Feuers.
»Ich möchte mit dem Reiseleiter sprechen!«, maulte Klaus.
Der Schwarze beachtete ihn kaum, fingerte aus dem Baströckchen zwei winzige Behälter, die verdächtig nach Salz- und Pfefferstreuer aussahen. Von beiden schüttete er eine Prise in den Kessel.
»Mhmmmmm!« Der Eingeborene grinste in voller Breite über das ebenholzschwarze Gesicht.
»Ich möchte den Reiseleiter sprechen!« Klaus warf die Arme trotzig in die Luft, sodass die dunkle Brühe überschwappte.
»Mugu!«, rief der Schwarze zornig, als die Suppe im staubigen Sand versickerte. Behäbig trottete er davon.
Klaus hockte im Kessel und blickte dem Schwarzen hinterher, bis er in einer Bambushütte verschwunden war. Hinter Klaus stampften die Schwarzen mit nackten Füßen auf der Stelle und wirbelten ihre Speere durch die aufsteigende Sandwolke. Blinzelnd starrte Klaus in die Sonne, die wie ein gleißender Ball über dem Horizont hing und sich gemächlich in den Zenit schob. Die Vormittagsstrahlen prickelten ihm auf der Haut. Da kletterte ein Mann in brauner Kakihose und geblümtem Hawaiihemd aus einer Strohhütte. Endlich! Klaus schirmte die Augen mit der Handfläche ab.
»Hallo!«, rief er quer durchs Dorf, als er den Reiseleiter erkannte. Hektisch begann er zu winken.
»Schscht!« Der Fremdenführer legte den Zeigefinger auf die Lippen. Er schlenderte unauffällig in die Nähe des Kessels. »Seien Sie still! Wenn Sie während der Essenszeremonie solchen Lärm machen, ziehen Sie den Zorn des Stammes auf sich.« Er nickte den tanzenden Schwarzen freundlich zu.
»Den Zorn des Stammes?«, brüllte Klaus. »Die wollen mich bei lebendigem Leib braten! Und Sie geben mir Ratschläge, wie ich mir nicht den Zorn dieser Horde zuziehe?«
»Kochen … nicht braten!«, wisperte der Reiseführer und legte erneut den Zeigefinger auf die Lippen. Unter dem Hawaiihemd spannte sich der braungebrannte, sehnige Bizeps. Vom Haaransatz lief ihm der Schweiß übers Gesicht. Er wischte sich über die Wange und glotzte auf Klaus’ schmächtige, knallrote Schultern. »Sie sollten sich vor einem Sonnenbrand in Acht nehmen.«
Klaus blickte ratlos an sich hinunter. Vom Boden des Kessels brodelten winzige Luftblasen an die Oberfläche, er trat von einem Bein aufs andere. »Holen Sie mich raus«, flüsterte er und streckte dem Fremdenführer die Arme entgegen.
Der Reiseleiter zuckte mit den Achseln. »Kann ich nicht!«
»Waaas?« Klaus’ Augen wurden groß.
»Schauen Sie.« Der Mann zog die Schultern hoch und breitete die Arme aus. »Ich habe Sie gewarnt, doch Sie wollten keine Rückreise-Versicherung abschließen.«
Klaus verdrehte die Augen.
»Sie wollten Afrika so kennenlernen, wie es ist«, argumentierte der Fremdenführer.
Klaus stöhnte auf.
»Eine All-Inclusive-Safari mitten ins Herz des Landes, mit den Stammesriten der Eingeborenen auf das Intimste vertraut«, zitierte der Mann den Slogan aus dem Werbeprospekt. »Außerdem haben Sie Gebrauch von unserem Frühbucherbonus gemacht. Deshalb wurden Sie für den Kessel ausgewählt und kein anderer.« Erneut zuckte er mit den Achseln.
»Ich will raus!«, brüllte Klaus.
»Ja, ja«, beschwichtigte ihn der Mann. »Es geht ungeheuer schnell, Sie spüren das kaum. In zwanzig Minuten ist alles vorüber.« Er bückte sich und legte einige Scheite Holz nach.
»Was machen Sie da?« Klaus versuchte über den Rand des Kessels zu spähen. »Ich will hier raus!«
»Ja, ja.« Der Reiseleiter zog ein Tuch aus der Brusttasche des Hawaiihemds. Er wischte sich den Schweiß aus dem muskulösen Nacken. »Verdammt heiß hier, nicht?«
»Ich will nach Hause!«, jammerte Klaus.
Die Augen des Reiseleiters erhellten sich. »Apropos nach Hause …« Er fingerte einen Packen Karten samt Kugelschreiber aus der Gesäßtasche. »Die müssen Sie unbedingt noch unterschreiben, bevor …« Er verstummte und reichte Klaus den Stapel.
»Bevor was?« Perplex griff Klaus danach.
»Vorsicht!«, zischte der Reiseleiter. »Passen Sie doch auf, Sie machen die Ansichtskarten nass und verwischen die Schrift.«
»Schöne Urlaubsgrüße aus Kenia. Hier gefällt es mir, hier bleibe ich«, las Klaus verdattert vor. »Das soll ich unterschreiben?«
»Ja.« Der Touristenführer zuckte wie beiläufig mit den Achseln. »Das ist gut für unsere Werbung. Public Relations von unseren zufriedenen Kunden, das verstehen Sie doch sicher, nicht wahr?«
»Natürlich.« Hoffnung keimte in Klaus auf. Er nickte und griff nach dem Stift. Während er unterschrieb hopste er von einem Bein aufs andere. »Holen Sie mich jetzt raus?«, fragte er leise.
»Seien Sie nicht trotzig!«, antwortete der Reiseleiter ärgerlich. Er blinzelte in die Sonne. Unauffällig zückte er ein winziges Fläschchen aus der Hosentasche und streute eine Prise in den Kessel.
»Was machen Sie da?«, kreischte Klaus.
»Oregano«, erklärte der Reiseleiter beiläufig und ließ den Streuer in der Tasche verschwinden.
Hier ist dein Geschenk
Im Prinzip ist Hier ist dein Geschenk eine nette kleine Kindergeschichte, die für eine Horror-Anthologie entstanden ist. Nur habe ich sie meinem eigenen Sohn bisher noch nie vorgelesen.
Zu dem Zeitpunkt als ich sie geschrieben habe, war er erst elf – und ich weiß nicht, ob er eine solche Story schon vertragen hätte.
Karmann kniff die Augen zusammen und blickte zur Hausmauer empor. Von dem Schriftzug aus verrotteten Leuchtstoffröhren waren einige Buchstaben abgefallen, dennoch konnte er den Text lesen. Heimkino: Mechanik und Montage jeder Art.
Der Wind trieb Karmann die Tränen in die Augen. Rasch blickte er hinunter. Der Altbau hatte nur einen Eingang: eine schmale Treppe in den Keller.
Karmann zog den Kopf ein, trat in die Nische und stieg die Treppe hinunter. Schlagartig verstummte das Pfeifen des Windes. Es roch nach Abwasser und feuchtem Mauerwerk. Die genagelten Sohlen der Lackschuhe klapperten über die Stufen. Wie konnte jemand in diesem verfallenen Stadtteil ein Geschäft führen? Mit Ausnahme von Pennern und arbeitsscheuem Gesindel wohnte hier niemand. Karmann hatte sie vom Auto aus gesehen, als er im Schritttempo durch die Gassen gefahren war. Sie hockten in den Hauseinfahrten oder starrten aus den vergitterten Fenstern der alten Fabrik. Kaum jemand würde sich in den Mechanikerladen verirren. Dennoch hatte Karmann ihn gefunden. Es hatte ihm widerstrebt, diesen Stadtteil zu besuchen, aber nirgendwo sonst hätte man seinen Auftrag ausgeführt.
Karmann war vom Geschäftsinhaber auf den heutigen Tag vertröstet worden. Wie jeden Freitagabend hätte Karmann auch an diesem Tag länger im Büro bleiben müssen, doch nach den wichtigsten Telefonaten hatte er die Firma am späten Nachmittag verlassen und war gleich hierher gefahren. Wenn alles geklappt hatte, würde die Montage fertig sein. Er würde bezahlen, alles mitnehmen und diese Gasse niemals wieder betreten.
Karmann wusste nicht einmal, wie der Inhaber des Ladens hieß. Bei Aufträgen dieser Art wurden keine Namen genannt. Also sprach er den Mann schlicht Mechaniker an. Der Alte war ein Sonderling, ein schrulliger Kauz – einer, der für Geld alles machte.
Am Ende der Treppe pochte Karmann an die schwere Brandschutztür.
»Herein!«
Er schob die Tür auf, und wie bei seinen beiden vorherigen Besuchen knirschte das Tor in den Angeln. Das Geräusch schnitt ihm schmerzvoll durchs Gehirn. Karmann trat in das Dunkel und sah sich in der Werkstatt um. Im Schein der nackten Glühlampe erkannte er nur Regale mit schattenförmigen Gebilden. Drähte und Rohre hingen von den Wänden, Kabeltrommeln standen auf dem Boden. So unordentlich sah es nicht einmal in seiner eigenen Garage aus.
Plötzlich stand der Mechaniker vor ihm. Die wenigen Haare grau und wirr. An diesen Anblick würde er sich nie gewöhnen. Der Alte reichte ihm bis zur Schulter. Vermutlich war er genauso groß wie Karmann, doch durch das krumme Rückgrat und die dürren, o-förmig gebogenen Beine wirkte er einen Kopf kleiner. Mit fahrigen Fingern schob er sich das Drahtgestell der Brille zurecht. Zwei winzige Lämpchen waren an den Bügeln befestigt.
Karmann blinzelte. »Guten Abend.« Er versuchte zu lächeln. »Haben Sie ihn fertig?«
Der Mechaniker nickte. Er kratzte über seine grauen Bartstoppeln. »Bin fertig, die Nacht durchgearbeitet.« Er nestelte mit den Fingern am Overall, der vor langer Zeit sicher einmal blau gewesen war. Jetzt bestand er nur noch aus Ölflecken, Rissen und zusammengeflickten Stoffresten. Karmann bemerkte die Finger des Mechanikers. Sie waren dunkelrot, als hätte er in einem Farbeimer gerührt. Seine Stirn war ebenso verschmiert. Aber Karmann wusste, dass es keine Farbe war.
»Kommen Sie!« Der Alte wandte sich um und ging davon. Mit ihm wanderte und hüpfte der müde Schein der Brille durch die Werkstatt wie das Grubenlicht in einem Stollen.
Karmann starrte auf die Füße des Mechanikers. Er trug keine Schuhe. In fusseligen Wollsocken schlurfte er davon. Karmann folgte ihm. Er stieg über einen Kabelsalat aus Drähten, Leitungen und Verteilersteckdosen. Vor einer Kommode machten sie halt.
»Übrig geblieben.« Der Mechaniker leuchtete in die geöffnete Lade. Dioden, Spulen, Lötzinn und Elektromagnete lagen durcheinander, darüber ein merkwürdig schmutziggraues Etwas.
»Braunsche Röhre, Mistding! Musste den Kram ersetzen.« Er schüttelte den Kopf. »Farbe ging nicht.« Er ließ die Schultern sinken. »Kann nur schwarz-weiß. Zu wenig Zeit, um zu experimentieren.«
»Oh.« Karmann ließ die Mundwinkel hängen. »Nur schwarz-weiß? Ich dachte …«
»Wegen der Übertragung«, erklärte der Mechaniker. Er fuchtelte mit den Fingern um seinen Kopf herum, als wäre er irre geworden. »Die Übertragung, die Elektroden, sie sprengen einem den Kopf.« Er hielt die Luft an, blähte die Wangen und riss die Augen auf.
»Verstehe.« Karmann wandte den Blick ab. Er verstand nichts, doch wollte er nicht mit dem Mann diskutieren. Außerdem war es egal, schwarz-weiß würde reichen. Er wollte nur bezahlen und von hier verschwinden. Sein Wagen stand in einer Seitengasse. Es dunkelte bereits, und wenn er lange trödelte, würden ihm die Penner die Radkappen abmontieren.
Karmann griff zur Brieftasche und zog einige Geldscheine hervor.
»Heizspannung war ein Problem. Scheißspannung! Elektronen brechen aus dem Wehneltzylinder. Riesensauerei! Mehrere Versuche.« Zum Beweis zeigte er Karmann die dunkelroten Finger. Sie glänzten im Schein der beiden Lämpchen.
Was für ein plumper Versuch! Der Mann wollte den Preis in die Höhe treiben. Sollte er! Karmann spielte mit der Krawattennadel. »In Ordnung.« Er legte einen Schein dazu und drückte dem Mechaniker das Bündel in die Hand. Spannung hin oder her! Wenn er mit dem Ergebnis zufrieden war, würde er gern mehr bezahlen. Er war ohnehin überrascht, wie billig er alles hatte kaufen können.
Der Mechaniker trat von einem Bein aufs andere. »Krempel mitnehmen?« Er deutete in die Schublade mit den Ersatzteilen.
»Nein, nein.« Karmann winkte ab. »Behalten Sie die Teile. Kann ich ihn sehen?«
Der Alte nickte. »Möchte nicht wissen, wofür Sie den brauchen, he, he … sind krank, hä?« Er kicherte und tippte sich an die Stirn.
»Da bin ich aber nicht der Einzige!«
Der Mechaniker schmunzelte. »Hätte den Auftrag sonst kaum erledigt.«
»Kann ich ihn jetzt sehen?«, drängte Karmann.
Der Mechaniker grinste. Für einen Moment richtete er sich auf. Karmann verzog schmerzhaft das Gesicht. Er glaubte, die Rückenwirbel des Alten knacken zu hören, als breche die Wirbelsäule auseinander.
Der Mechaniker wischte sich die Hände am Overall ab. »Hier ist er.« Schwungvoll zog er den Vorhang zurück. »Ta-daaa!«
Ein Schwall von Antiseptika drang aus der Nische, es roch nach Eiter und Wundinfektion. Im Schatten der Ecke lag eine Gestalt auf einem Tisch. Beim Anblick der monströsen Umrisse hielt Karmann den Atem an.
»Steh auf!«, befahl der Alte.
Das Bett knarrte. Die Gestalt hob den Oberkörper. Behäbig schwang sie die Beine über die Tischkante. Die Füße berührten den Boden. Ohne Probleme hätte der Mann das Eisengestell des Bettes auseinandernehmen können. Der Kopf saß auf einem breiten Nacken, die Schultern lagen enorm weit auseinander.
Karmann musterte den Riesen. Er war nicht alt, leicht hätte er der Sohn des Mechanikers sein können. Die Arme hingen ihm kraftlos an den Seiten herab. Sein Gesicht war bleich. Oder lag es an der matten Beleuchtung? Die Pupillen waren nur schwer unter den niedergefallenen Augenlidern zu erkennen. Der Junge blickte ins Nichts, als hätte sich jahrelang Agonie in seine Seele gegraben.
»Na, gefällt Ihnen?«
Karmann zog die Augenbrauen hoch. Der Mechaniker hatte es tatsächlich geschafft. Wo zum Teufel hatte er den Burschen aufgetrieben? Ein Student vom Campus etwa? Oder ein Sportler aus der Fitnesshalle? Für einen Moment regte sich in Karmann ein schlechtes Gewissen. Ob der Bursche wohl Familie hatte? Aber schließlich ging es ja genau darum. Jedenfalls war er gut gebaut, das war wichtig. Bestimmt hatte er den Eingriff gut überstanden.
»Komm her!«
Der Junge erhob sich. In einen bodenlangen, schmierigen Ledermantel gehüllt stand er da, sein Oberkörper wankte leicht nach vorn. Der ausladende Kragen zeigte den muskulösen Nacken. Die Haut war weiß, die Brustbehaarung rasiert. Nacktes Fleisch war auch zwischen den Knöpfen des Ledermantels zu erkennen. Offensichtlich trug er nichts darunter. Der Junge erinnerte Karmann an die armselige, zu Tode gequälte Kreatur eines Snuff-Videos. Mit einer Ausnahme: Das Gesicht des Mannes zeigte keine Narben, keine Nähte, keine Wunden, keine Verletzungen. Sein Gesicht war makellos, weiß wie die Wand einer Intensivstation, als wäre es mit einem Pulver bestreut worden. Was sich unter dem Mantel verbarg, konnte Karmann nur vermuten. Einzig ein Kabel ließ erahnen, was sich darunter befand. Es lugte unter dem Lederkragen hervor, verlief den Nacken entlang und verschwand in der borstigen Stoppelfrisur des Jungen.
»Wie soll ich ihn nennen?«
»Das habe ich mich auch schon gefragt.« Der Alte kicherte. »Mattscheibe, würde ich sagen. Nennen Sie ihn Mattscheibe!« Er schlug dem Jungen mit der flachen Hand auf die Stirn.
Mattscheibe taumelte einen Schritt zurück und ruderte mit den Armen. Dabei schob er das Bett über den Boden.
»Vorsicht!«
Der Mechaniker sprang hin und stützte den Koloss. Ihm beschlug die Brille. »Kann noch nicht Gleichgewicht halten«, schnaubte er.
Mattscheibe schwankte. Der Mechaniker stützte ihn an der Schulter.
»Ist ja gut!« Als Mattscheibe wieder stand, wischte sich der Mechaniker den Schweiß von der Stirn.
»Kann er allein gehen?«
»Ja sicher.« Der Mechaniker schlug dem Riesen auf den Hinterkopf. Mattscheibe wankte einen Schritt nach vorn.
Karmann starrte auf die schweren Stiefel des Giganten. Sie hinterließen feuchte Abdrücke auf dem Boden, das Leder glänzte im Licht.
Dem Mechaniker war Karmanns Blick aufgefallen. »Keine Sorge. Es heilt«, beeilte er sich zu sagen. »Bald sauber, es heilt. Nähte sind frisch, müssen den Verband ein-, zweimal wechseln.«
Karmann blickte den Inhaber des Ladens skeptisch an. Konnte er dem Mann trauen? Karmann deutete auf den Jungen. »Funktioniert er?«
Der Mechaniker kicherte.
»Ich möchte nicht, dass er mir unter den Fingern wegstirbt«, erklärte Karmann.
»Klar, klar! Denken wohl, ich mach Schrott, was?« Der Mechaniker fuchtelte mit den Fingern um den Kopf. »Empfang passt! Heilt aber noch zwei, drei Wochen. Funktioniert! Aber nicht länger als eine Stunde am Tag. Muss sich erholen, sonst …« Wieder blähte er die Backen und riss die Augen auf.
»Gut.« Karmann packte den Riesen am Arm und führte ihn zur schweren Feuertür. Langsam trottete Mattscheibe hinter ihm her und stapfte schwerfällig mit den Stiefeln über den Boden.
»Dauert! Kann nicht schneller. Ziemlich schwer.« Der Mechaniker grinste. Er zählte die Scheine. Dann rieb er sich die Hände und verschwand hinter dem Vorhang.
Karmann geleitete Mattscheibe über die Treppe, hinaus auf die Straße. Mittlerweile war es dunkel geworden, es nieselte. Er blickte zum Himmel. Die schmutzigen Leuchtstoffröhren mit den fehlenden Buchstaben surrten merkwürdig. Heimkino: Mechanik … war zu lesen, der Rest blieb vom Nebel verdeckt.
Karmann zog den Schlüssel aus dem Schloss und stieß die Tür auf. In der Wohnung war es still. Nur in einem Raum brannte Licht. Er ging durch die Diele und betrat das Kinderzimmer.
Von der Deckenlampe baumelten bunte Glasfische, Puppen lagen auf dem Boden verstreut, auf Regalen saßen Teddybären und blickten ins Leere. Inmitten der Spielsachen saß ein Mädchen im Schneidersitz. Karmann lächelte sie an. Seit ihre Mutter und ihre Schwester bei einem Autounfall gestorben waren, hatte die Kleine niemanden mehr, keine Freundin, keine Spielgefährtin. Es gab zwar einige Nachbarskinder in ihrem Alter, drüben bei den Altbauten, doch die würde er bestimmt nicht in ihre Nähe lassen. Immerhin war die Kleine nach dem Unfall sein Ein und Alles.
Das Mädchen sah auf. »Hallo Papi.« Es nahm die Stofffiguren aus dem Schoß.
»Hast du schön gespielt, meine Kleine?«
»Sag Hallo Laa Laa, sag Hallo Tinky Winky«, gluckste sie und hielt die Figuren in die Höhe. Sie sahen aus wie Teddybären in Raumanzügen. Einer der Teletubbys war rot, einer blau, der andere grün. Allesamt hatten sie eine Antenne auf dem Kopf und eine glänzende Folie auf dem Bauch.
»Hast du mir was mitgebracht, Papi?«
Karmann lächelte. »Hier ist dein Geschenk, meine Kleine.« Er trat einen Schritt zur Seite.
Das Mädchen blickte auf und verzog den Mund. Mattscheibe stand hinter Karmann in der Tür und füllte den Rahmen vollständig aus. Sein Oberkörper wippte vor und zurück, als versuche er das Gleichgewicht zu halten. Die Flüssigkeit tropfte ihm unter dem Mantel hervor und patschte auf den Stiefel.
»Aber Papi, das ist doch gar kein Teletubby!«
»Oh doch!«
Wie auf Befehl knöpfte sich Mattscheibe den Ledermantel auf.
Souvenirs vom Sensenmann
Souvenirs vom Sensenmann ist eine meiner Lieblingsstorys in diesem Buch. Und zwar deshalb, weil es mir Spaß machte, nach verrückten Ideen und Vorkommnissen zu suchen, sie umzudichten und zu einer verworrenen Story zusammenzureimen.
Angeblich sind all diese Geschichten tatsächlich passiert – vielleicht nicht gerade in dieser haarsträubenden Form, aber zumindest so ähnlich …
Mein Name ist Freddy Beagle. Ich bin nicht einmal einen Meter sechzig groß und leicht übergewichtig – das ist meine persönliche Art des Understatements, falls Sie verstehen, was ich meine. Ich sage immer, es kommt nicht auf das Äußere an, sondern auf den Grips, den ich zum Glück habe.
Ich arbeite für Bagger, Lloyd & Crown, die größte Rechtsanwaltskanzlei der Westküste. Mit Ausnahme weniger Stunden im Monat, in denen ich in meinem Büro Berichte für Mr. Lloyd tippe, bin ich unterwegs – von einem Unfallort zum nächsten. Meine Aufgabe ist es, Schwindler, Versicherungsbetrüger oder Urkundenfälscher auffliegen zu lassen. Deshalb liebe ich diesen Job. Mittlerweile bin ich über dreißig Jahre in der Branche. Sie glauben nicht, was mir alles unterkommt!
Die Woche beginnt stets mit dem gleichen Ritual: Mein Boss ruft mich an, Sir Arthur Lloyd, die graue Eminenz höchstpersönlich. Er klickt nervös mit dem Kugelschreiber, während er die Details eines neuen Auftrags in den Hörer knarrt.
»Freddy, hören Sie zu! Kurz vor Sacramento rasten zwei Jugendliche mit einem Sportwagen über die Interstate. Der Junge auf dem Beifahrersitz wurde durch einen aktivierten Airbag erstickt. Seine Mutter verklagt die Herstellerfirma der Airbags auf achtzig Millionen Dollar. Kümmern Sie sich darum!«
Alles klar! Ich fahre in die Werkstatt, die den Wagen abgeschleppt hat. Ein dunkelgrüner Pick-up mit Allradantrieb, breiten Geländereifen, jeder Menge Antennen und Zusatzscheinwerfern auf dem Überrollbügel. Der Wagen ist nagelneu, kein einziger Kratzer im Lack, folglich kein Unfall. Frage: Wodurch wurde der Airbag ausgelöst? Im Fußraum des Beifahrersitzes liegt eine wuchtige Soundmaschine. Frage: Warum klebt Blut auf dem Kassettendeck?
Ich rase in die Rechtsmedizin, sehe mir den gekühlten Jungen an und merke gleich, dass etwas faul ist. Warum? Jahrelanger Instinkt! Das ist ein Fall, wie ich ihn liebe. Ich habe bis 17 Uhr Zeit, spätestens dann muss Mr. Lloyd dem Airbag-Hersteller mitteilen, ob wir in dem Fall eine reelle Chance sehen oder er einen Vergleich anstreben sollte.
Ich lege los und umgarne die Medizinstudentin, die gerade ihr Praktikum in der Rechtsmedizin absolviert. Ich erfahre, dass der Archivar aus der Dokumentation ein Fan der Green Bay Packers ist und gern Tequila trinkt. Ich gehe ins Archiv und finde den Mann. Mit etwas Überredungskunst verspreche ich ihm zwei Eintrittskarten für ein Football-Match sowie eine Kiste vom feinsten mexikanischen Tequila, bezahlt von meinem Spesenkonto, woraufhin er mir den Bericht des Rechtsmediziners beschafft. So läuft die Sache! Und siehe da, der Rechtsmediziner ist ein guter Freund der Mutter des toten Jungen, und es gibt tatsächlich zwei Berichte: einen offiziellen und einen inoffiziellen. Natürlich interessiert mich die inoffizielle Variante. Darin steht, dass der Junge an seinem Nasenbein gestorben ist, das sich in sein Gehirn geschoben hat. Frage: Wie kann der Airbag eine solche Verletzung herbeiführen?
Es ist bereits halb fünf, meine Zeit wird knapp. Ich knöpfe mir also den Schulfreund des Toten vor, der den Pick-up gefahren hat, einen pickelgesichtigen Rotschopf mit Schweißflecken auf dem T-Shirt, so groß wie der Bundesstaat Louisiana. Ich bearbeite ihn, erzähle ihm etwas von einer gerichtlichen Vorladung, Untersuchungshaft und Beihilfe zum Mord. Zum Glück ist der Vater nicht zu Hause, die Mutter wird nervös, und der Bursche packt endlich aus. Danach ist die Geschichte rasch rekonstruiert: Es ist Sonntagabend, die beiden Jungs rasen über die Interstate Richtung Sacramento. Da das Autoradio kein Kassettendeck hat, stellen die beiden einen batteriebetriebenen Gettoblaster auf die Armaturenablage und ziehen sich mit voller Lautstärke ein Tape rein. In einer Linkskurve schlittert das Radio über die Armaturenfläche. Der Wagen holpert über eine Bodenschwelle, und das Radio knallt mit voller Wucht auf die Konsole, in welcher der Beifahrer-Airbag versenkt ist. Der schießt raus, wodurch dem Jungen das Radio ins Gesicht geschmettert wird – Klage an die Airbag-Firma abgewiesen, Fall erledigt!
Aber nicht für mich. Ich fahre noch einmal in die Werkstatt. Ironischerweise befindet sich auf der Seitenwand des Gefährts ein gut lesbarer Aufkleber: Wie finden Sie meinen Fahrstil? Beschissen! Mich interessiert aber mehr der Musikgeschmack des Jungen. Ich sehe mir das Radio an. Im Kassettendeck liegt ein Tape von Janis Joplin: Kozmic Blues aus dem Jahr ’69. Ich lasse es in meiner Sakkotasche verschwinden. Jetzt gehört es mir, der tote Junge hat keine Verwendung mehr dafür. Dort wo er jetzt ist, hört er Janis Joplin live und kann ihr höchstpersönlich den Schweiß von der Stirn wischen – ich hingegen habe ein weiteres Souvenir für meine Sammlung.
Eine Woche später schickt mich Mr. Lloyd wegen eines ähnlich bizarren Autounfalls sogar nach Los Angeles, und das, obwohl mir meine alte, schwerhörige Mutter ständig in den Ohren liegt, keine weiten Strecken mit dem Auto zu fahren. Sie wissen ja, wie Mütter sind. Meine alte Dame ist über siebzig und wird von Jahr zu Jahr unausstehlicher. Natürlich fahre ich trotzdem, schließlich ist es mein Job.
Diesmal geht es um die Filmschauspielerin Sybille Dawn, die in einigen lausigen Seifenopern mitgewirkt hat, damit aber nicht sehr berühmt wurde – egal, Sie werden ohnehin nie wieder etwas von ihr zu sehen bekommen. Weshalb? Während einer Probefahrt in einem gelben Zweisitzer-Sportcabriolet mit 300 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 Meilen in 6,2 Sekunden rast sie auf der Küstenstraße mit neunzig Sachen in eine riesige Palme. Der Wagen ist eingedrückt wie eine alte Ziehharmonika, und sie selbst landet mit Genickbruch im Leichenschauhaus. Ihr Manager sowie ihre Verwandten verklagen die Firma, die die Nackenstützen herstellt. Unser Fall!
Mr. Lloyd lehnt einen Vergleich ab und sichert unserem Klienten eine reelle Chance zu, ohne dass ich mir zuvor ein Bild von der Sache machen kann. Typisch! Aber zum Glück entdecke ich bei der Inspektion des Wagens, dass sich der Rest eines Seidenschals um die Hinterradachse gewickelt hat. In der Handtasche der Toten befindet sich noch die Rechnung einer Boutique. Rekonstruiert ergibt die Geschichte folgendes Bild: An jenem Tag ist es kühl, Sybille Dawn stoppt vor ihrer Stammboutique, kauft sich einen elendslangen gelben Seidenschal, passend zur Farbe des Wagens, schlingt sich das Ding um den Hals, setzt sich die Sonnenbrille auf und fährt los. Der Schal flattert hinter ihr her und verfängt sich im Rad. Den Rest können Sie sich denken! Genickbruch! Sie ist bereits tot, bevor der Wagen in die Palme rast – aber nicht wegen der Nackenstütze, und nur darauf kommt es an.
Natürlich habe ich ein Stück des gelben Seidenschals mitgenommen. Es ziert das Wandbord über dem Kamin meines Wohnzimmers, direkt neben der Kassette von Janis Joplin und dem verformten Projektil aus dem Lauf einer 38er Smith & Wesson. Wie ich zu diesem Prachtstück gekommen bin?
Der Fall beginnt wie immer. Mr. Lloyd telefoniert herum, sagt seine Unterstützung zu und schickt mich zu einem Unfallort. Diesmal in eine weiße Sandsteinvilla am Strand von Santa Barbara. Im Bett liegt ein Toter im Hawaiihemd, der sich mit einer Smith & Wesson das Gesicht weggeschossen hat. Hässliche Sache! Die Waffe ist noch in seiner Hand, Blut, Knochen und Hirnmasse kleben überall, und an den Fingern des Toten finden sich außerdem Spuren von Kordit. Ebenso finden sich in seiner Kleidung Rückstände des Anzündsatzes und der Treibladung der Munitionspatrone.
Die Witwe hat uns kontaktiert, weil sich die Versicherung im Falle eines Selbstmords weigert, die Prämie der Lebensversicherung auszubezahlen, und nun soll ich beweisen, dass es kein Selbstmord war. Witzig! Ich versuchte es trotzdem.
Als ich von der Telefongesellschaft die Liste der letzten Verbindungen mit der vom Rechtsmediziner ermittelten Todeszeit vergleiche, finde ich den entscheidenden Hinweis, was sich in jener Nacht tatsächlich zugetragen hat: Die Ehefrau des Toten steht mitten in der Nacht stinksauer am Bahnhof und ruft zu Hause an, weil sie den letzten Zug verpasst hat. Als ihr Mann, durch den nächtlichen Anruf geweckt, statt nach dem Telefon zur Waffe greift, die auf dem Nachttisch liegt, schießt er sich beim »Abheben« versehentlich in den Kopf. Blöder Zufall, kommt sicher nur einmal im Leben vor. Jedenfalls ist es ein Unfall und kein Selbstmord gewesen – Klage gewonnen, die Versicherung muss zahlen, und unsere Klientin erhält ihre Prämie.
Aber auch mich hat es eine schöne Stange Geld gekostet, um über den Rechtsmediziner, der die Autopsie durchgeführt hat, an das verformte Projektil zu kommen, das jetzt neben zahlreichen anderen Kleinodien mein Wandregal ziert.
Meine alte Mutter, diese Nervensäge, meckert zwar ständig herum, wie ich nur solch grausige Exemplare sammeln kann, die sie am liebsten in den Müll werfen möchte, aber ich habe meinen Grund dafür. Und zwar einen richtig guten. Meiner Mutter gegenüber habe ich ihn stets verheimlicht – sie muss nicht alles wissen –, aber Ihnen kann ich es verraten. Ein Aberglaube besagt, dass ein Gegenstand, der schon einmal den Tod gebracht hat, den nächsten Besitzer davor bewahrt. Das ist das ganze Geheimnis. Deswegen sammle ich solche Dinge – nicht, weil es sich um makabre Raritäten handelt.
Ein ebenso kurioser Fall ergibt sich, als Mr. Lloyd mich nach San Diego schickt.
»Freddy, finden Sie raus, was passiert ist!«
Ich komme hin, und die Typen von der Behörde erzählen mir folgende Geschichte: Ein älterer Mann läuft den Bordstein entlang zu seinem Auto und stürzt über die Straßenabsperrung, die die Bauarbeiter errichtet haben, um einen offenen Gullyschacht zu sichern. Der Mann fällt kopfüber in den Gully und stirbt. Aber nicht an Genick- oder Schädelbasisbruch, sondern er ertrinkt. Tatsächlich! Denn als ihn die Feuerwehrleute mit einer Seilwinde rausziehen, ist seine Lunge randvoll mit dreckigem Abwasser gefüllt, obwohl der Schacht nur etwa dreißig Zentimeter tief unter Wasser steht. Aber durch den Sturz steckt der Mann so fest mit den Schultern im Schacht, dass er hilflos ertrinkt. Das Bauunternehmen wurde wegen fahrlässig aufgestellter Absperrung verklagt – und wir vertreten die Firma! Scheiße!
Natürlich muss ich zuerst den Tatort besichtigen, und so stehe ich wadentief, mit einer Taschenlampe bewaffnet, in der Kloake. Unter der Wasseroberfläche glänzt ein silberner Gegenstand im Licht, der sich als Schlüsselbund entpuppt. Davon passt einer ins Schloss des alten, klapprigen Buicks, der am Straßenrand parkt und dem Toten gehört. Danach ist mir alles klar: Ungeschickt, wie der Mann ist, fällt ihm der Schlüssel aus der Tasche, mitten in den Gully. Er beugt sich kopfüber in den Schacht, verliert das Gleichgewicht, stürzt hinunter, bleibt stecken und ertrinkt. Tod durch eigenes Verschulden – Klage abgewiesen! Die Witwe bekommt den Bund mit dem Reserveschlüssel, aber der Original-Autoschlüssel gehört wem? Richtig, mir!
Leider wohnt meine Mutter im selben Wohnblock wie ich, denn nach Vaters Tod ist sie in eine frei gewordene Wohnung umgezogen, um in meiner Nähe zu sein, wie sie ständig betont. Jedes Mal, wenn ich auf einer längeren Dienstreise bin, schleicht sie sich mit dem Generalschlüssel des Hausmeisters heimlich in meine Wohnung, um zu putzen oder alle Möbel umzustellen. Einmal hätte sie mit dem Staubsauger in ihrem Sauberkeitsfimmel beinahe den Autoschlüssel des Buicks verschwinden lassen, dabei habe ich ihr schon tausendmal gesagt, sie soll die Finger von den Regalen mit meiner Sammlung lassen. Aber nicht nur das, mit ihrer herrischen Art vertreibt sie alle Frauen aus meinem Leben.
»Freeed, mach dir nichts draus, Junge«, pflegt sie dann zu sagen. »Wegen deines kranken Hobbys hätten diese Frauen dich ohnehin bald verlassen.«
Ja, ich gebe zu, in gewisser Weise bin ich ein Junkie, ein Todestourist, der makabre Souvenirs sammelt, um sich durch das Unglück anderer Vorteile zu verschaffen. Aber jedes dieser Stücke hat eine faszinierende Geschichte zu erzählen, wie auch jenes einfache blaue Benzinfeuerzeug. Sie würden nie erraten, was dieses harmlose Ding angerichtet hat.
Vor einigen Jahren um die Weihnachtszeit kauft sich ein Farmer aus Clearlake Oaks im Norden einen zwanzig Jahre alten, beinahe zu Schrott gefahrenen Trans Am. Der Mann heißt Joe Burner. Ich erinnere mich deshalb noch genau an den Namen, weil es einfach zu komisch ist. Jedenfalls möchte dieser Joe Burner Geld sparen und verdünnt das Benzin im Autotank des Trans Am mit Wasser. Anscheinend weiß er nicht, dass sich Benzin nicht mit Wasser vermischt, da Benzin obenauf schwimmt. Da der Ansaugstutzen im Tank eines Wagens unten ist, wird natürlich zuerst das Wasser in den Motor gesogen, worauf der Motor absäuft. Es ist Winter, über Nacht treten Minusgrade auf, und das Wasser gefriert, woraufhin der komplette Motor verreckt.
Uns leuchtet das natürlich ein, aber als ein Mechaniker dem Farmer erklärt, was geschehen ist, schiebt dieser seinen altersschwachen Trans Am in die Garage, rollt einen tragbaren Elektroheizkörper unter das Auto, um das Eis im Motor schneller aufzutauen. Als er schließlich mit dem Feuerzeug in den Tank leuchtet, um zu sehen, wie weit der Auftauprozess vorangeschritten ist, können Sie sich vorstellen, was passiert. Genau, das Gasgemisch im Tank entzündet sich. Die Explosion sprengt nicht nur das Auto mitsamt der Garage in die Luft, sondern das halbe Haus und tötet ihn und seine Frau … und der Mann heißt Joe Burner, welch Ironie! Merkwürdigerweise übersteht das blaue Benzinfeuerzeug die Katastrophe ohne Schaden, weshalb es unter all den Todesandenken mein Lieblingsstück ist. Falls der Aberglaube stimmt, dass ein Gegenstand, der schon einmal den Sensenmann gerufen hat, im Weiteren vor ihm schützt, muss dieses Feuerzeug ein wahrer Schutzengel sein.
Mittlerweile sind meine Wandregale ziemlich voll. Sie würden nicht glauben, was sich darauf alles befindet: Ein Tennisball, eine Krawattennadel, ein Fläschchen Nagellack, ein kaputter Fenstergriff, Essstäbchen aus dem Chinarestaurant, eine kindersichere Steckdose oder das rostige Kettenglied einer Motorsäge. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich Ihnen zu jedem Utensil eine köstliche Geschichte erzählen, wie beispielsweise die über meine jüngste Errungenschaft.
Eine junge Frau aus Palm Springs versucht auf dem Balkon den Käfig ihres Kanarienvogels mit Staubwedel und Putztüchern zu reinigen. Dabei steht sie auf einem Drehstuhl mit feststellbaren Rollen. Als der Vogel anfängt zu kreischen, beginnt der Stuhl zu rollen, obwohl die kleinen Kunststoffräder festgestellt sind. Die Frau stürzt aus dem elften Stock ihres Wohnhauses über die Brüstung und reißt den Käfig samt dem armen Vogel mit sich in den Tod.
In der Bedienungsanleitung des Sessels wird vor keiner derartigen Aktion gewarnt, und ich kann beweisen, dass eine der Rollen defekt ist – woran ein winziger Produktionsfehler in der kompletten Serie schuld ist. Kurios ist, dass nicht der Witwer, sondern der Verein für Kanarienvögel unser Auftraggeber ist. Wir gewinnen den Fall, die Sesselfirma muss zahlen – die volle Summe! Leider wird der Stuhl mit der defekten Rolle vom Gericht sofort eingezogen, aber immerhin besitze ich den verbeulten Vogelkäfig.
Ich bin ein Freak und kaufe mir ein Exemplar des gleichen Drehstuhls. Erstaunlicherweise sind die leichter zu finden, als ich dachte, denn nach der gewonnenen Klage gegen die Firma kann man die Stühle günstig aus der Konkursmasse erwerben. Ich finde heraus, wie einfach die Rollen zu manipulieren sind. Man muss nur einen Plastikstift abbrechen, schon lässt sich die Rolle nicht mehr fixieren und … Ach, von dem vielen Erzählen habe ich völlig die Zeit vergessen. Meine Mutter kommt soeben schwer beladen mit Papiertüten von ihrem Einkauf heim.
»Freeed! Was machst du hier Junge?«, kreischt sie.
O Gott! Es ist ihre übliche Begrüßung, wenn wir uns freitagabends sehen, um eine Partie Rommé zu spielen, bei der sie mir jedes Mal zehn Dollar abknöpft. Für meine Mutter ist das die schönste Zeit der Woche, da sie eine volle Stunde lang über mich lästern und mich herrlich demütigen kann … außerdem mogelt sie beim Kartenspiel und glaubt, ich merke es nicht.
»Ich habe im Treppenhaus deinen Nachbarn von oben getroffen!«, schreie ich, damit sie mich besser hört. »Er hat gemeint, du sollst den Efeu, der auf deinen Balkon herunterhängt, selbst abschneiden. Ich habe dir einen nagelneuen Stuhl gekauft …«
Zwar schaut mich meine Mutter skeptisch und verbissen an, wie sie es immer tut, aber wenn alles klappt, habe ich bald ein weiteres Souvenir in meiner Sammlung.
Nachts in der Bourbon Street
Nachts in der Bourbon Street ist eine von insgesamt drei Vampir-Geschichten, die Sie in diesem Buch finden werden. In typischer Anne-Rice-Tradition habe ich New Orleans als Schauplatz ausgewählt. Ich habe die Stadt tatsächlich besucht, lange vor der schrecklichen Hochwasser-Katastrophe, und der St. Louis Cemetary No. 1 und der Mississippi-Raddampfer sind mir von der gesamten USA-Reise am lebhaftesten in Erinnerung geblieben.
New Orleans zu beschreiben ist schwer. Die Stadt ist feucht, sie atmet, pulsiert und schwitzt richtiggehend. In manchen Straßen des French Quarter fühlt man sich als Weißer unter all den Schwarzen wie ein Fremdkörper, der nicht dazugehört. Ein Gefühl, das man einmal erlebt haben sollte.
Ob mir die Idee zu dieser Story tatsächlich auf dem St. Louis Cemetary gekommen ist, lässt sich natürlich nicht mehr genau sagen, aber unmöglich ist es nicht …
Der Nigger keuchte schwer und starrte mich an. Er stank wie ein Tier, nach Urin und Schweiß. Er war genauso fett wie alle anderen Nigger, die ich kannte. Seine Ausdünstung hing wie ein angepisstes Tuch in dem Büro. Auf der Stirn des Mannes glänzten Schweißtropfen, wie Glasmurmeln auf ebenholzschwarzer Haut, in denen sich das Licht der Gaslampe spiegelte.
»Sie wollen also morgen Abend tatsächlich sterben?«, stellte er fest.
Ich nickte und schob einen braunen Umschlag über den Tisch. Der Nigger warf einen kurzen Blick darauf. Er stützte sich auf die Ellenbogen, presste die Handflächen aneinander, wie zum Gebet gefaltet, und strich sich mit den Fingerkuppen über den breiten Nasenrücken. Dann griff er nach dem brüchigen Papier, löste den Bindfaden vom Umschlag und öffnete das Kuvert. Zuerst betrachtete er den Druck des Ölgemäldes, das noch aus der französischen Kolonialzeit der Stadt stammte. Das Bild war vergilbt, an den Rändern eingerissen und von der Luftfeuchtigkeit gewellt. Für mein Vorhaben würde es genügen. Er sah auf und betrachtete mich.
»Erstaunlich. Das Bild sieht Ihnen ähnlich, Baron von Wörderschlöff …«, murmelte er, einem Gurgeln gleich. Mit einer feuchten Aussprache, als wären seine Backen mit Kautabak gefüllt, der ihm jeden Augenblick zwischen den dicken Lippen hervorsprudeln könnte, verunstaltete er meinen Namen. Von Wörderhoff!
Zögernd entnahm er dem Kuvert das Schriftstück mit den Details. Das Pergament knackte, als er es auseinanderfaltete. Er las das Dokument und verharrte in der Bewegung. Seine Hände verschmolzen mit dem Mahagoniholz der Tischplatte, nur seine weißen Fingernägel leuchteten wie Münzen, in denen sich das Mondlicht spiegelte.
Am Ende des Schreibtisches glänzte eine Messingtafel mit eingraviertem Schriftzug: Wahoo Samuel Jacob – Solicitor. Das Licht der Lampe spiegelte sich darin. Ein ähnliches Schild prangte am Eingang des Büros über der Türglocke an der vom Meersalz zerfressenen Holzfassade. Das Fehlen der Louisiana-Registrierungsnummer und des Notariatsemblems von 1908 verriet die Zweitklassigkeit seiner Kanzlei.
»Um 23 Uhr, im Chattanooga, in der Bourbon Street.« Er nickte, flog mit den Augen über die geschwungene Handschrift, und wischte sich mit einem Taschentuch über die Stirn, doch schon im nächsten Moment schoss ihm wieder der Schweiß aus den Poren. Am Rand des schmierigen Stoffs waren die Initialen WSJ mit rotem Bindfaden eingestickt. Wahoo Samuel Jacob, der sein Büro schon wegen seines Namens nur in dieser Stadt führen konnte, knüllte das Tuch zusammen, um es anschließend in der Seitentasche des Anzugs verschwinden zu lassen.
Er blickte kurz auf. »Ist Ihnen nicht heiß?«
Ich schüttelte den Kopf. Für ein fettes Schwein wie ihn mussten die Nächte in New Orleans unerträglich sein. Sicher presste die Hitze seinen Brustkorb zusammen, die Luftfeuchtigkeit durchtränkte seine Kleidung, und tagsüber sprengte ihm der Druck die Schädeldecke. Ich wusste, wie er sich fühlte. Das Büro verfügte über keine Belüftung. Das Fenster war zwar geöffnet, die Jalousie klapperte aber nur müde im Luftzug, und gemächlich zogen die Rotorblätter des Ventilators ihre Kreise unter der Holzdecke. Draußen tuckerte der Viertaktmotor eines Automobils. Das Signalhorn des Wagens röhrte, und mit dem Knallen der elektrischen Zündung erstarb das Tuckern in einer Seitengasse.
Der Nigger legte die Stirn in Falten. »Sind Sie sicher, dass …?« Er rang nach Atem.