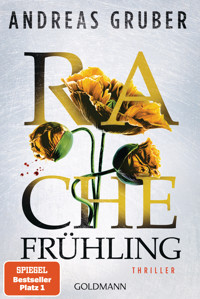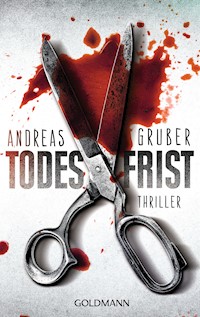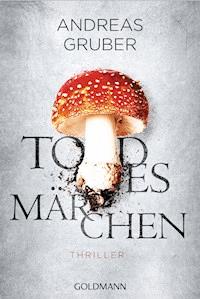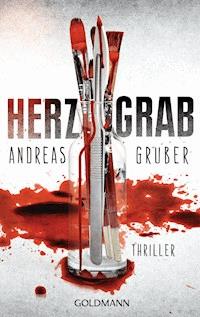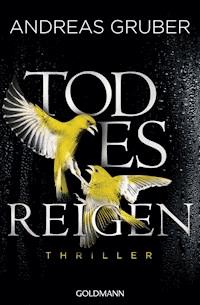Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Andreas Gruber Erzählbände
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Andreas Gruber erzählt über eine Zeit, in der Menschen mit Computern verschmelzen, Raumschiffe vom Radar verschwinden, Mitbürger sich mit Downloads konditionieren lassen müssen, Duelle mit defekten Decipher-Handfeuerwaffen verboten sind und niemand ohne weiteres ein Angebot der Regierung ablehnt. Erfahren Sie, was am Rande des Universums existiert und warum ein Penner mit einem Notebook am Würstelstand die Zukunft der Menschheit kennt. Entdecken Sie ein mysteriöses Motel an der Autobahn, das gar nicht existieren dürfte, und eine seltsame Firma, die bereits seit 1939 Zeitreisen anbietet – allerdings ohne Rücktrittsklausel. --------------------------------------------------------------- "Wer in Grubers Science-Fiction-Welten vordringt, wird niemals mehr wieder umkehren wollen. Nehmt euch in Acht!" [Michael Marcus Thurner]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE LETZTE FAHRT DER
ENORA TIME
Copyright © 2018 by Andreas Gruber
überarbeitete Ausgabe © 2024 LUZIFER Verlag
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Michael Schubert | Luzifer-Verlag
ISBN: 978-3-95835-343-5eISBN: 978-3-95835-344-2
Printed in Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Veronika A. Grager,danke für deine jahrelange Begleitung,deinen zynischen Humor und deine große Intuition
»Die Zukunft hat viele Namen.Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare.Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte.Für die Tapferen ist sie die Chance.«
Victor Hugo
INHALT
Vorwort: Warum das mein letztes Buch ist
Ecke 57th Street
Duell im Mintauer
Ex Libris: Achtzehntausend Gigabyte
Das Motel
Rendezvous
Zeitreise Inc. – Wir korrigieren alles
Dr. Stein
Das Planspiel
Joyce
Heimkehr nach Algata
Die letzte Fahrt der Enora Time
Nachwort
Quellenverzeichis
Vorwort:Warum das mein letztes Buch ist
Jetzt gerade ist es kurz vor Mitternacht, der Wind drückt das Laub ans Fenster, der Nieselregen klopft sanft an die Scheibe und wird vermutlich in den nächsten Stunden heftiger werden. Ich werde es erleben, denn ich habe vor, in dieser Nacht noch länger am PC zu sitzen. Immerhin soll dieses Vorwort ja fertig werden.
Zum Glück ist es in meiner Stube warm. Im Heizkörper gluckert und gluckst es, meine Frau, die ich am Nachmittag noch kurz gesehen habe, ist übers Wochenende mit einer Freundin in eine Wellnesstherme gefahren. Sturmfreie Bude! Ich habe mir am Abend noch Alarm im Weltall, einen Science-Fiction-Klassiker aus dem Jahr 1956 mit Leslie Nielsen auf DVD angesehen und bin jetzt in der richtigen Stimmung, dieses Vorwort zu schreiben.
Vor exakt einem Jahr bot mir Steffen Janssen an, meinen seit langem vergriffenen Science-Fiction-Erzählband Die letzte Fahrt der Enora Time in seinem Luzifer Verlag neu zu veröffentlichen. Damals sagte ich sofort zu. Es war die Chance, die alten Storys stilistisch zu überarbeiten, aufzupolieren und zu erweitern, um sie einem neuen Publikum zu präsentieren. Die Storysammlung hatte im Jahr 2001 den ersten Platz beim Deutschen-Phantastik-Preis belegt, den zweiten Platz beim Deutschen-Science-Fiction-Preis und den dritten Platz beim Kurd-Lasswitz-Preis. Nicht, dass ich mich damit brüsten möchte, aber ich denke, es wäre schade, wenn es als vergriffenes Buch in Antiquariaten verstauben würde.
Allerdings meinte mein neuer Verleger, ich müsste den alten Erzählband um neue Storys erweitern, denn damit würde der Band genauso dick werden wie meine anderen Bände im Luzifer Verlag. Kein Problem! In meiner Schublade lagen noch eine unveröffentlichte Erzählung und weitere SF-Storys, deren Rechte im Lauf der Zeit an mich zurückgefallen waren.
Nichts leichter als das. Ich hatte ja ein Jahr lang Zeit dafür. Aber dieses eine Jahr hatte es in sich. Und davon möchte ich Ihnen erzählen …
Einige Monate bevor dieses Jahr begann hatte mir Thomas Fröhlich, ein befreundeter Stückeschreiber, Rezensent und Herausgeber, eine E-Mail mit einer Handvoll YouTube-Links geschickt und dazu geschrieben, dass ich mir das einmal anhören sollte. Songs von Pete Mallick and the Sputniks. Sie wären zwar etwas psychedelisch, könnten mir aber gefallen. Ich hatte von dieser Band noch nie gehört. Außerdem dachte ich damals: Herrgott, schon wieder jemand, der mich bekehren will!
Ich höre nämlich leidenschaftlich gern Hard Rock und Heavy Metal, und das seit über fünfunddreißig Jahren, und nicht so einen psychedelischen Mist. Die erste Langspielplatte, die ich mir mit zwölf Jahren von meinem sauer ersparten Taschengeld gekauft hatte, war Back in Black von AC/DC gewesen. Thomas Fröhlichs E-Mail lag also einige Monate lang in meinem elektronischen Postfach, bis der Zeitpunkt kam, als ich eines Montagmorgens die erste Story für diesen Erzählband überarbeiten wollte, mir nicht die richtigen Worte einfielen und ich – zu gleichen Teilen aus Langeweile und zur Ablenkung – auf den ersten Link klickte, den Thomas Fröhlich mir gemailt hatte.
War of the Worlds hieß der Titel. Und ich war sogleich gefangen von der melancholisch traurigen Stimme, die mich an einen jugendlichen Orson Welles erinnerte, der panisch, nervös und vom Wahnsinn verfolgt, zurück in seine heimatliche Küstenstadt musste, wo der blanke Horror einer Alien-Invasion regierte. Was für ein Song!
Nun wusste ich, was Thomas Fröhlich gemeint hatte. Das könnte dir gefallen! Als Science-Fiction-Fan, der die klassischen Themen dieses Genres über alles liebte, klickte ich den nächsten Titel von Pete Mallick an. Der Song Orwell beschrieb eine Nacht in jener legendären Verhörzelle 101 in einer zukünftigen Welt des Jahres 1984. Wieder dieser sanfte, traurige, leicht besessene Gesang, begleitet von einer Gitarre, die sich dramatisch steigerte, und einer Orgel, die aus einem unheimlichen Raumschiff-Cockpit zu stammen schien.
Okay, dachte ich. Und dieses Okay bedeutete, dass das Manuskript, an dem ich gerade arbeitete, warten konnte. Ich schloss die Datei meines Storybandes und widmete mich den anderen YouTube-Links.
Der Song Guy Montag basierte auf Bradburys Roman Fahrenheit 451, und auch hier begegnete ich wieder diesem von Irrsinn befallenen Gesang, der sich dramatisch steigerte und diesmal von dem Geklimper eines historischen Tasteninstruments begleitet wurde, vermutlich eines futuristischen Cembalos, das den Sound brennender Bücher imitierte. Weiter!, dachte ich.
Der Song Body Snatchers basierte auf einem Roman von Jack Finney, der in den 70er Jahren mit Donald Sutherland genial verfilmt worden war. Mein Gott, worauf war ich da gestoßen? Diesmal mit harten Drums, einer psychedelischen Gitarre, einem Synthesizer und elektronisch verzerrtem Refrain, der den verwirrten Geist eines von Pflanzen verfolgten Mannes punktgenau traf. Wells, Orwell, Bradbury, Finney! Was würde Mallick noch zu bieten haben?
Ein anderer Song hieß Nostromo und spiegelte meine Liebe zu klassischen Raumschiffen wider, mit einem Sound und einem Refrain, der die Einsamkeit im All und die Verzweiflung der Crew im Kampf gegen ein außerirdisches Lebewesen wunderbar traf, und den Film Alien im Vergleich dazu wie eine TV-Kindersendung wirken ließ. Weitere Songs hießen Enterprise, Orion Patrol oder Event Horizon und – Sie haben es bestimmt schon erraten – auch für diese Raumschiffe hege ich eine große Leidenschaft. Worüber in The Time Machine, Blade Runner und Neuromancer gesungen wurde, können Sie sich vermutlich schon denken.
Okay, okay. Ich räumte also alles von meinem Schreibtisch beiseite und öffnete auf dem ersten Bildschirm das YouTube-Download-Programm und auf meinem zweiten Bildschirm Wikipedia. Während das Programm diese elf Songs runterlud, musste ich nachlesen, wer dieser Pete Mallick und seine Band, die Sputniks, eigentlich waren. Aha, Briten. Pete Mallick war fünfundfünfzig Jahre alt, Musiker und Songwriter. Gut, schon bald hatte ich ein Bild von ihm vor Augen. Und dieses Gesicht passte zu der kindlich singenden, teilweise krank anmutenden, verrückten und besessenen Stimme, die so düstere utopische Themen besang.
So ein Mist! Warum hatte ich diese Links nicht schon vor Monaten geöffnet? Endlich war der Downloader fertig und ich hatte diese elf Songs auf der Festplatte archiviert.
Kaum hatte ich sie gehört, gab ich sogleich in YouTube einen Suchbefehl ein. Ich wollte wissen, welche Songs es noch von Pete Mallick gab. Genauer gesagt, wollte ich wissen, über welche klassischen Science-Fiction-Themen er noch sang. Hätte ja gut sein können, dass diese Themen nur auf einer einzigen CD aus der Frühphase seines Schaffens zu finden waren und er mittlerweile über ganz andere Dinge wie Apartheid, Walfang oder Klimawandel sang.
Doch da irrte ich gewaltig!
Schon bald entdeckte ich einen Titel namens Mister Dick's Fantasies, der einen so einprägsamen Refrain hatte, dass ich schon nach dreißig Sekunden mitsang. Und ab da hatte mich das Pete-Mallick-Fieber gepackt. Die Warteschleife des Downloaders war voll mit Songs. Brave New World mit seinem packenden und dramatischen Refrain war ein ebenso mystischer Song, den ich unbedingt haben musste. Und als ich zum ersten Mal Space Odyssey hörte, mit dem traurigen Cello, das sanft und subtil im Hintergrund spielte, drückte es mir die erste Träne aus dem Auge, ohne zu wissen, worum es in diesem Song eigentlich ging. Und dann kam der Refrain, und ich ahnte, dass der Computer HAL einen Fehler begangen hatte, woraufhin vielleicht alle im All sterben würden, und mir liefen die Tränen über die Wangen.
Na, wie peinlich war denn das! Zuletzt hatte ich geweint, als ich 1990 Der mit dem Wolf tanzt im Kino gesehen hatte.
Reiß dich zusammen, dachte ich und klickte einen weiteren Song an. Und der gab mir den Rest. In Captain Nemos last Travel stand der gleichnamige Kapitän im Morgengrauen am Steuerrad der Nautilus und sprach zu seiner Mannschaft. Er hatte mit dieser Welt abgeschlossen.
Sogleich sah ich James Mason in der Walt-Disney-Verfilmung 20.000 Meilen unter dem Meer aus dem Jahr 1954 vor mir. Die Schlussszene hatte sich seinerzeit unauslöschlich in das Gedächtnis eines zehnjährigen Jungen eingebrannt, der Rotz und Wasser geheult hatte, als Captain Nemo es mit dem Ruderboot zu seiner Nautilus geschafft hatte und an Deck sprang, während die Soldaten den Hügel an der Küste herunterrannten und auf ihn schossen. Alle Mann waren bereits unter Deck, nur Captain Nemo musste noch die wenigen Meter bis zum Abgang schaffen, dann könnte er die Luke schließen und die Nautilus tauchen lassen. Doch auf den letzten Metern wurde er in den Rücken geschossen und taumelte schwer verletzt unter Deck. Mit keuchenden Atemzügen packte er das Steuerrad und ließ die Nautilus in die blauen Tiefen abtauchen.
All das sah ich plötzlich vor mir, dazu kam der Frauenchor in Pete Mallicks Song, der pochende Klang des Sonargeräts und die subtilen futuristischen Walgesänge im Hintergrund … und ich saß an meinem Schreibtisch und heulte mir erneut die Seele aus dem Leib.
Nach einer Weile verebbte mein melancholischer Anfall, und ich beruhigte mich wieder. Während das Download-Programm ratterte, bastelte ich mir schon ein Cover für eine Pete Mallick CD. Ich wollte mir keine Alben von ihm kaufen, da darauf ja auch bestimmt schlechte Songs enthalten waren. Stattdessen wollte ich mir selbst eine CD brennen. The Greatest Hits of Pete Mallick and the Sputniks. Noch ein paar Songs, dann hatte ich zwanzig beisammen, was für ein etwa 80 minütiges Album reichen würde.
Mittlerweile hörte ich die Songs auf YouTube gar nicht mehr zu Ende, sondern klickte einfach nur noch mitten rein. Die unter die Haut gehende Stimme, die herzzerreißende Traurigkeit, die düstere Atmosphäre und die ergreifenden Gitarren, die melancholischen Violinen, das unheimliche Piano und das zu Tränen rührende Cello, gepaart mit den mechanischen Klängen verrückt gewordener futuristischer Maschinen und Computersysteme auf defekten Kommandobrücken, waren einfach der Wahnsinn! Steampunk Diaries war ein ebenso genialer Song, genauso wie Umbrella Corporation, Mister Asimov's Robots, Future Crimes, Solaris oder Thirteen Monkeys. Jeder Song war eine großartige Hommage an eines der großen Themen der Science-Fiction.
Ich hörte nur Fragmente von den Lyrics und reimte mir meine eigene Zukunftswelt zusammen, um die es in diesen Songs zu gehen schien. In Triffids sah ich plötzlich einen netten, zuvorkommenden, aber besessenen Wissenschaftler vor mir, der einen fremden Gast in sein Haus einlud, um ihm seine Freunde vorzustellen … hungrige bizarr aussehende Pflanzen, die gefüttert werden mussten. Begleitet von einer Akustikgitarre und einer Flöte, die in meiner Vorstellung die Geräusche von fleischfressenden Blüten ziemlich gut imitierte. Und in meiner Phantasie entstanden weitere unheimliche Storys, über die Pete Mallick sang – Cyberspace Love, Colossus, Skywalker, Double-Singularity, Cought in the Void, Cyberdyne Systems oder The Hitchhikers of the Galaxy – und kaum hatte ich es versehen, waren vierzig Songs auf meinem PC heruntergeladen. Verdammt! Vierzig! Ich wollte doch nur eine Greatest Hits-CD machen.
Das mag Sie vielleicht wundern, aber dazu muss ich erklären, dass ich ein pedantischer Zwangsneurotiker bin, der alles in seinem Leben geordnet haben muss. Also kramte ich in meiner Schublade und fand tatsächlich eine leere Doppel-CD-Hülle. Okay, dann wurde es eben ein Doppel-Album Greatest Hits. Cover und Rückseite waren bald fertig – ich hatte im Web ein tolles, mystisch anmutendes Bild von einem havarierten Raumschiff in der Umlaufbahn eines Mondes gefunden, das ich für meine selbstgebrannte CD geklaut hatte und das zur phantastischen Welt des Pete Mallick passte – druckte es am Farbdrucker aus, schnitt es zurecht, faltete es, brannte die Rohlinge und fertig war das Doppelalbum.
Das alles spielte sich vom Vormittag bis zum Abend ab. Mein Manuskript war an diesem Tag liegen geblieben, der Abgabetermin der ersten überarbeiteten Story würde sich deshalb nur geringfügig verschieben, aber egal – die Arbeit an diesem Album war jede Minute wert gewesen.
Noch in derselben Nacht las ich vor dem Einschlafen zur großen Verwunderung meiner Frau nicht in Orson Scott Cards Sachbuch How to write Science-Fiction weiter, sondern hörte mit dem Discman die CDs. Jedes Album zweimal! Bis drei Uhr früh. Bei manchen Songs hatte ich sogar erneut Tränen in den Augen und Gänsehaut am ganzen Körper, da ich die Inhalte der Texte erst jetzt richtig verstand und mir den Rest der Handlung dazu fantasierte. Danach träumte ich wirres Zeug.
Am nächsten Morgen frühstückte ich mit meiner Frau, log sie beinhart an, dass die Arbeit an meinem neuen Buch gut voran ginge. Kaum hatte sie mich daran erinnert, die Waschmaschine am Nachmittag einzuschalten, mir einen Kuss gegeben und um sieben Uhr früh das Haus verlassen, um nach Wien ins Büro zu fahren, startete ich bereits den PC in meinem Schreibbüro. Das Manuskript öffnete ich gar nicht erst. Pfeif drauf! Heute würde ich etwas völlig anderes machen.
Während meiner verrückten Träume in der Nacht, die von Tentakelwesen in Raumschiffen, blutrünstigen Aliens, fehlerhaften Riesencomputern, Havarien und abstürzenden Raumsonden im Weltall, fremden Planeten, Wurmlöchern, Androiden, Robotern und geheimnisvollen Gehirn-Fabriken, viktorianischen mit Dampf betriebenen Luftschiffen, gescheiterten Zeitreisen, unheimlich blitzenden Hologrammerscheinungen und U-Booten und Kraken auf dem Meeresgrund handelten, war ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich alle verfügbaren Songs von Pete Mallick and the Sputniks haben musste. Und zwar nicht nur jene faszinierenden Songs, deren Titel mich an die klassischen Science-Fiction-Themen erinnerten, sondern einfach alle Songs, die ich auf YouTube von ihm finden konnte, ganz egal, worüber er sang. Alle! Sie verstehen, was ich meine? Alle! Ich bin eben ein Zwangsneurotiker.
Während ich also eine Liste mit Songtiteln erstellte, ratterte der Downloader unaufhörlich. Da Pete Mallick nicht gerade ein weltberühmter Musiker war, der radiotaugliche Musik machte, hatte er eine ziemlich nerdige Fan-Community, weshalb es relativ viel von ihm im Netz zu finden gab. Und die Job-Queue wurde immer länger und länger. Verdammt, so viele CD-Rohlinge und Hüllen hatte ich gar nicht zu Hause! Sobald ich einen Überblick darüber haben würde, wie viele Songs ich aus dem Netz geklaut hatte, würde ich in den Supermarkt fahren müssen, um Rohlinge zu kaufen. Am besten gleich mehrere Doppel-CD-Hüllen für weitere Greatest Hits Volumes.
Am Nachmittag hatte ich weit über hundert Songs, manche doppelt – in besserer und schlechterer Qualität – und manche in unterschiedlichen Fassungen: Out-Takes, Demoversionen, Spoken Word-Aufnahmen, Live-Mitschnitte, Instrumentalsongs, Rehearsals, alternative Re-Mixes oder Live Acoustic Radio Sessions. Es war zum Verrücktwerden!
Ich hörte mir alles an, suchte die besten Fassungen heraus, sortierte sie und schnitt mit einem Programm die unnötigen Anfänge und Enden weg. Bald wusste ich es: Ich hatte 156 verschiedene Songs in Top-Qualität. Das ging sich genau auf sechs Doppel CDs mit je 13 Songs pro Silberling aus. Dreizehn! Wie passend. Thirteen Monkeys! Ein dunkles Omen!
Ich setzte mich in den Wagen, fuhr in den Nachbarort zum Supermarkt und kaufte ein. Spaßeshalber fragte ich die Verkäuferin an der Kassa, ob sie CDs von Pete Mallick habe.
»Nein, habe den Namen noch nie gehört. Wer soll das sein?«
Dumme Tussi! Hast keine Ahnung, was dir da entgeht.
Rein ins Auto, heimgefahren, zum PC gelaufen, sechs neue passende bunte Motive aus dem Internet geklaut – Raumstation, Wurmloch, Alienwesen, Roboter, Shuttle und eine Maschinenfabrik – und sechs neue CD-Covers gebastelt.
Pete Mallick – Greatest Hits – Volume I – VI
Farbig ausgedruckt, zurechtgeschnitten, gefaltet, gebrannt – und fertig!
Mit geröteten Augen starrte ich stolz auf mein Werk. Zur gleichen Zeit kam meine Frau heim und ging in mein Arbeitszimmer.
»Du bist schon da?«, fragte ich sie erstaunt.
»Ha, witzig«, antwortete sie. »Es war ein Stau auf der Autobahn, ich bin eine Stunde zu spät.«
Verblüfft blickte ich zur Wanduhr. Es war nach 19 Uhr.
»Hast du bei deinem neuen Buch viel vorangebracht?«, fragte sie mich.
»Ja, sicher, ich hatte heute einen guten Schreibfluss«, antwortete ich und ließ die CDs unauffällig in der Schublade verschwinden.
»In der Küche riecht es gar nicht verbrannt. Hast du dir nichts zum Mittagessen gemacht?«
Das Essen! Das hatte ich ganz vergessen. »Ich war beim Chinesen«, log ich.
»Und hast du die Waschmaschine eingeschaltet?«
Scheiße!
Die nächsten Wochen waren wie der berühmte Paradigmenwechsel für mich gewesen, über den drittklassige Unternehmensberater ständig schwafelten, weil sie gern eine 180-Grad-Wendung in ihrer Lebensanschauung hätten.
Mir war das passiert! Unbeabsichtigt.
Ich verbannte meine CD-Kiste mit den Hard Rock und Heavy Metal Alben in den Kofferraum meines Wagens. Fortan sollte mein Gefährt nicht mehr Metal-Mobil, sondern Mallick-Mobil heißen, denn ich hörte während der Autofahrt nur noch meine Pete-Mallick-CDs. Außerdem kopierte ich mir die Songs auf den mp3-Player und hörte sie vor dem Schlafengehen, oft weit bis nach Mitternacht. Orson Scott Cards How to write Science-Fiction blieb jede Nacht ungelesen auf meinem Nachtschrank liegen.
Zusätzlich hörte ich die Compilations anstatt der üblichen Mark-Brandis- und Perry-Rhodan-Hörspiele auf dem mp3-Player beim Nordic Walken, denn jeden Donnerstag ging ich für eine Stunde in den Wald, um kreative Energie zu tanken. Allerdings brauchte ich die gar nicht mehr, denn das Manuskript des Erzählbandes blieb sowieso unbearbeitet liegen.
Stattdessen verbrachte ich die Tage, indem ich nach Pete Mallick googelte. Ich musste alles über diesen Mann und seine Band erfahren. Wenn ich für gewöhnlich im Internet ein interessantes Interview finde, lese ich es gleich am Bildschirm, überspringe die langweiligen Passagen und scrolle rasch nach unten. Doch die Pete Mallick Interviews, die ich bei diversen Online-Musikmagazinen gefunden hatte, druckte ich aus. Noch dazu ein paar Artikel und Biografien über seine Band. All das las ich im Wintergarten auf der Couch – und ich genoss jede Minute. Es war, als hätte ich eine verwandte Seele entdeckt, die musikalisch das umsetzte, wofür ich eine tiefe Leidenschaft empfand. Seine Musik war für mich wie eine Collage klassischer utopischer Filme, deren pure Atmosphäre niemals durch moderne Computertricks zerstört werden konnte. Außerdem war er fürchterlich belesen und hatte zu fast allen Interviewfragen etwas Intelligentes zu sagen.
Pete Mallick wurde für mich so etwas wie der letzte britische Gentleman. Er war gebildet, vornehm, zurückhaltend, bescheiden und tat vor allem das, was er für richtig hielt – und zwar so, wie er es für richtig hielt. Von seinen ersten Songs aus den frühen 80er Jahren bis heute blieb er seinem musikalischen Stil treu, einer Mischung aus hartem Rock, Folk, Psychopop, Klassik, Gothic Rock und schicksalhafter Ballade, wunderbar gepaart mit futuristischen Klängen. Er ließ sich nicht von Managern, Plattenlabels oder Musikproduzenten verbiegen. Dazu war er auch schon zu alt und hatte zu viel Lebenserfahrung. Immerhin hatte ihm David Bowie, den er gekannt hatte und mit dem er befreundet und zweimal auf Tour gewesen war, einen frühen Ratschlag mit auf den Weg gegeben:
Keep away from fu***ing music-labels!
Es war wie eine Sucht – ich musste alles über diesen Mann erfahren und alles von ihm und über ihn lesen. Dieses Fieber wurde mir zunächst gar nicht bewusst, erst als ich meine Frau eines Abends fragte: »Hast du eigentlich gewusst, das Pete Mallick auch einen Artikel über Salvador Dalí geschrieben hat, dem er den Song Bizarre Worlds gewidmet hat?«
»Ja, das hast du mir schon dreimal erzählt. Können wir bitte über etwas anderes reden als dauernd über diesen Pete Mallick. Das nervt mittlerweile«, seufzte sie, stemmte die Hände in die Hüften und legte den Kopf schief. »Was ist das eigentlich für eine komische nerventötende Musik aus dem Radio?«
»Ach nichts«, sagte ich und schaltete wie beiläufig den CD-Player aus.
Der Tag war gekommen, an dem ich mit meiner Frau nicht mehr über Pete Mallick sprechen konnte. Genauso wie Alkoholiker ihre Sucht zu verbergen suchten, versuchte auch ich meine Bewunderung für Mallick heimlich auszuleben. Aber da gab es jemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Außerdem war es ohnehin höchste Zeit geworden, ihm eine E-Mail zu schreiben: Thomas Fröhlich.
»Weißt du eigentlich, was du mir mit den Pete-Mallick-Links angetan hast?«, begann ich und schrieb ihm in knappen Worten all das, was ich Ihnen gerade erzählt habe.
Thomas schrieb zurück, dass es ihm ähnlich ergangen sei, als er Pete Mallick vor vielen Jahren entdeckt und das erste Mal gehört hatte. Und dann beendete er seine E-Mail mit den Worten: »Pete Mallick kommt übrigens im Sommer nach Wien und gibt ein Konzert.«
Was? Wann? Wo?
Ich war schon verdammt lange auf keinem Konzert mehr gewesen. Zuletzt bei Manowar, wenn ich mich recht erinnerte. Ein peinliches Konzert. Schwülstig und vor Selbstverliebtheit strotzend. Ich notierte mir also das Datum im Kalender. Am 13. Mai 2017 im Rhiz, einem Lokal mit Kelleratmosphäre im Gürtelbogen unter der ehemaligen Wiener Stadtbahn, wo jetzt die U-Bahn über die Gleise rumpelte.
Der Tag rückte näher, und als ich mit dem Wagen nach Wien fuhr, hörte ich natürlich immer noch Pete Mallick im Auto, obwohl ich bis dahin alle heruntergeladenen Songs bereits auswendig kannte.
Um in keinem Stau zu landen und den Beginn des Konzerts auf keinen Fall zu verpassen, war ich früher als nötig losgefahren. Natürlich war noch kein Mensch in dem Lokal, als ich ankam. Durch die angelehnte Tür hörte ich den Soundcheck. Mein Puls ging nach oben. Sie spielten Mister Dick's Fantasies – und es klang großartig. Ich spähte durch den Türspalt. Pete Mallick saß an der Gitarre, der Ire Scott Edwards an der zweiten Gitarre, Erica Finn am Synthesizer, der im Rollstuhl sitzende Frank Ihnken am Bass, die Italienerin Tanja Sclavi an der Percussion, der Asiate Shinichi Tanaka am Schlagzeug und der mächtig übergewichtige Mike Otto am Cello. Diese Besetzung war seit den 80er Jahren unverändert geblieben – und welche Band kann das schon von sich behaupten? Die Musiker hatten dementsprechend auch nur zwei Tage zuvor geprobt, wie mir der Barkeeper erzählte. Aber das ziemlich intensiv, denn schließlich war das der Beginn einer kleinen Tournee, der sogenannten Into-The-Void-Tour 2017, die anschließend nach Prag, Bratislava, Budapest, Zagreb, Belgrad, Bukarest, Sofia und Varna gehen sollte.
Ich bestellte einen Kaffee, starrte auf das Tourplakat neben dem Tresen der Bar, und da fiel es mir plötzlich auf. Scheiße, Alter! Ich rutschte vom Stuhl, trat näher und starrte auf das Plakat. Hatte das vor mir noch keiner bemerkt? Wenn man die Anfangsbuchstaben der Nachnamen aller Bandmitglieder aneinanderreihte, entstand aus Mallick, Edwards, Finn, Ihnken, Sclavi, Tanaka und Otto MEFISTO. So ein Zufall! Still und heimlich grinste ich wegen dieser Erkenntnis in mich hinein.
Der Soundcheck näherte sich dem Ende, ich wurde unglaublich nervös und umklammerte meine Umhängetasche, in der ich meine selbstgebrannten Greatest Hits mitgenommen hatte. Schließlich trudelten die ersten Konzertbesucher ein – langjährige Freunde und Fans von Pete Mallick –, die Musiker beendeten ihren Soundcheck, kamen in die Bar, Grußworte wurden ausgetauscht, ein paarmal fielen ein Fuck-You und Bitch, und dann ging die ganze Gruppe in ein Nachbarlokal, um eine Kleinigkeit zu trinken, bevor das Konzert um 21 Uhr beginnen würde. Der Besitzer eines kleinen Wiener Second-Hand-Schallplattenladens, den ich gut kannte, war auch darunter, und so kam es, dass ich plötzlich mitten in der ganzen Horde war und nur zwei Stühle entfernt neben Pete Mallick saß.
So sah er also aus der Nähe aus, dieser kluge, britische Gentleman mit der eindringlichen Stimme!
Er war eher klein, trug ein geflochtenes Ziegenbärtchen, hatte mittlerweile graue Haare, listige kleine Augen und sah ständig bescheiden zu Boden. Irgendwann trafen sich unsere Blicke, ich grüßte ihn, wir gaben einander die Hand und plauderten auf Englisch.
Dann outete ich mich als großer Pete-Mallick-Fan, erzählte ihm, was mir besonders an seiner Musik und seinem Gesang gefiel, gab aber gleichzeitig zu, dass ich sein Werk erst seit einem halben Jahr kannte. Das brachte mir natürlich merkwürdige Blicke der anderen Gäste ein, die Pete Mallick schon vor fünfzehn Jahren live in Wien gesehen hatten. Dennoch unterhielten wir uns weiter, über Musik und klassische utopische Filme, und als er erfuhr, dass ich unter anderem Autor von Science-Fiction-Geschichten war, rückte er mit seinem Stuhl ein Stück näher.
Ab da wollte er von mir alles über die Schriftstellerei wissen. Ich war komplett fertig. Warum ausgerechnet von mir? Er war doch selbst Songwriter. Ja klar, antwortete er, aber nur von kurzen lyrischen Texten. Also unterhielten wir uns über die Verlagswelt, und ich erzählte ihm alles, was ich wusste. Es wurde ein Fachgespräch, und wir stellten fest, dass es zwischen dem Produzieren von Musik und dem Schreiben von Romanen kaum Unterschiede gab. Natürlich kamen auch die illegalen Downloads zur Sprache, unter denen er als Musiker genauso zu leiden hatte wie ich als Buchautor. Und das war mein Stichwort. Jetzt oder nie! Ich zog der Reihe nach meine Greatest Hits Volume I bis VI aus der Tasche, legte sie ihm zögerlich auf den Tisch und bat ihn, ob er so nett wäre, sie mir zu signieren.
Die Gespräche am Tisch verstummten, und alle starrten mich mit offenem Mund an. Ein Verrückter!, las ich in ihren Gesichtern. Besonders die Musiker warfen sich seltsame Blicke zu. Pete Mallick sah mich mit zusammengekniffenen Augen an, als würden sich jeden Moment nach Algen stinkende tentakelige Fangarme aus Augen, Nase und Ohren schlängeln, mich packen und in das nächste Wurmloch zerren. Doch dann lächelte er plötzlich, murmelte ein Fuckin' excellent good covers, griff nach einem Stift und signiert mir die CDs.
For Andy – this is a criminal record – best regards, Pete.
Mann, was für ein cooler Typ.
Ich hatte zuvor gegoogelt, dass er verheiratet war und seine Kinder teilweise in Sheffield, England, und teilweise in New Mexico, USA, aufwuchsen. Seine Frau kam nämlich aus Roswell in New Mexico. Ja, genau aus dieser Ecke, in der auch die Area 51 lag, wo es angeblich diese UFO-Sichtungen und UFO-Abstürze gab. Typisch Mallick! Immer seinen Science-Fiction-Wurzeln treu, selbst was seine Familie betraf. Vorsorglich hatte ich daher eine Sammlung mit Science-Fiction-Kurzgeschichten von mir mitgenommen, die ich ihm nun im Gegenzug schenkte und für ihn, seine Frau und seine Söhne signierte. Er nahm das Buch dankend an sich, stand auf, und zehn Minuten später begann das Konzert.
Es war großartig, die Stimmung kochte und alle waren begeistert. Nur ein Mann fiel mir auf, der die ganze Zeit hinten in der Ecke neben der Bar stand. Ein grauhaariger Kerl im weißen Anzug, der nur beobachtete und keine Regung zeigte. Vielleicht jemand vom Magistrat der Stadt Wien, der die Veranstaltung überprüfen musste, dachte ich. Jedenfalls war er nach der Zugabe verschwunden.
Nach dem Konzert war Pete Mallick nur noch kurz angebunden. Wir unterhielten uns zwar, aber ich merkte, er musste los. Er wollte meine Karte mit meiner privaten E-Mail-Adresse, denn er würde mir schreiben, da er zu jedem seiner Alben meine ausführliche Meinung hören wollte.
Erneut war ich komplett erledigt. Ein begnadeter Musiker wie er fragt mich um meine bescheidene Meinung! Ich konnte es gar nicht fassen und sagte natürlich zu, fest davon überzeugt, dass er sich sowieso nie bei mir melden würde.
Eine Woche später kam tatsächlich seine E-Mail, und ich musste Pete versprechen, ihm eine detaillierte Kritik zu schicken. Ich sagte zu, alle Alben im nächsten Urlaub in Ruhe zu hören, schließlich würde ich bereits in einigen Tagen mit meiner Frau ans Meer fahren. Zwei Wochen Mittelmeerkreuzfahrt von Savona, über Marseille, Gibraltar und Lissabon bis nach Marokko.
Auf Marokko freute ich mich besonders, denn dieses orientalische Flair erinnerte mich an David Cronenbergs Verfilmung von Burroughs Naked Lunch. Was würde also besser passen, als im Urlaub an Bord des Schiffes die fantastischen Songs von Pete Mallick zu hören?
Allerdings waren es noch etwa zehn Tage, bevor das Schiff ablegen würde. Zeit genug, um ein paar Online-Bestellungen aufzugeben. Ich hatte nämlich beschlossen, dass ich alle Original Pete Mallick CDs besitzen musste – mit den Booklets. Koste es, was es wolle!
Mittlerweile war ich kein normaler Fan mehr. Ich war besessen! Ich hätte dringend behandelt werden müssen, aber dann hätte ich natürlich alles abgestritten.
Das erste veröffentlichte Album The Dimensions of TRON war 1980 erschienen, und das letzte Album Jules Verne's Jukebox im Jahr 2016. Dazwischen gab es sechzehn weitere Studioalben, wenn man die Live- und Greatest-Hits-Alben nicht dazu zählte.
Und meine Recherchen ergaben drei erfreuliche Neuigkeiten: Erstens waren die alten Alben mittlerweile alle digital remastered worden und hatten keine so lausige Qualität wie meine sechs YouTube Sampler. Zweitens gab es in jedem Album ein dickes Booklet mit Songtexten und einem einführenden Vorwort von Pete Mallick, in dem er über die Entstehungsgeschichte der Songs schrieb. Und drittens – ja drittens, meine Damen und Herren – waren die Alben gespickt voll mit unveröffentlichtem Bonus-Material, unter dem es mindestens fünf neue Songs pro CD gab, die ich noch nicht kannte.
Der Wahnsinn, der mich vor Monaten gepackt hatte, war in beängstigendem Maße mit neuer Leidenschaft weiter angestachelt worden. Mehrmals lief ich täglich zum Briefkasten und wartete darauf, dass die bestellten Päckchen der Reihe nach eintrudeln würden. Nur noch drei Tage bis zum Urlaub – und fünf CDs fehlten noch.
Noch zwei Tage – und drei CDs waren noch ausständig.
»Warum bist du in letzter Zeit so nervös?«, fragte mich meine Frau eines Abends kurz vor der Abreise. »Schaffst du die Abgabe deines Kurzgeschichtenbandes nicht mehr vor dem Urlaub? Du lagst doch so gut in der Zeit.«
Das Buch!
O Gott! Das hatte ich ja vollkommen vergessen.
Pfeif drauf, sagte ich mir. Ich würde den Verlag vertrösten müssen. Totale Schreibblockade! »Hast du heute vielleicht zufällig ein Paket aus dem Briefkasten geholt?«
»Ja, das liegt im Carport. Warum?«, antwortete sie. »He, wo läufst du hin?«
Alles war fein. Alles wurde gut. Sämtliche CDs waren rechtzeitig gekommen, und wir flogen nach Mailand, und von dort fuhren wir mit dem Shuttlebus nach Savona.
Im Koffer lagen mein Discman mit zehn Reservebatterien, achtzehn Studioalben, insgesamt 257 Songs, und eine Mappe mit allen Booklets. Zum Glück gab es auf dieser Reise drei Seetage ohne Landausflüge, die ich in der Sonne auf einer Liege an Deck verbringen konnte, um sämtliche Lyrics zu lesen und in das Pete Mallick Universum einzutauchen.
Während der Kreuzfahrt saß ich tatsächlich in einem Stuhl an Deck in der Sonne, spürte den salzigen Sprühregen, hörte Musik und las die Lyrics in den Booklets, während meine Frau einen Roman nach dem anderen am E-Book-Reader verschlang.
Am dritten Tag sprach mich ein Engländer aus Brighton an, der die CD-Covers bemerkt hatte, und sich ebenfalls als Pete Mallick Fan outete. Ich konnte es gar nicht fassen, auf einem Schiff auf hoher See einem anderen Mallick-Fan zu begegnen. Wie klein die Welt doch war. Wir unterhielten uns ein wenig und verabredeten uns nach dem Abendessen an der Bar zu einem ausführlicheren Gespräch.
Am selben Tag sah ich ihn noch in Begleitung eines grauhaarigen Herrn im weißen Anzug, doch danach nicht mehr. Er war wie vom Erdboden verschluckt, und zu unserem Treffen an der Bar kam er natürlich auch nicht. Meine Frau war entsprechend sauer auf mich, weil ich den ganzen Abend und die halbe Nacht mit fünf Tequilas allein am Tresen verbracht hatte.
Tags darauf zweifelte ich daran, ihm tatsächlich jemals begegnet zu sein. War er nur eine Fantasie gewesen? War ich mit Kopfhörern zwischen den Alben eingeschlafen und hatte geträumt, einem ähnlichen Fan wie mir zu begegnen?
»Kannst du dich noch an den jungen Mann erinnern, mit dem ich gestern an Deck geplaudert habe?«, fragte ich meine Frau.
»Welcher Mann? Meinst du den gut aussehenden Steward, der sich nach meiner Zimmernummer erkundigt hat?«
»Vergiss es!«
Nach dem Urlaub schrieb ich Pete Mallick eine lange E-Mail, in der ich ihm zu jedem einzelnen Album meine ausführliche Meinung mitteilte, und dass es absolut nichts zu kritisieren gab. Dieser Mann hatte einfach ein begnadetes Talent, nicht nur als Musiker, sondern auch als Songtexter.
Und weil wir gerade so schönen E-Mail-Verkehr hatten, packte ich die Gelegenheit beim Schopf und stellte ihm zu einem seiner Songs eine Frage. Denn mit einer Textpassage in Asylum in Space, einem Song über eine mysteriöse Irrenanstalt in einem besonders dunklen Teil des Universums, konnte ich nichts anfangen. Ich fragte ihn, was er mit einer bestimmten Stelle zum Ausdruck bringen wolle.
The mentally ill will be found, lost in reverie.
Beyond recall, boost them all.
Im Grunde genommen rechnete ich fest damit, keine Antwort darauf zu erhalten, und wenn, dann höchstens etwas in der Art wie: »Sorry, Andy, but I won´t explain any of my lyrics to you. Take them as they are and don´t bother me again with questions!«
Fragen Sie doch einmal David Lynch, warum seine Filme so sind, wie sie sind. Keine Chance auf eine Antwort!
Doch einmal mehr erstaunte mich Mallick, als er mir erklärte, dass es sich bei der Passage um eine Redewendung handelte, deren Sinn er mir erläuterte und wie sie zum Rest der Story in Asylum in Space passte. Die geistig Verwirrten und schwer Gestörten kämen auf mysteriöse Weise in dieses Asylum. Automatisch und unwiderruflich!
Mann, ich war schwer beeindruckt! Andererseits lief mir ein Schauder über den Rücken.
Außerdem schrieb er mir, was er bisher zuvor in keinem Booklet erwähnt hatte, nämlich woher er die Inspiration zu seinen Songtexten nahm und den Themen, über die er sang. Andy, believe me. It's all true. I have seen it all by myself. And I had escaped!
Wie bitte? Ich war verwirrt. Klar, als Autor wusste ich selbst, dass man nur über das schreiben konnte, was man zuvor irgendwo gesehen, gelesen oder gehört hatte – und den Rest erfand man dann irgendwie dazu. Darum interpretierte ich Mallicks Aussage so, dass er über diejenigen Dinge sang, über die er sich eben den Kopf zerbrach. Aber eine Aussage machte mich dennoch stutzig. Er meinte auch, das Asylum in Space gäbe es tatsächlich.
Naja, ein verschrobener Künstler eben!
Es gäbe noch so vieles zu erzählen, aber ich sollte mit diesem Vorwort langsam zu einem Ende kommen. Danke, dass Sie mir so lange zugehört haben. Mittlerweile ist es schon nach sechs Uhr früh, zarter Nebel liegt auf den Feldern, die ich von meinem Schreibbüro aus sehe, die Sonne erhebt sich gerade mit einem ersten zarten Leuchten über die Berge, und die Songs von Pete Mallick and the Sputniks laufen immer noch in einer Endlosschleife im CD-Player.
Obwohl mittlerweile ein Jahr vergangen ist, in dem ich keinen einzigen Heavy Metal Song gehört habe, habe ich mich an Mallicks Musik immer noch nicht sattgehört. Ich frage mich, ob dieser Moment je kommen wird. Und wenn ja, wann? Vielleicht kommt er nie. Vielleicht bin ich wirklich besessen und ein dringend medikamentös zu behandelnder Fall. Das mag sein. Ich bin selbst unsicher geworden. Wenn man meiner Frau Glauben schenken darf, dann bin ich das mit Sicherheit.
Orson Scott Cards How to write Science-Fiction habe ich übrigens immer noch nicht zu Ende gelesen, obwohl es ein großartiges Sachbuch ist, aber ich komme nicht dazu. Mittlerweile liegt eine ziemlich hohe Staubschicht auf dem Buch.
Meine Manuskripte sind immer noch nicht überarbeitet. In keinem einzigen davon auch nur eine einzige Zeile. Die fünf eingeschriebenen Mahnbriefe des Verlags liegen zusammengeknüllt im Papierkorb.
Marokko war übrigens genauso faszinierend und mystisch wie in David Cronenbergs Naked Lunch. Vielleicht komme ich eines Tages wieder dorthin – natürlich mit sämtlichen Pete Mallick CDs im Gepäck.
Mein Handy brummt gerade auf dem Schreibtisch. Ich erhalte eine SMS von Thomas Fröhlich. Um diese Uhrzeit? Es ist erst 6.15 Uhr. Er schreibt nur ein Wort: Lauf!
Was?
Ich blicke auf.
Vor meinem Haus hält ein weißer Kastenwagen. Kein Kennzeichen. Nur ein Logo an der Seitenwand: AIS. Zwei Hünen steigen aus. Ein alter grauhaariger Mann im weißen Anzug begleitet sie. Sie sehen sich um und reden miteinander. Fast kommt mir das alles wie ein schlechter Witz vor, denn sie haben eine weiße Jacke mit Schnüren dabei.
Zielstrebig betreten sie unser Grundstück und kommen zum Haus. Ich warte. Eine halbe Minute später läutet es an der Tür.
O nein! Die wollen sich doch bestimmt nicht nur nach dem Weg erkundigen. Mein Blick fällt auf die SMS.
Lauf!
Schließlich stehe ich auf. Meine Beine sind ganz steif vom langen bewegungslosen Sitzen. Ich schüttle sie durch und verlasse mein Schreibbüro. Im Gang liegt eine eingetrocknete tote Katze auf dem Parkettboden vor der Tür. Verdammt! Habe ich vergessen, sie zu füttern?
Eine zarte Staubschicht liegt auf der Kommode, Spinnweben hängen von der Decke und schwingen sanft im Luftzug. Ich betrachte mein Gesicht in der Fensterscheibe. Eingefallene Wangen, struppiger Bart, lange fettige Haare, Schatten unter den Augen. Das kann doch nicht wahr sein! Wenn ich es mir recht überlege, ist meine Frau nicht erst dieses Wochenende zur Wellnesstherme gefahren. Wie lange ist das schon her?
Es läutet erneut an der Tür.
Während ich die Treppe zur Eingangstür hinunter gehe, klingt aus meinem Zimmer der Beginn des nächsten Songs. Asylum in Space. Wie passend!
Ein Song über einen Mann, der in dieser weit entfernten Klinik von fremden Doktoren und Wissenschaftlern gegen seinen Willen gefangen gehalten wird, wo man versucht, ihn mit schrecklichen Mitteln zu heilen.
I'm pinned against the bed,
two hands against my head,
the belt is tight and fine,
keep the needles in my spine.
Ich erreiche das Erdgeschoss und öffne die Tür. Die drei Männer stehen mir gegenüber. Den Alten im weißen Anzug kenne ich doch! Er sieht aus wie ein Arzt im Kittel. Ist das nicht der Kerl, den ich schon auf dem Live-Konzert gesehen habe? Und danach später auf dem Kreuzfahrtschiff? Mein Blick fällt auf das Logo der Anstecknadel am Kragen seines Sakkos.
AIS.
Und plötzlich weiß ich, wofür diese Abkürzung steht. Pete Mallick hatte ja so recht. Das Asylum gibt es tatsächlich. Irgendwo. Weit weg! Er war dort und ist entkommen.
»Guten Morgen.« Der alte Mann tippt sich zum Gruß an die weiße Mütze. »Das war Ihr letztes Buch. Wir nehmen Sie jetzt mit auf eine lange, lange Reise …«
ECKE 57TH STREET
Von jeher haben mich so genannte Locked-Room-Szenarien fasziniert, wenn sich die Handlung in einem geschlossenen System abspielt, wie beispielsweise bei Mord im Orient-Express im Zug, Stirb Langsam in einem Wolkenkratzer, Alarmstufe Rot auf einem Schiff oder Air Force One in einem Flugzeug. Wenn die Handlung wie in einem Kammerspiel in einem Ort zusammengedampft wird, bin ich wie gefesselt. Je klaustrophobischer, desto besser.
Vermutlich ist aus dieser Faszination heraus Ecke 57th Street entstanden, das ich Ende der 90er Jahre geschrieben habe. Ich hoffe, Sie können diesem Thema etwas abgewinnen und es wird Ihnen nicht zu eng …
»Margarit Jenan?«, wiederholte der Portier nuschelnd, stützte sich mit den Ellbogen auf das Pult und blinzelte mich aus misstrauisch zusammengekniffenen Augen an. »Die wohnt im einundzwanzigsten Stock, Zimmer 2163.« Er deutete mit einem Kopfnicken zum Lift.
Seine Stirn erstarrte zu einer Fassade aus tiefen Furchen und sah aus, als wäre ihm das Muster ins Gesicht gemeißelt worden. Es fehlte noch, dass er sein Kauderwelsch mit dem obligatorischen Yeah! beendete, doch diesen Gefallen tat er mir nicht. Er justierte sein Steckmikro im Ohr und nestelte an dem Kabel, das an seinem Hals entlang verlief und unter dem Kragen der dunkelblauen Uniform verschwand.
»Ist sie zu Hause?«, fragte ich auf Englisch. Falls sie arbeiten ging, müsste sie zu dieser Zeit eigentlich schon da sein.
Der Portier warf einen Blick auf die Digitalanzeige über dem Halleneingang. 18.35 Uhr. Er zuckte mit den Achseln und lächelte nachsichtig, als läge ihm ein schnippischer Kommentar auf den Lippen. Woher-soll-ich-das-wissen-Bursche-sehe-ich-aus-wie-der-liebe-Gott? Geringschätzig blickte er über den Rand des Pults und musterte meine Schnürschuhe, die Bauchtasche, die über den Knien abgeschnittenen Jeans, meine Ray Ban Sonnenbrille, die im Ausschnitt steckte, und mein Bill geht's-T-Shirt, dessen Wortwitz er sowieso nicht verstand.
»Name?«, murrte er.
Verständnislos starrte ich ihn an. Mein Gott, was will der von mir? »Margarit Jenan«, wiederholte ich automatisch.
Er blähte seine Nasenflügel und sog die Luft scharf ein, sodass sich sein Brustkorb hob. »Nein, dein Name, Junge!«
Ach so! »Markus Breitler«, antwortete ich.
Wie ein Habicht fixierte er mich.
»Yeah!«, murrte er schließlich und klapperte mit den Fingern auf der Tastatur des Laptops, ohne den Blick von mir zu nehmen.
Arrogantes Arschloch, dachte ich. Wahrscheinlich konnte er meinen Namen nicht richtig schreiben und würde stattdessen eine amerikanische Version, wie Marcus Brightler, erfinden. Neugierig spähte ich auf den Bildschirm. Im nächsten Augenblick stand Markus Breitler in dunkelblauen Lettern auf dem Crystaldisplay des Monitors zu lesen.
»Aha!« Ich betrachtete ihn überrascht. Schließlich fügte ich ein duckmäuserisches »Vielen Dank« hinzu, stemmte meinen Tramper-Rucksack hoch, schwang den Riemen über die Schulter und ging zur Liftanlage.
Meine Schuhsohlen quietschten über die blau gesprenkelten Marmorplatten der Eingangshalle. In der Spiegelung einer Glaswand sah ich, dass in der Lasche des Rucksacks immer noch die Handtücher hingen, heute Morgen klitschnass hinein gestopft, bevor ich die Jugendherberge verlassen hatte. Mittlerweile hatte die Sonne sie jedoch getrocknet und sie waren so steif wie Bretter.
Der Zeiger des Fahrstuhls pendelte sich soeben zwischen dem achten und neunten Stockwerk ein. Ich drückte den Sensor und wartete. Auf der blankpolierten Messingverkleidung der Kabinentür bemerkte ich die verzerrten Umrisse des Portiers, der seinen Oberkörper wie eine Marionette über das Pult beugte und mir ein Loch in den Rücken starrte. Amerikaner, dachte ich, beinahe hätte ich es laut gesagt. Neugierig, bespitzelnd und denunzierend!
Aus Angewohnheit wischte ich mir den erkalteten Schweiß aus dem Nacken und rieb die Handfläche an den Jeans trocken. Zum Glück war der Wohnblock klimatisiert. Auf der Straße knallte die Nachmittagssonne auf den Asphalt und vermischte sich mit dem Smog, der zäh zwischen den Häuserschluchten hing; typisch für New York um diese Jahreszeit. Ende August. Doch nach Quebec, Montreal, den Niagara-Fällen und Boston war hier ohnehin mein letzter Stop, wo mein Urlaub zu Ende ging – fünf Wochen, die mir das Personalbüro der Siemens AG erstmalig genehmigt hatte.
Die weite Einsamkeit Kanadas war ein Traum gewesen, die Hektik New Yorks dagegen ein Albtraum! Mit einem Bus war ich während der Rushhour durch die halbe Stadt gegondelt, von Staten Island nach Manhattan, und hatte aus dem zerknautschten Gebrabbel des Fahrers mehr über den Big Apple erfahren, als ich bei einer Sightseeing-Tour je hätte lernen können. In der Nähe des Central Parks war ich an der Kreuzung Broadway und West 57th Street aus dem Bus gesprungen, zwischen Millionen von Menschen, hupenden Yellow Cabs, flackernden Neonreklamen, Hochhäusern mit verdreckten Backsteinfassaden und Türmen aus Beton und verschmiertem Spiegelglas. Mir hatte der Atem gestockt; die Menschenmasse hatte annähernd still gestanden und war wie ein Lavastrom quälend langsam an mir vorbei geflossen. Noch drei Tage, dann hatte ich es hinter mir, und die zweistöckige Boeing 747 der KLM würde mich zurück nach Wien bringen.
Margarit lebte also im einundzwanzigsten Stock. Vielleicht wusste sie eine günstige Unterkunft oder würde mir sogar anbieten, die paar Tage in ihrer Wohnung zu übernachten, dann ersparte ich mir die Dollars für eine Jugendherberge. Margarit war zwar nie besonders hilfsbereit gewesen, doch sie würde mir bestimmt weiterhelfen, denn für eine grobe Abfuhr kannten wir uns schon zu lange.
Aufgefallen war sie mir zum ersten Mal im Einführungs-Tutorium und später während der Vorlesungen des Wintersemesters '91. Meist saß sie allein in der hintersten Reihe und stellte bereits damals, trotz ihres Sprachfehlers, die unmöglichsten Fragen, besserwisserisch und rotzfrech, wie es ihre Art war. Zweifellos war sie anders, und ihr ungewöhnlicher Charakter faszinierte mich schon zu einer Zeit, als wir uns noch nicht kannten.
Erst im dritten Semester lernte ich sie persönlich kennen, in der Mensa der Technischen Universität Wien, als sie sich mit ihrem Essentablett bis zu meinem Tisch hindurch zwängte, ihre schmächtige Figur vor mir aufbaute, die rahmenlose Kunststoffbrille zurechtrückte und mich fragte, ob diese Nische mitsamt dem Tisch meine Studentenbude sei, weil ich mich mit den Büchern und Skripten so breitmachte. Bereits als junge Studentin betonte sie ihre weiblichen Reize nicht im Geringsten; anscheinend hatte sie keine. Allerdings wirkte sie vielleicht gerade deswegen interessant in ausgebeulter Hose und schlabberigem Hemd, die ihre schlaksige Figur verhüllten, den fusseligen, schulterlangen Haaren und dem nichtssagenden Gesicht, auf dem ich niemals Rouge, Lidschatten oder Lippenstift entdeckt hatte.
Von diesem Zeitpunkt an liefen wir uns in der Mensa öfter über den Weg und saßen beim Mittagessen in jener Nische beisammen, meiner sogenannten Studentenbude. Bald paukten wir gemeinsam in nächtlichen Marathonsitzungen den Seminarstoff des vierten Semesters und hockten dabei meist in ihrem Studentenzimmer, das fast ausschließlich aus Tastaturen ohne Abdeckungen bestand, Monitoren ohne Gehäuse und Computern, deren ausgebaute Motherboards verstreut wie Treibgut auf dem Boden lagen. Stundenlang lümmelte sie vor den Geräten, die Haare mit einem Gummiband zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden, während ihre blassen, dürren Hände im Zweifingersystem über die Tasten huschten. Sie knabberte gelegentlich trockenes Müsli ohne Milch, trank einen Joghurt dazu und drohte in ihrem Arbeitsfleiß magersüchtig zu werden. Jedenfalls aß sie nur dann etwas, wenn ich mit einer Tüte vom Supermarkt kam und ihr Fruchtsäfte und Thunfisch-Sandwiches mit Eiern und Käse brachte.
Viele Studienkollegen bezeichneten sie als Streberin, ich sah jedoch den besessenen Freak in ihr. Bereits im ersten Studienabschnitt kristallisierte sich Margarits Talent heraus, und binnen weniger Semester avancierte sie zur Begabtesten des Jahrgangs. Geradezu genial entwarf Margarit die erste vernetzte Datenbank, die sich mit einem integrierten KI-Chip selbst updatete und weiter entwickelte. Die Datenbank wusste, wo und wann sie welche Daten downloaden durfte, welche Informationen von Interesse waren und welche nicht. Im Grunde genommen nichts Aufregendes, doch programmierte Margarit dazu eine Hologramm-Plattform für Cyberbrillen, die an Schläfenkontakten – Scanpads, wie Margarit sie nannte – montiert wurden. Diese Pads ließen eine optische Datenverarbeitung zu, sodass der User mehrere Operationen gleichzeitig, praktisch in Nullzeit, durchführen konnte.
Zeitschriften wie Chip, PC-Intern und Computerwoche berichteten darüber, und schlagartig stand die TU-Wien im Mittelpunkt der Wissenschaft. Doch Margarit ging der Fortschritt viel zu langsam. Ständig wollte sie die Abläufe rationalisieren und schimpfte über die Hürden der veralteten Computertechnologie, bis sie schließlich an einem von Wirtschaftsgeldern gesponserten Forschungsprojekt beteiligt wurde, in dem sie einen mehrdimensionalen Maschinencode ausbrütete. Dafür wurde keine Programmiersprache mehr benötigt, die als Übersetzer fungierte und die Befehle in den binären Eins-Null-Code kompilierte, sondern nur noch ein Interface, das die Eingabe sofort als Maschinencode interpretierte. Wie das funktionieren sollte, fragten wir uns, und einige Studenten belächelten Margarit als eine spleenige Verrückte, die meisten anderen jedoch als arrogante Wichtigtuerin.
Dennoch, ihre Idee von einer neuen Technologie schien zu funktionieren – zumindest in der Theorie. Margarits Konzept basierte auf keiner simplen Strom-ein/Strom-aus-Methode, sondern nutzte das Farbenspektrum des Lichts, um komplexere Zustände gleichzeitig abzuarbeiten. Licht statt Strom! Ein revolutionärer Ansatz – offensichtlich –, und wie ich es von Margarit nicht anders erwartet hätte, arbeitete sie verbissen und fast bis zur körperlichen Selbstaufgabe daran. Es ging sogar soweit, dass sie die Welt um sich negierte, sich zu Hause einschloss, ihre sozialen Kontakte aufgab und gänzlich auf Partys, Kinobesuche und die Techno-Open-Air-Festivals auf der Donauinsel verzichtete, wo sie ohnehin nur selten zu sehen gewesen war. Auf diesem Niveau der Forschung klinkte nicht nur ich mich aus, sondern auch alle anderen Projektstudenten sowie der gesamte Lehrkörper … und Margarit blieb allein zurück mit ihren Überlegungen. Ob das Projekt eingestampft oder weitergeführt wurde, wusste ich nicht. Möglicherweise hatte das MIT die Forschung Jahre später fortgesetzt.