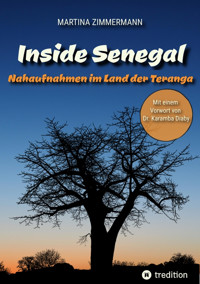Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
- Sprache: Deutsch
Mehrsprachigkeit gilt als Pfeiler der "Schweizer Identität". Universitäten halten sich in der Lehre jedoch ans Territorialitätsprinzip; Vorlesungen erfolgen in der lokal gesprochenen Sprache, was Studierende aus anderen Sprachregionen der Schweiz überfordern kann. Die Autorin ergründet, welcher Stellenwert der Sprache in Diskursen und Praktiken zukommt, die mit der intranationalen studentischen Mobilität über schweizerische Sprachregionen hinweg einhergehen. Mittels einer Ethnographie erfasst und interpretiert sie, wie in der sich wandelnden Hochschullandschaft der Wunsch nach Mobilität kreiert und legitimiert wird und wie Mobilität und damit verbundene Herausforderungen bewältigt werden. Die soziolinguistischen Daten zeichnen ein komplexes Bild der aufeinander einwirkenden universitären Akteure in einem mehrsprachigen Land und erhellen exemplarisch das Spannungsfeld zwischen zelebrierter Mehrsprachigkeit und praktizierter "Einsprachigkeit" sowie daraus hervorgehende Ungleichheiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martina Zimmermann
Distinktion durch Sprache?
Eine kritisch soziolinguistische Ethnographie der studentischen Mobilität im marktwirtschaftlichen Hochschulsystem der mehrsprachigen Schweiz
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8233-0034-2
Inhalt
Dank
Diverse Institutionen und Personen unterstützten mich bei meinem Projekt und trugen erheblich zu dessen Entwicklung und Abschluss bei. Besonderer Dank gilt meinem Betreuer, Prof. Dr. Alexandre Duchêne (Institut für Mehrsprachigkeit, Universität und Pädagogische Hochschule Freiburg). Er begleitete meine Arbeit vom Anfang bis zum Schluss und forderte mich mit seinen kritischen Fragen dazu auf, meine Daten aus immer neuen Blickwinkeln zu hinterfragen. Seine schier endlose Neugier hat mich sehr geprägt. Weiter bin ich Prof. em. Dr. Iwar Werlen (Institut für Sprachwissenschaft, Universität Bern) dankbar, dass er mich unmittelbar nach meinem Masterabschluss 2011 im Sinergia-Projekt „Mehrsprachigkeit und Lebensalter“ anstellte. Die Zeit am Institut für Sprachwissenschaft war für mich äusserst lehrreich. Ebenfalls möchte ich mich bei den Mitgliedern des vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Sinergia-Projekts (Leitung Prof. Dr. Raphael Berthele, Universität Freiburg) für die aufschlussreichen interdisziplinären Diskussionen bedanken. Ausserdem bin ich der Forschungsabteilung der Pädagogischen Hochschule Luzern für die Unterstützung in der Endphase dankbar. Dank einem grosszügigen Forschungs-Stipendium war es mir möglich, meine Arbeit in Reading (UK) zu finalisieren. Ein herzlicher Dank gilt auch meinen KollegInnen aus Luzern, die meine Lehrveranstaltungen in dieser Zeit übernahmen und mich zur „Abwesenheit“ ermutigten. Ferner möchte ich mich bei Prof. Dr. Rodney Jones und Prof. em. Dr. Viv Edwards bedanken, die mir während meines Aufenthalts in Reading (2015–2016) ihre Türen öffneten und mich einluden, an Workshops, Konferenzen etc. teilzunehmen.
Weiter bin ich verschiedenen Institutionen für ihre Unterstützung bei Konferenzteilnahmen und -reisen und bei der Drucklegung dieser Dissertation dankbar. Dazu gehören die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, die Vereinigung für Angewandte Linguistik in der Schweiz, die Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft, die Philosophischen Fakultäten der Universitäten Bern und Freiburg, das Institut für Mehrsprachigkeit der Universität Freiburg, die Ortsgemeinde Widnau und die Publikationskommission des Hochschulrats der Universität Freiburg.
Verdankt seien ausserdem diejenigen Universitäten, die ihren StudienanfängerInnen meinen Fragebogen zustellten und mich damit dabei unterstützten, InterviewpartnerInnen zu gewinnen. Weiter bin ich den verschiedenen an Universitäten tätigen ExpertInnen dankbar, die sich mir für ein Interview zur Verfügung stellten. Zu grossem Dank verpflichtet bin ich ausserdem den MaturandInnen und StudienanfängerInnen, die mit mir ihre Überlegungen zu bevorstehenden oder gefällten Entscheidungen zur Studienwahl bereitwillig teilten. Ein spezielles Dankeschön gilt den Mitgliedern des Tessiner Studierendenvereins in Bern, die mich herzlich in ihren Kreis aufnahmen und an ihrem Alltag teilhaben liessen.
Sehr wertvoll war für mich der Austausch mit zahlreichen Personen. Sie alle aufzuzählen, ergäbe eine lange, lange Liste. Besonders dankbar bin ich allen teilnehmenden DoktorandInnen der am Institut für Mehrsprachigkeit in Freiburg stattfindenden „Internal Workshops“, die Prof. Dr. Alexandre Duchêne initiierte. Dank ihm bestand ausserdem am Institut für Mehrsprachigkeit die Möglichkeit, vom Input namhafter ProfessorInnen zu profitieren und mit ihnen mein Projekt zu besprechen. Spezieller Dank gilt Prof. Dr. Aneta Pavlenko (Temple University, Philadelphia), Prof. Dr. Luisa Martin Rojo (Universidad Autonoma de Madrid), Prof. Dr. Monica Heller (University of Toronto), Prof. Dr. Eva Vetter (Universität Wien) und Prof. em. Dr. Marilyn Martin-Jones (University of Birmingham). Sie haben mich über die Treffen hinaus beeindruckt und unterstützt. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei meinen KollegInnen Dr. Mi-Cha Flubacher, Dr. Alfonso Del Percio, Dr. Nuria Ristin-Kaufmann, Dr. Daniel Hofstetter, Dr. Sebastian Muth und Larissa Greber; sie haben mich begleitet, inspiriert und in weniger produktiven Phasen aufgemuntert. Ein herzliches Dankeschön gilt ausserdem Dr. Jürg Zimmermann-Hug, der mir sowohl bei der redaktionellen Feinarbeit als auch bei der Suche nach stringenten Formulierungen mit Rat und Tat zur Seite stand. Ebenso bedanken möchte ich mich bei Rosella Romano, die mir dabei half, die zum Teil akustisch schwer verständlichen italienischen Audioaufnahmen zu erschliessen. Von Herzen möchte ich mich schliesslich bei meiner Familie und meinen FreundInnen bedanken, die mir während diesen Jahren zur Seite standen und mich während dem langen und zum Teil einsamen Arbeitsprozess auf verschiedenste Weise unterstützten.
1Einleitung
Vor rund 12 Jahren – ich war damals an der Pädagogischen Hochschule des Kantons St. Gallen in der Ausbildung zur Primarlehrerin – absolvierte ich ein Jahr meines Bachelor-Studiums in der französischsprachigen Schweiz (Lausanne). Dazu ermuntert wurde ich von der institutionsinternen Mobilitätsbeauftragten, die im Rahmen eines Vortrags für die Mobilität warb. Gerne hätte ich damals ein Semester in Schottland verbracht – ich wollte mein Englisch verbessern –, allerdings waren an der jungen Institution noch keine Verträge mit internationalen Partnerschulen unter Dach und Fach. So nahm ich stattdessen am Austauschprogramm „Mobilité Suisse“ teil, das Studierende dazu anregt, innerhalb der Schweizer Landesgrenzen mobil zu werden.
Im Herbst 2004 sass ich dann z.B. in einer Biologievorlesung an der Universität Lausanne, in der ein Professor über die „Dépollution“ (Entgiftung) von Luft im Zusammenhang mit dem Blattbestand von Bäumen referierte. Erst Tage darauf verstand ich, dass dies nichts mit „pollinisation“ (Bestäubung) zu tun hatte. Ebenso besuchte ich Französisch-Didaktik-Seminare, in denen auf erstsprachige Kinder ausgerichtete Hörtexte miteinander verglichen wurden, wobei es mir nicht gelang, die diskutierten Unterschiede zu identifizieren. Nebenher arbeitete ich in einem Café im Zentrum von Lausanne, versuchte mir Bestellungen zu merken, für mich bedeutungslose Audiostränge, bei denen das Segmentieren semantisch sinnvoller Glieder unmöglich war (z.B. /œ͂teosinɔʀɔdosilvuplɛ/ für „un thé au cynorrhodon s’il vous plaît“, einen Hagebuttentee, bitte). Zu diesen sprachlichen Herausforderungen kamen andere, die damit zu tun hatten, dass ich die Institution, die Stadt etc. kaum kannte. So realisierte ich etwa, dass Fahrkarten für das Stadtverkehrsnetz nur an Automaten bezogen werden konnten, die übrigens kein Retourgeld gaben, und Kontrolleure im Bus nur büssten, statt, wie ich es gewohnt war, den Passagieren Billetts zu verkaufen.
Lausanne war nicht meine einzige Erfahrung studentischer Mobilität. Mit meinem Wechsel an die Universität Freiburg hatte ich auch mit einem Bildungssystem zu tun, das nicht in jener Sprache funktionierte, in der ich meine Studienreife erlangt hatte. Es folgten Studienaufenthalte in Barcelona und Bolzano. Später kamen berufliche Mobilitätserfahrungen dazu – nach meiner Ausbildung war ich als Lehrerin in England und in Italien tätig.
Immer wieder traf ich innerhalb meiner Mobilitätserfahrungen – ob studentischer oder professioneller Natur – auf Zusammenschlüsse, in denen sich Menschen gleicher geographischer und/oder sprachlicher Herkunft in ihrer neuen und ihnen fremden Umgebung zusammentaten. Ich mied solche Gruppierungen eher, wunderte mich über das Bedürfnis ihrer Mitglieder, ihnen anzugehören, und fragte mich, weshalb diese Menschen, die „bloss“ Sprache und/oder geographische Herkunft teilten, miteinander Zeit verbrachten. Ferner hatte ich Mühe zu verstehen, weshalb – so meine retrospektiv formulierte Perspektive – man sich zeitweise der Möglichkeit verschloss, die lokal dominante Sprache zu erwerben; für mich war damals meine Dislokation jeweils an die Chance gekoppelt, meine Sprachkompetenzen zu verbessern.
Die Fragen, welche ich mir damals, veranlasst durch meine eigene studentische Mobilität, stellte, und die Perspektive, von der aus ich diese betrachtete, haben sich mit den Jahren, in welchen ich mich mit Soziolinguistik auseinandersetzte, verändert. Mein Interesse an der studentischen Mobilität über landesinterne Sprachgrenzen hinweg ist aber lebendig geblieben; aus ihm nährt sich meine Motivation zur Erarbeitung dieser Untersuchung. Sie widmet sich jenem Stellenwert von Sprache, der ihr in Diskursen und Praktiken im Zusammenhang mit der studentischen Mobilität im schweizerischen Hochschulsystem zukommt. Das erwähnte Interesse verlangte von mir, über individuelle Mobilitätserfahrungen von Studierenden hinauszugehen und institutionelle Diskurse und Praktiken zur Mobilität im Tertiärbereich einzubeziehen. Ferner wurden die Geschichte der Universität, analog zu welcher die Studentenmobilität entstand, und mit ihr die politisch-ökonomischen Bedingungen relevant, die studentische Mobilität erst ermöglichten und weiterhin ermöglichen. Ausserdem wurden Zusammenschlüsse, die Studierende mit gleichem sprachlichem Hintergrund und gleicher geographischer Herkunft vereinigten – vormals war ich ihnen mit Argwohn aus dem Weg gegangen – zu einem analytisch interessanten sozialen Raum, in dem Diskurse und Praktiken die Situation der Mobilität widerspiegeln.
In den zwei letzten Jahrzehnten hat die Schweizer Hochschullandschaft erhebliche Veränderungen erfahren. Zum einen besteht seit 1996 auch in der italienischsprachigen Schweiz, dem Tessin, die Möglichkeit, ein Studium zu machen, was bedeutet, dass seither in drei von vier Sprachregionen der Schweiz universitäre Bildung angeboten wird. Trotz dieser Option verlässt die Mehrheit der Tessiner MaturandInnen zwecks des Studiums die Herkunftsregion und immatrikuliert sich an einer Universität in der französischsprachigen oder deutschsprachigen Schweiz. Die vorliegende Arbeit geht dem Verhalten dieser studentischen BinnenwandererInnen auf den Grund, und widmet sich insbesondere denjenigen TessinerInnen, die sich für ein Studium in der Deutschschweiz entscheiden. Sie stellen eine interessante Gruppe Studierender dar. Denn erstens verfügen sie erst seit vergleichsweise kurzer Zeit in der eigenen Sprachregion über ein Angebot an universitärer Bildung, von dem sie grösstenteils nicht Gebrauch machen. Zweitens ist der Deutschschweizer Kontext mit seinem Nebeneinander von Standarddeutsch und Dialekt interessant, ein Kontext, in welchen die TessinerInnen – Standarddeutsch wird an Tessiner Schulen als Fremdsprache unterrichtet, nicht aber Schweizerdeutsch – sich mittels ihrer Mobilität begeben.
Zum andern hat sich die gesetzliche Grundlage der Schweizer Hochschulen verändert. Aktuelle Gesetzesartikel fördern vermehrt den Wettbewerb unter universitären Hochschulen. Die Bildungsstätten profitieren von staatlichen Subventionen, deren Höhe sich u.a. danach bemisst, wie erfolgreich sich eine Universität gegenüber ihrer Konkurrenz behaupten kann.
Auf diesen Vorbedingungen basieren die Überlegungen und Analysen dieser Arbeit. Sie ergründet, welcher Stellenwert der Sprache in Diskursen und Praktiken zukommt, die mit der intra-nationalen studentischen Mobilität über Sprachregionen in der Schweiz hinweg einhergehen. Mittels einer „multi-sited“ Ethnographie, die auf Prämissen der kritischen Soziolinguistik basiert, analysiert die Untersuchung, wie in der sich verändert habenden Schweizer Hochschullandschaft der Wunsch nach Mobilität kreiert und legitimiert wird und wie Mobilität und damit verbundene Herausforderungen bewältigt werden.
Dieses Vorhaben leitet die nachfolgenden Kapitel. Zuerst (Kapitel 2) skizziere ich die Geschichte und die Gegenwart der Hochschulen und umreisse die Entstehung universitärer Institutionen, welche die akademische Mobilität mit sich brachten. Weiter lege ich dar, wie es um die akademische Mobilität in Geschichte und Gegenwart in der Schweiz stand bzw. steht. Es folgt ein knapper Überblick über die Forschung zum Thema der studentischen Mobilität, und es wird auf bestehende Lücken in der Erkundung dieses Themas hingewiesen. Vor diesem Hintergrund wird erörtert, welchen Beitrag die vorliegende Arbeit leisten und wie sie sich positionieren will. Es werden die Forschungsfragen formuliert, und es wird erklärt, welche Daten zur Beantwortung derselben mit welcher Methode erhoben wurden und wie diese analysiert werden. Ausserdem werden drei theoretische Konzepte, die dem Vorhaben dienlich sind – nämlich Mobilität, Sprachideologie und politische Ökonomie – vorgestellt.
Das Kapitel 3 ist der Methodologie gewidmet. Es wird aufgezeigt, weshalb ein ethnographischer Ansatz für das Forschungsunterfangen gewählt wurde und wie dieser im Detail aussieht.
Darauf folgen drei analytische Kapitel. Kapitel 4 analysiert, wie der Wunsch nach Mobilität geweckt wird. Eine Analyse gesetzlicher Grundlagen und institutioneller Dokumente (Werbematerial), von Feldnotizen und Interviews mit an Hochschulen tätigen Personen zeigt, dass Tertiärinstitutionen in ihren universitären Promotionsdiskursen und -praktiken ihre je eigenen Vorteile in einem gesetzlich kompetitiv geprägten Setting hervorheben. Dabei wählen sie Strategien, die ihre Hochschule als die „richtige“ erscheinen lassen. In Bezug auf italofone Studierende wird die Sprache zum Instrument, mittels dessen der Studierendengruppe die für sie besonders relevanten Vorteile kommuniziert werden.
Kapitel 5 ist der Analyse von Interviews mit GymnasiastInnen und Studierenden aus dem Tessin gewidmet. Es legt dar, dass in ihren Begründungen der herannahenden oder zurückliegenden Entscheidung für ein Studium die sprach-politische Situation des Landes und ihre Konsequenzen für die Bildungssysteme der verschiedenen Sprachregionen und die markt-wirtschaftliche Dimension zum Ausdruck kommen.
In Kapitel 6 ergründe ich die zahlreichen Herausforderungen, die Tessiner Studierende im Zusammenhang mit ihrer Dislokation konstruieren, und gehe der prominenten Strategie, diesen Herausforderungen im Tessiner Studierendenverein zu begegnen, auf den Grund. Eine Analyse der Vereinspraktiken zeigt, dass die Individuen in ihrer Mobilitätserfahrung im Verein Unterstützung suchen und bekommen. Die individuelle Mobilitätserfahrung widerspiegelt sich in den institutionellen Praktiken und sichert das Fortbestehen des Vereins.
Die ethnographische Untersuchung erlaubt ein tiefgründiges Verständnis soziolinguistischer Praktiken und der ihnen zugrunde liegenden Sprachideologien verschiedener voneinander abhängiger Akteure in der tertiären Bildung (Hochschulen, GymnasiastInnen, Studierende). Das Deuten der Ergebnisse vor dem Hintergrund historischer und politisch-ökonomischer Bedingungen inner- und ausserhalb der Schweiz gibt ausserdem Aufschluss darüber, wie sich in Praktiken der studentischen Mobilität marktwirtschaftliche Interessen lokaler, nationaler, europäischer und globaler Natur widerspiegeln (Kapitel 7). Diese Interessen haben Einfluss darauf, welcher Stellenwert Sprache unter welchen Bedingungen zukommt und wie Sprache instrumentalisiert wird. Abschliessend zeige ich auf, welche gesetzlichen Veränderungen in dieser Arbeit noch nicht berücksichtigt worden sind, und führe aus, welche weiterführenden Fragen sich in zukünftigen Forschungsarbeiten aufgreifen liessen.
2Seit jeher der Bildung wegen in die Ferne
Paternitati vestre innotescat quod nos, sani et incolumes in civitate Aurelianensi, divina dispensante misericordia, conumorantes, operam nostram cum affectu studio totaliter adhibemus, considerantes quia dicit Cato: „scire aliquid laus est, etc.“ Nos enim domus habemus bonam et pulcram, que sola domo distat a scolis et a foro et sic pedibus siccis scolas cotidie possumus introire. Habemus etiam bonos socios nobiscum, hospicio vitaque et moribus comendatos; et in hoc nimium congratulamur, notantes quia dicit Psalmista: „Cum sancto sanctus eris, etc.“1
(Auszug aus einem an die Eltern adressierten Brief, verfasst von den zwei in Orléans studierenden Söhnen, 13. Jahrhundert2)
Several advantages we should find there, such as … better opportunities of growing perfect in the French, better masters for mathematics (which he has a mind to apply himself to for some time) and for any exercise of accomplishment that any of us might have a mind to advance or perfect ourselves in such as dancing, fencing, drawing, architecture, fortification, music, the knowledge of medals, painting, sculpture, antiquity […]
(Auszug aus einem Brief, der von Tutor Fish aus Paris nach England gesendet wird, anfangs 18. Jahrhundert, Black 2011: 162)
Ho sempre avuto la ferma intenzione di studiare in un’università germanofona fin da quando ho ottenuto la maturità in Ticino, poiché considero la lingua tedesca come valore aggiunto nel mio CV. Sono finito a Lucerna. Impiego due ore e mezzo, proprio pochissimo per noi Ticinesi. È la più vicina università per noi. Torno giovedì sera in Ticino, e domenica sera torno a Lucerna. Sono spesso sul treno. Però sono contenta con la mia scelta, mi sono trovato benissimo soprattutto grazie a una struttura accademica fatta a misura di studente, dove i professori ti conoscono personalmente e non è necessario ricorrere alla mediazione degli assistenti per comunicare con loro.3
(Auszug aus einem Interview mit Stefania4, Frühling 2012, Luzern)
Die drei Belege sind unterschiedlicher Natur. Sie stammen aus verschiedenen zeitlichen und räumlichen Kontexten. Zwei davon sind Auszüge aus Briefen, einer geht auf eine Tonaufnahme zurück. Während die Quelle in Latein wie auch diejenige von Stefania auf ein Studium an einer Universität Bezug nehmen, verweist diejenige aus Paris auf die „Grand Tour“, die v.a. im 17., aber auch im frühen 18. Jahrhundert unter Privilegierten verbreitet war und Aufenthalte in Kultur- und Universitätsstädten Europas beinhaltete.
Trotz dieser Unterschiede haben die Zeitzeugnisse auch Gemeinsamkeiten. Sie handeln von drei jungen Menschen, die der geeigneten Bildung zuliebe zum Teil weite und unbequeme Wege auf sich genommen haben. Die Entscheidung, sich fern der Heimat in Orléans, Paris oder Luzern aufzuhalten, scheint je nach Epoche die „richtige“ zu sein; die Ausbildung in der sprachlich-kulturellen Fremde ist die zeitgemässe Vorbereitung auf die Zukunft.
Bildungsmobilität geht weit zurück und ist eng mit Institutionen/Orten verbunden, die entsprechende Bildung versprechen. Aber wie sind diese Bildungszentren entstanden? Wie sind sie zu dem geworden, was sie heute sind? Wie kam es dazu, dass einige Städte zu universitären Stätten wurden? Und weshalb wird die an den Universitäten angebotene Bildung als „geeignet“ erachtet und mit ihr seit Jahrhunderten sozialer Aufstieg assoziiert? Um solchen Fragen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, weshalb Bildung Studierende seit jeher in die Ferne zieht, scheint es fruchtbar, im Folgenden einen Blick auf die Entstehung und Entwicklung der Bildungsinstitutionen zu werfen (2.1.1). Danach ist ein Unterkapitel der Bildungsmobilität in der Geschichte der Schweiz gewidmet (2.1.2). Schliesslich wird die aktuelle Mobilität beschrieben, die im Fokus dieser Arbeit steht (2.1.3).
2.1Die Hochschullandschaft – damals und heute
Seit um etwa 1200 die Uruniversitäten Bologna und Paris entstanden1, zählt gemäss Weber „die Universität zu den wichtigsten soziokulturellen Kräften, welche die Formierung, den Aufstieg und die hochrangige Positionierung Europas in der Welt ermöglichten“ (Weber 2002: 9). Seither hat sich einiges verändert, eine Elitenbildungsanstalt ist die Universität jedoch geblieben. Sie vermittelt und schafft höheres Fakten-, Methoden- und Orientierungswissen und nimmt qualifizierte Lernende auf, die mit und dank diesem Wissen später in der Regel bestimmte gesellschaftliche Positionen einnehmen.
Die aktuelle Schweizer Hochschullandschaft besteht aus 12 tertiären Institutionen2, welche vorwiegend in urbanen Zentren zu finden sind. Dazu zählen zehn kantonale und zwei eidgenössische Universitäten. Diese blicken auf eine 800-jährige Geschichte zurück, wobei freilich die Mehrheit von ihnen erst im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert gegründet wurde, aber meist auf bereits bestehenden Institutionen aufbauen konnte3. Um das aktuelle tertiäre Bildungswesen und die darin vorherrschenden hochschulpolitischen Beziehungen zu verstehen, ist vorgängig ein historischer Abriss hilfreich. Das jeweilige Zeitgeschehen spiegelt sich nämlich in der Universität, ihrer Struktur und Ausstrahlung wider. Diese Retrospektive soll dazu beitragen, das Aufkommen der Universität im europäischen Kontext zu situieren, wobei auch auf die Schweiz und die dortigen Gründungen verwiesen wird. Weiter soll dieser Rückblick verdeutlichen, vor welchem Hintergrund die studentische Mobilität entstanden ist.
2.1.1Die Entstehung und Entwicklung der Universitäten in Europa – ein Längsschnitt in Kürze
Der Blick in die Vergangenheit soll knapp sein; er dient der Kontextualisierung und wird ohne Details1 auskommen müssen. Den grossen Epochen Mittelalter, frühe Neuzeit und Moderne entlang werden zentrale Aspekte aufgeführt2. Ein letzter Abschnitt ist der Gegenwart gewidmet. Sofern es aus Schweizer Perspektive etwas vorzubringen gibt, wird dies im finalen Abschnitt der Darstellung der jeweiligen Epoche getan.
Die ersten Universitates im christlichen Europa: 1180–1400
Ihren Anfang nahm die Universität in Bologna und Paris. Die Universität Bologna (offizielles Gründungsjahr 1088) fasste die bereits bestehenden Rechtsschulen zusammen, die aufgrund von immerwährenden Konflikten zwischen Papsttum (Kirchenrecht), Bürgertum (kommunales Recht) und Kaisertum (Herrscherrecht) entstanden waren. In Paris hingegen wurden um 1200 verschiedene theologische Schulen organisatorisch zusammengefasst; der Papst erachtete Paris als künftiges universitäres Zentrum der europäischen Theologie und trug mit der „licentia ubique docendi“ dazu bei, dass alle Studenten, die den Magister erlangt hatten, an jeder europäischen Universität lehren konnten. Er animierte somit den Lehrkörper bereits in den universitären Anfängen zur Mobilität, erhoffte er sich dadurch doch eine Verbreitung seiner theologischen Lehre. Gemeinsam war den frühen Universitäten, dass sie aus einer bestimmten geistigen und sozialen Situation entstanden, als nämlich „herkömmliche Kloster- und Domschulen den fortschreitenden Erkenntnis- und Lehrmethoden der Scholastik und den Ansprüchen der wissenschaftstreibenden Bevölkerungsgruppen, vornehmlich Kleriker und in zunehmendem Masse auch Laien, nicht mehr genügten“ (Boehm & Müller 1983: 12). Lehrer und Scholaren schlossen sich zu Korporationen, also zu einer Art von Berufsgenossenschaften, zusammen. Daher kommt auch die Bezeichnung „universitas“, die für Kommunität steht. Auch wenn in Bologna und Paris Konflikte zwischen Hauptakteuren wie Papst, Bischof, Stadt oder Kaiser ausgetragen wurden, war das Modell der Universität rasch erfolgreich. Beide Universitäten hatten bald Ableger (z.B. in Padua, Siena), und es dauerte nicht lange, bis in Oxford die erste selbständige Gründung erfolgte. Im 13. und 14. Jahrhundert – es gab dann bereits über 30 Universitäten – festigte sich die Organisationsform, und mit der Gründung in Prag (1348) und später in Heidelberg und in Köln erreichte die Universität auch das „jüngere Europa“ (vgl. Moraw 1985). Zwar unterscheiden sich die lokalen Geschichten der einzelnen Institutionen voneinander, jedoch sind alle Gründungen mithilfe der Kirche entstanden. Zu dieser Zeit stand nämlich die Wissenssicherung und -verbreitung im Vordergrund, wobei es darum ging, die „doctrina sacra“ in ihrer Gesamtheit zu erfassen.
Dank der Kirche, dem aufstrebenden Stadtbürgertum und später der Höfe avancierten die universitären Titel und Abschlüsse „zu anerkannten sozialen Merkmalen, Ausweisen höherer Qualifikation und adelsnahen Rangs“ (Weber 2002: 69). Der Adel hiess das Prinzip „scientia nobilitat“ gut und begab sich ebenfalls – wenn meist auch ohne je einen Abschluss zu erlangen – an die Universität. Man könnte hier auch von einer ersten Bildungschance sprechen, die einem breiteren (aber durchaus zur Elite gehörenden) Publikum zuteil wurde und das Vorrecht des adeligen Blutes in Frage stellte. Die Studienvoraussetzungen formaler Art beschränkten sich nämlich darauf, dass derjenige, der zu studieren wünschte, getauft, ehelich geboren und unbescholtenen Leumunds war und ein Mindestalter hatte, in dem er fähig war, Verantwortung wahrzunehmen. Zu den tatsächlichen Studierenden zählten aber neben den Adeligen v.a. die Ober- und Mittelschicht aus dem städtischen Bürgertum. Schwinges (1986) unterscheidet neben den Adeligen, für die das Studium in erster Line einer „berufsunspezifischen Sozialqualifikation“ gleichkam (Seifert 1986: 619) und für die akademische Titel von geringer Bedeutung waren, verschiedene, für die Epoche charakteristische Typen von Studierenden. Der häufigste war der „scholaris simplex“, der während maximal zwei Jahren an der artistischen Fakultät Grundkenntnisse erwarb, ohne einen Abschluss zu erlangen. Schon seltener war der Student, der nach rund zweieinhalb Jahren eine artistische Grundausbildung mit dem Grad des „Bakkalaureus“ abschloss, manchmal sogar darüber hinaus studierte und den Magistergrad erreichte. In wenigen Fällen wurde dann das Bakkalaureat einer höheren Fakultät (Jurisprudenz, Medizin oder Theologie) erworben, im besten Fall verbunden mit der Lehrlizenz und der anschliessenden Doktorwürde. Abgänger der Universität (mit und ohne Abschluss) übernahmen nicht selten Funktionen in Verwaltungen und Kirchenbürokratien und forderten bereits im 13. und 14. Jahrhundert den Geburtsadel heraus (Verger 2000).
Gemeinsam war den Studierenden ihre Prägung aufgrund der Bildung. Das relativ einheitliche Sach- und Orientierungswissen, v.a. im Bereich der Jurisprudenz und der Theologie, fand in der „lectio“ (im vom Klosterbetrieb übernommenen 45-Minuten-Rhythmus) ebenso Verbreitung wie die Latinisierung und Standardisierung des Denkens und der Kommunikation (auf Grundlage der Schulung in Grammatik und Logik) (vgl. Weber 2002: 70). Die Studierenden nahmen zum Teil weite Wege auf sich, um in den Genuss universitärer Bildung zu kommen. Die studentische Wanderung war in den meisten Fällen auf das Fehlen einer einschlägigen Ausbildungsstätte in der Region zurückzuführen. So begaben sich bspw. deutsche Studierende und aufstrebende Junggelehrte vor der Errichtung der Universität Köln häufig nach Bologna, Paris oder Padua (Fisch 2015). Die gemeinsame Prägung, die Studierende an den Universitäten erfuhren, wurde durch die studentische Wanderung verbreitet und trug zur Europäisierung bei.
Unterrichtet wurden die Studierenden allerorts von einem Lehrkörper, der mehrheitlich aus Klerikern bestand und aus Pfründen bezahlt wurde. Im Allgemeinen war die Vergütung jedoch nicht prioritär, „Scientia donum Dei est, unde vendi non potest“1 stand im Vordergrund. Oft reichten diese Einkünfte aber kaum, weshalb die Lehrenden von ihren Studierenden „Collectae“ oder Examensgebühren verlangten (Verger 2000). Die Unterrichtenden waren somit immer abhängig von Herrschern und deren Mass an finanzieller Unterstützung. Ganz generell beeinflussten die Herrscher das universitäre Geschehen erheblich. Ihnen stand es zu, die Institutionen privilegiert zu behandeln, d.h. sie etwa bei den Steuern entlasten oder ihnen das Verleihen bestimmter akademischer Grade zu erlauben (Nardi 1993). Ebenso konnten sie Verbote aussprechen, an einer bestimmten Universität zu studieren (Kaiser Friedrich II. etwa verbot 1226 das Studium und die Lehre in Bologna im Zusammenhang mit seiner Absicht, in Neapel Kader fürs Königreich Sizilien auszubilden.) oder wichtige Vorschriften für den höheren Unterricht durchzusetzen (So schickte Papst Georg IX. 1234 Weisungen nach Bologna und nach Paris, wie die Lehre dort auszusehen habe.). In Anbetracht dieser (hier skizzenhaft dargestellten) Macht, die den Herrschern zukam, können Hochschulen bereits in den Anfangszeiten nicht als „autonome Gebilde, sondern müssen als gesellschaftliche Institutionen“ (Prahl 1978: 10) betrachtet werden, die in den damaligen Kontext der Weltmächte Papsttum und Reich eingebunden waren.
In der damaligen Eidgenossenschaft sind bis 1400 keine Universitätsgründungen zu verzeichnen. Gewiss existierten bereits institutionalisierte Gemeinschaften wie etwa religiöse Bruderschaften. Deren Lehrer und Scholaren schlossen sich aber bis 1400 nicht ausserhalb von Abteien oder Bischofskirchen zusammen. Studierende aus der heutigen Schweiz besuchten vorwiegend die bereits gegründeten Universitäten im heutigen Italien und Frankreich.
Humanismus, Konfessionalisierung und Aufklärung und die Universität: 1400–1790
Wegen Ereignissen wie dem Avignoner Exil (1309–1377) und dem Papstschisma (1378–1449) lockerte sich Ende des 14. und anfangs des 15. Jahrhunderts die päpstliche Kontrolle der Universitäten. Von universitären Akteuren entwickelte kirchliche Verfassungstheorien, die u.a. die Wahl des Papsts regelten, und Gutachten weltlicher Art wurden modifiziert. Diese Anpassungen schwächten die bisher enge Verbindung zwischen der Universität und dem Papsttum. Herrschaftlich-staatliche Bedürfnisse rückten in den Vordergrund, wobei es dem Landesherrn und den neuen Herren der Universität darum ging, das universitäre Wissen unmittelbar dem eigenen Land/der eigenen Region nützlich zu machen. Somit fängt das territoriale Zeitalter1 der europäischen Universität in der frühen Neuzeit an (Moraw 1994). Der Landesherr übernahm die vormals von der Kirche ausgeübte Rolle. Infolgedessen entklerikalisierte sich die Universität schrittweise und entwickelte sich zur Laieninstitution, die vermehrt territorial aktiv war. Die Landesherren waren zunehmend daran interessiert, die Landadeligen zu loyalen Anhängern zu erziehen, was eine Erweiterung des Fächerspektrums (Fechten, Tanzen, Artillerie etc.) mit sich brachte. Nach und nach wiesen die bisher der Kirche wegen sehr einheitlichen Universitätsmodelle erhebliche Unterschiede auf.
Kulturelle Bewegungen prägten die frühneuzeitlichen Universitäten massgeblich. Zunächst war es die humanistische Elite, die durch das Wiederaufgreifen antiken Wissens die scholastisch ausgerichteten Professoren herausforderte. Später wurde reformatorisches Gedankengut an die Universität herangetragen und trug zu deren Wiederverkirchlichung und damit auch zur „Wiederbelebung scholastischer Wissenschaftsstrukturen“ bei (Weber 2002: 75). Es folgten konfessionalisierende Bemühungen, mit dem Ziel, die „seit der Glaubensspaltung auseinanderstrebenden christlichen Bekenntnisse zu einem halbwegs stabilen Kirchentum nach Dogma, Verfassung und religiös sittlicher Lebensform geistig und organisatorisch zu festigen“ (Zeeden 1965: 9). Sowohl die Reformation als auch die Konfessionalisierung prägten die Universitäten und deren Entwicklung und Verbreitung in der frühen Neuzeit massgeblich. Etliche Krisen (z.B. die Inflation, die mit dem kolonialen Güterimport und dessen sozioökonomischen Konsequenzen einherging, Hugenottenkriege, französische Expansionskriege) lähmten die universitäre Weiterentwicklung ab 1600 fast gänzlich. Aufruhr, Verunsicherung und Krieg prägten den universitären Betrieb und verunmöglichten es den Akteuren, eine kritisch-verantwortliche intellektuelle Rolle einzunehmen. Das Festhalten am Staat, auch wenn dieser im Krieg war, und an der bewährten Wissenschaft schien die sicherste und am nächsten liegende Haltung.
Mitte des 17. Jahrhunderts prägten frühaufklärerische Gedanken aus ausseruniversitären Kreisen (z.B. Descartes, Leibniz, Newton) die Universität. Sie machten nach und nach die Natur als erforschbares Universum zur Basis aller Erkenntnis (vgl. Stollberg-Rilinger 2000) und kritisierten die Vorstellung von „einer göttlichen und statischen Weltordnung“ (Wollgast 2010: 59). Zwar wehrte sich die Professorenschaft gegen aufgeklärte Gegeneliten, die wie ihre humanistischen Vorgänger fürstlich-staatliche Protektion genossen und sich in Akademien, die vorwiegend Forschung betrieben, zusammenschlossen (Wollgast 2010). Jedoch mussten sämtliche Universitäten der staatlichen Forderung nachkommen und neue „nützliche“ Fächer in ihren Kanon aufnehmen, und allmählich verbreitete sich auch in ihnen aufklärerisches Gedankengut. Für den Fortbestand voraufklärerischer wie auch aufklärerischer Ideen sorgte nicht zuletzt der Medien- und Kommunikationswandel der Neuzeit (North 2001). Die Erfindung des Buchdrucks um 1450 und dessen rasche Verbreitung sowie das ausgebaute Boten- und Postwesen (Behringer 2002) verhalfen dazu, den individuellen Wissensspeicher in den Druck auszulagern und das Lehrbuch massenhaft verfügbar zu machen (vgl. Weber 2002: 78). Bereits um 1600 war der Schriftbestand an den Universitäten ohne System nicht mehr überblickbar.
Zahlenmässig vermehrten sich die universitären Institutionen in der frühen Neuzeit und rückten auch in bisher nicht erfasste Regionen vor. Gab es um 1400 rund 30 Universitäten, so waren es um 1500 bereits doppelt so viele. Um 1600 wurden 110 Universitäten in Europa gezählt. Im 17. Jahrhundert verlangsamte sich das stetige Wachstum – es waren nun etwa 150 Universitäten zu verzeichnen. Im 18. Jahrhundert hielten sich die Gründungen und Aufhebungen etwa die Waage. Bis 1790 wurden 28 Neugründungen gezählt. Die Universitätslandschaft galt nun als gesättigt2. Die prozentuale Zunahme der Anzahl an Universitäten überstieg die prozentuale Zunahme der Bevölkerung.
Aus der Menge universitärer Institutionen kann aber keinesfalls geschlossen werden, dass die Universität eine Institution für die Masse geworden sei; nach wie vor begab sich nur rund 1 % der Bevölkerung an die Universität. Wollten sich Studierende in der frühen Neuzeit immatrikulieren, waren sie dazu verpflichtet, (zum Teil jedes Semester) Gebühren zu zahlen und einen Eid auf die Vorschriften der Universität inklusive deren konfessionelle Ausrichtung abzulegen. Ferner wurden an manchen Orten Abstammungsmerkmale wichtig3. Noch war die Universität, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nur von Männern aus adeligen oder bürgerlichen Kreisen frequentiert. Während eine Zeit lang das Fehlen einer regionalen/lokalen Universität für diese den Hauptgrund darstellte, universitäre Bildung in der Ferne zu beanspruchen, ging mit der Verdichtung der Universitätslandschaft die Mobilität an manchen Orten zurück. Zuweilen legte die territoriale Organisation den Studierenden ein Studium an der lokalen Universität nahe; mitunter trug die jeweilige Ausrichtung dazu bei, eine gewisse Studierendenpopulation anzuziehen. Neben jener Mobilität, welche zur universitären Ausbildung an einer bestimmten Institution fern der Heimat gehörte, war in der frühen Neuzeit die bereits erwähnte „Grand Tour“ verbreitet, auf welcher noble junge Männer an verschiedenen Stationen, am liebsten in Universitäts- und Kulturstädten, Halt machten (Cohen 1992; De Ridder-Symoens 1996).
Auch in der frühen Neuzeit waren die Vorlesung (Modus Bononsiensis) wie auch die Vorlesung plus Übung (Modus Parisiensis) die üblichen Lehrformen. Unterrichtssprache war Latein. Aus Bürgersicht gewann das Doktorat an Akzeptanz und wurde bald zum einzigen gültigen Titel. Der Lehrkörper wurde z.T. direkt vom Landesherrn oder aus kirchlichen Ressourcen bezahlt. Nicht selten war das Salär aber karg, weshalb Professoren rege ihnen vorbehaltene Privilegien wie etwa das Braurecht nutzten.
Konzentriert man sich auf die Schweiz und die dortigen Universitätsgründungen in der frühen Neuzeit, steht man wie bei Gründungen anderswo vor dem Problem, das Gründungsjahr zu eruieren. Wie in vorausgehenden Abschnitten geschildert, entstanden Universitäten jeweils im Kontext der Zusammenschlüsse von Bruderschaften. Jede Universität hat eine Vorgeschichte, manche haben eine sehr lange. Ein Moment in der (Vor-)Geschichte einer Universität wurde als genügend gewichtig bewertet, um diesem den Status „Gründungsjahr“ zuzuschreiben4. Dieser muss nicht mit dem Jahr zusammenfallen, in welchem die Institution offiziell als Universität anerkannt wurde und universitären Charakter aufwies5. Wird im Folgenden auf Schweizer Universitäten verwiesen, geschieht dies chronologisch nach dem Kriterium der offiziellen Anerkennung des Universitätsstatus.
Dieser Einteilung zufolge bleibt Basel mit dem Eröffnen des Universitätsbetriebs 1460 bis ins 19. Jahrhundert die einzige Universität auf Schweizer Boden. Sie wurde aufgrund eines Privilegs von Papst Pius II. eröffnet. Das Verleihen von akademischen Graden stand ihr aber dank dem Basler Konzil (1432–1449) bereits davor zu; das „Studium generale“ war schon eingerichtet. Sie glich in ihrer Struktur und dem anfänglichen Lehrangebot (Theologie, Rechtswissenschaften, Medizin) den Uruniversitäten Bologna und Paris. Der internationale Lehrköper mit scholastischen und früh in Basel stationierten humanistischen Grössen (z.B. Erasmus von Rotterdam) strahlte weit über die Universität und die Stadt Basel hinaus. 1529 geriet die Universität der Reformation wegen in eine Krise, Altgläubige wanderten ab, Reformierte blieben oder begaben sich aus dem Ausland nach Basel (Boehm & Müller 1983). Im 17. Jahrhundert wurde die Universität v.a. von einzelnen bürgerlichen Familien gelenkt, aus denen Basler Gelehrtendynastien hervorgingen (z.B. Mathematiker Bernoulli). Im 19. Jahrhundert, nach der kurzen Zeit der Helvetischen Republik (1789–1803), wurde die Universität Basel in die Staatsverwaltung einverleibt. Der kriegerische Konflikt zwischen den beiden Halbkantonen Basel Stadt und Basel Land führte die Universität in eine schwere Krise, bis 1834 dem Kanton Basel Stadt das Universitätsgut zugeteilt wurde. Nach und nach erholte sich die Universität, und die Zahl der Studenten begann wieder zu steigen.
Die sich wandelnde Universität der Moderne (1790–1990)
Die Moderne kann in Bezug auf die Universität als Epoche des Wandels bezeichnet werden. Erst geriet die Universität wegen der Französischen Revolution in eine Krise, die bis nach der Mitte des 19. Jahrhunderts dauerte. In Frankreich erachteten die Revolutionäre die universitären Institutionen als Symbole des alten Regimes, schafften einige kurzerhand ab und gründeten stattdessen Spezialhochschulen. Nach dem Sieg über das napoleonische Reich war aber die Gefahr gebannt, dass es auch ausserhalb Frankreichs zu Abschaffungen kommen würde. Gesamteuropäisch blieb die Anzahl Universitäten gleich, in Nordamerika kam es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer deutlichen Zunahme.
Ab 1880 galt ein von Wilhelm von Humboldt geprägtes neuhumanistisch-idealistisches Curriculum, das sich alsbald (nicht ohne Konflikte) mit Ideen aus Preussen vermengte. Den Preussen war vor allem die Vermittlung von wirtschaftlich und politisch nützlichem Wissen wichtig, Wissen, das der nationalen Bildung und dem Prestige dienlich war. Die Universität und der Staat rückten einander näher. Somit gewann die Ausbildung von Industriepersonal über die bisher angepeilten Eliten hinaus an Bedeutung. Sie erfolge zunehmend auch an Spezialhochschulen (z.B. Technischen Hochschulen). Der Druck, alle junge Menschen rasch und gezielt zu qualifizieren, hatte eine Formalisierung und Reglementierung zur Folge und brachte neue Fragen mit sich, u.a. diejenige nach der voruniversitären Bildung, die nach und nach zur Norm wurde.
Zwischen 1918 und 1945 erfuhren verschiedene Universitäten diverse strukturelle Veränderungen. In Europa waren sie nach dem Ersten Weltkrieg sozial, politisch und finanziell in einer schwierigen Lage1. Zudem bekundeten die zutiefst nationalistisch und monarchisch imprägnierten Professoren (v.a. in Deutschland) Mühe mit den Veränderungen, die diese Jahrzehnte mit sich brachten (z.B. Aufheben des klassischen Vierfakultätenmodells, Heranwachsen eines Mittelbaus). Zwischen den Weltkriegen gab es kaum Neugründungen.
Während dem Zweiten Weltkrieg fungierte die Universität als Institution, die sich dem vorherrschenden politischen Programm im Dritten Reiche unterordnete. Von ernsthafter Kritik daran oder von einem Widerstand gegen die nationalistischen Massnahmen seitens der Universität kann kaum gesprochen werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Europa etliche neue Universitäten gegründet. Dieser Trend hielt bis in die 90er-Jahre an. In Deutschland beispielsweise wuchs der Bestand von 18 Hochschulen im Jahr 1959 auf 60 vor der Wiedervereinigung. Die vielen Neugründungen hatten ein Nebeneinander von halb-privaten, privaten und öffentlichen Bildungsinstitutionen zur Folge, die zwar alle die Bezeichnung „Universität“ verwendeten, aber nur mehr oder weniger weit gehende Graduierungsrechte besassen. Unter den Neugründungen fanden sich auch einige „postnationale Institutionen“, die von mehreren Ländern getragen wurden (z.B. Worlds Maritime University in Malmö, 1983). Die Studierenden nutzten das Angebot rege und schrieben sich trotz des technischen Fortschritts, der die akademische Mobilität hätte erleichtern können, v.a. an lokalen Universitäten ein und querten die Grenzen ihrer Herkunftsländer selten. Ab Ende der 80er-Jahre wurden (auch im Zusammenhang mit dem Mauerfall) Programme geschaffen, welche die akademische Mobilität in Europa fördern sollten (z.B. Erasmus). So wurden die bisher individuell organisierten Wanderungen mehrheitlich von institutionalisierten Mobilitätsformen im Kontext des tertiären Bildungssystems abgelöst (vgl. Wächter 2003; Van Mol 2014).
Anders als in früheren Epochen wurde die moderne Universität immer seltener von der Kirche finanziert. Letztere beschränkte sich darauf, theologische Fakultäten oder Bibliotheken zu unterstützen.
Die Universität büsste an Selbstverwaltung ein. Immer mehr mischte sich der Staat ein, finanzierte die Institution, nahm aber die Professoren und Universitäten in die Pflicht, das Nationalbewusstsein zu stärken.
Sowohl die Studierenden- als auch die Professorenzahlen stiegen in der Moderne an. Bei Letzteren geht man von 1850 bis 1990 von einer Verzehnfachung aus. Seit den 60er-Jahren wurde auch Frauen der Titel der Professorin erteilt, und seit den 70er-Jahren sind auch nebenberufliche Professoren üblich. Während ein Professor um 1880 forschte, Vorlesungen hielt, Seminare in Privatwohnungen durchführte und sich überdies rege am gesellschaftlichen Leben der Universität beteiligte, glichen die Aufgabe von ProfessorInnen um 1990 denjenigen von VerwalterInnen mit Zudienenden. Rund ein Drittel ihrer Arbeitszeit verbrachten sie mit administrativen Aufgaben. Bei den Studierenden war ein noch viel grösserer Anstieg zu verzeichnen, was erhebliche Auswirkungen auf die numerische Proportion von ProfessorInnen und Studierenden hatte und den direkten Kontakt zwischen Lehrkörper und Studierenden verminderte.2
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde von den Studierenden in der Regel ein Abschluss einer höheren Schule erwartet. Dies hatte zur Folge, dass in Europa die Universität lange den Oberschichten vorbehalten blieb. Von einer Massenuniversität kann erst seit den 60er-/70er-Jahren gesprochen werden, als auch andere soziale Schichten sowie die Frauen zahlreich an die Hochschulen gelangten (Van Mol 2014).
Konzentriert man sich auf die Entwicklung der Schweiz, stellt man fest, dass die meisten tertiären Bildungsstätten erst in der Moderne den universitären Status erhielten. Dies muss im Zusammenspiel mit der „Erfindung der Nation“ bzw. mit der Gründung des Bundesstaats 1848 (und mit dessen Vorläufern, dem „Staatenbund“ und der „helvetischen Republik“) gesehen werden (Anderson 1983). Einige dieser Bildungsstätten waren schon vorher aktiv gewesen. Die nachfolgenden Kurzportraits der einzelnen Schweizer Universitäten zeigen, dass den meisten von ihnen in der Moderne die „offizielle Anerkennung des Universitätsstatus“ zugesprochen wurde.
Den Anfang machte Zürich, wo sich im 16. Jahrhundert verschiedene Lehrstühle nach und nach zusammenschlossen. So kamen zu den reformierten Theologen unter Zwingli die Altphilologen und die Naturgeschichtler. Im 18. Jahrhundert stiessen ein staatswissenschaftlicher Lehrstuhl und ein Institut zur medizinisch-chirurgischen Ausbildung dazu. 1833 wurden die Lehrstühle zu Fakultäten erhoben und um eine philosophische Fakultät ergänzt. Somit durfte sich die Stätte offiziell als Universität Zürich bezeichnen. Die akademische Freiheit in der Lehre gehörte zu den neusten Errungenschaften. Die Ordinarien waren vor allem Deutsche. Früh waren auch Frauen zum Studium zugelassen, die vorwiegend aus Russland und Deutschland kamen (Boehm & Müller 1983). Die Universität gewann an Bedeutung, erweiterte sich bis zum und nach dem zweiten Weltkrieg und ist heute die grösste Hochschule der Schweiz (ca. 26000 Studierende, Stand 2013).
In der Stadt Bern wurde ein Jahr später (1834) die Universität Bern gegründet und umfasste die vier klassischen Fakultäten. Ihr vorausgegangen war eine Akademie, die bereits zu Beginn des Jahrhunderts als Fakultät der freien Künste und der Theologie gegolten hatte (Scandola 1984). Ziel der Gründung von 1834 war es, eine Ausbildungsstätte für loyal gesinnte Beamte zu schaffen. Während sich in der Anfangszeit vor allem Schweizer Studierende immatrikulierten, verfügte bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Universität über eine internationale Studentenschaft. Ab 1870 gehörten auch Frauen (aus Russland) dazu. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs blieben die Studierenden aus dem Ausland aus, und während des Zweiten Weltkriegs war der universitäre Betrieb eingeschränkt. Ab den 50er-Jahren erfuhr die Universität mehr und mehr Zulauf, und der Bau neuer Gebäude wurde unumgänglich, um die immer grösser werdende Studentenschaft zu unterrichten.
1855 wurde die Eidgenössische Polytechnische Schule in Zürich als erste nationale Hochschule des jungen schweizerischen Bundesstaates eröffnet. Obwohl die Idee einer nationalen Universität bereits vorher diskutiert worden war, befugte erst die Bundesverfassung 1848 die Eidgenossenschaft zur Gründung einer nationalen Institution. Zudem trug die industrielle Epoche zur erfolgreichen Gründung ihr Übriges bei; sie forderte ausgebildete Leute im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Die Institution hatte damals fünf Fachschulen (Architektur, Bau- und Maschineningenieurwesen [Ingenieurwesen], Chemie und Forstwissenschaft) sowie eine Abteilung für Mathematik, Naturwissenschaften und allgemeinbildende Fächer. Sie unterstand einem vom Bundesrat ernannten Schulrat. Vor allem ausländische Professoren waren für die Institution von Bedeutung, sie trugen zum über die Hochschule hinaustragenden Ruf bei. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Institution ausgebaut. 1911 wurde die Institution in Eidgenössische Technische Hochschule umgetauft (Gugerli et al. 2005). Im 20. Jahrhundert gewann die Forschung zunehmend an Bedeutung, und Entdeckungen führten zur Eröffnung zahlreicher Abteilungen und Institute (Fleer & Tobler 2012). 1969 übernahm der Bund die Ecole polytechnique de l’Université de Lausanne (EPUL), woraus die zweite eidgenössische Hochschule – die Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) – im französischsprachigen Teil der Schweiz entstand. Sie ging aus der Ecole spéciale de Lausanne (1853) hervor – einer privaten Stätte für Ingenieure –, die seit 1890 der Universität Lausanne angegliedert gewesen war. Seit 1991 unterliegen beide nationalen Hochschulinstitutionen dem Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen.
Der Universität Genf, ihr wurde 1873 der Universitätsstatus zugesprochen, ging wie der Berner Universität eine Akademie voraus, die ihrerseits 1559 auf ein humanistisch-theologisches Seminar und ein Collège zurückging. Genf zog als kulturelles Zentrum des frankofonen Protestantismus – mit der prägenden Figur Calvins – zu Beginn Studenten und Humanisten aus den reformierten Gebieten Europas an, was zur Folge hatte, das sich dort eine bemerkenswerte Gelehrtengemeinschaft herausbildete. Im Zuge der Territorialisierung, die ganz Europa beherrschte, wurde die Studentenschaft zunehmend lokaler (Aubert 2009). Während der französischen Herrschaft (1798–1813) konnte die Akademie sich relativ autonom entwickeln und mündete schliesslich 1873 in die Universität, die für die Naturwissenschaft, die Medizin und Linguistik bedeutungsvoll war. Während der beiden Weltkriege gingen die Studierendenzahlen zurück. Auch in Genf reduzierte sich in dieser Zeit die ausländische Studentenschaft erheblich. Ab 1960 überwog die lokale Studentenschaft.
Die Universität Freiburg erhielt 1889 den Universitätsstatus zugesprochen. Ausschlaggebend war Staatsrat Georges Python. Davor – seit 1582, als das Jesuitenkollegium St. Michael gegründet wurde – waren verschiedene Versuche unternommen worden, in Freiburg eine Hohe Schule für Schweizer Katholiken zu eröffnen. Die theologische Prägung wirkte sich auf die dort tätigen Professoren und ihre Studentenschaft aus, die des Katholizismus wegen von ausserhalb der Landesgrenzen den Weg ins zweisprachige Freiburg suchten. Bis in die 1960er-Jahre verstand sich die Universität als katholische Universität und wurde auch als solche wahrgenommen (Altermatt 2009). Erst später verlagerte sich der Schwerpunkt von der Theologie zu den Geisteswissenschaften, gefolgt von den Wirtschafts-, Sozial-, Natur- und Rechtswissenschaften.
Die im Jahre 1890 anerkannte Universität Lausanne geht auf eine protestantische Theologieschule des 16. Jahrhunderts zurück. Sie hatte rasch einen guten Ruf und dementsprechend Zulauf. Aufgrund politischer Unstimmigkeiten wechselte der Rektor 1558 mit dem gesamten Lehrkörper zu Calvin nach Genf. Diese Veränderung hinterliess an der Lausanner Schule bis ins 18. Jahrhundert Spuren. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde auf Französisch gelehrt, die Säkularisierung hielt Einzug, und es wurden drei Fakultäten geschaffen, nämlich die geistes-/naturwissenschaftliche, die theologische und die juristische. Die Universität war zunehmend erfolgreich, was 1890 in die Anerkennung des Universitätsstatus mündete (Musée historique de l’Ancien-Evêché [Hg.] 1987). Das Geschehen an der Universität wurde im 20. Jahrhundert über weite Strecken vom Kanton Waadt reguliert und kontrolliert. Erst ab 2000 gelang es der Universität, mehr Autonomie zu erlangen.
Neuchâtel bekam 1909 den Status einer Universität. Davor war zwei Mal eine Akademie gegründet worden, die jedoch nicht befugt war, Doktortitel zu verleihen, was im Vergleich zu anderen Schweizer Universitäten dem Ansehen von Neuchâtel nicht dienlich war. Obgleich 1909 erst die geistes- und naturwissenschaftliche, die theologische und die rechtswissenschaftliche Fakultät bestanden und eine medizinische Fakultät fehlte, bekam die Institution den Universitätsstatus zugesprochen. In den 60er-Jahren kam die wirtschaftswissenschaftliche Abteilung hinzu; sie wurde der rechtswissenschaftlichen Fakultät angeschlossen, spaltete sich aber 2003 davon ab. Die Universität Neuchâtel wirkte weit über die Kantonsgrenzen hinaus und zog vor allem Studierende aus dem Kanton Jura an. Die Krise in den 70er-Jahren bewirkte eine verstärkte Kollaboration mit anderen Bildungsinstitutionen, v.a. im technischen Bereich (Baumann 2009).
Universitäten um die Wende vom 20. ins 21. Jahrhundert (1990–)
Die Universität wird seit 1990 mehr und mehr von marktwirtschaftlichen Tendenzen bestimmt. Demnach wird sie nach ökonomischen Leitlinien geführt, und ihre Qualität wird nach einer ökonomischen Skala beurteilt. Laut Nida-Rümelin (2010) wird sie zunehmend zur Berufsakademie, die nach Marktlücken sucht und sich an möglichen Berufsfeldern orientiert. Studienangebot, Studierendenzahlen, durchschnittliche Studienzeit, Rankings intra- und internationaler Art und damit verbundene Hoffnungen auf Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Erfolg bei Drittmittelanträgen, Forschungsausweis, internationale Kooperationen etc. gelten als Qualitätskriterien. Finanziell müssen sich die Universitäten für gewöhnlich wie privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen ausweisen, auch wenn sie gewisse Anteile von der öffentlichen Hand erhalten.
In Übereinstimmung mit der Tendenz, international wettbewerbsfähig zu sein und der Dienstleistungsorientierung zu entsprechen, wurden 1998 an der Pariser Universität Sorbonne supranationale Kooperationen vereinbart. Die Bildungsminister aus Italien, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich erklärten, man wolle das enorme Potenzial an den europäischen Hochschulen besser nutzen und die Zusammenarbeit verbessern. Studierende und wissenschaftliches Personal müssten deshalb innerhalb Europas mobil und die jeweiligen Abschlüsse vergleichbar und gegenseitig anerkannt sein. Die sogenannte Sorbonne-Erklärung1 wurde 1999 in Bologna weiterentwickelt. Es bekannten sich bereits 30 europäische Staaten zum Ziel, bis zum Jahr 2010 einen gemeinsamen Hochschulraum zu schaffen. Es folgten zahlreiche Konferenzen, an denen sich immer mehr Staaten beteiligten und sich der Bologna-Reform2 verpflichteten. Zurzeit3 sind es 48 an der Zahl, die gemeinsam für Ziele zur Errichtung des europäischen Hochschulraums und zur Förderung der europäischen Hochschulen weltweit einstehen.
An den Universitäten der beteiligten Länder brachten diese Bestrebungen verschiedene Veränderungen mit sich. Dazu gehören ein einheitliches Leistungspunktesystem zur Förderung grösstmöglicher Mobilität aller an der Universität beteiligten Akteure, vergleichbare Abschlüsse (Bachelor und Master) zur Erlangung einer arbeitsmarktrelevanten Qualifikation, verstärktes europaweites Zusammenarbeiten im Hinblick auf die Erarbeitung vergleichbarer Kriterien und Methoden zur Qualitätssicherung und im Hinblick auf die Entwicklung von Curricula.
In der Schweiz sind in dieser Phase drei Universitäten zu erwähnen.
Die Hochschule St. Gallen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften erhielt 1995 den offiziellen Universitätsstatus. Ihre Aktivität geht aber aufs Jahr 1898 zurück, als eine Akademie für Handel, Verkehr und Verwaltung gegründet wurde. Die Verkehrskomponente wurde nur sechs Jahre später abgelegt und die Handelskomponente verstärkt (Burmeister & Universität 1998). Somit lag in St. Gallen der Fokus bereits in den Anfängen auf der Ausbildung der Kaufleute für den Welthandel. 1938 erhielt die Institution das Recht auf Verleihung akademischer Grade. Vier Jahrzehnte später kam eine juristische Abteilung hinzu. 1995 wurde die Handeslshochschule zur Universität erhoben. Sie gilt im Wirtschaftsbereich über die Landesgrenzen hinaus als führend. Dementsprechend international ist auch ihre Studentenschaft.
Weiter sind zwei Neugründungen zu verzeichnen. 1996 wurde in der italienischsprachigen Schweiz, dem Tessin, die erste tertiäre Bildungsinstitution gegründet, die Università della Svizzera Italiana (USI). Ihr nun rund 20-jähriges Bestehen hat eine längere, von erfolglosen Gründungsversuchen geprägte Vorgeschichte. 1844 scheiterte ein Projekt, das der Ausbildung zukünftiger Eliten des jungen Kantons hätte dienen sollen. Anfangs des 20. Jahrhunderts wurden universitäre Gründungsprojekte wieder aufgegriffen; diesmal stand die Verteidigung der „Italianità“ im Vordergrund. In der Zwischenkriegszeit kämpften Tessiner, die antifaschistisch eingestellt waren, für eine Universität. In den 70er-Jahren wurde im Tessin erneut diskutiert, endlich eine lokale Universität zu schaffen. Erst 1995 wurde ein Gesetz geschaffen, welches erlaubte, Plänen zur Gründung einer Architekturakademie in Mendrisio und zweier Fakultäten, einer der Wirtschafts- sowie einer der Kommunikationswissenschaften, in Lugano entgegenzukommen und diese zu einer Universität zu vereinen. 1996 wurde die Universität eröffnet. Ihre Studentenschaft stammt mehrheitlich aus dem nahe gelegenen Italien. Nur rund 25 % sind Studierende aus der Region.
In Luzern wurde im Jahr 2000 die Universität Luzern eröffnet. Wie eingangs erwähnt, geht die Vermittlung höherer theologischer Bildung in Luzern auf das 16. Jahrhundert zurück, in welchem das Jesuitenkollegium entstanden war. Dieses zur Akademie auszubauen gelang nicht. Die Tatsache, dass es schon die katholische Universität Freiburg gab, war diesem Projekt nicht dienlich. Weitere Ideen, wie etwa diejenige einer katholischen Universität mit Sitzen in Luzern sowie Freiburg oder aber die einer konfessionsneutralen Zentralschweizer Universität scheiterten. Ab 1973 anerkannte der Bundesrat die theologische Fakultät als beitragsberechtigt. Später ergab sich aus der Kombination des philosophischen Instituts mit dem historischen Lehrstuhl die geisteswissenschaftliche Fakultät. Eine politische Volksabstimmung im Jahr 2000 verhalf schliesslich dazu, die universitäre Hochschule zur Universität anzuheben, die eine theologische, eine rechtswissenschaftliche, eine kultur- und sozialwissenschaftliche und ab Herbst 2016 auch eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät umfasst.
Fazit
Auch wenn die Geschichte der Universitäten nur in Umrissen dargestellt werden konnte, wird daraus ersichtlich, dass die europäische Universität nie eine nach aussen abgekapselte Festung war, wo Genies sich nach Lust und Laune geistig austoben konnten. Die Institution der Universität war vielmehr seit jeher in Bezugs- und Machtverhältnisse eingebunden. Anfänglich waren diese v.a. kirchlicher, später vor allem politischer – zuerst territorialstaatlicher, dann nationalstaatlicher und schliesslich gesellschaftlich-wirtschaftlicher – Natur. Die Universität muss somit als Institution betrachtet werden, die seit den Anfängen einem dominanten Machtapparat zudient, der bestimmt, welche Art von Bildung es zu vermitteln gilt. Auch zeigt dieser knappe Überblick, dass die Machtverhältnisse, in denen die Universitäten sich entwickelten, erhebliche Auswirkungen auf die Herkunft der Studierenden und auf deren Mobilität hatten und haben.
Im Folgenden soll in zwei Unterkapiteln der Mobilität in der Schweiz Beachtung geschenkt werden. Es wird zuerst die Mobilität der akademischen Bildung seit ihren Anfängen umrissen, wobei zum Tragen kommt, inwiefern damals die Sprache bereits eine Rolle spielte. Danach steht die aktuelle Mobilität im Fokus, auch hier mit besonderem Augenmerk auf die Sprache.
2.1.2Bildungsmobilität in der Schweiz von den universitären Anfängen bis heute
Gyr (1989) stellt fest, dass es vor 1370 bei den eidgenössischen Studenten klare Favoritenuniversitäten gab. Dazu gehörten Bologna, Paris, Orléans und Montpellier. Die Notwendigkeit mobilisierte, die Eidgenossenschaft bot damals noch keine Tertiärbildung. Die Richtung der Mobilität war trotz anderer Möglichkeiten (z.B. Universitäten in Prag und Wien) vorbestimmt. Gemäss Stelling-Michaud (1938: 152) waren die Studenten aus der Eidgenossenschaft „orientés exclusivement vers les pays de langue romane“. Dies veränderte sich auch nach der Gründung der Universität Basel 1460 nicht sogleich. Die in der Ferne weilenden Studierenden kehrten nicht sofort in die Heimat zurück. Geographische Nähe war eben nur ein Argument. „Fachrichtung, Lehrangebot, Lehrkörper, konfessionelle Ausrichtung sowie politische Abkommen“ (Gyr 1989: 37) spielten ebenso eine Rolle. Wie Stelling-Michaud (1938: 153) festhält, bewirkte die Gründung der Basler Universität, „d’augmenter encore le nombre des Suisses dans les universités étrangères, car la nouvelle et vaste clientèle écolière de Bâle, attirée par la proximité du lieu, allait en grande partie poursuivre et terminer ses études dans d’autres pays“. Gyr (1989) verweist ausserdem auf die ausserhäusliche Erziehung als ein durchgängig befolgtes Prinzip, wobei das Aneignen von Fähigkeiten wie auch der Reifeprozess von Bedeutung waren. So sollte der Studierende sich, dank dem Aufenthalt in der Fremde, nicht nur eine Ausbildung aneignen, sondern auch erwachsen werden.
Seit wann genau der Erwerb von Sprachen für die Eidgenossen von Bedeutung war, ist schwierig zu sagen. Sicher ist, dass bis in die Epoche des Humanismus Latein jene europäische Sprache war, welche die an Universitäten Lehrenden und Lernenden ortsunabhängig miteinander verband und von der sie umgebenden städtischen Gesellschaft trennte (vgl. Fisch 2015: 21). Aber auch die Vorrangstellung des Französischen geht weit zurück, wie Bischoff in seinen Schlussfolgerungen zum Fremdsprachenlernen im Mittelalter aufzeigt. „From the twelfth century on, and especially in the thirteenth century, French acquired such a position; it was highly appreciated and its study was eagerly recommended. […] Already in the twelfth century Danish nobles sent their sons to Paris so that they should become familiar with the French language and literature“ (Bischoff 1961: 210). Im 15. Jahrhundert wurden sowohl aus Bern als auch aus Basel Studierende an die Pariser Universität geschickt, auch wegen der Sprache. Anfangs des 16. Jahrhunderts weisen Korrespondenzen, wie etwa diejenige zwischen dem Glarner Heinrich Loriti in Paris und Zwingli in der Eidgenossenschaft explizit auf die Möglichkeit hin, in Paris neben dem Hochschulstudium auch die französische Sprache zu erwerben (Amman 1928). Ebenso zeigen Belege aus Nachbarländern, dass neben dem Erwerb fachlicher Kenntnisse jener einer Fremdsprache mehr und mehr an Bedeutung gewann. Beispielsweise hiess es, deutsche Studierende würden die Universität Orléans nicht nur der Ausbildung, sondern auch der Sprache wegen wählen. So hält Paul Hentzner, ein deutscher Student, in seinem Reisejournal fest: „man spricht dort ein so reines Französisch, dass ‚Orléanisch’ den gleichen Ruf hat wie in der Antike der ‚Attizismus’“ (Babeau 1970: 70). Gemäss Gyr (1989: 44) ist es unklar, wie viele eidgenössische Studenten auch wegen der Sprache nach Paris gesandt wurden, hingegen macht er deutlich, dass es sich nicht um Einzelfälle handelte; vielmehr kündigten sich in solchen Äusserungen Elemente einer neuen Sinngebung des Aufenthalts in der Fremde an, die sich im 17. und 18. Jahrhundert verstärkten.
Aber auch die Schweiz, wo es, abgesehen von Basel, noch keine universitären Angebote gab, genoss eine über die regionalen Grenzen hinausgehende Anziehungskraft. Diese war vor allem klerikaler Natur. So zogen im 16. Jahrhundert katholische Geistliche u.a. aus dem Heiligen Römischen Reich, aus Staaten1, die heute zu Italien gehören, nach Luzern, damals Teil des Landes der Eidgenossen, wo sie als Reaktion auf fortschreitende Reformationsbewegungen das Jesuitenkolleg gründeten (Studhalter 1973). Bis Mitte des 17. Jahrhunderts nahm die Zahl der Studierenden ständig zu. In der Blütezeit besuchten bis zu 600 Studenten das Kollegium oder das später gegründete Lyzeum mit den Abteilungen Theologie und Philosophie (Luzern zählte damals rund 4000 Einwohner.). Dank diesem Bildungsangebot genoss Luzern ein hohes Ansehen über die Stadtgrenzen hinaus. Mit der 1605 von Bischof Johann VI. Fluggi erlassenen Anordnung, Kinder dürften „nicht zu Andersgläubigen in die Lehre, als Dienstboten oder in die Schule“ (Mayer 1914: 380), nahm die Mobilität weiter zu. In Graubünden gab es nämlich damals nur das Kloster in Disentis und die evangelische Nikolaischule in Chur (Maissen 1957). Deswegen kamen im Jesuitenkolleg Luzern im Zeitraum 1588–1778 rund 215 Bündner Studenten in den Genuss ihrer katholischen Schulbildung (Maissen 1957: 106). Mobilität war somit erstrebenswert und sozusagen unumgänglich. Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass ihr auch in einem der „ludi autumnales“ (Herbstspiele), die sehr bedeutungsvoll waren, öffentlich aufgeführt wurden und den Übergang von einem Schuljahr zum andern markierten (Ehret 1921), ein Platz eingeräumt wurde. 1715 handelt das von der „studierende[n] Jugend dess Gymnasii der Gesellschafft Jesu zu Lucern“ verfasste Stück davon, wie Gerold aus Liebe zu Christus die Regierung trotz Widerstand des ihm gut gesinnten Adels und der ihn schätzenden Untertanen an seinen ältesten Sohn übergab, um in das „ober Teutschland“ zu reisen (Jugend dess Gymnasii der Gesellschafft Jesu zu Lucern 1715: s.p.). Aus Sicht der Jesuiten im Kollegium in Luzern – viele davon waren zwecks ihrer theologischen Studien selber mobil geworden – war bildende Mobilität positiv konnotiert und hing direkt mit Glaubensfragen und theologischer Ausbildung zusammen.
Ende des 17. und anfangs des 18. Jahrhunderts wurden junge Männer von Adel aus der heutigen Schweiz wie aus umliegenden Ländern auch zur weltlichen Bildung in die Ferne geschickt, und sie begaben sich auf die „Grand Tour“ 2 (Cohen 1992; Boutier 2006). Ihre Reise, die zwischen drei und fünf Jahren dauerte, führte sie ins Königreich Frankreich, in Regionen des heutigen Italien, ins damalige Heilige Römische Reich und in die Republik der Vereinigten Niederlande. Die Dauer ihrer Tour ermöglichte es ihnen, längere Zeit am selben Ort zu verweilen und diesen kennenzulernen. Aufenthalte in Kulturstädten wie Florenz oder Rom, Universitätsstädten wie Jena oder Rotterdam, Fürsten- und Residenzstädten wie Potsdam oder Wien, ein Besuch auf der Insel Capri oder auf Ischia, die Besichtigung antiker Ausgrabungsstätten auf Sizilien und Erholung in Aachen oder Spa gehörten für gewöhnlich dazu. Von Tutoren begleitet, die der notwendigen Sprachen mächtig waren, übten sich diese jungen Männer zwischen 14 und 20 Jahren in Fertigkeiten wie Fechten, Reiten, Tanzen und bildeten sich beim Besichtigen von Bauten und Betrachten von Gemälden kulturell weiter (Brauer 1959). Ferner wurden ihnen standesgemässe Umgangsformen beigebracht, und sie konnten sich die französische Sprache aneignen (Green 2014). Nach einer solch ausgedehnten Bildungsreise „the young man returned […] polished and accomplished, a complete gentleman“ (Cohen 1992: 242). Mit der „Grand Tour“ verband man aber mehr als das Erlangen spezifischer Fähigkeiten. Michèle Cohen (1992: 242–243) fasst zusammen, welche Vorteile ihr von Autoren der damaligen Epochen zugeschrieben wurden: Howell betonte 1640 die Bereicherung des Geistes, die Verbesserung des Urteilsvermögens, die Verfeinerung der Manieren und überhaupt die Möglichkeit, einen jungen Mann bis zur Perfektion zu formen. Gailhard war 1678 der Überzeugung, dass der junge Mann, indem er reise, die Charaktere von Männern und deren Sitten kennenlerne, was zur Folge habe, dass dieser zum geeigneten Begleiter für jedermann werde. Laut Locke ermöglichte das Reisen den Erwerb anderer Sprachen. Ausserdem unterstrich er, dass man im Allgemeinen weiser werde, wenn man sich mit verschiedenen Sitten, Manieren, Lebensweisen und Menschen auseinandersetze (vgl. Bauman & Briggs 2003). Die von verschiedenen Autoren genannten Vorteile – sie waren allesamt selbst Gereiste und Privilegierte – unterschieden sich kaum voneinander. Fechten, Reiten und Tanzen zählten zu den Kernkompetenzen eines jungen Gentleman. Sitten, Benimm und Geschmack – z.B. „to refine taste and learn to be a Connoisseur“ (Breval 1726) – waren ebenso relevant. Solche Finessen gehörten zu den “marques de distinction“ (Bourdieu 1979), deren Aneignung einem Edelmann nicht verwehrt werden durfte, die ihn auszeichneten und die er sich dank der Mobilität zu eigen machen konnte (Cohen 1992). Darüber hinaus trug die „Grand Tour“ zur Etablierung eines geistigen wie auch kulturellen Netzwerks unter den Privilegierten in Europa bei (Plaschka & Mack 1987).
Verschiedene Faktoren begünstigten die Mobilität: dass dort, wo der Bildungsreisende herkam, ihm entsprechende Bildungsinstitutionen fehlten, dass ihm der Aufenthalt in der Fremde die Möglichkeit bot, eine weitere Sprache zu lernen und dass er in den Genuss einer erwünschten Erziehung kam, die ihm einen gewissen sozialen Aufstieg versprach. Trotz dieser Vorzüge blieben die Werte der Fremdkultur als Erziehungs- und Bildungsmittel nicht unangefochten. In der damaligen Eidgenossenschaft gipfelte diese kritische Haltung in einer Empfehlung, die 1769 von der „Helvetischen Gesellschaft“ abgegeben wurde. Sie regte dazu an, nach Möglichkeit Bildungsreisen und Erziehungsaufenthalte künftig innerhalb der Landesgrenzen und nicht mehr in Frankreich zu absolvieren (Gyr 2013)3.
Unter anderem führte diese neue Bewertung der „gar Frankreich’schen Kultur“ dazu, dass innerhalb der Eidgenossenschaft eine neue Mobilitätsbewegung entstand, die mit Bildung, Erziehung und Sprache verknüpft war. Diese muss vor dem Hintergrund des breiter werdenden lokalen Bildungsangebots wie auch, im 19. Jahrhundert, vor dem der territorialen Bestrebungen betrachtet werden. So war etwa die Welschlandgängerei (Gyr 1989) verbreitet, die über eine kleine studentische Elite hinausging und sämtliche Schichten erfasste, wobei die Möglichkeit, neben der Ausbildung die französische Sprache zu erlernen, eine erhebliche Rolle spielte. So wurden sogar junge Frauen aus der Deutschschweiz – Frauen waren bis ins späte 19. Jahrhundert mehrheitlich immobil – in die Westschweiz geschickt. Dabei handelte es sich anfangs um Töchter aus bürgerlichen Kreisen, gegen Ende des 19. Jahrhunderts aber auch um Mädchen aus dem bäuerlichen Milieu. Letztere dienten vorwiegend als Volontärinnen im Haushalt oder im Dienstbotenwesen.
Die zunehmende Entwicklung der Nationalstaaten, welche es notwendig machte, dem Staat zudienende Spitzenbeamten an eigenen Universitäten auszubilden, grenzte die Möglichkeiten zur studentischen Mobilität über Landesgrenzen hinweg zusätzlich ein (Rüegg 2010). Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden Massnahmen ergriffen, um an die „alten Formen“ der Mobilität anzuschliessen (Heinemann & Krametz 2008). Seit den 80