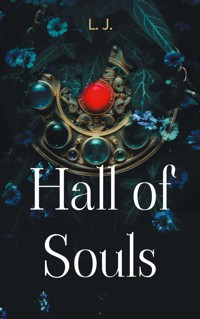9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Doctor Who Romane
- Sprache: Deutsch
Das Aerodrom in Culverton hat die Besitzer gewechselt, und diese versprechen dem kleinen idyllischen Dorf neuen Wohlstand. Aber der ehemalige Spitfire-Pilot Alex Whistler ist misstrauisch, und als schwarz gekleidete Truppen auf den Straßen erscheinen, kontaktiert er seinen alten Freund Brigadier Lethbridge-Stewart von U.N.I.T. Dieser sendet den Doktor nach Culverton, um die Angelegenheit zu untersuchen. Bald schon kommt er einer unheimlichen Verschwörung auf die Spur: Der Erde droht eine gnadenlose Invasion ...
Der erste Roman um den 3. Doctor auf Deutsch - einer der beliebtesten Doktoren der BBC-Erfolgsserie, gespielt von Jon Pertwee
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumEinleitungZitatPrologKapitel einsKapitel zweiKapitel dreiKapitel vierKapitel fünfKapitel sechsKapitel siebenKapitel achtKapitel neunKapitel zehnKapitel elfKapitel zwölfKapitel dreizehnKapitel vierzehnKapitel fünfzehnKapitel sechzehnKapitel siebzehnKapitel achtzehnKapitel neunzehnKapitel zwanzigKapitel einundzwanzigKapitel zweiundzwanzigKapitel dreiundzwanzigKapitel vierundzwanzigKapitel fünfundzwanzigKapitel sechsundzwanzigKapitel siebenundzwanzigKapitel achtundzwanzigKapitel neunundzwanzigKapitel dreißigKapitel einunddreißigKapitel zweiunddreißigKapitel dreiunddreißigKapitel vierunddreißigKapitel fünfunddreißigÜber dieses Buch
Das Aerodrom in Culverton hat die Besitzer gewechselt, und diese versprechen dem kleinen idyllischen Dorf neuen Wohlstand. Aber der ehemalige Spitfire-Pilot Alex Whistler ist misstrauisch, und als schwarz gekleidete Truppen auf den Straßen erscheinen, kontaktiert er seinen alten Freund Brigadier Lethbridge-Stewart von U.N.I.T. Dieser sendet den Doktor nach Culverton, um die Angelegenheit zu untersuchen. Bald schon kommt er einer unheimlichen Verschwörung auf die Spur: Der Erde droht eine gnadenlose Invasion … Der erste Roman um den 3. Doctor auf Deutsch – einer der beliebtesten Doktoren der BBC-Erfolgsserie, gespielt von Jon Pertwee.
Über den Autor
Mark Gatiss ist ein britischer Schauspieler, Komiker und Autor. Im deutschsprachigen Raum ist er hauptsächlich durch die BBC-Serie Sherlock bekannt geworden, für die er zusammen mit Steven Moffat das Konzept entwickelte, mehrere Episoden schrieb und in der er als Mycroft Holmes zu sehen ist. Seit 2014 hat er auch Gastauftritte in Game of Thrones. Als Autor hat er mehrere Kriminalromane mit dem Gentlemen-Ermittler Lucifer Box verfasst. Für Doctor Who ist er seit vielen Jahren als Autor und Schauspieler tätig.
Mark Gatiss
DOCTORWHO
DER NEUNTESCHLÜSSEL
Aus dem Englischen vonThomas Schichtel
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2000, 2013 by Mark Gatiss
Titel der englischen Originalausgabe: »Doctor Who – Last of the Gaderene«
First published in 2000 by BBC Worldwide Ltd and 2013 by Books.BBC Books is a part of the Penguin Random House Group of Companies
Doctor Who is a BBC Wales production for BBC OneExecutive producers: Steven Moffat and Brian Minchin
BBC, DOCTOR WHO and TARDIS (word marks, logos and devices) are trademarksof the British Broad-casting Corporation and are used under licence.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Stefan Bauer
Textredaktion: Dr. Frank Weinreich, Bochum
Umschlaggestaltung:
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5600-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Einleitung
Das vorliegende Buch wurde ursprünglich 2000 veröffentlicht. (Oder im Jahr 2000, wie es in meiner Jugend hieß. Möglicherweise sogar dem Weltraumjahr 2000. Oder habe ich mir das nur eingebildet?) Ich hatte eine kurze Einleitung geschrieben, und sie lautete wie folgt:
Nach wie vor ist es möglich, manche von uns, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, in eine magische Kindheit zurückzuführen, in der alle Nächte winterlich und dunkel schienen, die Fußballergebnisse niemals endeten und Doctor Who die beste Sendung im Fernsehen war. Man braucht dazu nicht mehr zu tun, als die schlichten Worte zu murmeln: »Weißt du noch, die Folge mit den Riesenmaden?« Es hätte keinen Sinn, wenn man erklären wollte, was die Serie uns damals bedeutete; es reicht, zu sagen, dass sie die große Konstante in unserem kleinen Leben war: der heldenhafte Doktor, Jo Grant, die leicht moralisierenden Geschichten, die fantastischen Monster, die Stunts von HAVOC. Und in der Ewigkeit zwischen den Staffeln hatten wir wenigstens die Bücher von Target. Sie boten uns aufregende Versionen von Geschichten, die wir gesehen hatten, und Einblicke in eine seltsame und geheimnisvolle Vergangenheit, als der Doktor noch jemand anderes gewesen war. Wann immer ich nicht zur Schule gehen konnte, war Planet of the Daleks meine Lieblingsmedizin (vielleicht neben Ochsenschwanzsuppe). Das Buch entführte mich Lichtjahre weit aus meinen vier Wänden, hinaus in das Universum des Doktors. Was für ein Trost und welch echte Inspirationsquelle diese Bücher doch waren! Übrigens finde ich, dass ich auf eines hinweisen muss: Das Cover des vorliegenden Buches zeigt den Dritten Doktor, dessen körperliche Erscheinung von den Time Lords verändert wurde, als sie ihn auf die Erde des zwanzigsten Jahrhunderts verbannten.
Wenn ich also darf, so möchte ich dieses Buch jener glücklichen Zeit und zwei Männern widmen: Terrance Dicks und dem verstorbenen, großen Jon Pertwee, zum Dank für all diese Samstagabende.
Was ich auf keinen Fall vorhersehen konnte (jedenfalls nicht ohne Raum-Zeit-Visualisierer): Nur wenige Jahre nach Veröffentlichung von Last of the Gaderene kehrte Doctor Who triumphal auf unsere Bildschirme zurück und fand sofort ein »Familienpublikum«, das man schon lange ausgestorben geglaubt hatte. Nicht nur das. Ich konnte außerdem dafür schreiben und sogar darin auftreten! Wenn ich sagen würde, das seien wahr gewordene Träume, so drückte ich es noch zurückhaltend aus.
Der unglaubliche Erfolg der neuen Serie führte zu frischem Interesse an ihrer Vergangenheit und zu einem Phänomen, das jenen von uns, die mit Typhoo-Tee-Schautafeln und Weetabix-Dioramen aufwuchsen, stets versagt geblieben war: richtigem Spielzeug. Inzwischen bin ich 45 Jahre alt. Ich brauche keine Zygonen-Figur, keinen K1-Roboter oder irgendeine Variation der Daleks. Welchen Platz sollen drei verschiedene Versionen von Jon Pertwee in meinem nicht-transzendental-dimensionalen Heim schon finden? Aber, wie man so schön sagt, Widerstand ist zwecklos.
All diese schönen Cybermen! Eine Hartnell-TARDIS, die dieses Entmaterialisierungsgeräusch erzeugt! Omega – komplett mit dem schicken Umhang (obwohl ich mir wünschte, man könnte seinen Helm aufklappen und damit offenlegen, dass nichts von ihm übrig ist). Und ist es nicht eine Schande, dass auf der Schachtel mit der Actionfigur des Letzten Osirianers nicht steht: »Spielzeug Sutekhs«? Ich habe umfassend meiner Nostalgie nachgegeben, und manchmal ist das völlig in Ordnung.
Was jedoch wirklich wundervoll ist: Dieses ganze Zeug, die Bücher, Hörspiele, Spielsachen, gehören zu einer nach wie vor laufenden Geschichte fantastischer Weltflucht. Einer brandneuen, lebendigen Fernsehserie, von der Zuschauer aller Altersgruppen in kommenden Jahren nostalgisch schwärmen werden. In diesem Geiste muss meine erneuerte Widmung dem Mann gelten, dessen unglaubliche Energie und Vorstellungskraft und dessen schierer Enthusiasmus uns den Doktor zurückgegeben haben: Russell T. Davies. Für all diese neuen Samstagabende.
Mark Gatiss
Oktober 2012
Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt: Verlass diesen Mann, du unreiner Geist! Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Mein Name ist Legion; denn wir sind viele.
Markus 5:8, 9
Prolog
Die Augen der Frau waren so braun wie das Bakelit-Radio, das hinter ihrem Kopf im Regal stand.
Das Lied, das aus dem Radio ertönte, war gedämpft und knisterte, als wäre die Sängerin weit entfernt. Trotzdem klang die Stimme gleichzeitig sowohl süß als auch wehmütig und schmerzlich melancholisch. Blaue Vögel würden über den weißen Klippen von Dover fliegen, versprach die Sängerin, und ihre mitreißenden Klänge spülten über das Publikum in der gedrängt vollen Kneipe hinweg.
Ein stämmiger junger Mann mit ordentlich geschnittenem Schnurrbart lehnte an der Theke, in seinen lebhaften Augen funkelte gute Laune.
Er verfolgte, wie die Frau sich im Raum umschaute, bei dem es sich im Wesentlichen um einen riesigen verwischten Fleck aus blauer Serge handelte. Sie hob ihren Rock ein Stück weit an und zupfte an einem Strumpf, achtete aber darauf, dass die übrigen Männer ringsum, deren Gesichter von Hochstimmung und zu viel Bier gerötet waren, es nicht sahen. Derartiges war nur für den stämmigen jungen Mann gedacht.
Dieser Mann schob die Offiziersmütze nach hinten, zwängte sich durch die Menge und hielt dabei mit knapper Not vier Pints Bitter fest in den Händen. Qualm aus seiner Pfeife schlängelte sich ihm ums Gesicht. Er schob sie zwischen zusammengebissenen Zähnen von einer Seite auf die andere und navigierte vorsichtig zwischen seinen Luftwaffenkameraden hindurch zu einem mit rotem Leder gepolsterten Sitz.
Die schlanke und ziemlich schöne Frau sah ihn näher kommen, und ein erfreutes Lächeln hellte die Miene ihres runden Gesichts auf. Er spürte einen leichten Kitzel der Freude. Vielleicht würde er ihr jetzt die Frage stellen. Er hatte nichts zu verlieren. Und so viel zu gewinnen. In seiner Vorstellung sah er sie beide von jeher Arm in Arm über eine sonnige Lichtung schlendern, nicht eingezwängt hinter einem kleinen Tisch in einer Kneipe sitzen. Der Krieg sorgte jedoch dafür, dass alles so viel mehr drängte.
Der junge Flieger schob zwei der Pints über den Tisch hinweg zu seinen Freunden und setzte sich dann neben die Frau und gab ihr auch ein Glas. Sie dankte ihm und nahm einen Schluck vom schäumenden Bier.
»Bist du sicher, dass du ein Bier wolltest?«, fragte er und nahm die Pfeife aus dem Mund.
Sie nickte und strich sich eine verirrte Strähne langer kastanienbrauner Haare aus den Augen.
Er rieb nervös sein Kinn und überlegte, wie er seine Frage am besten formulierte.
Der Krieg hatte sie aufeinander zugestoßen – fast wortwörtlich. Eine Brandbombe war direkt vor dem Schutzraum eingeschlagen, in dem er sich versteckte, und die junge Frau stürmte gerade noch rechtzeitig hinein. Schweiß stand ihr auf der Stirn, und aus ihren hellen Augen leuchtete die Angst. Beim Anblick des jungen Mannes entrang sich ihr jedoch ein breites Lächeln.
Er betrachtete das Pint Bier, das vor ihm auf dem Tisch stand. »Na, ich vermute mal, wenn du meine Frau werden möchtest, wirst du dich an dieses Zeug gewöhnen müssen.«
Ihre hübschen Augen hatten sich in Halbmonde verwandelt, als sie lächelte und dann von ihrem Pint trank. Jetzt erstickte sie beinahe an dem Bier. Sie drehte sich auf ihrem Platz herum.
»Was hast du gesagt?«
Er tat unschuldig. »Wann?«
»Gerade eben.«
»Oh.« Er nahm einen tiefen Schluck von seinem Pint. »Du meinst, von wegen dich heiraten?«
Sie wirkte auf einmal verletzlich und furchtbar hübsch. Er beugte sich vor und küsste sie.
»Oh Alec …«, nuschelte sie. Eine Weile später wich sie zurück und lächelte glücklich. »Okay, Mister. Ich werde dich heiraten.«
»Gute Show!«, lachte der Flieger.
»Unter einer Bedingung.«
Er runzelte die Stirn. »Oh?«
Sie umfasste sein Gesicht mit den Händen und lächelte ein bisschen traurig. »Sieh zu, dass du das alles lebend überstehst, ja?«
Er nickte strahlend und umarmte sie. Er schaute sich in der Kneipe um und betrachtete die von Rauch geschwärzte Decke, wo Männer ihre Namen und ihre Staffelnummern mit Kerzen eingebrannt hatten. Sein Blick glitt weiter über die Knäuel aus jungen Fliegern in ihren blauen Uniformen und den Mief aus Rauch und Gelächter. Er dachte an die Nächte, die er und das Mädchen seit der ersten Begegnung im Luftschutzraum zusammen verbracht hatten. Ihr komisches Lachen. Das eine Mal, dass er mit dem Flugzeug über die Fabrik geflogen war, in der sie arbeitete, und dabei einen Looping gedreht hatte, nur um seine Liebste zu beeindrucken.
Er hob ihre Hand von ihrem Knie, drückte sie und hielt sie sich dann zärtlich an die eigene Wange.
Da drang aus der Ferne ein leises rumpelndes Dröhnen heran.
Seine Sinne waren sofort hellwach. Er warf sich herum und blickte zur Decke hinauf, wobei er die Hand des Mädchens festhielt. Einige wenige andere Flieger hatten das Geräusch auch gehört.
Er öffnete den Mund, wollte etwas sagen, dem wundervollen Mädchen an seiner Seite zurufen, sie solle sich sofort zu Boden werfen. Oder um ihr Leben laufen. Das Geräusch war eine V1-Rakete der Deutschen. Musste eine sein. Auch wenn es irgendwie anders klang, mehr so ein stotterndes, betäubendes Tosen war. Dann brach das Geräusch ab, und es kehrte Stille ein.
Einen Augenblick später explodierte der Raum zu weißem Nichts.
Es war einige Tage später, als sich der junge Mann dabei wiederfand, wie er über das verwüstete Gelände schritt, wo die Kneipe gestanden hatte. Weiche Baumwollpflaster deckten die schweren Verbrennungen auf seiner Wange ab, und seinen schmerzenden Arm trug er in der Schlinge. Er hatte Glück gehabt.
Das schöne Mädchen mit Augen wie Alice Fey; das Mädchen, mit dem er einmal im Pally getanzt hatte; das Mädchen, um dessen Hand er angehalten hatte; sie hatte kein Glück gehabt.
Der junge Mann in der blauen Offiziersuniform setzte die Mütze ab und klemmte sie sich unter den unverletzten Arm. Vor ihm der Erdboden war kaum mehr als ein geschwärztes Loch und der Schlamm zu einem weiten Krater aufgeworfen worden. Entlang des Randes lagen verstreut diverse Überreste – Glas, Stuhlbeine, sogar die Handtasche eines Mädchens.
Der junge Mann blickte auf, als mit pochendem Dröhnen eine Staffel Jagdflugzeuge vorbeiflog.
Er würde diesen Krieg überleben. Für das Mädchen.
Etwas zog seinen Blick an. Es zeichnete sich ebenso auffällig wie unpassend auf der schwarzen Erde ab, wie ein Haifischzahn in einer Portion Kaviar.
Er bückte sich und hob es auf. Das Ding war etwas über sieben Zentimeter lang, jadefarben und kristallin. Es schien auf seiner rötlichen Handfläche zu leuchten.
Er runzelte die Stirn und steckte sich den Gegenstand in die Jackentasche, drehte sich auf den Fersen um und schritt auf das Tor des Flughafens zu, während ihm das Dröhnen der Spitfire-Motoren noch in den Ohren klang.
Tief in der Erde rührte sich etwas, versteckt im flachgedrückten Schlamm.
Kapitel eins
Wetterleuchten
Ein Marienkäfer fiel vom klaren blauen Himmel und landete auf Jobey Packers Hand; klar wie ein Blutstropfen hob er sich von seiner Haut ab.
Er unterbrach die Arbeit, und statt den Käfer wegzuschnippen, sah er zu, wie dieser langsam über seine Knöchel zottelte. Die kitzlige Empfindung war ganz angenehm, entschied er.
Der Marienkäfer breitete die Flügel aus und war einen Augenblick später verschwunden.
Jobey lächelte vor sich hin und legte den Kopf in den Nacken, um die gewaltige Ausdehnung des Himmels in sich aufzunehmen. Draußen, weit außerhalb des Dorfs, beherrschte der Himmel alles wie eine riesige Leinwand, die sich leicht vom schmalen Streifen Erde lösen ließe. Brachvögel zogen dort oben flatternd ihre Bahn – dunkle Flecken vor dem Hintergrund aus perfektem Blau. Jobey schloss die Augen und lauschte ihren traurigen Rufen, die in der Wärme des Sommernachmittags dumpf klangen.
Das Land breitete sich unterm Himmel wie ein Strich trüber Wasserfarbe aus, hier und dort mit stummeligen Bäumen und den glänzenden Spiegeln der Binnengewässer gesprenkelt.
Jobey nahm den Kopf noch weiter in den Nacken, bis ihm beinahe der Strohhut hinunterfiel. Dessen engmaschiges Gewebe löste sich allmählich auf und legte die sich abschälende rote Haut auf Jobeys sonnengebräunter Stirn frei. Vielleicht gönnte er sich eines schönen Tages mal einen neuen Hut. Er ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen.
Er hatte sich nie versucht gefühlt, aus Culverton wegzuziehen, obwohl er anderswo viel Leben mitbekommen hatte. Selbst in der ausgedörrten Wüste vor Alexandria, unter den Sternen, wo einst die Pharaonen über die Erde geschritten waren, hatte er stets von seinem kleinen Dorf geträumt. Sicher, geborgen, immer gleich bleibend. So alt wie die Höhen – außer dass man in Culverton natürlich keine Anhöhen fand. Es gab nicht eine einzige nennenswerte Erhebung in seinem ganzen geliebten East Anglia. Nur Land und Himmel.
Land und Himmel.
Nirgendwo sonst schien es genauso auszusehen.
Jobey war vor vielen Jahren mal in London gewesen, im dichten Gedränge unzähliger tausender Menschen, als der König und Mr Churchill auf dem Balkon des Palastes erschienen und das Ende der Feindseligkeiten verkündeten. Er hatte natürlich nicht weniger als alle anderen gejubelt und geweint, aber nach ein paar Tagen in der Hauptstadt sehnte er sich regelrecht danach, nach Hause zurückzukehren. London war ein solch fieses, schmutziges Labyrinth. Alle hatten es so furchtbar eilig. Niemand fand Zeit für ein »Guten Morgen« oder »Wie geht es Ihnen?«. Ganz anders als in Culverton.
Als kleiner Junge hatte Jobey der Gewohnheit gefrönt, nur dazustehen und mit den Armen zu rudern, einfach um die Leere am besten zu nutzen. Manchmal tat er das immer noch, wenn niemand hinsah.
Er schirmte die Augen ab, während er jetzt über das morastige Ackerland hinwegblickte. Da war die Grünfläche mit der alten Pumpe, die Postfiliale mit der einsinkenden Wand, das Sammelsurium aus Cottages und Häusern, die sich um die rostbraune Kirche drängten, als suchten sie dort Schutz. Die Luft summte von Insekten und dem klagenden Lied der fortwährend kreisenden Vögel. Jobey seufzte zufrieden und wandte sich wieder seiner Arbeit zu.
Er hob den Hammer und trieb mit ein paar kurzen Schlägen Nägel in das Schild. Es am Gatter vor ihm zu befestigen, hatte ihn den größten Teil des Vormittags beschäftigt. Jobey unterbrach die Arbeit und schüttelte den Kopf. Da kamen ihm eben noch fast die Tränen bei der Vorstellung, dass sich Culverton niemals änderte, und doch starrte ihm hier der Wandel ins Gesicht. Das Ende einer Epoche. Er trat einen Schritt weit zurück, um sein Werk zu betrachten. Auf dem weißen Schild funkelte ihm rote Schrift anschuldigend entgegen.
Culverton-Flughafen geschlossen
Das Ministerium der Verteidigung
Commander Harold Tyrell hatte entschieden, dass es an der Zeit war, Lebewohl zu sagen.
Mit seinem zerknitterten Gesicht und dem ansteckenden Lachen war dieser große Bär von einem Mann im ganzen Dorf beliebt gewesen, solange er den Flugplatz geleitet hatte. Er hatte die Anlage durch manche ihrer Sternstunden geführt. Jedenfalls nach dem Krieg.
Da war die prachtvolle Flugshow anlässlich der Krönung zu nennen. Und dann der dramatische Rettungseinsatz, den Tyrell persönlich koordinierte und in dessen Verlauf er Frachtmaschinen zur Unterstützung eines havarierten Tankers vor der Küste schickte. Wann war das gewesen? ’64? ’65?
Der Commander seufzte und fuhr mit dem Finger über den großen Eichentisch in der Leitstelle. Ein breiter brauner Streifen blieb im Staub zurück. Tyrell blickte sich in dem Raum um, den er so gut kannte. Das fleckige, teilweise verschlagene Aussichtsfenster; die Radarmonitore, das Modell eines Wellington-Bombers. Das hob er auf und drückte es sich an die Brust. Er hatte es bis ganz zum Schluss übriggelassen, weil es ihm am meisten bedeutete.
Er war seit jeher ein regelmäßiger Kirchgänger, und ihm ging wie eine Endlosschleife immer wieder sein liebstes Kirchenlied durch den Kopf: »Wandel und Verfall in allem, was ich sehe …«
Er kniff die Augen zusammen, während er zu dem breiten, gebogenen Fenster hinausblickte. Das hereinfallende Sonnenlicht erzeugte auf dem alten Teppich ein weitgefächertes Farbspektrum.
Da draußen war jemand und überquerte raschen Schritts den rissigen Asphalt der Startbahn.
Tyrell runzelte die Stirn. Das war seltsam. Und recht ärgerlich. Er hatte einigen Aufwand betrieben, um zu gewährleisten, dass er an seinem abschließenden Arbeitstag auf dem geliebten alten Flugplatz allein war. Mehr als alles andere wollte er wirklich vermeiden, dass er irgendeinen Rowdy mit einer ordentlichen Standpauke vom Gelände weisen musste, ehe er das Tor zum letzten Mal abschloss.
Er seufzte mürrisch und nahm Kurs auf die Tür, blieb dann jedoch plötzlich stehen.
Schritte kamen draußen die Treppe herauf. Wer immer das war, er besaß die Unverfrorenheit, sich schnurstracks zu ihm zu begeben. Es sei denn natürlich, es ging um eine dringliche Meldung. Vielleicht war seine Frau erkrankt. Sie hatte die Schließung des Flugplatzes fast so schlecht aufgenommen wie er.
Tyrell war auf einmal besorgt und streckte die Hand nach dem Türgriff aus, doch die Tür ging auf, ehe er ihn zu fassen bekam.
Jobey fand es traurig, dass die alte Anlage geschlossen wurde. Aber natürlich waren alle traurig.
Er stieg über seine Werkzeugtasche und blickte forschend durch das rautenförmige Gewebe des Maschendrahtzauns.
Die Startbahn erstreckte sich vor ihm, längst rissig und voller Unkraut, zu beiden Seiten gesäumt von den Parabolantennen in Fertigbauweise, die ihrerseits von langem Gras belagert wurden. Der große Tower ragte gleich neben dem Asphalt auf, über dem Hitzeschleier schwindelerregend waberten.
Jobey konnte sich die Anlage immer noch so vorstellen, wie sie früher gewesen war: voller Flugzeuge, deren Triebwerke vor Kraft surrten, während Gruppen junger Flieger in Lederjacken ringsherum auf Feldstühlen saßen und darauf warteten, zu ihren Maschinen zu stürmen.
Jobey schüttelte den Kopf. Diese Tage waren vorbei. Und man bezahlte ihn nicht dafür, untätig herumzustehen.
Irgendwo, nicht besonders weit entfernt, hörte er jemanden rufen.
Jobey spannte sich an, aber die Rufe brachen ab.
Ungeachtet der Hitze schauderte ihn, und er bückte sich, um seine alte marineblaue Werkzeugtasche aufzuheben. Er nahm sich vor, auf ein halbes Pint im Pub vorbeizuschauen, nur um sich zu vergewissern, dass alles sonst genauso war, wie es sein sollte. Er rückte sich den Strohhut zurecht, richtete sich auf, schnupperte die Luft und machte sich dann auf den Weg zum Dorf, wobei seine genagelten Schuhe laut auf der Straße hallten. Er hörte die Grillen im Gras leise zirpen und das träge Summen einer dicken Hummel, die von Blüte zu Blüte schwebte.
Am Horizont leuchtete auf einmal ein weißer Blitz auf. Jobey blinzelte und hatte trotzdem ein deutliches Nachbild des Phänomens auf den Netzhäuten. Wetterleuchten, dachte er und wartete auf den begleitenden Donnerschlag. Der kam nicht.
Jobey schüttelte die nostalgische Stimmung ab und lächelte breit. Es war ein guter Tag, um zu leben, auch wenn er allein diesem alten ausgetrockneten Weg folgte.
Jobey war jedoch nicht ganz allein. Er begegnete unterwegs jemandem. Jemandem, der nicht hätte hier sein dürfen. Jemandem mit dunklen Augen und einem wirklich breiten Lächeln. Jobeys Schreckensschrei verjagte die Stille des Sommernachmittags, aber niemand hörte den Laut inmitten der melancholischen Rufe der Brachvögel.
Jo Grant stieß einen kurzen Schrei aus, als ein dunkler Schatten über sie strich. Sie hatte erwartet, ungestört zu bleiben, während sie ausgestreckt auf einer grell gemusterten Sonnenliege auf dem Flachdach eines Nebengebäudes des Hauptquartiers von UNIT lag und sich verzweifelt um eine tiefere Bräunung bemühte. Ihrem einwöchigen Urlaub hatte es auf deprimierende Weise an Sonnenschein gemangelt, und sie hatte in dieser Zeit meistens drei Tage alte Zeitungen gelesen, die Großbritanniens Rekordhitzewelle priesen.
Die kleine und sehr hübsche Jo schob sich die große, runde, grün eingefärbte Sonnenbrille auf die Stirn hoch, schirmte die Augen ab und kniff sie zusammen. Ein Mann ragte als massive schwarze Silhouette vor der grellen Sonnenscheibe über ihr auf. Verlegen deckte Jo die Brust ab, um ihren spärlichen rosa Bikini zu unterstützen.
»Verzeihung, Miss«, sagte eine vertraute Stimme, »ich wollte Sie nicht erschrecken.«
Jo seufzte erleichtert. »Oh, Sie sind es, Sergeant Benton«, sagte sie und schenkte ihm ein gewinnendes Lächeln. »Gott sei Dank!«
»Wen hatten Sie denn erwartet?«, fragte Benton und trat an ihre Seite. Ein Stirnrunzeln legte sein großes, gut gelauntes Gesicht in Falten.
»Niemanden«, antwortete Jo. »Niemand Besonderen. Man weiß halt nur nie, was sich hier so alles herumtreibt.«
»Vielen Dank auch!«, lachte Benton mit gespielter Entrüstung. »Ich weiß nicht recht, ob es mir gefällt, als Rumtreiber betrachtet zu werden.«
»Sie wissen schon, was ich meine.« Jo hob einen Finger und zog die Sonnenbrille wieder vor die Augen. »Entweder hat man es mit einem schleimigen Monster zu tun oder …«
»Oder?«
»Oder mit dem Brigadier, wie er hier rumstreicht.«
Benton senkte eine breite Hand und schob ihr die Sonnenbrille wieder nach oben. »Beim zweiten Mal richtig geraten. Der Brig möchte Sie sehen.«
Jo verzog das Gesicht und schwenkte seufzend die Beine von der Sonnenliege. »Er kann nicht behaupten, dass ich nicht versucht hätte, ihn zu treffen. Mein Name steht im Protokoll. Als ich hier eintraf, war aber niemand zu finden.«
Sie streifte sich ein leichtes Sommerkleid über, während sie beide über das heiße Dach gingen. »Und ich habe offiziell sowieso noch Urlaub.«
Sie ging mit raschen Schritten auf Zehenspitzen, denn der glühend heiße Asphalt fühlte sich unter ihren Füßen an, wie sie es von einem spanischen Strand erwartet hätte.
»Der Brigadier war auch unterwegs, Miss«, sagte Benton und half Jo auf die Metallleiter, die an der Flanke des Gebäudes hinaufführte.
»Wohin ging es?«
Benton zuckte die Achseln. »Mit Bestimmtheit weiß ich nur, dass er heute ein sehr strenges Regiment führt.«
Jo ächzte leise und machte sich an den Abstieg. Das Metall fühlte sich warm an, und sein heißer Rostgestank erinnerte sie an Schulspielplätze. Benton stieg rasch hinab, und seine schweren Armeestiefel klatschten auf den Asphalt, als er am Boden eintraf.
»Wo ist der Doktor?«, fragte Jo.
Benton lachte leise und humorlos. »Die Erklärung überlasse ich dem Brigadier«, sagte er, blinzelte ihr hintersinnig zu und entfernte sich in die entgegengesetzte Richtung.
Jo runzelte die Stirn, drückte die Doppelflügeltür auf und betrat das Gebäude.
Sie blinzelte mehrfach; im Kontrast zur Helligkeit draußen kam es ihr hier drin unnatürlich dunkel vor. Der Springbrunnen und die Telefonzelle mit dem blasenförmigen Dach ragten vor ihr auf, umhüllt von Dunkelheit. Nach einer Weile gewöhnte sie sich an die Lichtverhältnisse und fand den Weg zum Labor des Doktors.
Jo schob die Tür auf und schaute sich um, während sich die Tür wieder schloss. Es war erstickend heiß und still hier. Die Laborbank mit den Bunsenbrennern, die Waschbecken und Wasserhähne waren an vertrauter Stelle zu sehen, ebenso der Kleiderständer, an dem der Doktor stets seinen Umhang aufhängte. Drei Hocker waren in einer Ecke zu einem ordentlichen Dreieck zusammengeschoben worden.
Jo hörte einen klopfenden, summenden Laut in der Nähe. Eine Schmeißfliege rammte immer wieder gegen das Fenster, und Jo durchquerte rasch den Raum, um ihr den Weg freizumachen. Warme Luft strömte herein, als sie das Fenster öffnete, aber die Fliege setzte ihre sinnlosen Angriffe auf die Scheibe fort.
»Nun flieg schon raus, du dummes Ding!«, rief Jo gereizt.
Als sie zu einem weiteren Fenster ging, um es ebenfalls zu öffnen, blieb sie stehen. Irgendwas stimmte hier nicht. Die Hocker waren zu ordentlich arrangiert. Der Kleiderständer war leer. Die Laborbank, die normalerweise mit den komplizierten elektronischen Bastelarbeiten des Doktors übersät war, hatte jemand sauber gewischt. Und in der Ecke, wo immer die ramponierte blaue TARDIS stand, war nichts zu sehen.
Die leere Stelle gähnte sie an wie das staubige Rechteck, das zurückbleibt, wenn man ein Bild von der Wand nimmt. Als die Tür hinter ihr geöffnet wurde, blinzelte Jo langsam und drehte sich um.
Dort stand Brigadier Lethbridge-Stewart, der sich bei dieser Hitze in der Uniform augenscheinlich nicht wohlfühlte. Schweiß glänzte in seinem Gesicht. Er blickte Jo in die Augen und senkte den Blick dann zu Boden.
»Das ist richtig, Miss Grant«, sagte er rundheraus. »Er ist fort.«
Kapitel zwei
Unerlaubt abwesend
Ein sich zersetzender Kondensstreifen hatte eine breite, dünne Spur auf dem kobaltblauen Himmel zurückgelassen. Alec Whistler, DSO, ehemals Wing Commander der Royal Air Force, öffnete ein wässriges Auge und starrte abfällig auf diese Erscheinung am Himmel. Er war ein kleiner, gepflegt aussehender Herr in den Sechzigern, der es sich im Garten seines Häuschens in einem Liegestuhl bequem gemacht hatte. Er döste in der Hitze des Nachmittags, ein dickes Buch lag auf der senffarbenen Weste und erinnerte an die Flügel eines Schmetterlings.
Er klappte das Auge zu und schniefte vor sich hin, während er die warme Brise genoss, die ihm die lockigen grauen Haare und den ordentlich gebügelten Sommerblazer zauste. Das Gesicht war stark sonnengebräunt, abgesehen von einer komplett vernarbten Wange, die stets weiß wie Aspirin blieb.
Ein weiterer Jet entschied sich für diesen Augenblick, um dem Echo eines fernen Donnerschlages gleich über den Himmel zu dröhnen. Whistler richtete sich zackig auf, wobei ihm Entrüstung aus den glänzenden grünen Augen leuchtete. »Zum Teufel mit diesen Dingern!«, brüllte er, ohne sich an jemand Besonderen zu wenden. »Kann man nicht mal einen Moment lang seine Ruhe haben?«
Eine weichere, lieblichere Stimme trieb zur Antwort durch den Garten.
»Aber, aber, Sir. Nicht nötig, sich aufzuregen. Sie waren zu Ihrer Zeit genauso schlimm.«
Whistler lächelte vor sich hin, als die angenehm rundliche Gestalt seiner Haushälterin Mrs Toovey ins Blickfeld trat. Sie trug ein Tablett mit Tee und Gebäck. »Das war etwas anderes«, grummelte er. »Wir hatten damals Krieg, wissen Sie noch?«
»Ich weiß noch«, sagte Mrs Toovey sanft.
Sie stellte das Tablett auf einem Tisch neben dem Wing Commander ab und schenkte Tee ein. Whistler sah ihr mit stiller Zufriedenheit zu und erfreute sich an der satten Orangefarbe des Getränks und dem diffusen Sonnenlicht, das durch das feine Porzellan der Tassen fiel.
Whistler schlürfte seinen Tee und warf erneut einen gehässigen Blick zum Himmel hinauf, wo die Düsenstrahlen ein Gitternetz aus Wolken erzeugt hatten. Keine zehn Pferde würden ihn in eines dieser modernen Dinger zerren. Er hatte sie natürlich schon aus der Nähe gesehen. Recht schnell, recht hübsch. Aber kein Vergleich zu den Kisten, die er in den Vierzigern geflogen hatte. Bei Gott, damals hatte man sich wirklich darauf verstanden, Flugzeuge zu konstruieren! Er ließ den Blick durch den Garten schweifen.
Der war weitläufig und schön gepflegt, und ein großes verschlossenes Tor am hinteren Ende führte direkt auf eines der Sträßchen von Culverton. Dicht am Tor bedeckte eine ausladende Plane einen Großteil des Bodens unterhalb eines Bestands von Linden. Whistler bedachte sie mit einem leisen Lächeln und drehte sich um, als Mrs Toovey erneut zu sprechen anhob.
»Heute ist es also so weit«, sagte sie seufzend.
»Hm?«
Mrs Toovey zeigte ein trauriges Lächeln, das die Winkel ihrer Eichhörnchenaugen in Falten legte.
»Der Flugplatz, Sir. Er wird heute offiziell geschlossen.«
Whistler stellte die Tasse auf dem Tisch ab und zuckte die Achseln. »Ach ja? Wirklich heute?«
Mrs Toovey warf ihm einen mahnenden Blick zu. »Als ob Sie sich daran nicht erinnerten, Wing Commander! Hier zu sitzen und so zu tun, als wären Sie nicht nervös deswegen, wo es Ihnen doch seit sechs Monaten mit der Regelmäßigkeit von Big Ben den Blutdruck in die Höhe treibt!«
Whistler brummte missbilligend und fummelte an einem Knopf seiner Weste herum. »Kann nicht behaupten, dass es mir heute noch was ausmacht. Das Land geht zum Teufel, und damit basta.«
Mrs Toovey lächelte vor sich hin. »Max Bishop sagt, morgen früh werde eine Bekanntmachung erfolgen.«
»Wer?«
»Max Bishop. Von der Post. Er sagt, einige Leute seien eingetroffen und wollten, dass sich morgen früh um zehn alle Bürger im Gemeindesaal einfinden.«
Whistler, der nicht viel von Max Bishop hielt, blickte sich um und runzelte die Stirn. »Was meinen Sie mit einer ›Bekanntmachung‹?«
»Was ich sage«, brummte Mrs Toovey und zog ein zerknittertes Taschentuch aus dem Ärmel ihrer Strickjacke. Sie nieste auf einmal. »Uuh!«, sagte sie und tupfte sich die Nase ab. »Vermaledeiter Heuschnupfen. Gibt nichts Schlimmeres.«
Whistler räusperte sich. »Ich dachte, alles wäre entschieden. Einsparungen bei der Verteidigung heißt, Flugplatz eingemottet. Haben es die Leute vom Ministerium nicht so ausgedrückt?«
Mrs Toovey zuckte die Achseln. »Max sagt, es wäre nicht das Verteidigungsministerium, das mit uns reden möchte. Es ist jemand anderes.«
Whistler reckte sich im Liegestuhl und schloss die Augen. »Na ja, ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Niemand wollte mir zuhören. Dieser spezielle alte Soldat wird sich also in aller Stille trollen.«
Er verschränkte die Hände auf der Brust. Noch immer gab er mit seinem präzise geschnittenen grauen Schnurrbart und der gestreiften Krawatte eine prachtvolle Gestalt ab.
Ein Blitz leuchtete in der Ferne zwischen den Bäumen auf. Sie beide sahen ihn, und Whistler hielt nach irgendeiner Spur von Wolken am Himmel Ausschau.
»Was denken Sie, ob wohl ein Gewitter aufzieht?«, fragte er.
Brigadier Alistair Gordon Lethbridge-Stewart hatte keinen guten Tag. Zunächst einmal war da das verdammte Wetter zu nennen. Hitze, so pflegte er zu sagen, sei dem militärischen Denken nicht zuträglich, weil sie alle viel zu träge werden ließ. Man war hier schließlich in Großbritannien – einem kalten, nassen, vernünftigen Land, das einst den halben Globus beherrscht hatte. Auf einer feuchten kleinen Insel zu leben, das brachte eine Geduld und eine Besonnenheit mit sich, an die andere Regionen einfach nicht herankamen. Heißes Wetter erzeugte Intoleranz und ausgesprochenen Jähzorn. Kein Wunder, dass diese ganzen lateinischen Länder in einem Zustand permanenter Revolution lebten. Hätte sich Kuba auf Regen und Cricket konzentrieren können, hatte der Brigadier für sich entschieden, dann hätte Castro nie eine Chance gehabt.
Zweitens machte sich die Inaktivität bemerkbar. Nach einer besonders arbeitsreichen Zeit war für UNIT auf einmal eine scheußliche Stille eingekehrt, in der Jo Grant Urlaub genommen hatte und der Brigadier sich wie ein Klassenlehrer fühlte, der schon zu lange eine Sommerschulklasse unterrichten musste. Nach einem Vormittag zu viel, den er in seinem muffigen Büro eingesperrt verbracht hatte, war er zum Labor hinabspaziert, um den Doktor zu sehen. Als er dort eintraf, hatte sich der Schrank jedoch als leer erwiesen, wie es im Kinderlied hieß …
Der Brigadier rieb sich die Stirn mit einem Taschentuch ab und kippte in einem Zug ein großes Glas Limonade hinunter, in dem die Eiswürfel klimperten, als er es an die Lippen hob. Er stellte das Glas auf dem Labortisch ab und drehte sich auf seinem Schemel zu Jo Grant um.
»So sieht es im Wesentlichen aus, Miss Grant. Während Sie im Urlaub waren, ist der Doktor einfach verschwunden.«
Jo lächelte schief. »Ist es hier drin deshalb so ordentlich und sauber?«
»Durchaus. Der Doktor erlaubt dem Reinigungspersonal nie, diesem Labor auch nur nahe zu kommen. Die Leute haben jetzt die verlorene Zeit nachgeholt.«
Jo suchte sich ebenfalls einen Hocker aus und ließ sich schwer darauf sinken. »Aber er würde doch nie einfach verschwinden, ohne sich zu verabschieden. Ich meine … Das würde er einfach nicht tun.«
Der Brigadier wischte sich Limonade von den Schnurrbartenden. »Nun, es steht ihm frei, zu kommen und zu gehen, wie es ihm passt, Miss Grant. Um ganz offen zu sein: Mich überrascht, dass er überhaupt so lange hiergeblieben ist.«
Jo schüttelte den Kopf. »Nein. Da muss ein Grund vorliegen. Er ist mit der TARDIS irgendwohin verschwunden, und er wird dort festgehalten.«
Der Brigadier nickte. »Vielleicht.«
Jo fuhr sich mit der Hand durch die widerspenstigen blonden Haare. »Alle anderen scheinen Ferien zu machen«, sagte sie strahlend. »Warum nicht der Doktor?«
Der Brigadier runzelte die Stirn. »Nun, er ist nicht gerade der Typ, der einen Gedanken auf Betriebsferien verschwendet, oder? Ich meine, was, wenn etwas Wichtiges dazwischenkäme?«
Jos Blick schweifte zu der leeren Ecke, in der sonst immer die TARDIS stand. »Er kommt zurück, das weiß ich. Bis dahin, Sir, denke ich, sollten Sie sich ein wenig entspannen.«
»Ich soll was?«
Jo lächelte. »Mal ausspannen, Brigadier. Das Wetter ist großartig. Es ist Sommer. Nichts wird passieren.«
Kapitel drei
Die Besucher
Die Hand, die über der Steuerung schwebte, war dick, bleich und wächsern wie die einer Puppe.
Sie fuhr in einem schnellen, lautlosen Muster über die blinkenden Schalttafeln und drückte dabei zarte membranartige Felder und Schalter. Dann waren zwei Hände am Werk und spürten einer spiralförmigen roten Linie nach, die über eine ganze Reihe kleiner schwarzer Bildschirme hinweg stieg und sank, die wie dunkle wachsame Augen in die Steuerung eingelassen waren.
Die rote Linie blieb einen Augenblick lang bewegungslos und breitete sich dann wie eine sich entfaltende Blüte über die Bildschirme aus. Eine detaillierte Karte von leuchtendem Grün bildete sich unterhalb der roten Flut. Culvertons Kirche zeichnete sich als vollständiges, dreidimensionales Bild ab. Die Woge aus rotem Licht spülte darüber hinweg, aber das Erscheinungsbild blieb gleich.
Neben den Bildschirmen gähnten neun rechteckige leere Löcher wie Fassungen in einem metallischen Kiefer.
Die Hände bewegten sich auf sie zu und steckten rasch acht Objekte hinein. Die neunte Fassung blieb leer, erfüllt von Schatten.
Die rote Linie leuchtete merklich intensiver. Jemand trat vor, eine massige, in Schwarz gekleidete Gestalt. Ihre Hände, bleich wie Winterbeeren, legten sich auf die Steuerung, und die Finger tanzten auf dem kalten Metall, als wäre das Wesen sehr erregt. Im grellen roten und grünen Licht rührte sich etwas unter seiner Haut …
Whistler hörte die Triebwerke als Erster. Ein leises Pochen, unterlegt mit einem fast drohenden Knurren.
V1-Flugbomben!
Da war das Mädchen wieder, und er wollte sie warnen, an der Hand packen und aus der dicht gedrängten Messebar zerren. Er öffnete den Mund, aber alles schien verlangsamt. Seine Stimme klang wie eine abgebremste Grammophonplatte.
Jede Sekunde jetzt würde das Triebwerksgeräusch der Bombe abbrechen. Dann würde sie stürzen. Einschlagen wie damals und ihm das Mädchen nehmen …
Das Motorengeräusch hielt an. Whistler öffnete die Augen und fand sich erschrocken im Wohnzimmer seines Häuschens wieder. Er blieb noch einen Augenblick im Lehnstuhl sitzen und ging dann zum Fenster, zog einen Vorhang auf und blickte in das purpurne Leuchten des Sonnenuntergangs.
Ein LKW-Konvoi fuhr vorbei, und das Licht der Scheinwerfer huschte über das alte Mauerwerk der Häuser von Culverton. Es waren eine Menge Lastwagen, vielleicht zwanzig, und sie zerstörten die warme Stille des Sommerabends. Whistler blieb am Fenster und beobachtete den Zug der bedrohlichen schwarzen Fahrzeuge, bis ihm auffiel, dass Mrs Toovey das Zimmer betreten hatte.
Whistler wandte sich wieder dem Innenraum zu und schaltete eine Lampe ein, die im Wohnzimmer ein warmes orangefarbenes Licht verbreitete. Es hatte eine Balkendecke, und an den dick verputzten Wänden hingen Schmuckplaketten für Pferdegeschirre neben Aquarellen alter Flugzeuge.
Mrs Toovey hatte sich gesetzt und lauschte mit schief gelegtem Kopf den rumpelnden Fahrgeräuschen und dem gelegentlichen Zischen der Bremsen. Die kleinen Erkerfenster klapperten, während der Konvoi vorbeifuhr.
»Nun«, sagte die alte Frau schließlich, »was hat das alles zu bedeuten?«
Whistler zuckte die Achseln. »Sie scheinen unterwegs zum Flugplatz.«
Mrs Toovey machte ein finsteres Gesicht. »Diese neuen Leute, von denen Mr Bishop gesprochen hat?«
Whistler drehte seine Taschenuhr immer wieder auf der rötlichen Hand. »Scheint so.«
Er warf einen weiteren Blick zum Fenster. »Verdammt rücksichtslos, wenn Sie mich fragen.«
Sie lauschten dem Konvoi schweigend. Endlich blickte Whistler auf die Uhr. »Ich denke, ich gehe ein Bier trinken«, brummte er und steckte die Uhr in eine Westentasche.
Auch Mrs Toovey stand auf. »In Ordnung, Wing Commander«, murmelte sie, »aber …«
Whistler drehte sich mit hochgezogenen Brauen um.
»Aber was?«
Mrs Toovey rang die Hände. Sie löste die Finger wieder voneinander und senkte die Hände zu den Seiten. »Seien Sie vorsichtig, Sir.«
Whistler lächelte sie gut gelaunt an. »Liebe Frau, was meinen Sie damit? Wir sind hier in Culverton, wie Sie wissen. Und …«
»Und hier passiert nie etwas«, sagte sie und schloss so seine vertraute Maxime ab. »Ich weiß. Aber ich meine … die Lastwagen und all das. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über die Straße gehen.«
Sie hob die Hände und zog sachte Whistlers Krawatte fester. Er tätschelte leicht ihre Hand. »Natürlich bin ich das, meine Liebe.«
Whistler ging auf den Flur hinaus, suchte sich an der Garderobe eine Tweedmütze aus und drehte sich wieder zu Mrs Toovey um. »Jedenfalls gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen«, lächelte er und griff nach einer kleinen ramponierten Box, die auf dem Telefontischchen lag. Er klappte sie auf und holte etwas heraus. »Ich habe meinen Glücksbringer dabei.«
Er hielt einen kleinen Kristallgegenstand von ungefähr der Größe und Form einer Kaninchenpfote hoch. Das Objekt sah nach Jade aus und glänzte matt im Schein des Kaminfeuers. Whistler steckte es sich in die Westentasche und stand einen Augenblick später vor der Tür seines Häuschens.
Ein kalkweißes Gesicht ruckte nach vorn ins Licht der Bildschirme. Die Augen waren groß und dunkel und glommen feucht, während sie die grüne Karte betrachteten. Ein kleines Wohnhaus stieg aus den digitalen Ablesungen hervor, und das rote Licht wanderte über das Gebäude. Ganz unvermittelt legte sich ein scharfes helles Licht darüber und pulsierte in einem gleichmäßig blinkenden Rhythmus.
Die Gestalt lächelte …
Whistler blieb vor seinem Cottage kurz stehen und ließ sich von den süßen Düften des Sommerabends überspülen. Der Himmel zeigte sich in einem dunstigen Dunkelblau mit nur wenigen sichtbaren Sternen, und ein Miasma aus Insekten wirbelte im gelben Schein der Verandalampe. Die vertrockneten Überreste ihrer Artgenossen bildeten am Grund der Lampe einen Teppich aus Flügeldecken und Facettenaugen.
Whistler blickte zum Haus zurück. Mrs Toovey setzte sich gerade wieder in einen Sessel. Es war ein warmer Samstagabend. Vielleicht würde sie das Radio einschalten und sich ein Hörspiel oder Konzert anhören. Unter Umständen riskierte sie es gar mit dem Fernseher. Heute Abend wirkte sie jedoch fahrig. Sie verschränkte schon wieder die Hände, zupfte an den Ringen, die Miene voller Sorge.
Whistler richtete sich auf und unternahm einen bewussten Versuch, die melancholische Stimmung abzuschütteln. Er atmete die nach Blumen duftende Luft tief ein und verschränkte die Hände hinterm Rücken. Seine Haltung war kerzengerade, seine Schritte forsch. Er fing an, leise und recht unmelodisch zu pfeifen. Endlich fühlte er sich ein wenig besser.
Bei dem Gedanken musste er lächeln, aber sein Pfeifen war nicht besser geworden. Tatsache war: Er hatte stets gehofft, dass die Männer unter seinem Kommando ihm einen liebevollen Spitznamen verpassten, und »Whistling« Whistler war die Bezeichnung, die ihm am liebsten gewesen wäre. Egal, wie viele Stunden lang er sich jedoch absichtlich mit populären Liedchen aus der Kriegszeit abrackerte, die Männer scheiterten resolut an der Aufgabe, daraus schlau zu werden. »Stubby« Parkinson hatte natürlich einen Spitznamen und auch »Beaver« Kirk, Whistlers alter Vorgesetzter. Während die Jahre des Krieges jedoch ins Land gingen, fand sich Whistler deprimierend spitznamenlos. Er dachte sich damals allmählich schon, dass sogar etwas wie »Stinker« passen könnte, als er zufällig auf die Wahrheit stieß. Bei der Erinnerung daran musste er glucksen, selbst nach all dieser Zeit.
Auf einmal donnerte ein Lastwagen mit tosend protestierendem Motor vorbei. Die Bremsen zischten explosiv, und der Außenspiegel durchschnitt nur Zentimeter von Whistlers Gesicht entfernt die Dunkelheit.
Er blieb abrupt stehen und sprang ein wenig erschrocken von der Straße, wobei ihm der kalte Schweiß ausbrach. Mrs Toovey wäre nicht erfreut gewesen. Er war gedankenverloren durch die Dunkelheit spaziert, versunken in Erinnerungen, und hatte dabei völlig die großen gefährlichen Dinger vergessen, die gerade durchs Dorf dröhnten.
Whistler stand am Bordstein und verfolgte, wie drei oder vier dieser Fahrzeuge in der Nacht verschwanden. Die Ladung war unter schweren schwarzen Planen versteckt. Was in aller Welt ging hier vor? Falls irgendwelche Arbeiten auf dem alten Flugplatz durchgeführt wurden, hätte man gewiss die Einwohner konsultiert. Es sei denn, und er tippte sich bei diesem Gedanken mit dem Finger an die Lippen, es war absolut geheim. Das war jetzt mal eine Idee. Vielleicht rief er am Morgen einige alte Bekannte im Verteidigungsministerium an. Erkundigte sich, ob da irgendwas im Busch war. Man konnte nie wirklich ruhig sein. Nicht, solange die Russen und die Chinesen auf all diesen Raketen hockten …
Er wartete, bis die Straße frei und die warme, stille Decke des Abends wiederhergestellt war, und setzte dann den Weg zum Pub fort. Gerade als er sich in Bewegung setzte, hörte er jedoch Schritte näher kommen. Es war ein ganz spezielles Geräusch, und eines, mit dem er sehr vertraut war.
Soldaten. Im Gleichschritt.
Ohne recht zu wissen, warum er so reagierte, duckte sich Whistler in eine schmale Gasse zwischen zwei strohgedeckten Cottages. Er drückte sich fest an einen feuchten Wandputz und hockte sich hin, wobei die alten Knie geräuschvoll knackten. Die Schritte kamen näher.
Whistler blickte forschend zur Straße und lauschte dem eigenen Atem. Er rieb sich die Augen und schnupperte. Alle Sinne waren gespitzt. Dann sah er sie.
Vielleicht ein Dutzend schwarz uniformierte Männer marschierten in sein Blickfeld. Ihre gutaussehenden Gesichter schienen im weichen Mondlicht zu leuchten, ebenso die Spangen an ihren schwarzen Hemden.
Whistler spürte, wie er förmlich gefror.
Er steckte die Hand in die Westentasche und rieb den Glücksbringer, bis dieser sich unter den Fingern warm anfühlte. Dann lief er so unauffällig, wie er konnte, zum Pub.