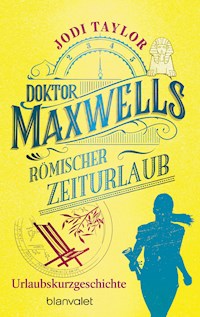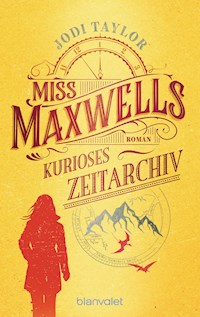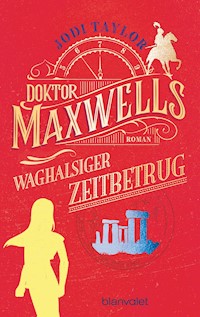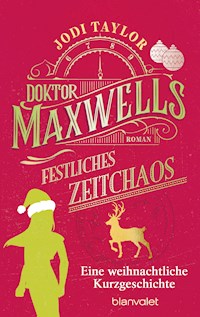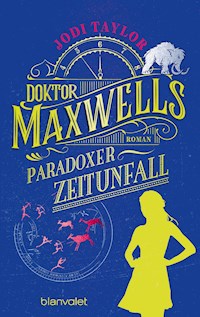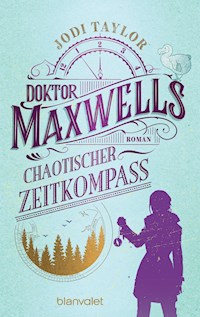
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken von St. Mary’s
- Sprache: Deutsch
Die etwas andere Zeitreiseserie – »Viel Humor, viel Action und sogar ein Hauch von Romantik.« Library Journal
Nicht einmal die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, bewahrt Madeleine »Max« Maxwell vor Déjà-vus. Und so rennt sie schon wieder um ihr Leben – diesmal verfolgt von Jack the Ripper. Es wird nicht das letzte Mal sein. Ihre Mission führt sie über die hängenden Gärten von Ninive und den Mord an Thomas Becket bis zu einer außerplanmäßigen Dodo-Rettungsmission. Diesmal geht es nicht nur um den Schutz der ganzen Menschheit, sondern um das Bewahren der Zeit selbst – und dabei wird Max vom Chaos verfolgt, wann sie sich auch befindet.
Die chaotischen und unabhängig voneinander lesbaren Abenteuer der zeitreisenden Madeleine »Max« Maxwell bei Blanvalet:
1. Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv
2. Doktor Maxwells chaotischer Zeitkompass
3. Doktor Maxwells skurriles Zeitexperiment
4. Doktor Maxwells wunderliches Zeitversteck
5. Doktor Maxwells spektakuläre Zeitrettung
6. Doktor Maxwells paradoxer Zeitunfall
E-Book Short-Storys:
Doktor Maxwells weihnachtliche Zeitpanne
Doktor Maxwells römischer Zeiturlaub
Doktor Maxwells winterliches Zeitgeschenk
Weitere Bände in Vorbereitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Nicht einmal die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, bewahrt Madeleine »Max« Maxwell vor Déjà-vus. Und so rennt sie schon wieder um ihr Leben – diesmal verfolgt von Jack the Ripper. Es wird nicht das letzte Mal sein. Ihre Mission führt sie über die hängenden Gärten von Ninive und den Mord an Thomas Becket bis zu einer außerplanmäßigen Dodo-Rettungsmission. Diesmal geht es nicht nur um den Schutz der ganzen Menschheit, sondern um das Bewahren der Zeit selbst – und dabei wird Max vom Chaos verfolgt, wann sie sich auch befindet.
Autorin
Jodi Taylor war die Verwaltungschefin der Bibliotheken von North Yorkshire County und so für eine explosive Mischung aus Gebäuden, Fahrzeugen und Mitarbeitern verantwortlich. Dennoch fand sie die Zeit, ihren ersten Roman »Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv« zu schreiben und als E-Book selbst zu veröffentlichen. Nachdem das Buch über 60 000 Leser begeisterte, erkannte endlich ein britischer Verlag ihr Potenzial und machte Jodi Taylor ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte.
Ihre Hobbys sind Zeichnen und Malerei, und es fällt ihr wirklich schwer zu sagen, in welchem von beiden sie schlechter ist.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Roman
Deutsch von Marianne Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
»A Symphony of Echoes
(The Chronicles of St. Mary’s Book 2)«
bei Accent Press, Cardiff Bay.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2013 by Jodi Taylor
This translation published by arrangement with Accent Press Ltd.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by
Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Werner Bauer
Umschlaggestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz,
Inkcraft unter Verwendung eines Motivs von
illustrissima/Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24005-9V001
www.blanvalet.de
Dieses Buch ist für Connie und Martin,
die Vertrauen hatten und das zeigten.
Und für Dani, die es tatsächlich getan hat.
Und für Christine.
PROLOG
Eines der besten Dinge an unserem Job ist die Tatsache, dass man sich seinen letzten Sprung aussuchen darf – falls man lange genug am Leben bleibt.
Mit am schlimmsten an unserem Job ist, dass bislang niemand lange genug gelebt hat, um sich seinen letzten Sprung auszusuchen.
Der letzte Sprung soll eine kleine Belohnung sein – die Gelegenheit, einen Lieblingsmoment in der Geschichte mitzuerleben, vielleicht Azincourt zu besuchen oder Antonius und Kleopatra dabei zuzusehen, wie sie den Nil hinunterschippern, oder der Rede von Elisabeth I. an die Truppen von Tilbury zu lauschen. Man kann Zeuge eines epochemachenden Ereignisses seiner Wahl werden. Eine lebenslange Leidenschaft befriedigen.
Um es kurz zu machen: Es soll ein Sprung werden, der einem Freude macht.
Es ist nicht als ein wirbelnder Albtraum aus Blut und Schmerz und Schrecken gedacht.
Es ist nicht vorgesehen, dass es dabei um wildes Abschlachten, Verstümmelung, Enthauptung oder darum geht, dass einem die Hälfte vom Gesicht weggerissen wird. Auch ist nicht Teil des Plans, dass man in einem blutbesudelten Pod beinahe draufgeht, eingepfercht mit einem Monster – ohne dass es ein Entrinnen geben würde.
Es sollte nichts mit dem namenlosen Entsetzen zu tun haben, das einen überfällt, wenn man seine beste Freundin bis auf die Knochen aufgeschlitzt herumliegen sieht und man sie von ihrem Leid erlösen müsste.
Es sollte sich nicht darum drehen, dass man alleingelassen wird, um nie wieder das Licht der Sonne zu sehen.
Um nichts, rein gar nichts davon sollte es dabei gehen.
1
Gott allein wusste, wo wir uns befanden, denn wir anderen konnten nichts sehen. Eine richtige Erbsensuppe war das. Ich fragte: »Hast du eine Ahnung, wo wir sind?«
Kal antwortete: »Also, wir sind in Whitechapel, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Es ist gegen dreiundzwanzig Uhr am 8. November 1888. Gar nicht schlecht, was? Viel genauer, als ich es erwartet hatte. Ich schlage vor, dass wir uns in irgendeinen Pub verkrümeln, abwarten und sehen, was passiert. Man sagt, dass es heute Nacht sein letztes Opfer gab. Vielleicht, weil er in einer dunklen Gasse uns begegnete.«
»Wir können ihn nicht töten«, sagte ich beunruhigt.
»Nein, aber wir können ihm zumindest eine Heidenangst einjagen.«
Ich dachte darüber nach. Das klang gut.
Ich hatte mich in das Thema eingelesen. Jack the Ripper war berüchtigt dafür, im Sommer und Herbst des Jahres 1888 London in Angst und Schrecken versetzt zu haben. Insgesamt hatte es elf Morde gegeben, auch wenn im Allgemeinen nur fünf davon dem Ripper zugeordnet werden – Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth White, Catherine Eddowes und Mary Kelly. Kelly wurde in den frühen Morgenstunden des 9. November 1888 getötet und entsetzlich verstümmelt, und auch wenn es hinterher noch weitere Morde gab, wird sie zumeist als das letzte Opfer angesehen. Sie hatte in Miller’s Court gewohnt, in der Nähe der Dorset Street, und das war der Ort, den wir uns vorgenommen hatten.
Entgegen der allgemeinen Auffassung sind wir Historikerinnen nicht völlig bekloppt. Wir mochten vielleicht wie ärmliche, aber ehrliche Verkäuferinnen aussehen, doch das Waffenarsenal, mit dem wir uns umgaben, war beachtlich. Obwohl allerdings die Tatsache, dass die vereinten Kräfte der H-Division, der Londoner Polizei und von Scotland Yard es nicht geschafft hatten, Jack the Ripper dingfest zu machen, es nicht gerade wahrscheinlich erscheinen ließ, dass es uns gelingen würde. Für Kal war dies ein leidenschaftliches, lebenslanges Ziel und ihr letzter Sprung. Für mich war es nur ein Abenteuer. Ich glaube nicht, dass eine von uns beiden tatsächlich damit rechnete, ihn zu sehen.
Wir machten uns auf den Weg ins Ten Bells, wo Kelly angeblich ihren letzten Abend verbracht hatte. Sie war spät aufgebrochen, um zu Fuß nach Hause zu gehen, und sie hatte wohl einen Mann in ihr winziges Zimmer mitgenommen. Am nächsten Morgen war ihr Leichnam von Thomas Bowyer gefunden worden, der gekommen war, um die Miete einzutreiben.
Es war hoffnungslos. Im Pub war die Hölle los. Es gab keine Möglichkeit herauszufinden, wer sie war, denn mindestens zwanzig Frauen hätten Mary Kelly sein können. Natürlich wollten wir keine Aufmerksamkeit erregen, indem wir uns umhörten.
Trotz der Novemberkälte draußen war es drinnen heiß und dunstig, und es roch durchdringend nach Menschenmassen und Alkohol. Wir bestellten uns jede einen Gin und quetschten uns in eine Ecke, in der wir mit einem sehr freundlichen Mann namens George Carter ins Gespräch kamen.
»Gestatten: Carter, Fahrer von Beruf!«, bemerkte er launig, »und meine Frau Dolly.«
Es stellte sich heraus, dass er die beiden Männer kannte, die Mary Nichols gefunden hatten.
»Schockierende Sache«, sagte er, leerte sein Glas und wischte sich den Mund ab. »Kann ich den Damen noch etwas zu trinken bestellen?«
Wir lehnten höflich ab, aber er hatte noch eine Menge über den »Herbst des Schreckens«, wie die Zeitungen titelten, zu sagen, und er schilderte die Einzelheiten genüsslich und mit großer Ausführlichkeit.
»Aber jetzt ist alles überstanden«, sagte er mit beachtlicher Autorität und knallte seine riesigen Hände auf seine feisten Knie. Kal und ich sahen uns nicht an. »Es sind so viele Polizisten hier in der Gegend unterwegs, dass man nicht einmal mehr furzen kann, ohne dass gleich einer von ihnen auftaucht. Carter, der Furzer, was?« Unser kleines Grüppchen war beträchtlich angewachsen, weil auch andere Gäste ihre Gedanken zu den Morden und zu den Reaktionen darauf kundtun wollten, und wir alle lachten.
Es war schon zu weit fortgeschrittener Stunde, als wir endlich aufstanden, um aufzubrechen. Er war ein anständiger Mann, dieser George Carter. Seine Frau stieß ihm einen Ellbogen in die Rippen, woraufhin er sagte: »Also dann, meine Damen. Sind Sie bereit für den Heimweg? Wenn nicht, dann sind da noch Jabez hier oder mein Sohn Albert oder Jonas Allbright. Das sind alles gute Burschen. Sie arbeiten für mich, und man kann darauf vertrauen, dass sie Sie heil und gesund nach Hause bringen würden. Ich weiß, dass in den letzten paar Wochen nichts mehr passiert ist, aber ich habe selbst Töchter und lasse sie in diesen Tagen nicht mehr allein auf die Straße. Sie müssen es nur sagen.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen, Mr. Carter«, sagte Kal, »aber wir haben es nicht weit. Nur um die Ecke, kurz hinter …« Sie versuchte angestrengt, sich irgendeinen Straßennamen auszudenken, »der Burggasse.«
»Nun, wenn Sie sicher sind, dann wünschen wir Ihnen hier und jetzt eine gute Nacht.«
Mit lauten Gute-Nacht-Rufen und dem Versprechen, man würde sich wiedersehen, brachen wir auf. Wir schlugen ein strammes Tempo an und schwankten kaum.
Dann aber lehnte Kal sich gegen eine Mauer und fächelte sich mit der Hand Luft zu. »Zum Teufel noch mal, was war denn in diesem Gin?«
»Viel Gin«, sagte ich sehr hilfreich. Er hatte geschmeckt, als hätte der Pub-Betreiber ihn in der Badewanne selbst gebrannt, und zwar während er ebenfalls in der Wanne saß.
»Du hast aber nicht viel getrunken, oder? Du weißt doch, wie du dann bist.«
»Nur ein paar Schlucke. Ich habe aufgehört, als meine Lippen taub wurden.«
»Okay«, sagte sie und richtete sich wieder auf. »Lass uns …« In diesem Augenblick kam etwas aus dem Nebel und bewegte sich schnell und kaum wahrnehmbar an uns vorbei. Im Bruchteil einer Sekunde konnte ich einen Blick auf ein langes weißes Gesicht und schwarze Kleidung werfen. Da war ein unangenehmer Geruch, aber das war nicht ungewöhnlich zu dieser Zeit an diesem Ort. Und dann war der Schatten auch schon wieder weg.
Kal und ich tauschten Blicke aus.
»Glaubst du …?«, fragte ich. »Wie spät ist es?«
»Schon deutlich nach zwei Uhr. Ich schätze, das könnte er gewesen sein. Mir hat wirklich gar nicht gefallen, was ich da zu Gesicht bekommen habe, und dir?«
»Nein«, sagte ich langsam und starrte in den wabernden Nebel. »Nein, das gefiel mir ganz und gar nicht.«
»Dann los, komm.«
Und wir stürmten los.
Das wollten wir jedenfalls, nur dass es uns nicht gelang. Man kann auf nassem, rutschigem Kopfsteinpflaster nicht rennen, wenn man die Hand vor Augen nicht sieht. Aber wir eilten so schnell wie möglich die müllverdreckte Straße hinunter und spähten in alle Gassen und Türeingänge hinein. Wir suchten nach Jack the Ripper.
Und dann fanden wir ihn. Oder besser gesagt: Er fand uns.
Wir rannten. Mein Gott, und wie wir rannten!
Wir rannten, bis ich glaubte, meine Lungen würden explodieren. Wir rannten durch die dunklen, schmalen, lärmerfüllten Gassen, rutschten auf Gott weiß was aus und verloren immer wieder den Halt. Wir rasten durch einsame und verlassene Straßen, deren Belag vom Regen und dem vielen Verkehr schmierig geworden war. Meine dummen Röcke wickelten sich um meine Beine. Meine Haube war runtergefallen. Und das verdammte Korsett und das Mieder – all das Zeug halt, das wir für die vollkommene Sanduhr-Silhouette tragen mussten – würden mich vermutlich noch das Leben kosten.
Es gab schon Gaslaternen in Whitechapel, aber die Lampen waren rar gesät und standen weit voneinander entfernt, sodass jede von ihnen nur für einen schwachen Schein im dichten Nebel sorgte. Immer wieder stolperten wir über Holzstapel, Abfallhaufen, Kisten und eine über die andere. Wir fielen unerwartete Stufen hinunter und flohen Hals über Kopf durch menschenleere Straßen, auf denen es den Zeitungen von 1888 zufolge von Polizeibeamten der H-Division nur so wimmeln sollte, was aber gar nicht der Fall war. In meinen Ohren hörte ich das rasende Pochen meines Herzens. Es war keine blinde Panik, denn wir waren Historikerinnen, und die verfielen nicht in blinde Panik. Aber wir waren nicht sehr weit davon entfernt.
Es war unsere eigene Schuld, schließlich hatten wir uns das selbst eingebrockt. Dies war Kals letzter Sprung; ihre lebenslange Leidenschaft war es gewesen, einmal Jack the Ripper zu sehen. Wir waren voller überwältigendem Selbstvertrauen und Einbildung, denn ganz gewiss konnte kein Monster aus dem 19. Jahrhundert zwei modernen Historikerinnen etwas anhaben, die mit Haltung und selbstbewusstem Auftreten, Neugier und einem überentwickelten Sinn für die eigene Unsterblichkeit ausgestattet waren. Und so hatten wir uns auf die Suche nach ihm gemacht.
Und wir hatten ihn gefunden. Eine Gestalt löste sich plötzlich aus dem Nebel; nah, viel zu nah, unmittelbar hinter uns. Ein verschwommener Schatten, der nach Blut und Verwesung roch und die Hand ausstreckte – nach uns. Plötzlich war die Jagd eröffnet, und wir rannten. Auch wenn wir es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, rannten wir um mehr als nur unser Leben.
Wir waren nicht mehr länger die Jäger, sondern waren zu Gejagten geworden.
Wir hasteten durch das Labyrinth der Straßen und Gassen von Whitechapel, Treppen hoch und runter, und wir vertrauten darauf, dass wir ihn schon bald in dem erstickenden, in der Kehle schmerzenden Nebel abhängen würden. Aber es gelang uns nicht. Egal, wohin wir auch liefen – es hatte den Anschein, als wäre er schon vor uns da. Eine Gestalt im Nebel, die uns dazu brachte, abzudrehen und einen anderen Weg auszuprobieren. Wir glaubten, wir müssten nur unseren Pod erreichen, um in Sicherheit zu sein.
Aber wir waren nicht annähernd so clever, wie wir dachten. Denn während wir rennend und stolpernd Hals über Kopf zum sicheren Pod stürmten, kamen wir nicht ein einziges Mal auf den richtigen Gedanken. Wir glaubten, wir würden um unser Leben laufen.
Tatsächlich aber wurden wir getrieben.
Beim Rennen sahen wir uns immer wieder um und hielten die Ohren offen – jeder Sinn, über den wir verfügten, war auf unsere Umgebung gerichtet. Wir achteten auf jedes Geräusch, jede Bewegung, irgendetwas, das uns auch nur den geringsten Hinweis darauf geben konnte, wo sich unser Verfolger befand. Denn er war da. Irgendwo, gar nicht weit entfernt, war er. Vermutlich befand er sich sogar nahe genug, um in der Dunkelheit die Hand auszustrecken und …
Kal kam schlitternd zum Stehen; ich prallte gegen ihren Rücken, und gemeinsam taumelten wir in einen günstig gelegenen Eingang. Meine Brust hob und senkte sich bei dem Versuch, genug Sauerstoff aufzunehmen, um die Muskeln anzutreiben, die fürs Schreien benötigt werden. Meine Beine zitterten. Ich beugte mich vor, stützte meine Hände auf die Knie und versuchte, in meinem verdammten Korsett wieder zu Atem zu kommen.
»Wir können uns hier nicht ausruhen«, keuchte Kal. »Wir müssen in Bewegung bleiben. Wenn er uns in die Finger bekommt – dann war’s das mit uns.«
Ich nickte. Im Augenblick waren wir immerhin noch am Leben, und das war doch schon mal was. Jedenfalls mehr, als man über Mary Kelly sagen konnte. Ich griff in meinen Muff und befestigte mein Betäubungsgerät an meinem Handgelenk. Pfefferspray hatte ich auch dabei, und ich würde nur zu gerne beides zum Einsatz bringen.
»Los, komm«, drängte Kal. »Der Pod steht in dieser Richtung.«
Und schon hasteten wir wieder los, aber dieses Mal vorsichtiger, denn zum einen glaubten wir, wir hätten ihn abgehängt, zum anderen waren wir erschöpft. Kal rannte vorneweg, ich folgte ihr und achtete darauf, was hinter unseren Rücken geschah.
An einer Kreuzung blieben wir stehen und ließen uns ein paar Sekunden Zeit, in denen wir versuchten, wieder zu Atem zu kommen, während wir in die gespenstische, modrige Stille lauschten. Wir standen Rücken an Rücken. Ich kniff die Augen zusammen in dem Versuch, die dicken gelbgrauen Nebelschwaden zu durchdringen, die um uns hin und her waberten.
Dann hörten wir es ganz schwach in der Ferne wieder. Ein kaum wahrnehmbares Geräusch.
Hinter uns.
Wir setzten uns so leise, wie wir nur konnten, in Bewegung. Kal kümmerte sich herzlich wenig um historische Korrektheit und schaltete ihre kleine Taschenlampe ein, die sich aber als beinahe gänzlich nutzlos entpuppte. Der Nebel warf den Schein einfach auf uns zurück. Die dicke, schmutzig-gelbe Luft schmeckte nach billiger Kohle, kratzte in meinem Hals und ließ meine Augen tränen. Ich hatte viel über diese Erbsensuppe gelesen. Tausende von Menschen starben jedes Jahr in London an Lungenbeschwerden, und vom Großen Gestank will ich erst gar nicht anfangen.
»Gott weiß, was das unseren Lungen antut«, maulte Kal.
»Zum Glück kann ich nicht richtig atmen. Ansonsten wäre ich jetzt vielleicht tot.«
»Ach, hör auf, dich zu beklagen. Da nehme ich dich mal auf einen netten Ausflug mit, und alles, was du machst, ist jammern.«
»Wenn ich morgen eine halbe Tonne schwarzen Schleim aushuste …« Da war das Geräusch wieder. Näher dieses Mal.
»Hier rein«, sagte Kal. Wir standen am Eingang einer langen, schmalen Gasse mit hohen, fensterlosen Mauern zu beiden Seiten. Uns blieb nichts anderes übrig, als hintereinander zu laufen. Ich spürte, wie sich mir die Haare im Nacken aufstellten. Die Gasse war sehr schwarz, und ich wollte hier wirklich, wirklich nicht einbiegen.
»Glaubst du, der Nebel lichtet sich?«
Tatsächlich glaubte ich genau das. Ich dachte, ich könnte vor uns ein kleines, helles Viereck ausmachen, was ein Ausgang sein könnte, falls der Gott der Historiker es gut mit uns meinte.
»Okay, bist du bereit?«
»Kal …«
»Ja, ich weiß. Aber er ist hinter uns, und der Pod befindet sich in dieser Richtung. Wir müssen einfach durch dieses nächste Stückchen hindurch, und dann sind wir zu Hause und im Trockenen.«
Wir holten beide tief Luft. Kal ging mit ihrer Taschenlampe vorneweg; ich lief hinter ihr, meine Hand auf ihrer Schulter, halb zurückgewandt, sodass ich im Blick behalten konnte, was hinter unseren Rücken passierte. Meine Betäubungswaffe und ein zutiefst unbehagliches Gefühl waren bereit.
Da ich mir nur allzu bewusst war, wie weit jedes Geräusch getragen werden konnte, flüsterte ich: »Bist du bewaffnet?«
»Taschenlampe und Pistole.«
»Du hast eine Pistole mitgenommen?«
»Du nicht?«
»Nein, ich nicht.«
»Keine Panik. Sie ist zeitgenössisch. Eine Remington Derringer. Sie waren damals als Muff-Pistolen bekannt.«
»Das macht es nicht richtiger.«
Der Nebel über uns bewegte sich. Wir blickten beide nach oben. Ich hatte den Eindruck, dass wir gerade irgendetwas nicht gesehen hatten. Als ich wieder nach unten schaute, konnte ich das Licht vom Eingang der Gasse hinter mir nicht mehr sehen. Irgendetwas versperrte den Weg. Irgendetwas stand hinter uns. Etwas Großes. Ich verspürte eine eisige Kälte, die nichts mit dem Wetter zu tun hatte. Mir war immer klar gewesen, dass wir eines Tages einen größeren Bissen im Mund haben würden, als wir schlucken konnten.
»Kal, da ist irgendwas hinter uns.«
Ihr Arm und ihre Hand mit der Taschenlampe tauchten über meiner Schulter auf. Urplötzlich, entsetzlich nahe, erhaschte ich einen allerkürzesten Blick auf etwas Nasses, Weißes, das im Lichtschein aufblitzte. Es bewegte sich mit unnatürlicher Geschwindigkeit, schlug Kal die Taschenlampe aus der Hand und schob sich an uns vorbei. Und dann versetzte es mir einen harten Stoß, aber es gelang mir, mich auf den Beinen zu halten. Ich lehnte mich mit dem Rücken an die Wand, die Betäubungswaffe hoch erhoben, und gab uns beiden damit Deckung.
»Kal«, fragte ich drängend. »Alles in Ordnung mit dir?«
»Ich bin hier«, sagte sie schwach ganz in der Nähe. »Ich glaube, ich habe einen Messerstich abbekommen. Ich blute.«
Jeder Funke von Instinkt, den ich besaß, befahl mir, sofort aus dieser Gasse zu verschwinden. Zu rennen. Blindlings zu fliehen. Irgendwohin. Nur weg. Verschwinde, Max! Ich holte so tief Atem, wie das in meinem blöden viktorianischen Aufzug möglich war. Dann noch einen.
Historikerinnen geraten nicht in Panik.
Taten wir aber natürlich doch.
Ich bückte mich, tastete nach der Taschenlampe, fand sie und schaltete sie ein. Anders als bei solchen Gelegenheiten üblich, funktionierte sie noch. Als ich damit in beide Richtungen in die Gasse hineinleuchtete, konnte ich in der Nähe nichts entdecken. Aus irgendeinem Grund sah ich auch über unseren Köpfen nach. Vor uns konnte ich den Ausgang erkennen. Er war näher, als ich geglaubt hatte. Der Nebel lichtete sich tatsächlich.
»Kannst du rennen?«
»Ja, klar. Es ist nur mein Arm.«
Wir bewegten uns, so schnell es ging. Kal hatte meinen Arm gepackt, und ich vertraute darauf, dass sie mich mit sich zog, denn ich wich rückwärts zurück.
Wieder kämpfte ich meinen Drang nieder, einfach zu türmen. Dieser schmale Ort war eine Todesfalle. Wir würden hier gestellt werden. Zwischen diesen fensterlosen Wänden zermalmt werden, ohne genug Platz zu haben, um uns zu bewegen. Ohne irgendwo hinrennen zu können. Wir traten auf unserem Weg Abfall und Geröll beiseite.
»Beinahe da«, flüsterte Kal, und mit einer Geschwindigkeit, bei der mir beinahe das Herz stehen blieb, verschwand das Licht am Ende unseres Tunnels wieder. Mir blieb gerade noch Zeit zu kreischen: »Kal, er ist wieder da«, und schon ragte eine Gestalt drohend über uns auf, und ich roch Blut und Erde. Ich versetzte ihr einen Stoß aus meiner Betäubungswaffe, und mit einem Zischen kippte sie rückwärts um.
»Beweg dich«, rief ich und gab Kal einen Stoß, »los, los, los.«
Sie rannte los, und ich folgte ihr; gemeinsam liefen wir wie eine Krabbe, denn ich versuchte, ihr den Rücken freizuhalten, während sie meinem Deckung gab. Wir strengten uns an, mit klopfendem Herzen alle Richtungen gleichzeitig im Blick zu behalten, während wir verzweifelt, verzweifelt, probierten, aus diesem engen Gefängnis zu entkommen.
Es war so ein altes Filmklischee – beim letzten Einsatz ums Leben zu kommen. Auf keinen Fall würde ich zulassen, dass es auf Kal zutraf. Ich hatte Angst, und wenn ich Angst habe, werde ich wütend. Kal würde nichts zustoßen. Ich würde sie heil und gesund zurückbringen. Das schwor ich mir.
Mit hochgerafften Röcken galoppierten wir aus der Gasse hinaus und landeten auf einer breiteren Straße. Kal hielt ihre Pistole gezückt, ich mein Pfefferspray. Dort standen wir, Rücken an Rücken, und starrten in die Nacht hinein, nur allzu bereit, alles anzugreifen, was uns aus der Gasse heraus folgen würde.
Nichts passierte. Niemand kam aus der Gasse. Die Straße war leer. Ein paar gedämpfte Lichter waren in den Häusern in der Nähe zu erkennen, aber alle braven Bürger lagen in ihren Betten. Es gab nur uns auf der Straße. Keuchend stand ich da, meine Rippen kämpften gegen dieses verfluchte Korsett. Wohin war er gegangen? Wie hatte er verschwinden können? Hatte der Stoß aus der Betäubungswaffe ihn umgebracht? Ganz sicher war er Gegenwehr von einer Frau nicht gewohnt. Wir drehten uns langsam, Rücken an Rücken, im Kreis. Nichts. Noch eine weitere Runde. Immer noch nichts. Wir waren allein. Langsam normalisierten sich mein Herzschlag und mein Atem wieder auf ein akzeptables Maß.
»Also gut«, sagte Kal und schob ihre kleine Pistole zurück in ihren Muff. »Das war lustig. Glaubst du, dass er es war?«
Ich untersuchte ihren Arm, während sie über meine Schulter hinweg Wache hielt. Der Schnitt war nicht tief, aber er würde, wie wir immer zu sagen pflegten, am nächsten Morgen ordentlich brennen.
»Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass mir sein Anblick nicht gefallen hat. Sein Geruch auch nicht. Und wie hoch stehen schon die Chancen, dass heute Nacht zwei Verrückte in den Straßen von Whitechapel herumlungern?«
»Du meinst: abgesehen von uns?«
Kal plapperte zwar tapfer vor sich hin, aber sie begann auch zu zittern. Der Schweiß, der auf meinem Gesicht und meinem Rücken zu trocknen begann, ließ mich ebenfalls frieren. Noch einmal sahen wir die Straße hoch und runter. Whitechapel schien merkwürdig ausgestorben. Ich schätze, dass es in diesen Straßen in der Zeit vor Jack the Ripper niemals still gewesen war. Selbst nach Einbruch der Dunkelheit dürften alle möglichen nächtlichen Geschäfte stattgefunden haben. Heute allerdings nicht.
Wie immer war mein Ortssinn heillos überfordert. »Wo befindet sich der Pod?«
»Eigentlich gar nicht weit von hier. Nur um die Ecke. Auf unbebautem Gebiet.« Wir setzten uns in Bewegung und marschierten zielstrebig Arm in Arm mitten auf der Straße entlang. Der Klang unserer Schritte wurde von den Häusern rechts und links zurückgeworfen. Ein gespenstischer Laut. Eine kleine Bö brachte Bewegung in die Nebelschwaden. Ich schaute immer wieder über meine Schulter nach hinten und konnte es nicht glauben, dass wir so leicht entkommen waren. Anstatt uns in den labyrinthartigen Straßen von Whitechapel zu verlaufen, waren wir genau da, wo wir sein mussten.
Weil wir getrieben wurden!
2
Vor Ewigkeiten – als ich noch ein Kind war – versteckte ich mich oft. Ich erinnere mich daran, dass ich mit fest geschlossenen Augen in der Dunkelheit kauerte, den Atem anhielt, nicht nachdachte und gegen die überwältigende Gewissheit ankämpfte, dass irgendjemand ganz in meiner Nähe war. Genau dieses Gefühl hatte ich jetzt wieder. Irgendjemand war ganz nahe und …
»Da!«, sagte Kal. »Da ist der Pod. Dort drüben.«
Die gute alte Nummer fünf wartete exakt an derselben Stelle, an der wir sie zurückgelassen hatten, was – wenn man in der Kreidezeit gewesen war und zugesehen hatte, wie der eigene Pod ohne einen selbst darin einen Berghang runterrutschte – immer eine große Erleichterung war.
Wir stolperten und schlitterten über den unebenen Boden und drehten uns ständig mit erhobenen Waffen um. Ich konnte sehen, wie dunkles Blut über Kals Finger rann. Sie sah bleich aus und bewegte sich langsamer als gewöhnlich. Sobald ich sie zurück in den Pod geschafft, ihre Wunde verbunden und ihr etwas Alkoholisches eingeflößt hätte, würde sie bestimmt wieder die Alte sein.
Wir waren fast da. Ungefähr sieben Meter vor dem Pod blieben wir stehen. Kal rief nach der Tür, damit sie sich öffnete, und wir drehten uns langsam um 360 Grad, nur für den Fall, dass noch immer irgendwas hier herumlungerte, aber wir konnten nichts entdecken. Was auch immer es gewesen war – jetzt war es fort. Und das war, verdammt noch mal, auch gut so.
Halb enttäuscht und halb erleichtert, schoben wir uns rückwärts auf den Pod zu. Ich leuchtete überall mit der Taschenlampe hin. Es schien ungewöhnlich lange zu dauern, endlich diese Tür zu erreichen. In meinem Nacken hatten sich alle Haare aufgestellt. Ich kämpfte körperlich gegen den Drang an, alles fallen zu lassen und einfach loszurennen.
»Immer weiter«, sagte Kal leise und tätschelte meinen Arm. »Wir sind fast da.«
Und dann waren wir beim Pod angekommen. Die Tür schloss sich hinter uns und sperrte die Nacht und das Monster aus. Wir waren endlich im Warmen und in Sicherheit – und zurück in St. Mary’s würden wir ganz schön was zu erzählen haben.
Nummer fünf war Kals Lieblingspod. Sie hatten eine Menge zusammen durchgemacht, aber sie hatten beide überlebt. Anders als mein Pod, Nummer acht, der nach der Notrückholung aus der Kreidezeit letztes Jahr immer noch schwer beschädigt war und in seinen Einzelteilen überall im Hawking-Hangar verstreut lag, während Chief Farrell und seine Leute von der Technikabteilung versuchten, ihn wieder zusammenzusetzen.
In Nummer fünf befanden sich die Konsole und der Computer rechts von der Tür, und die beiden ziemlich zerfledderten und ungemütlichen Mannschaftssitze waren davor am Boden festgeschraubt. Die Toilette war in einer abgetrennten Ecke untergebracht. Verschiedene Fächer ringsum an den Wänden enthielten alle möglichen Ausrüstungsgegenstände, die ein Historiker brauchen konnte. Am wichtigsten waren die grundlegenden Dinge des Lebens wie der Wasserkocher, einige Becher und Gläser und ein kleiner Kühlschrank mit Alkohol.
Pods bilden das Herzstück unserer Operationen; es sind massive, scheinbar aus Stein errichtete Hütten, und sie springen mit uns darin in jedwede Epoche zurück, die uns zugewiesen wird. In ihnen arbeiten, essen und schlafen wir. Es ist eng darin, häufig ziemlich verwahrlost, und trotz aller Bemühung der Technikabteilung funktioniert das Klo nie vernünftig. Nummer fünf roch wie jeder Pod nach verschwitzten Historikern, nassem Teppich, überhitzter Elektronik, unzuverlässigen Abflussrohren und Kohl.
Bündel mit dicken Kabeln liefen an der Wand entlang und hingen in schlaffen Bögen von der Decke. Lichter blinkten zwischen den Unmengen an Schaltern, Anzeigen und Reglern auf der Konsole. Die Koordinaten für den Sprung zurück waren bereits fertig eingegeben. Alles sah nach schäbigem Hightech aus. Angekratzt und mitgenommen. Genau wie wir Historiker. Eigentlich wie wir alle in St. Mary’s.
Wir arbeiten für das Institut für Historische Forschung, das seinen Sitz im St. Mary’s-Stift unmittelbar vor den Toren von Rushford hat. Wir unternehmen keine Zeitreisen. Das ist was für Amateure. Wir reisen nicht durch die Zeit – wir sind Historiker. Wir »untersuchen historische Ereignisse in zeitgenössischer Umgebung«. Das hat so viel mehr Stil und Klasse. Im Grunde sind wir recht eigenständig, aber wir sind, was die finanziellen Mittel angeht, von der Thirsk-Universität abhängig. Manchmal ist diese Beziehung nicht ganz spannungsfrei, aber wir haben vor Kurzem einen riesigen Coup gelandet, als wir nämlich erfolgreich Bücher aus der brennenden Bibliothek von Alexandria retteten. Jetzt im Augenblick liebte uns Thirsk. Aber so würde es nicht ewig bleiben.
Ich half Kal dabei, ihren Mantel auszuziehen. Wie es die Mode der späten 1880er-Jahre vorschrieb, war er eng geschnitten, auch an den Ärmeln, und das hatte Kal davor bewahrt, allzu viel Blut zu verlieren. Ich riss den Ärmel von ihrer Bluse ab (was mir vermutlich am nächsten Morgen eine vorwurfsvolle Notiz von den Mitarbeitern der Garderobe einbringen würde) und klatschte eine sterile Wundauflage auf Kals Arm.
»Na bitte, so gut wie neu. Setz dich. Ich räum den Rest weg. Sieh zu, dass dir nicht kalt wird. Schlüpf lieber wieder in deinen Mantel.« Also zog sie ihn sich wieder über. Sie trug Marineblau, ich Grau. Beide Outfits sahen abgewetzt, doch gut gepflegt aus. Wir hatten uns für den Look »arme, aber ehrliche Verkäuferinnen« entschieden. Unsere Reifröcke hatten für viel Gelächter und Spott unter unseren ordinären Kollegen gesorgt, während uns unsere verfluchten Korsetts beinahe umgebracht hatten.
Ich schob Kals Pistole und Taschenlampe zurück in ihren Muff und legte ihr diesen auf den Schoß. Sie saß da und streichelte das weiche Material.
»Da ist eine gute Flasche im Kühlschrank. Wollen wir uns einen letzten Drink auf meiner letzten Mission gönnen?«
Ich holte die Flasche und Gläser, und sie schenkte ein. »Prost!«
»Prost, Kal. Und alles Gute!«
Wir kippten den Inhalt unserer Gläser runter, und ich spürte, wie ich anfing, mich ein bisschen zu entspannen. Es war eine anstrengende Nacht gewesen, aber jetzt war alles überstanden. Zeit, etwas runterzukommen, ehe wir uns auf den Heimweg machten. Wir lehnten uns zurück und legten die Füße auf die Konsole.
»Mein Gott«, sagte Kal und betrachtete mich mit einer seltsamen Mischung aus Euphorie, Erstaunen und Traurigkeit. »Das war mein letzter Sprung. Ich habe überlebt. Ich habe tatsächlich überlebt. Weißt du, dass es Zeiten gab, in denen ich daran nicht geglaubt hätte? In dieser Nacht in Brüssel, nach dem Ball der Herzogin von Richmond – ich hatte Peterson in dem ganzen Chaos verloren und gedacht, ich würde weder ihn noch den Pod jemals wiederfinden. Die Aufstände im Zusammenhang mit diesen Maisgesetzen von 1846 – was wohl irgendwie mit Getreideanbau zu tun gehabt hatte. Die Zeit mit dir an der Somme. Erinnerst du dich, wie wir durch den Matsch gerannt sind? Oder in Alexandria, als Professor Rapson uns alle beinahe ins Jenseits gepustet hätte? Ich habe alles überlebt. Und jetzt haben wir vielleicht Jack the Ripper gesehen, und ich lebe immer noch. Ich habe es geschafft. Das hätte ich nie für möglich gehalten.«
Ungläubig schüttelte sie den Kopf.
»Tja, all die Geschichten, die man seinen Kindern nicht erzählen kann.«
Sie lachte und leerte ihr Glas.
Ich beugte mich vor, um nachzufüllen.
»Was glaubst du: Wirst du es vermissen?«
»O Gott, ja. Ja, ich werde es vermissen.«
»Aber dann … Warum?«
Sie seufzte. »Ich will mehr. Das war ein wirklich riesiger Spaß. Und ist es immer noch. Aber ich will etwas anderes. Möglicherweise verstehst du das nicht, Max, aber Dieter und ich … Na ja, vielleicht eines Tages … vielleicht will ich eines Tages ein Kind haben. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ich will, aber ich weiß, dass das nicht mehr reicht.« Sie lächelte mich an. »Und vielleicht wirst du eines Tages genauso empfinden.«
»Unwahrscheinlich.«
»Max, man kann nie wissen.«
»Das werden wir sehen.«
Ich wusste nicht, was ich sonst noch sagen sollte. Auf keinen Fall wollte ich mir eingestehen, wie sehr ich sie vermissen würde. Sie war mein Fels in der Brandung, meine Vertraute, meine Mitverschwörerin, meine Saufkumpanin und meine Lebensretterin. Was auch immer gerade gebraucht wurde. Ich konnte mir eine Welt ohne sie nicht vorstellen. Aber sie würde St. Mary’s verlassen. Dies war ihr letzter Sprung, wie es der Tradition entsprach. Sie würde als unsere Verbindungsoffizierin an der Universität von Thirsk arbeiten, denn sie war befördert worden.
Das waren wir alle drei.
Tim Peterson war jetzt der Leiter der Ausbildungsabteilung, und in einem Moment von unerklärlicher geistiger Umnachtung hatte Dr. Bairstow mich zur Leitenden Missionschefin ernannt. Da ich nun auch die beiden liebenswerten Pyromanen in der Abteilung für Forschung und Entwicklung unter meinen Fittichen hatte, war ich mir nicht so sicher, ob ich wirklich das große Los gezogen hatte oder eher doch nicht.
Mein Name ist Madeleine Maxwell. Meinen Vornamen habe ich mitsamt meiner Kindheit hinter mir gelassen. Anders als Tim und Kal bin ich nicht groß, schlank und blond. Ich bin klein, rothaarig und zwar nicht unbedingt fett, aber ich habe, wie Leon Farrell mal atemlos feststellte, als wir gerade eng verschlungen waren, ein »kaum zu bändigendes Übermaß an Körperfülle ober- und unterhalb der Taille«. Ich wollte ihn deswegen zur Rede stellen, aber zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr in der Lage weiterzureden, und Sekunden später hatte ich die Fähigkeit verloren, noch irgendetwas zu hören, und so blieb im Dunkeln, was ganz genau er damit hatte sagen wollen.
Hier und jetzt im Pod beobachtete Kal mich dabei, wie ich meinen Wein schlürfte.
»Neue Herausforderungen liegen vor uns allen. Und du, Max, musst als Leitende Missionschefin anfangen, dich zu benehmen. Dir nicht mehr die Kante geben. Dich nicht mehr rauswerfen lassen. Keine Pods mehr klauen. Und auch nicht den Chief der Technikabteilung verführen. Du wirst jetzt Doktor Maxwell sein. Du trägst jetzt Verantwortung.«
»Kein Problem«, sagte ich, setzte meine blöde Haube ab und warf sie auf den Boden neben meinen Sitz. »Dem Boss zufolge war ich bislang für so ziemlich alles verantwortlich, was in St. Mary’s passiert ist, seitdem ich einen Fuß hineingesetzt habe. Willst du noch mal Nachschub?«
»Und du hast jetzt auch eigene Leute«, sagte sie und strahlte mich an.
Ja, ich hatte einen Assistenten …
Nach einer Nacht, in der wir ausgelassen unsere Beförderungen gefeiert hatten (und in der wir der Liste der Dinge, für die ich nun verantwortlich war, noch einiges hinzugefügt hatten), hatte ich ausgesprochen langsam und vorsichtig ein spätes Frühstück zu mir genommen.
Mrs. Partridge war an meinem Tisch erschienen, lautlos wie immer. Vielleicht hatte das in ihrer Jobbeschreibung gestanden: Gesucht – persönliche Assistentin des Direktors. Muss in der Lage sein, sich mit vorwurfsvoller Miene in den unpassendsten Augenblicken zu materialisieren.
»Dr. Maxwell, ich möchte gerne mit Ihnen über Ihren Assistenten sprechen.«
Ich hatte noch nie einen gehabt und versuchte, etwas Begeisterung zu entwickeln.
Mrs. Partridge fuhr fort: »Ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich noch an David Sands erinnern.«
»Natürlich«, sagte ich. »Er ist der Auszubildende, der an diesem Verkehrsunfall kurz vor Rushford beteiligt war. Ist er denn mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden?«
»Das ist er, und zwar schon vor einigen Monaten. Er ist bereit, zum St. Mary’s-Institut zurückzukehren – tatsächlich ist er sogar ganz erpicht darauf. Aber er wird nie mehr als Historiker arbeiten können. Das hat er akzeptiert, auch wenn es ihm alles andere als leichtgefallen ist. Doch er ist ein Bursche mit hoher Intelligenz und großartigem Charakter. Natürlich liegt die endgültige Entscheidung bei Ihnen, aber für mich hat es den Anschein, als ob er ein sehr geeigneter Assistent wäre. Wollen Sie ihn kennenlernen?«
»Natürlich«, antwortete ich. »Wann denn?«
»Am besten sofort.« Sie trat einen Schritt zur Seite.
David Sands saß im Rollstuhl. Ich drehte mich auf meinem Stuhl zu ihm herum und streckte meine Hand aus. »Mr. Sands.«
»Dr. Maxwell.«
»Ich lasse Sie mal einen Moment allein«, sagte Mrs. Partridge und verschwand, weiß der Himmel wohin.
Wir beiden Verbliebenen musterten uns. Sein Haar war kürzer, als es bei Historikern üblich war, denn er würde die traditionelle Frisur, die für alle Jahrhunderte taugte, nicht brauchen. Auf seinem schmalen Gesicht hatten Anspannung und Schmerzen Spuren hinterlassen.
Ich versuchte, mich wieder daran zu erinnern, wie Vorstellungsgespräche gewöhnlich abliefen.
»Verraten Sie mir, warum ich Sie, genau Sie, brauche.«
»Ich bin intelligent und arbeite effizient. Ich trage einen Doktortitel, genau wie Sie. Ich weiß, wie der Laden hier läuft. Ich weiß, an wen ich mich in egal welcher Angelegenheit wenden muss. Ich kann Ihnen tonnenweise Arbeit von den Schultern nehmen. Ich kann Aufgaben erledigen, ehe Sie überhaupt wissen, dass sie anstehen. Ich weiß, wie Sie Ihren Tee mögen, und ich habe einen unerschöpflichen Vorrat an schlechten Witzen.«
Er hatte seinen Doktortitel. Er könnte auch an die Thirsk-Universität gehen und eine Stelle annehmen, die seinen Qualifikationen entsprach. Aber wie dem Rest von uns lag ihm St. Mary’s im Blut, und er wollte lieber hier ein Assistent sein als irgendein hoch dotierter Irgendwer irgendwo anders.
Ich war verwirrt. »Wie bewegen Sie sich hier im Gebäude?«
»Oh, das ist kein Problem. Ich fahre mit dem Lastenaufzug hoch und runter.«
»Das erscheint mir nicht richtig.« Ich runzelte die Stirn.
»Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Gewöhnlich fährt Professor Rapson mit und hat etwas Spannendes dabei, sodass wir ein Schwätzchen halten können. Er wird versuchen, meine Höchstgeschwindigkeit raufzusetzen.«
»Sie wollen zulassen, dass Professor Rapson sich an Ihrem Rollstuhl zu schaffen macht? Vermutlich schießt er Sie in den Orbit. Was für ein Idiot sind Sie denn?«
»Ich hoffe, ich bin der Idiot, der für Sie arbeitet, Dr. Maxwell.«
»Das hoffe ich ebenfalls. Sie klingen zu gut, um wahr zu sein. Wie halten Sie es mit Schokolade?«
»Kann man nie genug von haben«, sagte er und beförderte eine Handvoll verschiedener Schokoriegel aus verwegenen Tiefen seiner Taschen.
»Sie sind eingestellt«, sagte ich. »Fangen Sie gleich an.«
Mrs. Partridge erschien wieder auf der Bildfläche und hob ihre Augenbrauen.
»Sagen Sie kein Wort.«
Sie lächelte und verschwand.
So, das war es also, wohin ich zurückkehren musste. Zu einer Beförderungsstelle, meinem eigenen Büro und einem Assistenten mit dem weltgrößten Repertoire an schwachsinnigen Witzen. Ich brauchte ihn. Ich musste eine große Mission planen. Letztes Jahr waren wir in den Besitz einer Sammlung von Shakespeare-Sonetten gekommen, ebenso von einem eindeutig echten, bis dato aber unbekannten Shakespeare-Stück, das den Titel Die Schottische Königin trug und – nebenbei bemerkt – getrost einem unbekannten Meister zugeschrieben werden kann. Unglücklicherweise exekutiert in diesem Stück ein unbekümmertes sechzehntes Jahrhundert die falsche Herrscherin, und Maria Stuart, die Tartan-Tusse, ist weiter damit beschäftigt, Schottland und England zu vereinen und offenkundig den Lauf der Geschichte zu verändern. Sobald ich zurück wäre und mir den Whitechapel-Schmutz aus den Haaren gewaschen hätte, würde ich mir etwas einfallen lassen müssen. Meine Zukunft sah rosig aus?
Falsch.
»Sind wir bereit?«
»Ja, lass uns zurückspringen.«
Ich legte meinen Muff auf die Konsole, zog mein Kleid zurecht und strich mir mit den Händen die Haare glatt. Historiker sehen bei ihrer Rückkehr nie zerzaust aus. Manchmal kehren wir tot zurück, aber selbst dann haben wir immer dafür gesorgt, dass wir gut aussehen. Kal initialisierte den Countdown, und die Welt wurde weiß.
Nur Augenblicke später waren wir wieder in St. Mary’s. Es waren ein paar Leute im Hangar, aber ich schätzte, die meisten waren in der Bar. Wir hatten ganz schön was für Kal geplant. Diese stellte die Dekontaminationsanlage ein, damit wir all die unschönen kleinen viktorianischen Keime loswerden konnten, und wir warteten beide darauf, dass das blaue Licht ausging. Kal hielt den Blick auf den Bildschirm gerichtet und schaltete die Regler runter.
Mit dem vermutlich einzigen Quäntchen Glück, das uns in dieser Nacht zur Verfügung stand, fiel mein Blick Richtung Tür, direkt auf meinen Muff, und so sah ich, wie es passierte. Später dachte ich immer, wie leicht es gewesen wäre, so etwas Winziges zu übersehen. Wir hätten fröhlich die Tür geöffnet, und wer weiß, was wir dann auf die Welt losgelassen hätten. Es wäre ganz allein unser Fehler gewesen.
Der Muff bewegte sich.
Nur ganz wenig.
Vollkommen von allein – bewegte er sich.
Ich fixierte ihn mit dem Blick. Auch Kal war aus den Augenwinkeln etwas aufgefallen. Nur für eine Sekunde war mein Geist völlig leer, dann traf es mich wie eine Abrissbirne: die einzige mögliche Erklärung. Ich spürte, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich.
Irgendetwas war hier. Irgendetwas war hier bei uns. Es war unglaublich, denn etwas, das wir nicht sehen konnten, war hier bei uns. Irgendetwas, das so dringend zur Tür hinauswollte, dass es einen winzigen, stümperhaften Fehler gemacht hatte. Wir waren nicht allein in diesem Pod. Wir hatten etwas mitgebracht.
Vorsichtig wandte ich meinen Kopf Kal zu. Sie war kalkweiß, sogar an den Lippen. Ich hatte sie noch nie so gesehen. Es war Todesangst, die sich in ihre Gesichtszüge geschlichen hatte. Und wenn Kal sich fürchtete, dann bekam auch ich es mit der Angst zu tun.
Irgendetwas war hier bei uns, und keiner von uns würde lebendig aus dem Pod kommen.
3
Die Leute denken ja immer, wir Historiker sind alles Flachpfeifen. Sie meinen, wir sausen die Zeitlinie hoch und runter, dokumentieren ein paar Schlachten oder eine komische Revolution, springen dann zurück zum St. Mary’s-Institut und verbringen die Nacht in der Bar. In gewisser Hinsicht trifft diese Vorstellung zu. Allerdings: Wenn es mal schlecht für uns läuft, dann aber auch so … richtig … übel. Ich denke da an meinen Freund und Mitauszubildenden Kevin Grant, der auf seiner allerersten Mission getötet wurde. Oder an Anne-Marie Lower, die auf dem Boden ihres Pods saß, mit starrem Blick und blutverschmiert, während ihr Partner in ihren Armen starb. Aber das hier bei uns war das Schlimmste, was passieren konnte. Schlimmer noch als der Tod, denn unser Ende würde nicht rasch kommen, und es würde auch nicht leicht sein.
Wir waren kontaminiert.
Das sollte nicht passieren. Pods sollten mit fremden Objekten an Bord nicht springen können. Für den Fall, dass wir je versehentlich etwas mit in unseren Pod geschleppt hätten, würde er nicht springen. So einfach war das. Gott allein wusste, wie es zu dieser Situation hier gekommen war. Aber zweifellos war der Fall eingetreten, und wir saßen wirklich in der Scheiße. Die Regeln waren ganz eindeutig. Niemand würde diesen Pod verlassen. Jemals.
Und wir konnten ihn auch nicht wieder zurückbringen. Die Geschichte sagte eindeutig, dass Mary Kelly das letzte Opfer von Jack the Ripper gewesen war. Nach der heutigen Nacht war er verschwunden. Und nun wussten wir auch warum. Also konnten wir nicht – so mir nichts, dir nichts – nach Whitechapel zurückspringen und ihn einfach aus dem Pod werfen, damit er weiterhin sein Unheil treiben konnte. Und selbst wenn wir das hätten tun können, hätten wir es nicht getan.
Ich sah Kal an, die offenkundig zu demselben Schluss gekommen war wie ich. Sie schenkte mir ein kleines trauriges Lächeln, und nach einer nur winzigen Pause sagte sie leise: »Würdest du so freundlich sein, Max?«, und steckte ihre Hände in ihren Muff.
Ich aktivierte die Außenlautsprecher und die Innenkameras, sodass sie draußen sehen konnten, was vor sich ging. Was auch immer hier bei uns war, sollte nicht ahnen, dass wir Bescheid wussten, und so sagte ich langsam und ruhig: »Darf ich um Aufmerksamkeit bitten. Hier ist Pod fünf. Hier ist Pod fünf. Code blau. Code blau. Code blau. Ich wiederhole: Hier ist Pod fünf, der Code blau meldet. Autorisation Maxwell, fünf, null, alpha, neun, acht, null, vier, bravo. Dies ist keine Übung.« Ich lehnte mich zurück, ließ das Mikro aber eingeschaltet.
»Los geht’s, Max«, sagte Kal leise und stand auf. Auch ich erhob mich, und wir beide bewegten uns vorsichtig, ganz vorsichtig zur Tür, wo wir uns umdrehten und zurück in den Pod blickten, die Rücken geschützt, Schulter an Schulter. Als ob uns das viel bringen würde.
Kal nahm all ihren Mut zusammen und sagte in scharfem Befehlston: »Zeig dich. Wir wissen, dass du da bist. Zeig dich.«
Er war nicht unsichtbar. Aber es gibt Mittel und Wege, nicht zu sehen zu sein. Irgendetwas an unserer Wahrnehmung änderte sich. Es war, wie wenn man lange auf farbige 3-D-Punkte starrt und plötzlich feststellt, dass man eine Giraffe sieht, die auf einem Fahrrad fährt. Nichts verändert sich, aber mit einem Mal kann man es erkennen.
Und jetzt sahen wir ihn.
Er war groß und dürr und wie ein Mann gebaut. Eine ungesunde grauweiße Blässe. Ein blutleeres Ding. Die feuchte Haut glänzte im harten Licht des Pods. Er erinnerte mich an eine weiße Nacktschnecke, nur dass die fleischig sind. Dieses Ding hier hatte nirgends Fleisch, stattdessen riesige Hände, gewaltig wie Schaufeln. An den dicken gelben Nägeln klebte überall das getrocknete Blut von Mary Kelly. Lange Arme baumelten rechts und links vom Körper und reichten bis zu den Knien; die Handflächen waren nach hinten gedreht. Die Augen waren dunkel und tief eingesunken, sodass sie hinter Falten von feuchter Haut beinahe verschwanden. In ihnen spiegelte sich nichts – das Licht wurde aufgesogen, aber nicht zurückgeworfen. Ein Eingang in nur eine Richtung, der in etwas Entsetzliches führte. Die Proportionen des Gesichts waren völlig falsch. Der zu groß geratene Mund markierte die Hälfte des Gesichts. Das Kinn war lang und spitz, aber nicht mittig, genauso wenig die Nase, die sich versetzt auf einer Seite befand und keine Scheidewand hatte. Dieses Ding war etwas, das man falsch zusammengebaut hatte. Ich konnte verfaulte Erde riechen. Mein Magen krampfte sich zusammen. Ich umklammerte meine Betäubungswaffe mit der einen Hand und das Pfefferspray mit der anderen, aber meine trotzige Verteidigungshaltung war nur Show. Vor uns stand das, was als Jack the Ripper bekannt war, und sein Ruf sprach für sich selbst. Es gab keinen Ausweg für uns, und es würde schlimm werden. Kal sprach als Erste, und ihre Stimme war fest und furchtlos. Noch nie hatte ich sie tiefer bewundert. »Kannst du mich verstehen?«
Das Ding ruckte mit dem Kinn nach unten.
»Dann hör mir genau zu. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du getan hast. Sieh dich um. Du bist in einem Pod gefangen, den du niemals wieder verlassen wirst. Niemand wird lebendig aus diesem Pod herauskommen. Hast du das verstanden?«
Wieder senkte sich kurz das Kinn.
»Du hast meine Kollegin gehört. Sie hat Code blau ausgerufen. Das bedeutet, dass wir kontaminiert sind. Dieser Pod untersteht nicht länger unserer Kontrolle. Wir können die Tür nicht öffnen. Wir können hier nicht hinausgelangen. Du kannst nicht raus. Wir werden alle hier drinnen sterben. Hast du das begriffen?«
Er zischte.
Ich deutete auf den Bildschirm. »Da, schau.«
Das Ding beugte sich vor, und ich nutzte die Gelegenheit, um einen halben Schritt näher zu rücken. Draußen waren alle Leute von der Technik verschwunden. Sie hatten die Lichter gedimmt, sodass nur noch ein blauer Schein übrig geblieben war. Ein doppelter Kreis aus Sicherheitsleuten mit Chemikalienschutzanzügen stand um den Pod herum. In der vorderen Reihe knieten sie, die hintere Reihe stand. Alle hatten schwere Waffen im Anschlag, die sie direkt auf uns gerichtet hielten.
Das Ding nickte mit dem Kinn.
»Sie können nicht herein«, log ich. »Dieser Pod ist unzerstörbar. Sie sind nur aus einem einzigen Grund hier: um alles und jeden beim Versuch, den Pod zu verlassen, totzuschießen. Sie verfügen über eine Feuerkraft, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Falls es dir doch irgendwie gelingen sollte hinauszugelangen, werden sie dich abknallen. Und mich. Und meine Kollegin. Alles in diesem Pod ist dem Untergang geweiht. Hast du das verstanden?«
Zum ersten Mal schüttelte das Ding den Kopf.
»Ich denke nicht.«
Die Stimme war tief, dumpf und zischend, mit einem leichten Akzent. Er hatte Schwierigkeiten beim Sprechen. Seine Zunge war lila und viel zu groß für seinen Mund. Gelbe und braune Spucke war in den Mundwinkeln getrocknet und verkrustet. Der Gedanke, dass seine Lippen mich berühren könnten, war unerträglich.
Er sprach weiter. »Ich denke, sie werden nicht gerne zusehen, wie so hübsche Mädchen … leiden. Ich denke, wenn ihr beide genug gekreischt habt, werden sie schon bereit sein, die Tür zu öffnen. Vor allem, wenn sie hören, wie ihr fleht.«
Kal schüttelte den Kopf. »Das wird nicht geschehen. Diese Tür wird sich nie wieder öffnen. Es gibt hier kein Essen und kein Wasser. Nach einer Woche werden wir tot sein, entweder durch deine Hand oder durch unsere eigene. Die Wachen werden sich nicht rühren. Sie werden dableiben, bis sie sich davon überzeugt haben, dass wir nicht mehr am Leben sein können. An jenem Tag werden sie diesen Pod nehmen und ihn für immer und ewig verbuddeln. Er wird unser Grab sein. Ich weiß nicht, was du bist, und auch nicht, ob du sterben kannst oder nicht, aber ich hoffe für dich, dass du das kannst, denn ansonsten wirst du bis in alle Ewigkeiten in dieser winzigen Kiste festsitzen, ganz allein in der Kälte und der Dunkelheit. Du hättest uns nicht hier hineinfolgen sollen. Das war ein großer Fehler. Hast du das verstanden?«
Er ruckte sein Kinn. »Das habe ich verstanden, aber ich stimme nicht zu. Ich schlage vor, dass wir die Sache testen.«
Plötzlich stand er vor uns. Ich hatte keinerlei Bewegung mitbekommen. Zwar schaffte ich es, meine Betäubungspistole hochzureißen, aber sie wurde mir aus den Händen geschlagen, ehe ich abdrücken konnte. Derselbe Schlag beförderte mich seitlich zu Boden. Ich rollte mich zusammen und hörte Kal schreien. Ihre Waffe ging los. Ich sah, wie das Ding, das wir mitgebracht hatten, den Arm hob und ihn niedersausen ließ, ihn hob und erneut mit ihm zuschlug, Haut zerfetzend und Wunden schlagend. Kal schrie wieder. Ich riss den Feuerlöscher von der Wand und donnerte ihn ihrem Angreifer seitlich gegen den Kopf. Etwas knirschte, aber es hatte keine weiteren Auswirkungen. Kal beschrieb einen Bogen mit dem Arm, und ich hörte, wie eine Flasche zerbarst.
Rasch hob ich eine Hand an meinen Hinterkopf und zog eine lockere Haarnadel heraus. Diese wollte ich dem Ripper ins Ohr rammen, aber er drehte seinen Kopf, und so landete sie stattdessen in einem seiner Augen. Ich konnte das nicht als eigenen Erfolg verbuchen, denn er selbst hatte sich das zugefügt. Er stieß eine schrille, kreischende Art von Schrei aus und taumelte rückwärts, während seine plumpen Hände durch die Luft ruderten. Mit einem kurzen Hub aus meinem Pfefferspray direkt in sein verletztes Auge gab ich ihm den Rest. Dachte ich.
Wieder jammerte er, ging aber dann auf mich los. Ich sah nichts, aber plötzlich brannte mein Gesicht wie verrückt. Ich glaubte, er hätte mit dem Wasserkocher nach mir geworfen, denn ich spürte, wie mir heiße Flüssigkeit übers Gesicht lief und mich verbrühte. Sein Atem stieg mir in die Nase, und ihm hing die Zunge aus dem Mund. Ich war mir sicher, dass das mein Ende war, als Kal vom Fußboden aus heiser ausstieß: »Jetzt.« Sie umschlang seine Beine unmittelbar unter den Knien mit ihren Armen. Ich versetzte ihm einen kräftigen Stoß, und er stürzte zu Boden, wo er hart aufschlug. Sein Aufprall sorgte dafür, dass sich eine Schranktür öffnete, und wie durch einen Nebel entdeckte ich dort die Feuerwehraxt.
Wieder packte ich den Feuerlöscher und ließ ihn aus Hüfthöhe in sein Gesicht krachen. Der Ripper jaulte auf, und sein gebrochener Kiefer öffnete und schloss sich. Seine Arme hieben auf Kals Rücken, durchdrangen Stoff und Fleisch und gruben sich bis zu den Knochen durch. Sie schrie immer weiter, ließ aber nicht los. Stattdessen hielt sie ihn unbeirrt umklammert und hinderte ihn daran, sich frei zu bewegen, so gut sie konnte. Sie war meine Freundin, und sie ließ nicht los.
Mit zitternden Händen griff ich ungeschickt nach der Feuerwehraxt im Schrankfach.
Es ist in Wahrheit gar nicht so einfach, wie man denkt, jemandem den Kopf abzuschlagen. Ich schwang wild die Axt, konnte aber nicht richtig sehen. Zweimal hackte ich mir beinahe meinen eigenen Fuß ab. Elf Schläge brauchte ich! Ich hatte sie gezählt. Jeden einzelnen. Überall war Blut. Unser Blut. Das von Kal und mir. Kal war darin wie gebadet. Ich konnte die Farbe ihrer Haare nicht mehr erkennen. Eigentlich war ich mir nicht mal mehr sicher, ob sie noch am Leben war. Meine ganze Vorderseite war rot von frischem, nassem Blut. Ich hatte keine Ahnung, wo diese großen Mengen herkamen. Ich wusste noch nicht, dass eine Hälfte meines Gesichts herunterhing.
Beim elften Hieb löste sich der malträtierte Kopf vom Körper. Eine kleine Menge von dicker bräunlicher Flüssigkeit suppte träge aus dem Torso, wurde aber beinahe sofort runzlig und fest. Vom Geruch wurde mir übel.
Plötzlich war alles still.
Ein leises Stöhnen von Kal holte mich in die Realität zurück. Ohne die Axt loszulassen, zog ich ein Kissen aus einem Regalfach und gab es ihr, damit sie sich drumherum zusammenkrümmen konnte.
»Drück ganz fest, Kal, versuch, die Blutung zu stillen.« Sie war leichenblass, nickte aber kaum merklich. Noch war sie bei mir.
Ich trat einen Schritt zurück und versuchte tunlichst, die Lache aus klebriger Flüssigkeit zu meiden. Dann lehnte ich mich gegen eine Wand, meine Brust hob und senkte sich mühsam in diesem elendigen Korsett, und ich versuchte, einen Plan zu machen. Mich überkam die vage Vorstellung, die Koordinaten neu einzugeben, um uns irgendwohin zu bringen, zum Beispiel in die Kreidezeit, wo wir den Ripper einfach aus dem Pod werfen könnten. Das letzte bisschen Zeit, das mir noch blieb, wollte ich nun wirklich nicht mit diesem Ding zusammen verbringen – auch wenn es neben mir verrotten würde. Allerdings hatte ich ja gar keine Kontrolle mehr über den Pod. Wir würden hier drin sterben. Wir konnten nicht hinaus.
Unschlüssig drehte ich mich um und sah auf den Bildschirm. Das gesamte Team von der Sicherheit war noch da – niemand hatte sich bewegt. Der Boss, Dieter, Peterson – sie alle würden vom Monitorraum aus zusehen. Ich dachte kurz an sie, auch an Leon Farrell – was mochte er in diesem Augenblick empfinden? Doch ich konnte es mir nicht leisten, jetzt darüber nachzugrübeln, also drehte ich mich wieder zurück zum Inneren des Pods.
Und dann, o Gott, kam der schlimmste Moment von allen.
Gerade als ich hinschaute, rollte der Kopf, der ein gutes Stück vom Körper entfernt gelegen hatte und an dem noch immer eine meiner Haarnadeln zu sehen war, die aus einem Auge herausragte, von selbst zurück. Zurück zum Körper. Das verbliebene Auge öffnete sich, entdeckte mich, und ganz leicht verzogen sich die Lippen im Gesicht zu einem Lächeln.
Es hatte einige böse Momente in meinem Leben gegeben, und noch weitere sollten folgen, aber dies war der allerschlimmste, weil mir plötzlich dämmerte, dass das einfach nur ein Teil des Spiels war. Dies waren nur die Eröffnungszüge. Ich schaute mich in dem blutbesudelten Pod um, sah Kalinda, die ohnmächtig und wahrscheinlich hier vor meinen Füßen sterbend dalag, und ließ den Blick dann wieder zurück zu diesem Ding wandern, das sich nicht töten ließ. Das war es. Das war die Hölle. Es gab keinen Ausweg. Wir würden für alle Ewigkeit verdammt sein. Und es waren erst fünfzehn Minuten vergangen.
Die Waffe! Irgendwo in diesem Schlachthaus befand sich Kals Waffe. Uns blieb keine Hoffnung aufs Überleben, aber ich konnte unser Ende ein gutes Stück leichter machen. Ich würde Kal erschießen und dann mich selbst. Dann konnten sie den Pod verscharren oder im Meer versenken, und dann wäre alles vorbei.
Ich tastete mit einer Hand herum, ungeschickt, denn ich wollte meine Augen nicht länger als eine Sekunde von diesem … was auch immer es war … abwenden, und ich wollte auch nicht meine Axt loslassen. Schließlich fand ich die Waffe, die unter meinen Sitz getreten worden war. Nur ein Schuss war bislang daraus abgefeuert worden.
Ich stand über Kal, verdrängte jeden Gedanken aus meinem Kopf und empfahl unsere Seelen dem Gott der Historiker.
Irgendetwas knisterte, und ich bildete mir ein, eine Stimme sagen zu hören: »Max, zurück! Weg mit der Waffe.«
Ich verstärkte meinen Griff und blinzelte die Tränen weg. Jetzt nur nicht schwach werden.
Die Tür ging auf. Vier Wachen mit Sturmhauben und entsprechend ausgerüstet waren zu erkennen; zwei standen, zwei knieten, die Waffen im Anschlag. Sie drehten sich hin und her und hatten jeden Zentimeter des Pods im Blick.
Major Guthrie rief: »Max, ich bin es, Ian. Leg die Waffe weg.« Vorsichtig watete er durch das Blut, ging zur Toilette und riss die Tür auf. Ein anderer Wachmann nahm augenblicklich seinen Platz ein. Gemeinsam bildeten sie eine undurchdringliche Barriere vor der Tür. Nichts konnte hinausgelangen.
Major Guthrie brüllte: »Gesichert«, legte sich seine Waffe auf die Schulter, beugte sich über Kal und fühlte nach ihrem Puls. »In Ordnung, schaffen wir sie raus.«
Zwei Männer kamen herein, hoben Kal auf und trugen sie nach draußen. Ich sagte: »Pass auf, dass du nicht in seinem Blut stehst«, aber später wurde mir berichtet, dass ich nur eine Reihe von unverständlichen Lauten ausgestoßen hätte.
Der Major baute sich vor mir auf. »Max, ich bin’s, Ian. Lass die Waffe und die Axt los.«
Ich versuchte immer wieder zu sehen, was hinter ihm passierte. Ich durfte meine Augen nicht von diesem Kopf lösen, und ich versuchte, ihm das zu erklären.
Schließlich fragte er: »Was ist denn?«, und nun probierte ich, ihm mit den Augen ein Zeichen zu geben.
Er drehte sich um und sagte: »Er ist sehr, sehr tot, Max. Er wird nie wieder irgendjemandem irgendetwas zuleide tun.« Doch dann, Gott sei Dank, bewegte sich der Kopf genau in dem Augenblick wieder, als er hinsah. Es war nur eine winzige Bewegung, die den Kopf näher an den Körper heranrückte.
Eine ganze Minute lang stand Major Guthrie wie angewurzelt da, dann fragte er in einer ganz anderen Tonlage: »Wo ist die Axt?« Einmal, zweimal und ein drittes Mal schlug er damit zu; es waren gewaltige Hiebe mit der ganzen Kraft seines Körpers dahinter. Wir beide starrten auf den zermalmten Überrest des Kopfes. Doch selbst dann noch war ich nicht beruhigt. Major Guthrie ebenso wenig.
»Ich werde mich um all das hier kümmern, Max. Aber erst wollen wir dich hier rausschaffen. Überlass den Rest mir.«
Ich wollte noch etwas über Kontamination hinzufügen, aber er sagte: »Du vertraust mir doch, dass ich das erledige, oder?«
Ich nickte.
Er trug mich aus diesem stinkenden Pod hinaus, durch einen Plastikschlauchgang hinein in einen kleinen isolierten Behandlungsraum und an die wunderbare, berauschende frische Luft.
Ich konnte Kal nicht sehen, denn da waren so viele Menschen, die sich über sie beugten. Sie war an alle möglichen Infusionsbeutel und Maschinen angeschlossen. Die Leute um sie herum arbeiteten ruhig, aber effektiv. Das blutige Kissen lag auf dem Fußboden, umgeben von vollgesogenen Verbänden. Das Ärzteteam schnitt ihre Kleidung auf. Gestalten in Ärztekluft und mit Mundschutz tauchten rings um mich herum auf und versperrten mir die Sicht. Jetzt war ich dran.
Jemand sagte: »Mach die Augen zu«, und ich spürte, wie kalte Flüssigkeit über mein Gesicht rann.
Eine andere Stimme sagte: »Immer weiterspülen. Nicht aufhören.«
Ich erkannte Schwester Hunter. Dr. Foster musste bei Kal sein. Hunter beugte sich über mich. »Hallo, Max, was hast du denn dieses Mal wieder angestellt? Alles ist gut. Wir müssen nur mal nachgucken.«
Auch meine Kleidung wurde aufgeschnitten. Mrs. Enderby, die Leiterin der Garderobe, würde nicht sehr gut auf uns alle zu sprechen sein. Ich versuchte, ihnen zu sagen, dass sie alles eintüten sollten, aber keiner hörte mir zu, und außerdem befand ich mich ja schließlich in einem Isolationszelt. Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass sie alles sorglos wegwerfen würden. Vermutlich sollte ich sie einfach ihre Arbeit machen lassen. Ich begann zu zittern.
»Okay, wir brauchen ein paar Wärmeeinheiten hier. Legt ihre Füße hoch. Halt durch, Max.« Stimmen schwollen an und verstummten, so wie es klingt, wenn man vor dem Fernsehgerät eindöst.
»Schnitte und Abschürfungen an ihren Vorderarmen – vermutlich Abwehrwunden. Einer davon ist wirklich tief. Zwei tiefe Risse an ihrem linken Knöchel und einige kleinere Schnitte im Bauchbereich. Nichts allzu Ernstes, Max. Du solltest heilfroh über dieses Korsett sein. Wir sollten uns wirklich von unseren schusssicheren Westen verabschieden und auf Fischbein umsteigen.«
Ich weiß nicht, warum sich die Leute vom Ärzteteam immer für so witzig halten. Einmal war ich zu einer Ohrenuntersuchung, und Helen schwor, sie würde ein Echo hören. Wie lustig war das bitte? Helen schob Hunter beiseite und sagte, während sie sich ihre Handschuhe auszog: »Sie ist noch bei uns, Max. Wir bringen sie jetzt nach oben.« Ich sah, wie ihre Blicke kurz zu Hunter huschten, die ganz leicht den Kopf schüttelte.
»Reg dich nicht auf. Du hast ein paar schlimme Schnitte im Gesicht. Wir halten sie sauber, und Dr. Bairstow will, dass wir dich in die große Abteilung für plastische Chirurgie in Wendover schicken. Alles ist hier unter Kontrolle. Du konzentrierst dich jetzt auf dich.«
Nebel wallte auf und schwirrte wie ein Seidentuch um mich herum. Ein T-Rex senkte seinen furchteinflößenden Kopf, sah mich an, entschied, dass sich bei mir die Mühe nicht lohnte, und trottete davon. Er wurde von Major Guthrie ersetzt, der sagte: »Sie sind auf dem Weg – noch zehn Minuten.« Dann sagte mein Vater: »Hallo, Madeleine.« Ich kämpfte und strampelte, um wegzukommen.
Mrs. Partridge erschien auf der Bildfläche. Sie trug eine weiße Robe, und ihr dunkles Haar wurde mit einer silbernen Spange zusammengehalten. Alles andere war nur schemenhaft zu erkennen, aber sie sah ich klar und deutlich. Wenn Kleio, die Muse der Geschichte, hier war, dann musste die Lage ernst sein. Ich fragte: »Bin ich tot?«