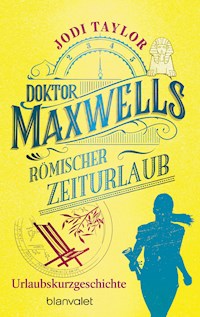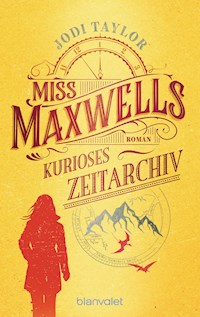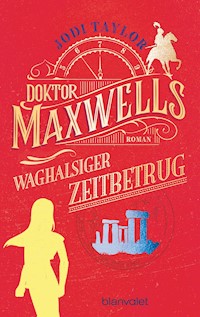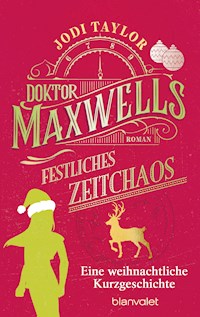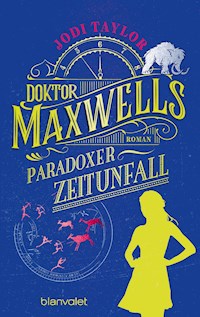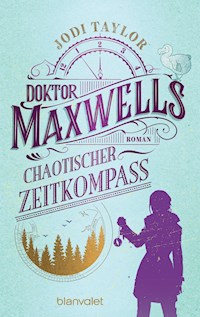9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken von St. Mary’s
- Sprache: Deutsch
Was ist schlimmer als ein Firmenfest zu organisieren? Sie können sich auch nichts vorstellen? Dann lesen Sie den fünften Roman um Doktor Maxwell!
Madeleine »Max« Maxwell befürchtet, dass ihr Leben demnächst sehr trist und langweilig wird. Denn ihr wurde die ehrenvolle Aufgabe aufgezwungen, den Tag der offenen Tür von St. Mary’s zu organisieren. Das Event muss ein Erfolg werden – nicht dass ihr Chef Druck aufbauen würde …
Zum Glück kommt alles ganz anders, als fast die gesamte Crew der zeitreisenden Historiker im London des 17. Jahrhunderts verschwindet. Max bricht auf, um ihre Kollegen zurückzuholen. Das Fest vorzubreiten und die Welt zu retten, verschiebt sie eben auf später. Ist ja kein Problem für eine Zeitreisende – hoffentlich …
Die spektakulären und unabhängig voneinander lesbaren Abenteuer der zeitreisenden Madeleine »Max« Maxwell bei Blanvalet:
1. Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv
2. Doktor Maxwells chaotischer Zeitkompass
3. Doktor Maxwells skurriles Zeitexperiment
4. Doktor Maxwells wunderliches Zeitversteck
5. Doktor Maxwells spektakuläre Zeitrettung
6. Doktor Maxwells paradoxer Zeitunfall
E-Book Short-Storys:
Doktor Maxwells weihnachtliche Zeitpanne
Doktor Maxwells römischer Zeiturlaub
Doktor Maxwells winterliches Zeitgeschenk
Weitere Bände in Vorbereitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Madeleine »Max« Maxwell befürchtet, dass ihr Leben demnächst sehr trist und langweilig wird. Denn ihr wurde die ehrenvolle Aufgabe aufgezwungen, den Tag der offenen Tür von St. Mary’s zu organisieren. Das Event muss ein Erfolg werden – nicht dass ihr Chef Druck aufbauen würde …
Zum Glück kommt alles ganz anders, als fast die gesamte Crew der zeitreisenden Historiker im London des 17. Jahrhunderts verschwindet. Max bricht auf, um ihre Kollegen zurückzuholen. Das Fest vorzubreiten und die Welt zu retten verschiebt sie eben auf später. Ist ja kein Problem für eine Zeitreisende – hoffentlich …
Autorin
Jodi Taylor war die Verwaltungschefin der Bibliotheken von North Yorkshire County und so für eine explosive Mischung aus Gebäuden, Fahrzeugen und Mitarbeitern verantwortlich. Dennoch fand sie die Zeit, ihren ersten Roman »Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv« zu schreiben und als E-Book selbst zu veröffentlichen. Nachdem das Buch über 60 000 Leser begeisterte, erkannte endlich ein britischer Verlag ihr Potenzial und machte Jodi Taylor ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte. Ihre Hobbys sind Zeichnen und Malerei, und es fällt ihr wirklich schwer zu sagen, in welchem von beiden sie schlechter ist.
Die spektakulären und unabhängig voneinander lesbaren Abenteuer der zeitreisenden Madeleine »Max« Maxwell bei Blanvalet:
1. Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv
2. Doktor Maxwells chaotischer Zeitkompass
3. Doktor Maxwells skurriles Zeitexperiment
4. Doktor Maxwells wunderliches Zeitversteck
5. Doktor Maxwells spektakuläre Zeitrettung
6. Doktor Maxwells paradoxer Zeitunfall (in Planung)
E-Book Short-Storys:
Doktor Maxwells weihnachtliche Zeitpanne
Doktor Maxwells römischer Zeiturlaub
Doktor Maxwells winterliches Zeitgeschenk
Weitere Bände in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Roman
Deutsch von Marianne Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »No Time Like the Past (The Chronicles of St. Mary’s Book 5)« bei Accent Press, Cardiff Bay.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2015 by Jodi Taylor
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Werner Bauer
Umschlaggestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com (adamcarl90; TRONIN ANDREI)
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-27969-1V002
www.blanvalet.de
Für den besten Haufen loyaler und begeisterter Fans, den sich eine Autorin nur wünschen kann. Das St. Mary’s dankt für eure Unterstützung und Ermutigung während der letzten vier Episoden. Dieser Band, also Buch 5, ist euch allen gewidmet.
Prolog
Es war mir schon immer etwas merkwürdig vorgekommen, dass ein so altes Gebäude wie das des St.-Mary’s-Instituts keinen Geist beherbergen sollte.
Keinen kopflosen Mönch.
Keine graue Dame.
Keinen finsteren Schatten, der die Flure heimsucht und murmelnd mit Rache und Vergeltung droht, sodass einem das Blut in den Adern gefriert. Natürlich ist damit nicht Dr. Bairstow gemeint, der das Formular Lohnabzug zum Schadensausgleich verteilt. Als Markham also behauptete, er habe einen Geist gesehen, glaubte ihm niemand, und der Grund dafür, dass ihn niemand ernst nahm, war der, dass Markham die einzige Person war, die diesen Geist je zu Gesicht bekommen hatte.
Dann passierte es wieder.
Und dann erneut.
Und noch mal …
Und noch immer bemerkte niemand sonst etwas. Niemand außer Markham, der in mein Büro gestürzt kam, so aufgelöst, wie ich ihn noch nie erlebt hatte, und von etwas faselte, das kein anderer sehen konnte.
Was wir damals nicht begriffen: Der Grund, warum Markham als Einziger den Geist sehen konnte, war der, dass er selbst der Geist war.
Eins
Eine weitere Vollversammlung fand für die Belegschaft statt, angesetzt von Dr. Bairstow. Die erste seit unseren Scherereien mit der Zeitpolizei im letzten Sommer. Aber immerhin war diese Truppe verschwunden, und wir waren immer noch hier, der Großteil des Gebäudes war bereits renoviert worden und das St. Mary’s also wieder einsatzbereit.
Wir arbeiten im Institut für Historische Forschung im St.-Mary’s-Stift. Dort untersuchen wir größere historische Ereignisse in zeitgenössischer Umgebung. Um Himmels willen – man nenne es nicht Zeitreise. Die letzte Person, die das tat, bekam eins über den Schädel und wurde versehentlich die Treppe hinuntergestoßen.
Jedenfalls hatte sich das Gebäude von allen zugefügten Blessuren erholt, genau wie wir von unseren Verletzungen, und hier waren wir alle wieder und litten unter den Ausdünstungen von neuem Holz, feuchtem Gips und frischer Farbe. Nicht die besten Gerüche der Welt, aber immer noch eine enorme Verbesserung gegenüber Kordit, Blut und Niederlage.
Tim Peterson und ich saßen in der ersten Reihe und hatten Mienen von wildem Enthusiasmus und praktisch absoluter Hingabe aufgesetzt. Früher einmal hätten wir ganz hinten gehockt und Schiffe versenken gespielt, aber die leitenden Mitarbeiter mussten vorne Platz nehmen und Bereitschaft signalisieren. Das machte die Zerstörung der gegnerischen Flotte viel schwieriger, aber wir waren bereit, uns der Herausforderung zu stellen.
Und da kam auch schon der Boss. Er hinkte bis zum Treppenabsatz und blieb dort in seiner üblichen Haltung, schwer auf seinen Gehstock gestützt, stehen. Die kalte Wintersonne fiel durch das frisch erneuerte Oberlicht direkt über ihm, während er sein versammeltes Institut mit dem Blick eines ungeduldigen Geiers bedachte, der ein verendendes Gnu belauert und endlich zuschlagen will.
»Guten Morgen allerseits. Danke, dass Sie gekommen sind.«
Als ob wir irgendeine Wahl gehabt hätten.
»Wie Sie sehen können, nimmt St. Mary’s von heute 10.00 Uhr an die Arbeit wieder auf.«
Es gab höflichen Beifall. Die meisten von uns hatten die letzten drei Wochen richtig rangeklotzt, um die Bibliothek und das Archiv neu aufzubauen und überhaupt dabei zu helfen, das Gebäude wieder in Schuss zu bringen. Deshalb spielte es für den Großteil von uns keine große Rolle, ob das Institut nun geöffnet war oder nicht.
»Es gibt ein paar Veränderungen bei den Mitarbeitern zu verkünden. Wenn Sie bitte so nett wären, sich die Organigramme anzusehen, die zu Beginn dieser Versammlung von Mrs. Partridge verteilt worden sind …« Er machte eine kurze Pause für die traditionelle Panik all derer, die ihre Kopien bereits verbummelt hatten. Peterson und ich nutzten unsere Unterlagen, um die Position der jeweils anderen Armada auszukundschaften.
»Zuerst möchte ich Dr. Maxwell in ihrer Funktion als Leitende Missionschefin bestätigen.«
Wieder wartete er ab. Ich konzentrierte meine ganze Aufmerksamkeit auf meine gefährdeten Schlachtschiffe und drückte mir im Geist die Daumen. Es gab kurz Beifall, und ich stieß einen erleichterten Seufzer aus. Letztes Jahr zu Weihnachten hatte es diese Episode gegeben, bei der Dr. Bairstow von einer seltenen durchzechten Nacht aus Rushford zurückgekehrt war und festgestellt hatte, dass er auf mysteriöse Weise zwei zusätzliche Historiker gewonnen hatte. Alles in allem betrachtet, sage ich mal, hatte er das ganz gut aufgenommen. Sie waren jetzt nicht mehr hier, sondern orientierten sich neu und versuchten, sich an der Thirsk-Universität einzugewöhnen – ein notwendiges Prozedere nach einer so langen Zeit der Abwesenheit. Sie waren zehn Jahre lang vermisst gewesen. Und Ian Guthrie, für den die eine aufgefundene Historikerin eine wirklich ganz besondere Bedeutung hatte, hatte mich eines Tages im Flur abgepasst, mir sehr fest die Hand gedrückt und gesagt: »Ich schulde dir was, Max.« Dann war er schnell weitergegangen, ehe einer von uns beiden eine unschickliche Gefühlsregung hätte zeigen können.
Dr. Bairstow fuhr fort. »Dr. Peterson kehrt auf seinen ursprünglichen Posten als Leitender Ausbilder zurück. Chief Farrell nimmt seine Arbeit als einer der beiden Chefs der Technischen Abteilung wieder auf, und zwar an der Seite von Mr. Dieter. Miss Perkins wird zur Leiterin der IT-Abteilung ernannt und ersetzt damit Miss Barclay, die uns … verlassen hat.«
Ja, das hatte sie, verdammt noch mal. Sie war in dem allgemeinen Durcheinander entkommen, das entstanden war, als die Küchenbelegschaft das Gebäude mit mehlgefüllten Kondomen in die Luft gejagt hatte. Lange Geschichte. Allerdings war ein zerstörtes Gebäude ein kleiner Preis dafür, dass wir uns von Bitch Barclay befreit hatten. Bedauerlicherweise war sie nicht endgültig verschwunden, sondern steckte immer noch irgendwo da draußen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder aufeinandertreffen würden. Sie hatte mir eine entsprechende Notiz hinterlassen.
Dr. Bairstow sprach weiter. »Ich möchte gerne Mr. Markham zu seiner Beförderung zur Nummer zwei der Sicherheitsabteilung gratulieren.«
Nein, ich hätte nie gedacht, dass er es über sich bringen würde, die Worte Nummer zwei und Mr. Markham im selben Satz zu benutzen. Es war, als ob er das Unglück herausforderte. Markham setzte sich kerzengerade hin und strahlte ihn freudig an. Seine Haare standen wie üblich in unregelmäßigen Büscheln ab. Er sah aus, als würde er wegen Räude behandelt. Und zwar keineswegs zum ersten Mal.
»Mrs. Partridge wird als meine persönliche Assistentin bestätigt, und Miss Lee kehrt auf ihren früheren Posten als Verwaltungsassistentin der Historischen Abteilung zurück.«
Die Historische Abteilung seufzte. Und ich ganz besonders. Ja, da saß sie, zwei Reihen weiter, und ihr kurzes, dunkles Haar wellte sich um ihren Kopf wie Medusas Schlangen, allerdings etwas furchteinflößender. Sie selbst bedachte die Versammelten mit ihrem starren Gorgonenblick, und sofort verstummten alle.
»Ganz besonders möchte ich unseren zurückgekehrten Hausmeister, Mr. Strong, begrüßen.«
Dieses Mal war der Applaus stürmisch und echt. Mr. Strong war ein alter Mann, und letztes Jahr hatte er alle Anweisungen missachtet, hatte sich seine Orden ans Revers geheftet und war angetreten, um für St. Mary’s zu kämpfen. Er war dabei verwundet worden – das waren wir alle. Einige von uns waren gestorben. Der Boss hatte ihn zur Genesung fortschicken wollen, aber er hatte sich höflich zu gehen geweigert und seine Zeit stattdessen damit zugebracht, in den Ruinen der Großen Halle herumzustapfen. Dort hatte er den Bauarbeitern mitgeteilt, was sie alles falsch machten, und hatte außerdem die GSHG, die Gesellschaft zum Schutz Historischer Gebäude auf die Palme gebracht, deren Leute eigentlich dafür da waren, die Reparaturen zu überwachen. Sie hatten sich beschwert, woraufhin ihnen Dr. Bairstow in einigen wohl gewählten Worten, die man überall im St. Mary’s hören konnte, verklickert hatte, dass Mr. Strong einer seiner meistgeschätzten Mitarbeiter sei und dass seine langen Jahre im St.-Mary’s-Institut ihn zu einer führenden Autorität in Fragen des Gebäudes und allem darin gemacht hätten. Sie hatten die Botschaft kapiert. Mr. Strong hatte sich jedoch als Zeichen seines guten Willens darauf eingelassen, einen zweiwöchigen Besuch bei seinen Enkeln einzuschieben.
»Mr. Strong hat mich gebeten, Sie daran zu erinnern, dass sich dieses Gebäude jetzt in einer besseren Verfassung als zu irgendeinem früheren Zeitpunkt in seiner langen Geschichte befindet, und erst recht, seitdem wir hier eingezogen sind. Deshalb wäre Mr. Strong Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die größten Anstrengungen unternehmen könnten, dass das auch so bleibt. Und ich wüsste das ebenfalls zu schätzen.«
Er machte eine Pause, um seine Worte auf uns wirken zu lassen, und mittendrin flüsterte Peterson:
»B6.«
»Daneben.«
»Der normale Betrieb soll so bald wie möglich wieder aufgenommen werden. Die Historische Abteilung wird mir bis morgen ihren Plan mit den anstehenden Missionen und Empfehlungen vorlegen.«
»B7.«
»Mist!«
»Dr. Foster, bitte bestätigen Sie mir, dass das gesamte Personal aus medizinischer Sicht bereit ist, an die Arbeit zurückzukehren. Oder dass jeder wenigstens so fit ist, wie bestenfalls zu erwarten wäre.«
»B8.«
»Du schummelst doch, oder?«
»Die Technische Abteilung bestätigt bitte, dass alle Pods einsatzfähig sind.«
»B9.«
»Versenkt.«
»Dr. Peterson? Verfügen wir im Augenblick über irgendwelche Auszubildenden, oder haben die sich während unserer Unannehmlichkeiten im Laufe des Sommers in alle Winde zerstreut?«
»Nein und nein, Sir. Wir hatten auch schon vor diesen Schwierigkeiten keine Auszubildenden, ganz zu schweigen von danach. Unsere letzten Anwerbungsversuche waren … von keinem existenzfähigen Erfolg gekrönt.«
Dr. Bairstow seufzte ungeduldig. »Ich kann nicht verstehen, warum sich St. Mary’s so schwer damit tut, neue Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten.«
Vor meinem geistigen Auge sah ich die zerschmetterten Körper, halb unter Schutt begraben, das Blut überall, und ich hörte das Donnern der Explosionen …
»Bitte sammeln Sie Ideen und machen Sie Vorschläge dafür, wie wir künftiges Personal anlocken und, viel wichtiger, halten können. Bitte interpretieren Sie diese Anweisung nicht als Erlaubnis, mit Netzen und Seilen durch die Straßen zu ziehen und die Leute mit dem Königsschilling anzuwerben. Auch möchte ich keinerlei Versuche erleben, zukünftige Auszubildende an der Kündigung zu hindern, indem sie am Schreibtisch festgenagelt werden.«
»Sie erlegen uns unvernünftige Restriktionen auf, Sir, aber ich werde mein Bestes geben.«
Dr. Bairstow wandte sich nun einem anderen Thema zu, aber ich hatte Petersons Kreuzer aufgestöbert, die sich schlauerweise in der linken oberen Ecke seines A4-Ozeans versteckt hielten. Während der folgenden Zerstörungsorgie verpasste ich völlig, was der Boss als Nächstes sagte, und wurde erst wieder durch das traditionelle »Gibt es noch irgendwelche Fragen?« zurückgeholt, was Dr.-Bairstow-Sprech ist für »Ich habe Ihnen gesagt, was Sie zu tun haben, jetzt gehen Sie an die Arbeit.« Er war mal gezwungen worden, ein Seminar zu einfühlsamem Management zu besuchen, und in diesem hatte jemand all seinen Mut zusammengenommen und ihn darüber informiert, dass Mitarbeiter viel produktiver seien, wenn sie sich eingebunden und wertgeschätzt fühlten. Es war ganz offensichtlich, dass Dr. Bairstow nicht ein einziges Wort davon geglaubt hatte. Es gab nie irgendwelche Fragen.
»Dr. Maxwell, wenn Sie bitte einen Moment für mich erübrigen könnten. Danke schön an den Rest. Das war’s.«
Zurück in seinem Büro verschwendete er keine Zeit.
»Ich überlasse es Ihnen, den Zeitpunkt festzusetzen, Dr. Maxwell. Sie werden mir vermutlich zustimmen, dass ein Termin irgendwann im kommenden Sommer besonders passend wäre – gutes Wetter und so weiter. Natürlich wartet ein enormer Berg an Arbeit auf Sie, aber verteilen Sie sie, wie Sie es für richtig halten. Ich möchte wöchentliche Updates haben; ein kurzer Bericht über die Arbeitsfortschritte wird ausreichen. Holen Sie sich ins Boot, wen auch immer Sie brauchen. Im Laufe der nächsten paar Tage werde ich auch in der Lage sein, Ihnen die Details zum Budget mitzuteilen.«
Ich hatte nicht den geringsten Schimmer, wovon er sprach.
Mrs. Partridge hinter ihm lächelte wenig hilfreich vor sich hin.
»Ich bitte um Verzeihung, Sir?«
»Mrs. Partridge wird sich um die administrative Seite kümmern – Lizenzen, Genehmigungen, Versicherungen usw. Bitte versorgen Sie sie mit allen nötigen Einzelheiten.«
»Äh …«
Er reichte mir einen Aktenordner, der bereits aus allen Nähten platzte, und entließ mich mit den Worten: »Danke sehr, Dr. Maxwell.«
Mein tief ausgeprägter Historikerinnensinn sagte mir, dass ich irgendetwas verpasst hatte. Und dass der Boss das auch genau wusste. Es gab keinen Ausweg.
»Entschuldigung, Sir – könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen?«
Er seufzte, und wie jemand, der mit einem Schwachkopf spricht, sagte er: »Der Tag der offenen Tür.«
»Was denn für ein Tag der offenen Tür?«
»Der Tag der offenen Tür im St.-Mary’s-Institut.«
»Was? Wann?«
»Welchen Tag auch immer Sie dafür festlegen. St. Mary’s soll einen Tag der offenen Tür veranstalten, und Sie werden ihn organisieren.«
»Werde ich das? Wann ist das denn verkündet worden?«
»Vor ungefähr zwanzig Minuten, als Sie gerade einen von Dr. Petersons Kreuzern versenkt haben.«
Ich war wieder zurück in meinem frisch renovierten Büro. Die Fenster waren weit aufgerissen worden, aber der stechende Geruch von frischer Farbe ließ meine Augen trotzdem tränen. Der Gestank erinnerte mich an die Polyurethan-Vergiftung, die ich mal als Studentin hatte, als ich an einem Wochenende mein Zimmer gestrichen und nur ein rudimentäres Verständnis von den Worten ausreichende Lüftung gehabt hatte.
In umgekehrter Reihenfolge der Wichtigkeit nannte ich neuerdings einen ergonomischen Schreibtisch, einen neuen, schicken Stuhl und einen frisch erstandenen Teekessel mein Eigen. Bedauerlicherweise hatte ich auch Miss Lee am Hals, die mit zusammengekniffenen Augen auf ihren Bildschirm sah und wahrscheinlich mit ihrem medusenhaften Blick die Elektronik zum Erliegen brachte.
Mit einem lauten Knall ließ ich den Ordner auf meinen Tisch fallen und war drauf und dran, Miss Lee um einen Becher Tee zu bitten – ein weiteres Beispiel dafür, dass manchmal blinder Optimismus über die Erfahrung siegt –, als Markham in den Raum platzte.
»Max! Schnell! Es ist jemand vom Dach gefallen!«
Mit einem Satz war ich auf den Beinen und folgte ihm nach draußen. Wir rannten durch den Flur zum vorletzten Fenster am Ende. Anders als die anderen Fenster entlang des Ganges stand dieses offen. Markham steckte seinen Kopf nach draußen und lehnte sich bedenklich weit über den niedrigen Sims.
»Hier war es!«
Ich krallte meine Hand hinten in seinen grünen Jumpsuit und riss ihn wieder zurück.
»Immer schön vorsichtig, sonst liegen da gleich zwei Leute auf dem Kies …«
Aber da war gar nichts.
Ich sah nach links und nach rechts, doch es gab nichts zu entdecken. Der Efeu mit seinen kahlen Ranken bedeckte die Mauer, aber davon abgesehen gab es viele Meter weit keine weitere Vegetation. Ein breiter Kiesweg führte an dieser östlichen Seite vom St.-Mary’s-Institut entlang. Es gab nur diesen einen Weg und das mit Raureif überzogene Gras, das bis hinab zum See reichte. Das einzige Lebenszeichen waren ein paar unserer nicht ganz so arg traumatisierten Schwäne, die auf der gegenüberliegenden Seite des Sees herumwatschelten. Abgesehen davon war da – nichts.
Ich zog meinen Kopf wieder zurück.
»Wo denn?«
»Hier. Ich habe es gesehen. Sie sind an diesem Fenster vorbeigefallen. Aber als ich nachgeschaut habe, war da niemand.«
Ich machte mir nicht die Mühe zu fragen: »Bist du sicher?« Immerhin war das Markham. Er war zwar klein, ein bisschen schmuddelig und neigte zu Unfällen, aber er war beinahe unverwüstlich und sehr, sehr zäh. Und doch stand er hier vor mir, so bleich, dass ich die blauen Adern an seinen Schläfen bemerkte. Es gab keinen Zweifel, dass er etwas gesehen hatte.
Nun schob er seinen Kopf erneut durch die Fensteröffnung, vermutlich für den Fall, dass die Körper auf magische Art und Weise wiederaufgetaucht waren.
»Vielleicht haben sie sich nichts getan – oder sich nicht allzu schlimm verletzt«, sagte er. »Dann sind sie aufgestanden und haben sich Hilfe geholt.«
»Guter Gedanke.« Ich öffnete meine Kom-Verbindung und meldete mich bei Dr. Foster. »Helen – ist in den letzten zehn Minuten irgendjemand bei dir vorstellig geworden?«
»Nein. Warum?«
»Es besteht die Möglichkeit, dass jemand vom Dach gefallen ist.«
»Hör dich doch mal um. Besonders bei diesen Spinnern in der Abteilung Forschung und Dokumentation. Klingt ganz nach ihnen. Ich lass es dich wissen, wenn jemand aufkreuzt.«
Sie beendete die Verbindung.
Markham war so kurz davor, wütend zu werden, wie ich es noch nie bei ihm erlebt hatte.
»Es geht hier nicht um eine Möglichkeit. Ich weiß, was ich gesehen habe.«
»Was hast du denn gesehen? Erzähl mir jedes Detail.«
»Ich stand genau hier.«
Er schob mich zur Seite und stellte sich dahin, wo ich eben noch gewesen war.
»Vorhin war ich gerade auf dem Weg zu deinem Büro.«
Er tat so, als würde er losgehen, nur für den Fall, dass ich seinem Bericht nicht folgen konnte.
»Das Fenster befand sich zu meiner Linken. Als ich auf Höhe des Fensters war, fiel etwas Schwarzes an mir vorbei. Ich war so überrascht, dass ich mich sekundenlang nicht rühren konnte.«
Er mimte ein Ausmaß an Überraschung und Entsetzen, das jeden zu der Überzeugung geführt hätte, er hätte gerade mit ansehen müssen, wie ein Asteroid die Dinosaurier auslöschte.
»Dann habe ich das Fenster hochgeschoben, mich hinausgebeugt und … Und da war nichts.«
»Besteht die Chance, dass sie aufgestanden und weggerannt sind, ehe du die Gelegenheit hattest nachzusehen?«
»Weiß ich nicht. Ich habe ein Weilchen gebraucht, um das Fenster aufzubekommen, aber du hast es ja gerade selbst gesehen – hier gibt es nichts, um sich zu verstecken. Gut möglich, dass sie nicht tot waren, da sie nur auf Kies gelandet sind, aber das Gebäude ist immerhin drei Stockwerke hoch. Zumindest dürften sie sich den einen oder anderen Knochen gebrochen haben. Und warum sollten sie sich verstecken? Das ergibt keinen Sinn.«
Er sah wirklich völlig aus der Fassung geraten aus, was bei ihm eine Premiere war.
Langsam sagte ich: »Ich denke, dass dir jemand einen Streich gespielt hat. Irgendjemand steigt aufs Dach, dann werfen sie einen alten Dummy runter, und in der Zwischenzeit, während du dich abmühst, das Fenster aufzumachen und nach draußen zu schauen, beugt sich jemand im Erdgeschoss aus dem Fenster und holt das Ding wieder rein. Ich wette, die sind jetzt da unten und lachen sich kaputt, während sie darauf warten, dass du jeden Augenblick nach draußen geschossen kommst, um nach Leichen zu suchen.«
Sein Gesicht heiterte sich auf. »Natürlich. Diese Schweinebande! Aber ein guter Trick! Mir fällt mehr als nur ein Stein vom Herzen, eher ein ganzer Felsbrocken. Danke, Max.«
Er schlenderte davon, vermutlich, um es irgendwelchen noch unbekannten Personen heimzuzahlen, und ich machte mich auf den Weg zurück in mein Büro.
Am nächsten Tag war er wieder da, und dieses Mal war er nicht allein.
Sie marschierten zu zweit durch meine Tür. Peterson eskortierte Markham, der so aussah – auch wenn ich das nicht allzu sehr betonen sollte –, als ob er einen Geist gesehen hätte.
»Es ist schon wieder passiert«, brach es aus ihm hervor, und dafür, dass er in Major Guthries Tradition der präzisen Berichterstattung ausgebildet worden war, bekam man bemerkenswert wenige Einzelheiten genannt.
Immer schön der Reihe nach. Ich öffnete den Mund und wollte Miss Lee beauftragen, Markham mit einer dringend benötigten Tasse Tee zu versorgen. Sie hatte den Braten allerdings offenbar schon gerochen, schnappte sich wahllos zwei, drei Akten und sprintete mit der Ankündigung Richtung Tür, sie müsse den Postboten noch erwischen – der erfahrungsgemäß erst in ungefähr vier Stunden zur Abholung erscheinen würde.
Stattdessen kochte Peterson Tee für uns alle. Ich dachte kurz daran, etwas Tröstliches aus der untersten Schublade meines Schreibtisches dazuzuschütten, aber Markham war auch so schon durch den Wind.
»Ich habe es wieder gesehen, Max«, berichtete er. »Eine schwarze Gestalt ist am Fenster vorbeigefallen, und als ich nach draußen guckte, war da nichts. Schon wieder nicht. Aber Dr. Peterson war dabei, er hat es auch gesehen.«
»Ich habe gesehen, dass du etwas gesehen hast«, berichtigte Peterson. »Ich habe nichts fallen sehen, aber ich kann bestätigen, dass nichts da war, als wir nachgesehen haben.«
»Aber du musst doch was davon mitbekommen haben«, warf Markham ein. »Eine schwarze Gestalt, die sich als Silhouette vom Himmel abgehoben hat. Ich habe Arme und Beine gesehen. Nur für einen kurzen Moment, das stimmt, aber man kann einen herabstürzenden Körper doch nicht verkennen.«
Mir kam ein Gedanke. »Was hast du denn gehört?«
Markham saß still da und ließ sich alles durch den Kopf gehen.
»Nichts.«
»Nichts? Keinen Schrei? Kein Geräusch vom Aufprall?«
Er sah plötzlich sehr nachdenklich aus. »Nein. Es gab kein Geräusch vom Aufschlagen. Und wenn diese Mistkerle aus Forschung und Dokumentation sich wirklich einen Spaß machen und Dinge vom Dach werfen, dann würde man doch irgendetwas hören, oder?«
Ja, würde man. Ich musterte ihn erneut. Ich hatte ihn schon mal verwundet gesehen; ich hatte ihn gesehen, wie er um sein Leben lief; ich hatte ihn sogar gesehen, wie er Frauenkleider trug, aber so wie jetzt – noch nie. Auf keinen Fall konnte ich die Angelegenheit einfach beiseitewischen.
Also stand ich auf. »Tim, kannst du mal bei den Leuten von Forschung und Dokumentation nachhaken? Natürlich sehr taktvoll, bitte.«
Er nickte. »Und was willst du tun?«
»Ich werde mit Dr. Dowson sprechen.« Ich sah Markham an. »Alles in Ordnung bei dir?«
»Ja. Was soll ich tun?«
»Im Augenblick nichts. Wenn dir jemand einen Streich spielt, dann ist das Beste, was du tun kannst, es zu ignorieren. Wir treffen uns um halb drei wieder hier.«
Dr. Dowson war unser Bibliothekar und Archivar. In den meisten Instituten würde das bedeuten, dass er seinen Tag in einer Atmosphäre friedlicher Ernsthaftigkeit verbringt. Normalerweise bereiten einem Bücher nicht viel Ungemach. Heute stand er auf seinem Schreibtisch, donnerte mit einem Besenstiel gegen die Decke und brüllte Verwünschungen. Auf Latein, Griechisch und, dem Klang des Besens nach zu urteilen, im Morse-Code.
Er unterbrach seine Tätigkeit, um mich mit einem Lächeln zu begrüßen. »Ah, Max. Kann ich helfen?«
Ich war zu schlau, um ihn zu fragen, was hier vor sich ging. Er und Professor Rapson aus der Abteilung Forschung und Dokumentation waren alte Freunde, was augenscheinlich eine ausreichende Grundlage bot, sich bei jeder Gelegenheit das Leben zur Hölle zu machen. Die Vertreter der Sektion Forschung und Dokumentation besetzten die Räume unmittelbar über Dr. Dowsons Wirkungskreis, und wahrscheinlich hatten sie gerade unabsichtlich – aber vermutlich wohl eher doch nicht – etwas getan, um seinen Zorn auf sich zu ziehen.
Ich half ihm vom Schreibtisch runter und erzählte ihm die ganze Geschichte. Auch wenn ich mir ein bisschen blöd vorkam, schloss ich die Frage an: »Ist es möglich … Ist es auch nur im Entferntesten vorstellbar, dass wir einen Geist haben, von dem wir nichts wissen?«
Er stand einen Augenblick lang reglos da und polierte seine Brillengläser, völlig in Gedanken versunken; dann verschwand er kurz und kehrte mit einem alten Buch, zwei modernen Broschüren und einem Aktendeckel mit losen Fotokopien zurück.
All das legte er auf den Tisch, und wir setzten uns.
»Gut«, sagte er. »Ein kurzer Abriss der Geschichte des St. Mary’s. Das erste Gebäude, das ursprüngliche Kloster von St. Mary’s, wurde von Augustinermönchen gegen Ende des 13. Jahrhunderts errichtet. Dieses Gebäude stand mehr oder weniger hundert Jahre. Ich denke allerdings, der Ort war zu abgelegen, und im Laufe der Jahre verstreuten sich die Mönche einfach immer weiter. St. Mary’s, das Dorf und das ganze umliegende Land wurden schließlich, ohne dass man die genauen Umstände kennt, von Henry von Grosmont, dem 4. Earl von Lancaster, erworben. Er machte nichts weiter damit, als die Pacht einzutreiben, aber sein Schwiegersohn, John von Gaunt, Herzog von Lancaster, überließ den Landsitz als Schenkung Henry von Rushford, einem Waffenbruder, für die geleisteten Dienste während des Feldzugs in Kastilien im Jahr 1386.
Der nächste Teil ist interessant. Offenbar gab es ein paar Scharmützel während der Wirren von 1399. Während Richard II. und Henry Bolingbroke um die Vorherrschaft kämpften, machte sich allem Anschein nach ein anderer Zweig der Rushford-Familie das Durcheinander zunutze und griff St. Mary’s an. Trotz einer beherzten Verteidigung verschafften sich die Angreifer Zutritt, aber ihre Pläne wurden vereitelt, als in einem letzten verzweifelten Aufbäumen die Verteidiger, angeführt von Henrys Enkelin, versuchten, den Ort niederzubrennen, um ihre Flucht nach Rushford zu vertuschen. Aufregende Tage, was?
Offenbar fand sich eine angemessene Lösung für die Angelegenheit, aber etwa eine Generation später war St. Mary’s nicht mehr in den Händen der Rushford-Familie. Ich fürchte, das lag daran, dass es keinen Erben gab, wie es so häufig der Fall ist. Ich weiß wirklich nicht, warum diese Dinge immer an die männlichen Nachkommen weitergegeben werden – Mädchen sind in ihrer Kindheit so viel robuster als ihre Brüder, und seien wir doch mal ehrlich, Max – während es immer wieder mal Zweifel über die Identität des Vaters gibt, sind sich die meisten Leute ziemlich im Klaren darüber, wer die Mutter ist.«
Er brütete eine Weile über den unbefriedigenden Stand der Dinge, und ich konnte ihm wohl kaum widersprechen.
»Auf jeden Fall hatte St. Mary’s unzählige Besitzer, von denen alle offenkundig ein vollkommen friedliches Leben verbrachten, selbst in unruhigen Zeiten. Das Anwesen überstand die Rosenkriege und den religiösen Zwist unter den Tudors. Dann, im späten 16. Jahrhundert, zogen die Laceys von Gloucestershire ein.«
Er schlug das Buch auf. »Der Bürgerkrieg hatte die Familie in der Mitte geteilt; die Hälfte von ihr unterstützte den König, die andere Hälfte stellte sich hinter Cromwell. 1643 verließ ein Kontingent von parlamentarischen Kräften, angeführt von Captain Edmund Lacey, aus irgendwelchen Gründen Gloucester und kam hierhergeritten. Die Überlieferungen gehen ziemlich durcheinander, und es gibt mehrere unterschiedliche Berichte über die Ereignisse, aber alle stimmen darin überein, dass die Große Halle niedergebrannt wurde und Margaret Lacey und ihr älterer Sohn, Charles, in den Flammen ums Leben kamen. Der jüngere Sohn, James, war damals noch ein sehr kleiner Bursche, und er entkam aufs Dach, wo er von einem Dienstboten gerettet und sicher ins Dorf gebracht wurde. Captain Lacey verschwand, wurde angeklagt, in Abwesenheit des Mordes schuldig gesprochen und nie wieder gesehen. Die Halle wurde von James wieder aufgebaut und sieht im Großen und Ganzen so aus, wie wir sie heute kennen. Natürlich mit Ausnahme des gläsernen Oberlichts.
Auch weiterhin wechselte St. Mary’s die Besitzer und büßte dabei Ländereien ein, bis es schließlich im 19. Jahrhundert verwaiste. Es war zu groß für einen Familiensitz, und da es kein Land mehr gab, das es versorgt hätte, wurde es ein bisschen zu einem weißen Elefanten, fürchte ich. Während des Ersten Weltkriegs wurde es als Genesungsheim für Soldaten genutzt, dann war es für eine kurze und desaströse Zeit eine Schule. Anscheinend hatte jemand einen Wasserhahn offen gelassen, und das Dach stürzte dort ein, wo sich heute die Garderobe befindet. Im Zweiten Weltkrieg wurde es erneut als Krankenhaus genutzt. Und das war es dann auch, bis wir vor, ach, du meine Güte, ziemlich vielen Jahren mittlerweile einzogen.« Er klopfte auf die Dokumente. »Das steht alles hier. Und noch viel mehr.«
Langsam sagte ich: »Danke, Doktor, aber ich denke, ich habe alles, was ich brauche.«
Er nickte. »1643?«
»Ja, genau. Der kleine Junge ist aufs Dach geflohen. Er hat überlebt, aber vielleicht ist jemand anderes gestürzt. Captain Lacey möglicherweise. Das könnte der Grund dafür sein, warum er nie wieder gesehen wurde. Weil er gestorben ist. Entweder im Feuer oder bei dem Sturz. Kann ich noch weitere Details kriegen?«
Er lächelte. »Bestimmt. Ich brauche höchstens eine Stunde.«
Wir trafen uns wieder. Da es keine Spur von Miss Lee gab, kümmerte ich mich dieses Mal selbst um den Tee.
»Irgendetwas machst du falsch«, bemerkte Peterson selbstzufrieden. »Meine Mrs. Shaw bringt mir auch noch Schokoladenkekse mit dazu.«
Ich ignorierte ihn.
»Anscheinend gibt es zwei Kandidaten für Mr. Markhams fallende Körper. 1399 gab es einen kleineren Kampf um das Besitztum. Ich schätze, es ist absolut möglich, dass dabei jemand vom Dach gestürzt sein könnte.«
»Oder auch gut möglich, dass jemand eine verrückte Frau hatte, die gesprungen ist, wie Mrs. Rochester«, fügte Markham hinzu, der nicht dazu neigte, sich für die wahrscheinlichere Version zu erwärmen. »Und sie hat sich unten auf den Steinen das Gehirn rausgehauen.«
»Wann hast du denn Jane Eyre gelesen?«, erkundigte sich Peterson, der sich immer leicht ablenken ließ.
»Ich habe mir mal den Knöchel gebrochen.«
Wir warteten, aber das schien schon die ganze Erklärung gewesen zu sein.
»Oder 1643«, sagte ich, wild entschlossen, alle wieder auf die richtige Spur zu bringen. »Während des Bürgerkriegs kamen die Roundheads und bedrohten und ermordeten vermutlich eine Frau und ein Kind. Allerdings, und das ist der interessante Teil, gab es ein zweites Kind, das auf dem Dach Schutz suchte. Beschreib doch noch mal den Körper.«
»Da gibt es nichts zu beschreiben. Ein schwarzer Umriss mit Armen und Beinen.«
»Könnte es ein Kind gewesen sein?«
»Ich schätze schon, ja. Es sah nicht sehr groß aus, aber …« Er klang voller Zweifel. »Ich weiß nicht. Und überhaupt, das Kind hat doch überlebt, oder? Es ist alles ziemlich mysteriös.«
Schweigen. Wir schlürften unseren Tee.
»Also gut«, sagte Peterson. »Und wie jetzt weiter? Das ist ja alles sehr interessant, aber was hat das mit uns zu tun?«
Darauf gab es keine gute Antwort, und so tranken wir unseren Tee aus und standen auf. Ich begleitete die anderen zur Tür und hinaus auf den Flur.
»Tut mir leid, Mann«, sagte Peterson zu Markham. »An der Sache ist einfach nicht genug dran, um sie weiterzuverfolgen. Abgesehen von deinen täglichen Halluzinationen haben wir keinerlei …«
Markhams ganzer Körper spannte sich an, als er den Finger ausstreckte und schrie: »Da! Oh mein Gott. Schon wieder!«
Wir standen wie erstarrt da, denn wir sind gut ausgebildete Profis, dann hasteten wir zum Fenster. Peterson schob es hoch und streckte seinen Kopf nach draußen. Ich verschaffte mir mit den Ellbogen ein bisschen Platz und tat dasselbe. Markham dämmerte, dass er hier keine Chance hatte, und rannte zum nächsten Fenster, um hinauszusehen.
Sonnenstrahlen fielen auf den mit Raureif überzogenen Kies. Wir schauten nach Norden. Wir schauten nach Süden. Markham kam auf die Idee, sich noch weiter aus dem Fenster zu lehnen, sich in alle Richtungen zu verdrehen und nach oben zu blicken.
Nichts.
»Kommt mit«, sagte er, und wir machten uns auf den Weg zum Dach, das wir durch eine winzige Tür in der nordöstlichen Ecke erreichten. Trotz der harschen Temperaturen wurde hier immerhin ein bisschen Sonne eingefangen. In früheren Zeiten war es ein gedecktes Giebeldach gewesen, doch irgendwann im Laufe der Geschichte hatte man es erneuert und abgeflacht. Überall ragten hohe Schornsteine in kleinen Grüppchen auf. Dort drüben war das große Glasfenster eingelassen, durch das genügend Licht in die Große Halle fiel. Weiter rechts konnten wir hinabsehen auf die Dächer der unteren Stockwerke. Es gab sogar eine Feuerleiter, auf die Markham nun zusteuerte. Wir sahen ihm nach.
»Was hältst du davon?«, fragte Peterson. »Es ist schon erstaunlich, oder?«
»Ich weiß. Ich bin immer noch ganz verblüfft. Jane Eyre!«
»Verfolgen wir das weiter?«
»Machst du Witze?«
»Wir werden dafür nie die Genehmigung bekommen.«
»Überlass das nur mir. Ich habe da eine brillante Idee.«
Er seufzte.
Markham kehrte zurück, marschierte zur Brüstung, die nur etwas mehr als hüfthoch war, und sah hinunter. Wir gesellten uns zu ihm.
»Verflucht noch mal«, sagte Peterson und machte einen Schritt rückwärts.
»Alles in Ordnung mit dir?«
»Bestens«, sagte er, wandte den Blick ab und trat vier oder fünf weitere Schritte zurück. »Sag mir einfach, was du da siehst.«
»Nichts. Da ist nichts.«
»Und auch hier oben war heute noch niemand«, fügte Markham hinzu.
Er hatte recht. Unsere Fußabdrücke waren deutlich auf dem bereiften Dach zu erkennen. Und zwar nur unsere. Es sei denn, irgendjemand wäre barfuß hier raufgekommen …
Wir schauten uns um, und unser Atem hing weiß in der kalten, beißenden Luft.
Ich sah Markham an. »Bist du dabei?«
»Was für eine Frage!«
Den Rest des Tages verbrachte ich damit, alles zusammenzustellen, was wir hatten, und gerade als die Lichter angingen und die Leute Richtung Speisesaal strömten, machte ich mich auf den Weg zu Dr. Bairstow. Als er mich sah, blickte er genauso erfreut, wie es üblicherweise der Fall war.
»Dr. Maxwell. Darf ich annehmen, dass Sie mir Einzelheiten bezüglich Ihres Fortschritts bei der Planung des Tags der offenen Tür bringen?«
»Alles bereit, Sir«, sagte ich mit übergroßer Zuversicht und sehr geringem Wahrheitsgehalt.
»Dann sind Sie hier, weil …?«
»Ich möchte meinen Sprung einfordern, Sir. Wenn Sie gestatten.«
Am Ende unseres letzten unerfreulichen Jahres hatte er mir in einem Akt unverhohlener Bestechung eine Mission meiner Wahl versprochen. Damals hatte ich die Thermopylen ins Auge gefasst, aber nun …
»Im Ernst? Und was schwebt Ihnen da so vor?«
»St. Mary’s. 1643.«
Er stapelte seine Akten zu Ende, dann richtete er sich langsam auf.
»Eine interessante Wahl. Darf ich fragen, wieso?«
»Geisterjagd, Sir.«
Er warf mir einen scharfen Blick zu. »Es gibt keinen Geist im St. Mary’s.«
»Möglicherweise haben wir in letzter Zeit einen bekommen, Sir.«
»Wie das?«
Ich ging meine Optionen durch, rief mir wieder ins Gedächtnis, dass niemals etwas Gutes dabei herauskam, wenn man den Boss anlog, und sagte: »Bei mittlerweile drei Gelegenheiten hat Mr. Markham jemanden vom Dach fallen sehen. Wenn wir nachsehen, ist niemals irgendetwas zu finden.«
»1643? Das dürfte der ruchlose Captain Lacey sein, wie?«
»Ganz genau, Sir.«
Er schob seine Akten hin und her.
»Haben wir einen funktionsfähigen Pod?«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass Chief Farrell irgendwo einen versteckt haben wird.«
Ich wartete. Es war nicht nötig, ihn an sein Versprechen zu erinnern.
»Die Tatsache, dass ich diese Mission bereits im Vorfeld genehmigt habe, sollte Sie nicht zu der Annahme verleiten, dass ich dieses Mal auf den üblichen Missionsplan verzichten werde, Dr. Maxwell.«
»Natürlich nicht, Sir.«
»Und Ihr Team wird bestehen aus …?«
»Mir, Dr. Peterson und Mr. Markham.«
»Ah. Aus den üblichen Verdächtigen. Warum Mr. Markham?«
»Es ist sein Geist, Sir«, sagte ich, und damit traf ich viel mehr ins Schwarze, als irgendjemand zu diesem Zeitpunkt ahnen konnte.
»Nun, ich schätze mal, Mr. Markhams Abwesenheit vom St.-Mary’s-Institut dürfte doch immer ein Grund zum Feiern sein.«
»Verzeihen Sie, aber das ist nicht ganz zutreffend, Sir. Er wird ja immer noch hier sein, nur halt eben vor vierhundert Jahren.«
Er seufzte. »Für meinen Geschmack liegt das nicht annähernd weit genug in der Vergangenheit.«
Zwei
Ich setzte ein Meeting an.
Da wir nur zu dritt waren, fand die Besprechung in meinem Büro statt. Ich hatte um Tee gebeten, und Miss Lee hatte Becher, Milch, Zitrone, Zucker und Teebeutel herausgesucht und sogar Wasser in den Kessel gefüllt. Bedauerlicherweise hatte sie jedoch keinerlei Anstalten gemacht, die einzelnen Bestandteile zusammenzufügen, die ringsum im Raum verstreut standen. Es war wie eine Schatzsuche.
»Deine Aufgabe«, sagte ich zu Markham, und begleitet vom Klang des sprudelnden Kessels und klappernder Teelöffel, gab ich weiter, was Dr. Dowson herausgefunden hatte.
»Okay, mal gut zuhören. Man schreibt das Jahr 1643 – wir befinden uns mitten im Bürgerkrieg, kurz vor der Belagerung von Gloucester. An irgendeinem Punkt und aus unerfindlichen Gründen verlässt Captain Edmund Lacey die Stadt und kommt hierher, ins St. Mary’s. Sein älterer Bruder, Rupert,« ich legte das Foto eines sehr düsteren Porträts von einem mürrischen Mann mit einer riesigen Perücke auf den Tisch, »ist weit weg und kämpft für den König.«
Markham verschluckte sich an seinem Tee. »Sie standen auf verschiedenen Seiten?«
»Ja. Das war gar nicht so ungewöhnlich in diesem besonderen Konflikt. Familien brachen auseinander. Einige Mitglieder kämpften für den König – andere für Cromwell. Wie auch immer, Captain Lacey taucht hier am …« Ich sah in Dr. Dowsons Unterlagen nach. »… 3. August auf. Sir Rupert, dessen Aufenthaltsort zu diesem Zeitpunkt unbekannt ist, ist fort und hat seine Frau, ihre beiden Söhne und vermutlich ein oder zwei Dienstboten zurückgelassen. Später am selben Tag gibt es ein Feuer – wahrscheinlich von den Roundheads gelegt. Vielleicht wollte Edmund sie dazu bringen, St. Mary’s zu verlassen und aufzugeben, und sie weigerte sich. Allerdings ist es schwer vorstellbar, wie sie sich hätte zur Wehr setzen können. Auf jeden Fall gibt es ein Feuer. Ein gewaltiges Feuer. Es bricht in einem der Räume aus, die von der Galerie abgehen, und breitet sich rasch aus. Holzfußboden, Holzmobiliar, Wandteppiche – alles geht in Flammen auf.
Margaret Lacey und ihr älterer Sohn, Charles, überleben nicht. Der jüngere Knabe, ein Bursche von sechs oder sieben Jahren, kann irgendwie entkommen. Er rennt hinauf aufs Dach. Vielleicht wird er von Edmund Lacey verfolgt, der stirbt, als das Dach einstürzt. Wir wissen es nicht. Edmund Lacey kehrt nie zu seiner Einheit zurück. Tatsächlich wird er überhaupt nie wieder gesehen, also ja, zu diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass er zusammen mit seiner Schwägerin und seinem Neffen im Feuer umkommt.«
»Was ist mit James?«
»James wird von einem Diener gerettet und ins Dorf in Sicherheit gebracht. Sir Rupert wird später im Krieg getötet, also erbt James schließlich St. Mary’s. Angesichts seiner Jugend entgehen die Bewohner des Anwesens den Strafen und Einkerkerungen, die gewöhnlich über die Verlierer verhängt werden. Als Charles II. später wieder die Monarchie ausruft, entgeht James den Strafen und Einkerkerungen, die gewöhnlich drohen, wenn man einen Parlamentarier in der Familie hat, und zwar dank der Tatsache, dass sein Vater im Dienste des Königs gestanden hatte. Soweit allgemein bekannt ist, verbringt er seine Tage glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende.«
Wir tranken unseren Tee.
»Also ist niemand vom Dach gestürzt?«, hakte Markham nach.
»Tja, falls doch, dann wette ich, dass es Edmund Lacey gewesen ist.«
»Warum hat er denn überhaupt seine Einheit verlassen?«
»Keine Ahnung. Vielleicht hat er geglaubt, dass sein Bruder schon tot ist, und hat sich auf den Weg gemacht, um Anspruch auf das Anwesen zu erheben.«
»Aber es gab doch Söhne in der Erbfolge.«
»Ja«, antwortete ich langsam, »aber es gab auch ein Feuer, in dem einer der Söhne starb. Der andere verdankt seine Flucht einem ihrer Dienstboten. Wer weiß schon, aus welchem Grund Captain Lacey ihn aufs Dach gejagt hat?«
Stille.
»Also ein richtiger Bastard«, stellte Markham fest.
»Allerdings.«
»Und dem wollen wir mal auf den Zahn fühlen?«
»Allerdings.«
»Cool.«
Wir versammelten uns vor meinem Lieblingspod, Nummer acht, und überprüften einander.
Peterson und Markham trugen ungefütterte Jacken, knielange Bundhosen, Strümpfe, schwere Lederschuhe und Hüte, die für Spott und Heiterkeit sorgten. Zu meinem Glück war die Ausstattung der Damen etwas lockerer und bequemer als die reich bestickten, tragbaren Folterkammern der elisabethanischen Zeit. Ich muss allerdings dazusagen, dass die Mode Mitte des 17. Jahrhunderts einer kleinen, etwas pummeligen, rothaarigen Historikerin keineswegs stand. Mrs. Enderby aus der Garderobe beharrte zwar darauf, dass mein Po-Polster sehr moderat gehalten war, aber mit meinem knöchellangen Rock wirkte ich breiter als hoch.
Unklugerweise erkundigte ich mich danach, ob mein Hintern in diesem Aufzug voluminös aussehen würde.
Es gab eine kurze Pause.
»Verdammt ausladend«, sagte Peterson. »Ich bin mir nicht sicher, ob wir dich überhaupt durch die Tür kriegen.«
Ich funkelte ihn an. »Du hättest ja wenigstens versuchen können, dir eine taktvolle Antwort einfallen zu lassen.«
»Das war die taktvolle Antwort. Du solltest dich glücklich schätzen.«
»Genau«, bekräftigte Markham, »denn ich wollte eigentlich sagen …«
»Haltet einfach die Klappe und steigt in den Pod.«
Als wir drinnen waren, gesellte sich das Zentrum meines Universums dazu. Oder Chief Farrell, wie alle anderen ihn nannten. Er trug den orangefarbenen Jumpsuit der Technischen Abteilung und war, wie immer, mit Werkzeugen und Gerätschaften bestückt. In seinem Haar war mehr Silber zu sehen als bei unserem ersten Treffen, aber seine blauen Augen waren so strahlend wie immer. Er winkte mir zu und machte sich daran, die Konsole zu überprüfen.
Markham verstaute unser Gepäck, während Peterson und ich einen Blick auf die Anzeigen warfen.
»Alles eingegeben«, sagte Leon und trat einen Schritt zurück. »Auch die Daten für den Rücksprung.«
Nach den Erfahrungen einer Mission im letzten Jahr hatte ich Dr. Bairstow zwei Vorschläge unterbreitet. Der erste besagte, dass es keine Missionen mit offenem Ende mehr geben sollte. Peterson und ich waren letztes Jahr nach Southwark im 14. Jahrhundert gesprungen, und er hatte sich leichtsinnigerweise die Pest eingefangen. »Nur ein bisschen«, behauptete er gerne, aber es war mir nicht gelungen, ihn ins St.-Mary’s-Institut zurückzuschaffen.
Normalerweise wäre das kein großes Problem gewesen, denn man hätte rechtzeitig einen Suchtrupp losgeschickt. In unserem Fall jedoch war das Missionsende offen, und es gab kein festes Datum für unsere Rückkehr, sodass niemand mitbekam, dass wir in Schwierigkeiten steckten. Bis man im St. Mary’s endlich gemerkt hätte, dass etwas nicht stimmte, hätte es auch schon längst zu spät sein können. Und so mussten von nun an alle Missionen ein Datum und eine Uhrzeit für die Rückkehr festlegen, und wenn wir dann nicht auftauchten, würde man nach uns suchen.
Die zweite Empfehlung betraf mögliche Ansteckungen. Nach jeder Mission dekontaminieren wir uns bei unserer Ankunft. Mir war klar geworden – genau genommen hatte ich zu diesem Zeitpunkt gerade an Petersons Schritt geschnüffelt, aber sei es drum –, dass unsere modernen Keime für Zeitgenossen ebenso tödlich sein können wie ihre für uns. Man muss sich nur Cortés und die südamerikanischen Ureinwohner ansehen. Nach einiger Diskussion schalten wir nun nicht mehr nur bei unserer Rückkehr die Dekontaminationsanlage ein, sondern auch dann, wenn wir das St.-Mary’s-Institut verlassen. Die Tatsache, dass Peterson die Pest hatte, war ein unschöner Schock für alle gewesen, besonders für ihn, und so strichen wir als weitere Vorsichtsmaßnahme das Innere des Pods mit dieser besonderen Farbe, die Bakterien abtötet, wenn man sie mit fluoreszierendem Licht bestrahlt. Ein ebensolcher Streifen quer über den Fußboden stellte sicher, dass auch unsere Schuhe dieser Behandlung unterzogen wurden.
Markham schloss eine Schranktür und sagte: »Alles erledigt.«
»Dann war’s das«, sagte Leon. »Viel Glück euch allen.« Bei diesen Worten streckte er seine Hand aus. Wir schüttelten uns also die Hände, wie wir es immer taten, wenn andere dabei waren. Die seine war warm und rau und drückte fest zu. »Pass auf dich auf.«
»Du auch auf dich«, antwortete ich.
Sein Lächeln galt nur mir, dann verließ er den Pod. Die Tür schloss sich hinter ihm.
Ich setzte mich. »Sobald du bereit bist, Tim«, und ich spürte das vertraute Kribbeln der Vorfreude.
»Computer – Sprung initialisieren.«
Und die Welt wurde weiß.
Wir starrten ein fremd aussehendes St. Mary’s an.
»Es wirkt so klein«, stellte Markham schließlich fest, und er hatte recht.
Dies war nicht das St.-Mary’s-Institut, das wir kannten, mit seinem Flachdach und dem Efeu, mit seiner Vielzahl an Nebengebäuden, dem Parkplatz und dem gepflegten Außengelände. Dieses St. Mary’s war quadratisch und ein einziger Klotz mit einem spitzen Giebeldach, auf dem scheinbar wahllos platzierte Schornsteine aufragten, die nicht zum ursprünglichen Bau gehört hatten und wohl nachträglich nach Bedarf hinzugefügt worden waren.
Es gab keine sorgfältig in Ordnung gehaltenen Außenbereiche, wie wir sie kannten, nur Büsche, einen großen Gemüsegarten sowie Obst- und andere Bäume. Schafe hielten den Vorläufer von Mr. Strongs geliebtem Südrasen kurz. Keine Auffahrt führte zum Haus, nur ein breiter, grasbewachsener Pfad mit den Furchen von Wagenspuren. Die Tore waren hoch, aus Holz und fest verschlossen. Am auffälligsten war, dass es keinen See gab. Eine Reihe von Teichen war angelegt worden, meiner Vermutung nach von den Mönchen, um ihren Speiseplan gelegentlich mit einem Karpfen zu bereichern. Als Capability Brown oder wer auch immer St. Mary’s in die Finger bekam, wurden die Teiche und die morastigen Gebiete ringsum ausgehoben, um unserem vertrauten See ins Leben zu verhelfen.
Es herrschte absolute Stille. Mir fiel wieder ein, was Dr. Dowson über die Mönche berichtet hatte, die fortgegangen waren. Was unser St.-Mary’s-Institut so angenehm abgeschieden machte, wirkte hier weitab vom Schuss und einsam. Alles sah klein, ländlich und, im Moment zumindest, sehr friedlich aus.
Aber das würde nicht so bleiben. In ungefähr einem Tag würde ein Großteil dieses St. Mary’s verschwunden sein.
Niemand war in der Nähe. Die Schatten waren schon lang, denn die Sonne war bereits im Untergehen begriffen.
»In Ordnung«, sagte ich und riss mich vom Anblick los. »Hier kommt der Plan. Wir warten, bis es dunkel ist, dann huschen wir über die Wiese. Stolpert nicht über die Schafe. Wir werden uns von Osten her nähern und schauen, ob wir ein Fenster öffnen können. Dann geht’s nach oben zum Dachboden, wo wir uns einen Platz suchen werden, um alles zu beobachten. Morgen ist der Tag, an dem die Roundheads auftauchen werden.«
»Kann es sein, dass Hunde uns erwarten?«, erkundigte sich Peterson.
»Unwahrscheinlich«, antwortete Markham. »Nicht, solange sie draußen Schafe halten. Aber für den Fall, dass die Dame des Hauses ein Schoßhündchen oder etwas Ähnliches hat …« Er wedelte mit einer kleinen Sprühflasche.
»Kein Pfefferspray«, sagte ich warnend. Das Letzte, was wir gebrauchen konnten, war ein Rudel hysterischer, hechelnder, in Panik geratener Spaniels, die überall im Haus herumkläfften.
»Nein, nein, hier ist etwas, das sich der Professor hat einfallen lassen. Es ist ziemlich harmlos und wird sie einfach nur … durcheinanderbringen.«
»Wenn das so ist, dann besprüh um Himmels willen nicht Peterson damit.«
»Sprüh einfach gar nicht damit«, schärfte ihm Peterson ein. »Erinnerst du dich noch an das Haarspray vom Professor?«
Guter Punkt.
Als Antwort auf die vielen Beschwerden von Historikerinnen über ihre Schwierigkeiten, enorme Haarlängen zu bewältigen, mit denen sie geschlagen waren, hatte sich der Professor des Problems angenommen. Schließlich hatte er die Erfindung eines Haarsprays verkündet, das garantiert auch die widerspenstigsten Locken an Ort und Stelle halten würde. Hocherfreute Historikerinnen hatten es ausprobiert, bis die gesamte Produktion von Dr. Bairstow konfisziert wurde. Es hatte sich nämlich eine höchst unliebsame Nebenwirkung ergeben: Der Haarlack war so leicht entflammbar, dass man nicht mal unter einer Straßenlaterne entlangspazieren konnte, ohne als Beispiel für spontane menschliche Selbstentzündung für Schlagzeilen im nächsten Wissenschaftsmagazin zu sorgen.
Ich unterbrach die Diskussion zwischen Peterson und Markham, die dazu übergegangen waren, sich darüber zu zanken, wer denn nun für das kleine Feuer im Wäldchen hinter unserer großen Scheune verantwortlich gewesen war und warum Peterson keinen Pod sanft landen konnte, und die ganze Sache drohte auszuufern und laut zu werden.
»Die Sonne ist verschwunden. Ich schalte jetzt die Dekontamination an«, verkündete ich und machte die Lampe an. Dann spürte ich, wie im kalten blauen Licht die Haare an meinen Armen vibrierten.
»Ich schwöre, das verfluchte Ding macht einen zeugungsunfähig«, murmelte Markham.
Niemand fiel über ein Schaf. Das allein war schon eine kleine Sensation.
Der Mond ging auf und warf lange blaue Schatten auf das silberne Gras. Wir huschten in dieser magischen Landschaft von Baum zu Baum. Der Wald reichte viel weiter ans Haus heran als in unserer Zeit, und wir suchten diesen Schutz, solange es nur ging.
Ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt nötig war, denn es gab ringsum nirgendwo ein Lebenszeichen. Kein Lichtschein fiel aus den blinden Fenstern. Keine Hunde bellten. Sogar der Stall schien verlassen. Hatte Sir Rupert alle seine Pferde mit in den Krieg genommen? Waren für seine Frau nicht mal die Arbeitsgäule geblieben, damit sie das Land bestellen konnte?
Wir machten halt, um ein letztes Mal die Lage zu sondieren, ehe wir uns dem Haus näherten.
»Das ist verdächtig einfach«, murmelte Peterson. »Sind wir überhaupt sicher, dass irgendjemand zu Hause ist?«
»Wir sind uns bei gar nichts sicher«, flüsterte ich, was der Wahrheit entsprach. Unsere Missionen hatten gewöhnlich einen festgelegten Zweck. Zum Beispiel den Fall von Troja zu beobachten. Oder eine eingehende Studie der Kreidezeit durchzuführen. Einen Blick auf Isaac Newton zu werfen. Heute waren wir einfach aufgetaucht, um abzuwarten, was als Nächstes geschehen würde. Um ein Rätsel zu lösen, obwohl wir nicht einmal mit Gewissheit wussten, ob es überhaupt je eines gegeben hatte. Und natürlich, um herauszufinden, warum irgendetwas oder irgendjemand, den nur Markham sehen konnte, immer wieder vom Dach stürzte.
Es schien naheliegend, dass die Mitglieder des Haushalts hier draußen auf dem Land bei Sonnenuntergang zu Bett gingen und im Morgengrauen wieder aufstanden. Auf jeden Fall schien sich das gesamte Haus schon für die Nacht bereit gemacht zu haben.
»Los, kommt«, raunte ich, »wir sollten das Mondlicht nutzen.«
Wir legten einen letzten Sprint bis an die seitliche Hauswand ein, blieben dort im Schatten stehen und sahen zu, wie die Wolken über den Himmel zogen. Der Wind fühlte sich kalt im Gesicht an.
Peterson und Markham tasteten die Fenster ab, während ich Wache hielt. Sie schienen nirgends Glück zu haben, bis ich schließlich irgendwo in der Dunkelheit ein leises Klirren von zerbrochenem Glas hörte.
»Was ist passiert?«, fragte ich, und es gelang mir mühelos, mein Flüstern ausgesprochen empört klingen zu lassen.
»Entspann dich«, sagte Markham. »Ich habe das schon gemacht, als ich noch in der Wiege lag.«
»Wie bitte?«, entfuhr es Peterson, ebenfalls im Flüsterton.
»Deshalb musste ich ja auch in die Armee eintreten.«
»Du wurdest mal verurteilt?« Es braucht schon ein bisschen Talent zu zischen, obwohl es kaum ein »s« im Satz gab.
»Hm, also … ja. Du nicht?«
»Du musstest in die Armee eintreten?« Peterson ließ nicht locker.
»Ja. Mir blieb nur das … oder was anderes.« Er hakte das Fenster auf. »Habe unter Major Guthrie gedient. Wusstet ihr das nicht? Na also!«
Zufrieden schob er das kleine Fenster auf.
Wir hielten inne und warteten ab, ob sich aufgebrachte Hausbewohner, Wachhunde, Dienstboten auf ihren Rundgängen, weinende Kinder oder sonst irgendwer melden würde, aber abgesehen von einem Eulenruf hin und wieder konnten wir nichts hören.
Markham sammelte sorgfältig die Glasscherben auf.
»Was treibst du denn da?«
Er warf die Scherben unter einen Busch. »Wir wollen doch wohl nicht, dass irgendjemand aus der Dienerschaft die kaputte Scheibe bemerkt und Alarm schlägt.«
»Oh. Gut mitgedacht.«
»Bei mir gibt es immer einen Rundumservice«, antwortete er selbstzufrieden.
Wir schoben den Vorhang zur Seite, kletterten durch die Öffnung und sprangen so leise wie möglich auf den Boden. Peterson wagte es, für ein bisschen Licht zu sorgen, indem er seine winzige Taschenlampe einschaltete.
Wir befanden uns allem Anschein nach in einem kleinen, holzvertäfelten Raum. Ich fragte mich, ob das hier Sir Ruperts Arbeitszimmer war. Ganz schwach konnte ich den Geruch von Holz, Leder und Tabak ausmachen. Wie die meisten Zimmer dieser Zeit war es nicht mit Möbeln vollgestopft, und die wenigen Stücke, die es gab, waren dunkel und schwer. Markham ging zur gegenüberliegenden Tür, öffnete sie einen Spalt breit und spähte hinaus. Peterson und ich blieben reglos stehen.
Markham schien sich eine halbe Ewigkeit lang umzuschauen und zu lauschen, dann gab er uns das Zeichen, uns in Bewegung zu setzen. Von jetzt ab würden wir kein Wort mehr wechseln.
Wir schlüpften durch die Große Halle und hielten uns in den Schatten. Im Dach gab es kein Oberlicht. Gewaltige Balken stützten die hohe Decke, aber der Geruch war hier genau derselbe – Staub und feuchtes Gemäuer. Ich hörte zu, wie das St. Mary’s in der Dunkelheit vor sich hin tuschelte. Dielen knarrten. Heruntergebranntes Feuerholz sank in sich zusammen. Irgendwo huschte wohl eine Maus über den Boden.
Der Treppenaufgang war unvertraut, denn er war lang und gerade und führte an der Wand hinauf. Der berühmte Absatz auf halber Höhe, das Zentrum des Lebens im St. Mary’s, existierte noch nicht. Wir liefen über die Galerie – geräuschlos, abgesehen vom Rascheln meines Kleides. Irgendwo in der Dunkelheit konnte ich eine Frauenstimme murmeln hören. Eine hohe, kindliche Stimme antwortete. Schweigend bogen wir ab, vorbei an geschlossenen Türen, und steuerten die schmale Treppe an der Ecke an. Unser Plan sah vor, dass wir die Nacht auf dem Dachboden verbringen würden, und das war auch schon alles, was wir uns überlegt hatten. Wir hatten keine Ahnung, was als Nächstes passieren würde. Es hatte schon Missionen gegeben, bei denen alles um uns herum schiefgelaufen war – das geschah eigentlich ständig –, aber dies war das erste Mal, dass wir ohne klare Vorstellung vom Ablauf aufgebrochen waren. Und eigentlich war das ziemlich aufregend.
Die Räume auf dem Dachboden waren winzig. In unserem kleinen Verschlag konnten wir kaum aufrecht stehen. Peterson knipste wieder seine Taschenlampe an, und wir bewunderten den Schatz von zerbrochenen Haushaltswaren, Porträts, die aus der Mode gekommen waren, und Krimskrams … All das würde in ein oder zwei Tagen fort sein, nachdem der ganze Ort hier in Flammen aufgegangen war. Wir suchten uns ein Eckchen; Markham verkündete, dass er die erste Wache übernehmen würde, und ich legte mich schlafen.
Mir fiel die letzte Wache zu. Ich lehnte mich gegen die Wand und beobachtete, wie die Muster vom hereinströmenden Licht über den Boden wanderten, während die Sonne aufging; dann weckte ich die anderen fürs Frühstück. Wir saßen auf dem Boden und futterten einige dieser unsäglichen, aber reichhaltigen Kekse, die immer in unsere Feldrationen gestopft wurden, und lauschten darauf, wie sich das Haus langsam regte. Eine Tür wurde geöffnet, und eine Frau rief etwas nach draußen. Irgendjemand musste im Hühnerstall sein, denn ich konnte ein Gackern hören. Leise rief ein Kind etwas, dann hörten wir rennende Schritte auf dem Holzfußboden. Alle waren aufgestanden. Zeit, uns bereitzumachen.
Wir verstauten gerade wieder unser ganzes Zeug, als wir Hufschläge hörten. Jemand näherte sich, und zwar mit großer Geschwindigkeit. Und dann ging’s los.
»Teufel noch mal, der ist aber früh dran«, murmelte Peterson. »Lasst alles hier. Wir können später zurückkommen und es holen.«
Und so schlichen wir die Stufen hinunter und schlüpften auf die Galerie – jetzt waren wir zur Abwechslung mal ganz froh über die schlechte Beleuchtung. Da wir in unserer Vermutung bestätigt wurden, dass alle ihre Aufmerksamkeit auf die Vordertür konzentrieren würden, schlängelten wir uns weiter nach vorne, legten uns bäuchlings auf den Boden, krochen bis ans Gitter und spähten hindurch. Wir hatten eine ausgezeichnete Sicht auf die Vordertür unten und auf den Großteil der Halle. Es gab keinen Eingangsbereich, sondern man gelangte nach dem Eintreten unmittelbar in das Vestibül. Wer auch immer da war – was auch immer gleich geschehen würde –, wir würden alles mit eigenen Augen mit ansehen können.
Peterson und ich sind Historiker. Wir vergessen uns im Geschehen. Das ist der Grund, warum wir gewöhnlich jemanden vom Sicherheitsteam mitnehmen, der uns den Rücken freihält, denn wir vergessen einfach allzu leicht, selbst darauf zu achten. Meine Aufmerksamkeit war von dem gebannt, was unten vor sich ging. Ich verschwendete keinen einzigen Gedanken daran, mal hinter mich zu schauen.
Bis Markham mich anstupste und über meine Schulter hinwegnickte. Zwei kleine Jungen, gut, aber schlicht gekleidet, standen im Durchgang zu dem Raum, von dem ich vermutete, dass er Lady Laceys eigenes Wohnzimmer war. Sie hielten sich an den Händen und sahen verängstigt aus. Reiter, die mitten im Bürgerkrieg kurz nach Tagesanbruch im gestreckten Galopp eintrafen – das war nie ein gutes Zeichen.
Der ältere Bursche war sehr bleich, und in seiner blauen Jacke und den Kniebundhosen wirkte er außerordentlich schlank und zart. Blonde Locken hingen ihm ins Gesicht. Sein Bruder war stämmiger, dunkelhaarig und in ähnlichen Stoff gekleidet. Beiläufig fragte ich mich, ob er vielleicht die Sachen auftrug, aus denen sein Bruder herausgewachsen war. Das mussten Charles und James sein, das Brüderpaar.
Die beiden starrten uns schweigend an. Angesichts der Tatsache, dass sie drei völlig Fremde vor sich hatten, die auf dem Bauch lagen und durchs Geländer schauten – etwas, das sie vermutlich noch nie zu sehen bekommen hatten –, blieben uns wohl nur noch Sekunden, ehe einer der beiden Alarm schlagen würde.
Unten hämmerte jemand gegen die Vordertür und verlangte Einlass. Die Jungen rissen ihre Blicke von uns los und widmeten sich stattdessen der Großen Halle. Dann starrten sie wieder uns an.
Markham rollte sich auf den Rücken, winkte ihnen zu, legte einen Finger auf seine Lippen und bedeutete ihnen mit einer Geste, sich wieder in den Raum hinter ihnen zurückzuziehen. Erstaunlicherweise taten sie genau das. Genau genommen schienen sie sogar ganz froh darüber zu sein.
Unten wurde das Donnern gegen die Tür lauter. Kein Dienstbote kam, um aufzumachen. Waren bereits alle geflohen? In unserer gesamten Zeit dort bekamen wir keinen einzigen zu Gesicht.
Lady Lacey – jedenfalls vermutete ich, dass sie es war – durchquerte langsam die Halle. Ich konnte sie nur von hinten sehen. Sie trug irgendetwas auf dem Kopf – es war nicht genau zu erkennen. Ihr Kleid aus einem dunklen, steifen Stoff wurde über einem einfacheren Unterkleid getragen. Ihr Rockteil kam mir noch üppiger vor als mein eigenes, und ihre weiten Ärmel ließen ihre Taille von hinten modisch schmal aussehen. In der plötzlichen Stille konnte ich hören, wie die Seide ihres Kleides über den steinernen Fußboden rauschte.
Dann setzte das Pochen wieder ein. Sie straffte sichtbar ihre Schultern und schob die Riegel zurück. Sofort wurde die Tür aufgestoßen und schlug gegen die Wand. Überall im Gebäude hallte das Echo vom Aufprall wider. Ich riskierte einen Blick über die Schulter. Die Jungen waren fort.
Eine staubige Gestalt wankte in die Halle, beugte sich vor und rang keuchend nach Luft.
Margaret Lacey trat einen Schritt zurück und hielt sich die Hände vors Gesicht.
»Edmund?«
Plötzlich hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache.
Der frisch Eingetroffene richtete sich auf und griff nach ihren Händen. »Margaret, ich bin da, um dich zu warnen. Er kommt. Er ist auf dem Weg hierher. Ich habe über die Felder abgekürzt, aber er wird jeden Augenblick hier sein.«
Sie drehte sich halb um, und ich konnte ihr weißes Gesicht erkennen.
»Rupert? Er kommt hierher? Aber warum?«
Das Gesicht des Mannes konnte ich nicht richtig sehen, denn das Licht kam von hinter ihm, aber ich hörte, wie er tief und schlotternd Luft holte.
»Weil er es weiß, Margaret. Gott steh uns beiden bei – er weiß es.«
Drei
Genau hier liegt offenkundig das Problem mit Legenden. Es sind nichts als Legenden. Ein bunter Strauß farbenfroher Fakten, so zusammengebunden, dass daraus eine gute Geschichte entsteht. Was der Grund dafür ist, dass die Welt Historiker braucht. Wir springen zurück zu irgendeinem beliebigen Ereignis, finden die echten Tatsachen heraus, gehen dabei allen Widrigkeiten aus dem Weg, die uns zu jener Zeit begegnen können, und kehren im Triumph zurück. Das ist es, was Historiker tun. Nur, um das mal klarzustellen: Es ist ja nicht so, dass wir nur herumsitzen, Tee schlürfen und ständig alles vermasseln.
Auf jeden Fall hatte es den Anschein, dass selbst St. Mary’s sich hin und wieder bei den Fakten irrt. Der Art und Weise nach zu urteilen, wie die beiden einander umschlungen hielten, war es offensichtlich, dass Edmund Lacey und seine Schwägerin eine größere Zuneigung füreinander hegten, als uns bekannt gewesen war.
Aber wer war dieser »er«? Und was wusste er? Das waren Fragen, die nicht besonders schwer zu beantworten waren, und er war auf dem Weg hierher. Ab jetzt befanden wir uns auf unbekanntem Terrain.
Ich warf einen Blick zu Peterson, der sich völlig von dem menschlichen Drama dort unten vereinnahmen ließ, und zu Markham, der immer noch die Lage hinter uns überwachte. Er legte seinen Kopf schräg und lauschte. Und dann hörte ich es ebenfalls: weitere Hufschläge. Diesmal war es mehr als nur ein Reiter. Markham verschmolz mit den Schatten, kehrte einige Augenblicke später wieder zurück und flüsterte: »Es sind vier. In gestrecktem Galopp. Was ich da sehe, gefällt mir gar nicht.«
Mir gefiel es auch nicht. Ich drehte mich herum, um mich zu vergewissern, dass die beiden Kinder aus der Schusslinie und in Sicherheit waren.
Dort unten in der Halle hatten auch Margaret und Edmund Lacey den Lärm der sich nähernden Reiter gehört. Margaret stieß einen kleinen Schrei aus und klammerte sich an Edmund.
Er schob sie in Richtung Treppe. »Ich werde mit ihm sprechen. Geh du nach oben und bleib bei den Jungen.«