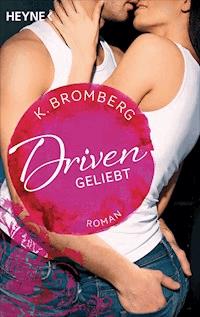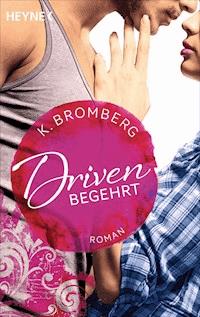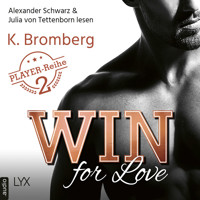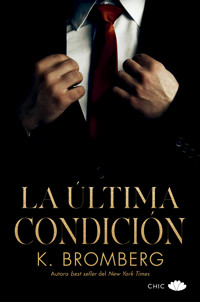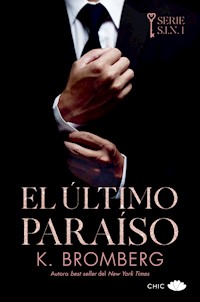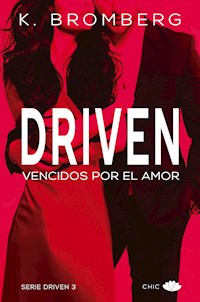9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Die Liebesgeschichte von Zander und Getty: Ein Spin-off zur Driven-Serie
Rennfahrer Zander Donovan fühlt sich wie ein König hinter dem Lenkrad. Doch dann wirft ihn ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit völlig aus der Bahn. Seine Karriere scheint am Ende, und er sucht Zuflucht im Haus eines Freundes. Doch hier wohnt bereits Getty Caster, die endlich ihr altes Leben hinter sich gelassen hat und dringend Zeit für sich braucht. Der unfassbar attraktive Zander macht keine Anstalten, zu gehen, und so kommen sich die beiden immer näher …
»K. Bromberg lässt uns an die Kraft der wahren Liebe glauben.« Audrey Carlan
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Ähnliche
Das Buch
Zander Donovan, erfolgreicher Rennfahrer, liebt seinen Job. Doch dann dringt etwas aus seiner Vergangenheit ans Licht, und seine Karriere scheint zu Ende. Nachdem er seine Sponsoren verloren hat und von seinem Team gefeuert wurde, sucht er Zuflucht in Pine Ridge. Aber das Haus seines Freundes ist nicht so verlassen, wie er gedacht hatte.
Getty Caster ist ihrem alten Leben, ihrem gewalttätigen Mann und ihrem Vater endlich entkommen. Ohne das Geld ihrer Familie muss sie auf eigenen Beinen stehen und arbeitet als Barkeeperin in Pine Ridge. Eine Freundin überlässt ihr ein Haus am Strand, wo sie endlich zur Ruhe kommen will. Doch ein ungebetener Gast wartet hier auf sie. Zander ist zwar unfassbar attraktiv, aber Gesellschaft kann Getty gerade überhaupt nicht gebrauchen.
Die Autorin
K. Bromberg lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern im südlichen Teil Kaliforniens. Wenn sie mal eine Auszeit von ihrem chaotischen Alltag braucht, ist sie auf dem Laufband anzutreffen oder verschlingt gerade ein kluges, freches Buch auf ihrem eReader.
Lieferbare Titel
Driven. Verführt
Driven. Begehrt
Driven. Geliebt
Driven. Die Lovestory von Rylee und Colton
Driven. Verbunden
Driven. Tiefe Leidenschaft
Driven. Bittersüßer Schmerz
Driven. Starkes Verlangen
K. BROMBERG
Roman
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Down Shift bei Berkley.
Deutsche Erstausgabe 02/2020
Copyright © 2016 by K. Bromberg
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag,
München in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Uta Dahnke
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Shutterstock, Alex Volot
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-25867-2V001
www.heyne.de
Zander
Blut.
So viel Blut. Meine Hände sind voll davon, und es dringt nass und klebrig durch meine Schlafanzughose – die Scooby-Doo-Hose mit dem Loch am Knie von der netten Frau mit der komischen Brille bei der Heilsarmee.
Lieber denke ich an sie, an ihre komische Brille, und nicht an das viele Blut.
Es ist überall. Und es kommt immer mehr, immer mehr.
Es hört einfach nicht auf.
Was soll ich nur machen?
Staub tanzt in der Luft. Winzige Partikel wirbeln in den Lichtstreifen, die durch den Spalt zwischen Jalousien und Fensterrahmen ins Hotelzimmer dringen. Meine Sicht ist verschwommen. Mein Hirn erschöpft.
Und benebelt.
Weil Alkohol die Träume, die einfach nicht aufhören wollen, erträglicher macht. Träume, die keine echten Träume mehr sind. Die eingesetzt haben, als ich vor drei Wochen den Karton geöffnet habe und das Stück Papier fand, das meine Welt in ihren Grundfesten erschüttert hat.
Erneut setze ich die Flasche Jameson an und nehme einen tiefen Schluck. Kein Brennen mehr in der Kehle, die Wärme nur flüchtig. Und doch reicht der Alkohol aus, um meinen Verstand zu betäuben. Damit die Träume verblassen.
Damit die Wahrheit in einem anderen Licht erscheint.
Die Pflaster. Hastig klebe ich eins nach dem anderen auf; die Schachtel ist fast leer. Aber sie helfen gar nicht. Das Blut läuft und läuft. Es hört einfach nicht auf.
Was soll ich nur machen?
Noch einen Schluck. Und noch einen.
Ich bin so müde. Aber ich hab’s auch so satt. Ich hab’s satt, mich fragen zu müssen, ob meine Adoptiveltern Bescheid wussten. Natürlich wussten sie es. Warum mich also anlügen? Hatte ich kein Recht darauf, zu wissen, was in diesem Bericht steht? Sodass ich mich damit hätte auseinandersetzen können? Um es zu verarbeiten?
Verdammt, doch! Verdammt, nein. Ich weiß es einfach nicht.
Noch einen Schluck. Und gleich noch einen hinterher.
Die Schere. Ein silbernes Glänzen an ihrem Hals. Das dunkle Rot, das durch meine Finger quillt, als ich versuche, sie wieder heil zu machen. Ihr zu helfen. Sie zu retten. Das Blut zu stoppen.
Der Geschmack nackter Angst. Mein Wimmern und Flehen. Was soll ich nur machen?
An all das kann ich mich erinnern, warum also nicht daran, ob ich es getan habe oder nicht? Aber offenbar habe ich es. So steht es in dem Bericht. Warum sollte der lügen?
Moment mal. Die Sonne scheint. Ich sehe den Staub tanzen. Es ist Tag? Seit wann denn das?
Ich hebe die Flasche an. Leer. Hole tief Luft. Lasse mich im Sessel zurückfallen. Keine Chance mehr, zu vergessen. Verdammt.
Ich fahre zusammen, als jemand an meine Tür hämmert. Dabei hätte ich damit rechnen müssen. Ich weiß schließlich, dass ich gerade wieder Mist baue. Nur interessiert mich das bei allem, was mich sonst so umtreibt, überhaupt nicht.
Ich weiß, wer draußen steht, noch ehe ich die Stimme höre. War schon klar, dass er irgendwann hier aufkreuzen würde. Und natürlich ist er stinksauer – was sonst?
Soll er doch.
»Zander!« Seine Faust hämmert gegen die Tür und dröhnt wie Donner in meinem Kopf. »Mach auf.« Wieder das Dröhnen. »Mach verdammt noch mal die Tür auf.«
Und als ich schließlich gehorche, ist das Licht im Flur, passend zum Donner, grell wie ein Blitz. Schützend halte ich mir den Unterarm vor die Augen, doch es bringt nicht viel, bis er das Licht mit seinem Körper abschirmt.
Colton. Mein Mentor. Mein Chef. Der Mensch, der mich besser kennt als jeder andere.
Mein Vater. Okay, Adoptivvater, aber spielt das eine Rolle?
Wir sehen einander an. Sein Blick verrät Sorge, aber auch Verärgerung, als er meine verknitterte Kleidung mustert – noch die von gestern – und betont in der Luft schnuppert, um mir klarzumachen, dass er den Schnaps riechen kann, der mir wahrscheinlich aus allen Poren dringt.
Doch. Es spielt eine Rolle.
Lügen spielen eine Rolle. Vor allem, wenn sie von Leuten stammen, die dich angeblich lieben.
»Hast du nicht etwas vergessen?«
Sein Tonfall ist beißend, und ich habe zu viele Promille im Blut, um meine Worte mit Bedacht zu wählen.
»Ich wüsste nicht, was«, antworte ich und will ihm die Tür vor der Nase zuschlagen.
Er rammt seine flache Hand dagegen, und mit einem ohrenbetäubenden Krachen prallt die Tür im Zimmerinneren gegen die Wand. Ich habe seinen Zorn verdient, das weiß ich, aber in meinem trunkenen Zustand fällt es mir schwer, auch nur einen feuchten Kehricht darum zu geben.
Seine Schulter stößt mir gegen die Brust, als er eintritt und das Licht einschaltet, und es kostet mich meine ganze Kraft, nicht die Beherrschung zu verlieren und mit den Fäusten auf ihn einzuprügeln, um Frust, Wut, Unglaube und alles, was sich noch in mir aufgestaut hat, an ihm auszulassen.
All den Kram, den ich selbst zu verantworten habe, aber lieber auf ihn schiebe. Und auf Rylee, meine Adoptivmutter. Auf die ganze verdammte Welt.
Und plötzlich wird mir beinahe übel von meinen eigenen Gedanken. Wie kann ich ausgerechnet den Mann angreifen wollen, dem ich alles verdanke? Und doch tauchen prompt wieder die Bilder auf: das Blut. Die Pflaster. Die Schere.
Meine Mom.
Die Wahrheit, die mein Hirn vor mir verborgen hat.
Die Wahrheit, die es vor mir hat verbergen wollen.
Die Fäuste geballt und am ganzen Körper bebend, bleibe ich stehen, wo ich bin, und kämpfe den Zorn zurück, der seit ein paar Wochen in mir tobt, ohne ein Ventil zu finden.
»Weißt du, was ich nicht kapiere?«, fragt er wie beiläufig, als er die leere Whiskeyflasche vom Boden aufhebt und mit einem kleinen, freudlosen Lachen auf das unberührte Bett wirft. »Warum?«
Eine echte Fangfrage. Die so viel Ballast mit sich bringt, dass ich gar nicht erst anfangen will, es ihm zu erklären. Obwohl es mich in den Fingern juckt. Ich weiß nur nicht, ob ich mit dem, was ich damit auslöse, umgehen kann.
Also antworte ich nicht. Die Frage hängt in der abgestandenen Luft des Hotelzimmers, und die Stille lastet auf mir, während er sich umsieht. Nach ein paar Sekunden begegnet er meinem Blick erneut. »Warum?«, wiederholt er die Frage. Und ich beschließe, auch weiterhin das Arschloch zu geben. Das ist so viel einfacher, als laut auszusprechen, was ich selbst noch immer nicht glauben will.
»Warum was?«, kontere ich mit vor Sarkasmus triefender Stimme, die impliziert, dass es ihn einen Dreck angeht.
»Das hier ist kein Witz, Junge.« Er zieht missbilligend eine Augenbraue hoch und schüttelt wieder den Kopf.
Seine Enttäuschung ist auch etwas, womit ich mich nicht auseinandersetzen will. Fragen steigen in mir auf. Schwären wie eine Wunde. Brennen sich in mich, bis ich die Bitterkeit nicht mehr unterdrücken kann.
»Schon klar. In letzter Zeit bin der Witz ja ich.« Der Autopsiebericht blitzt erneut vor meinem geistigen Auge auf und schürt meinen Zorn noch.
Seine Augen werden schmal. Meine Feindseligkeit muss ihm wehtun. »Damit hast du verdammt noch mal recht«, sagt er schließlich.
Erst jetzt nehme ich sein T-Shirt und die Trainingshose wahr. Es ist sein Glücksoutfit, das er gewöhnlich unter dem Rennanzug trägt.
Und endlich kapiere ich auch, dass ich tatsächlich Mist gebaut habe – und wie! Es ist Tag. Ich sollte ganz woanders sein und etwas anderes tun, als mich bis zur Bewusstlosigkeit zu betrinken.
Er sieht mir offenbar an, dass es mir dämmert. »Ah. Dir ist es also entfallen? Die Trainingsfahrt für die letzten Anpassungen? Oder ist dir vielleicht sogar das komplette Rennen morgen entfallen? Na ja, nach dem gestrigen Abend würde ich an deiner Stelle auch am liebsten alles vergessen, was mich an Alabama erinnert.«
Bei seiner letzten Bemerkung blitzen Erinnerungen auf: laute Musik, die fette Rechnung aus dem VIP-Bereich der Bar, Groupies, die etwas von mir wollen. Alle wollen was von mir.
Viele Hände, Gedränge, ein Handgemenge. Alle schubsen und schieben.
Genug!
Smitty, der mich zurückhält, meine Arme mit eisernem Griff umklammert. Aber wieso? Was zum Henker ist geschehen? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass er mich hier abgesetzt hat. Im Hotel. Meinem Zuhause für diese Woche.
»Ich hab einfach ein bisschen Spaß gehabt«, sage ich verächtlich, um die Lücken in meiner Erinnerung zu überspielen. »Was geht dich das an?«
Mit einem Satz ist er bei mir und drückt mich gegen die Wand. Er ist schnell. Das hätte ich nicht erwartet, aber bisher hatte ich ihn auch noch nie herausgefordert.
Wir starren einander an – Vater und Sohn, Mentor und Schützling, Chef und Angestellter, und doch nur zwei Männer –, und einen Moment lang erkenne ich in seinem Blick, wie sehr ich ihn gekränkt habe.
»Was es mich angeht? Was es mich angeht?«, knurrt er und wird mit jedem Wort lauter. »Wo genau soll ich anfangen? Zu Hause zu spät zum Training zu kommen ist eine Sache, Zander. Aber deine Sponsoren lächerlich zu machen, indem du sie bei dem aufwendigen Abendessen, das sie nur für dich organisiert haben, einfach versetzt, um nebenan in der Bar zu sitzen und so laut zu lachen, dass sie dich hören können, ist unverzeihlich! Und dann der endlose Strom mehr als fragwürdiger Frauen, mit denen du dich überall blicken lässt – Herrgott, Zander! In deinem Alter war ich genauso wild auf Erfahrungen, aber sogar ich hatte gewisse Ansprüche.«
Ich verdrehe die Augen und schnaube verächtlich. Meint er ernsthaft, ich kaufe ihm diese Heiligennummer ab? Ich kenne doch all die Geschichten von früher. Als hätte er sich damals nicht ausgetobt!
»Hältst du das für witzig?«, fährt er mich an und stößt mir erneut gegen die Brust. »Die wichtige Testfahrt vor einem Rennen zu verpassen, bei dem du der Fahrer bist und eine gottverdammte Meisterschaft gewinnen sollst, halte ich absolut nicht für witzig. Du tauchst einfach nicht auf. Ohne ein Wort zu sagen. Lässt deine Leute hängen. Dein Team! Die ungefähr hundert Fans, die im VIP-Zelt treu auf ihren Star gewartet haben – und warum das Ganze? Weil du dich lieber mit billigem Whiskey besoffen hast wie irgendein Penner von der Straße. Na, komm, sag mir, du Wunderkind der Rennszene, ist das wirklich witzig?«
»Lass. Mich. Los«, presse ich hervor, obwohl mir der Druck seines Unterarms auf meiner Brust guttut.
Er tritt einen Schritt zurück, löst aber die Finger, die mich am Hemd gepackt haben, erst mit einem Moment Verzögerung. Ich rege mich nicht; sein Blick hält mich fest. Ich sehe Enttäuschung in seinen Augen, aber auch Besorgnis und eine Wut, die meiner in nichts nachsteht.
Ich konzentriere mich auf die Wut, denn sie kann ich nachvollziehen, wenn meine auch ganz andere Gründe hat als seine. Oder auch nicht. Was für eine Ironie – er ist sauer, weil er von seinem Sohn mehr erwartet hat, und ich bin es, weil ich von meinem Vater mehr erwarte.
»Du kommst zu spät, erscheinst total verkatert zum Training und lässt ohne Grund dein Team hängen. Du stößt Rylee vor den Kopf, benimmst dich mir gegenüber wie ein Arschloch und hältst deine Brüder auf Abstand. Und da fragst du mich noch, was es mich angeht? Vielleicht solltest du dir diese Frage selbst stellen.«
»Das ist alles nicht dein Problem.«
»Und ob das mein Problem ist. Alles, was dich betrifft, ist mein Problem, und im Augenblick drehst du durch.« Die Verbitterung in seiner Stimme lässt mir die Brust eng werden. »Du bist definitiv zu weit gegangen.«
»So wie du jetzt gerade?«, stoße ich hervor. »Lass mich verdammt noch mal in Ruhe. Hau ab!« Ich weiß, er hat recht, und ich weiß auch, dass ich meine Worte nicht zurücknehmen kann, aber es kümmert mich nicht.
Wieder tritt er einen Schritt auf mich zu, das Kinn erhoben, die Fäuste geballt. Seine Augen blitzen. Er hat die sprichwörtlichen Samthandschuhe ausgezogen. »Hör zu, ich hab’s kapiert. Irgendwas kocht in dir, aber du willst nicht darüber reden. Lieber attackierst du die Leute um dich herum und versuchst alles, was du dir hart erarbeitet hast, durch schwachsinnige Aktionen zunichtezumachen. Ja, ich kapiere es, Zander, und gerade deshalb solltest du gründlich darüber nachdenken, mit wem du es hier zu tun hast!« Er presst die Worte hervor, und natürlich weiß ich, worauf er anspielt. Er hat in seiner eigenen Kindheit massiven Missbrauch erfahren, weswegen er tatsächlich weiß, wie ich mich fühle. »Ich kenne den Hass, der in den Eingeweiden brennt und dein Herz verhärtet, aber er bringt dir nichts – gar nichts. Ich gebe mir Mühe, Geduld mit dir zu haben. Für dich da zu sein, wann immer du mich brauchst. Immer wieder habe ich dir angeboten, dir zuzuhören oder auf andere Art zu helfen, aber du willst nicht. Nun muss ich zusehen, wie du dir selbst alles kaputtmachst, und soll dich in Ruhe lassen? Abhauen? Du bist doch nicht mehr ganz richtig im Kopf.« Er verstummt, um wieder zu Atem zu kommen, während ich innerlich koche. Weil er recht hat. Weil ich unfähig bin, diesen Unsinn zu beenden und ihm die eine Frage zu stellen, die ich stellen muss.
Weil der Schmerz nicht nur meine Urteilskraft vernebelt, sondern auch den wahren Grund für meinen Zorn vor mir verbirgt.
»Ich habe die Presse abgewimmelt und Rylee ausgeredet, sich einzumischen. Ich habe dir alle Freiheiten gelassen, aber du hast dir deine eigene Grube gegraben, und jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Tja, Glückwunsch, Kumpel, Schluss mit lustig. Deine Sponsoren sind ausgestiegen.«
Was?
In der plötzlichen Stille rauscht das Blut in meinen Ohren. Ich kann nicht glauben, was er gerade gesagt hat. Ich will nicht glauben, was er gesagt hat.
Das ist seine Schuld. Das ist der einzige Gedanke, der durch meinen Kopf trudelt. Das hätte er verhindern müssen. Er hat mich im Stich gelassen. Wahrscheinlich hat er es sogar aktiv vorangetrieben, damit er mich wieder unter seine Kontrolle zwingen kann. Weil er alles kontrollieren will.
Einschließlich meiner Vergangenheit.
Gott, ich brauche einen Drink. Am besten eine ganze Flasche, um den ganzen Mist, der mir im Kopf umhergeht, zu vertreiben. Um das, was ich mir selbst zu verkaufen versuche, irgendwie zu rechtfertigen, obwohl es sich sogar in meinen Gedanken lächerlich anhört.
»Du lügst!«, brülle ich plötzlich, als ich es nicht mehr aushalte. In meinem Kopf kreisen so viele Gedanken, dass er anfängt, zu dröhnen, und fast tut der Schmerz mir gut.
»Ich würde dich niemals anlügen, Zander«, antwortet er, und seine Stimme ist, ganz im Gegensatz zu meiner, plötzlich ruhig. Gleichmäßig. Todernst.
Und seine Worte – die die Lüge schlechthin sind – entfachen die Glut, die seit einigen Wochen in mir glimmt, zu einer Stichflamme.
»Das ist Quatsch, und das weißt du ganz genau!«, brülle ich. Ich balle die Fäuste, die auf irgendetwas einprügeln wollen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir keine Freunde mache, wenn ich den Putz von den Wänden dieses ach so schicken Hotels herunterhole. Mein Körper zittert vor Zorn, und ich kann mich nicht mehr beherrschen. »Du hast mich doch angelogen, du und …«
»Schau an, du hast also alles im Griff, ja?«, fragt Colton, noch immer ruhig, doch der drohende Unterton ist unverkennbar, verspottet mich in meinem irrationalen Zorn. »Seit wann ist es okay, auch nur darüber nachzudenken, seinem Vater eine zu verpassen?«
Du bist nicht mein Vater. Der Satz blitzt grell in meinem Kopf auf und brennt sich durch die Wut. Schockiert mich. Sät Gedanken, die mir noch nie in den Sinn gekommen sind. Und obwohl sie schwachsinnig sind, bleiben sie hängen. Färben die Wut, manipulieren die Worte.
»Ich hab mich absolut im Griff«, presse ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Ach ja?« Er schüttelt den Kopf, greift in seine Tasche und holt sein Handy hervor. Verwirrt und von dumpfer Furcht erfüllt, sehe ich ihm zu. Was hat er vor? Obwohl ich keine Ahnung habe, was er mir zeigen will, ahne ich tief in meinem Inneren, dass es nichts Gutes sein kann. Er wischt durch eine Reihe von Bildern, bis er gefunden hat, was er sucht. »Sagen wir einfach, du stehst verdammt tief in Smittys Schuld, Zee, denn ich werde für das, was du verbockst, nicht mehr aufkommen. Hier. Das war das einzige Foto, das gestern gemacht wurde. Sei froh, dass der VIP-Raum leer war, als es passierte. Smitty hat sich genug Sorgen um dich gemacht, um in deiner Nähe zu bleiben und aufzupassen, dass du nicht in Schwierigkeiten gerätst. Der einzige Reporter, der sich reingemogelt hatte, musste seine Kamera dem Rausschmeißer überlassen, weil er gegen die Hausordnung verstoßen hatte.«
Dass Colton den Blick nicht von dem Bild nimmt, macht mich nervös. Eine unbestimmte Furcht lockert den stählernen Griff der Wut, und mir schwant, dass es übel sein muss, wenn er eine solche Vorrede für nötig hält.
Erinnerungsfetzen geistern durch meinen Kopf. Eine heiße Blondine. Ein Kuss wie Sex. Ein Freund, der ausrastet. Explosives Testosteron. Und meine Worte: »Ich bin Zander Donovan, verdammt noch mal!«
Das kann nicht gut ausgegangen sein.
»Mach hier nicht einen auf Dramaqueen, sondern zeig’s mir einfach.«
»Dramaqueen?« Mit einem Schritt ist er wieder bei mir und hält mir das Display vors Gesicht, damit ich das Foto sehen kann. Sofort schalte ich auf Abwehr. So war das nicht. Unmöglich kann es so gewesen sein, wie das Foto es zeigt.
Wie auch der Traum von deiner Mom nicht die Wahrheit abgebildet hat.
Wie vom Donner gerührt, stehe ich da und starre auf das Display, während ich versuche, die Lücken zwischen meinen Erinnerungen und dem, was ich auf seinem Handy sehe, zu schließen. Das Schlimme ist, dass ich nicht sicher sein kann. Vielleicht hab ich es doch getan.
»Du denkst, ich mache hier eine Show, ja? Aber weißt du, Zander, für mich sieht das hier ziemlich eindeutig aus.«
Das Foto zeigt definitiv mich. Die Fäuste geballt, die Arme angewinkelt, mein Gesicht vor Wut verzerrt. Aber all das ist nichts gegen die Miene der Frau vor mir. Sie hat Angst. Und wie.
»Es war nicht so, wie es aussieht.« Ich schüttele den Kopf. Ihr Mistkerl von Freund muss außerhalb des Bildes, aber direkt neben ihr gestanden haben – nämlich genau dort, wohin meine Faust zielt. Für einen Sekundenbruchteil sehe ich in meiner Miene meinen Vater. Meinen biologischen Vater. Das Ungeheuer. Das gewalttätige Arschloch. Das nie zu werden ich mir geschworen habe.
Rigoros weise ich den Gedanken zurück.
»Aber du bist auf diesem Bild, Zander. Schau genau hin. Du meinst, es wäre unangenehm, einen Sponsor zu verlieren? Warte nur, bis dieses Bild an die Öffentlichkeit dringt – Zander Donovan und wie er mit Frauen umgeht! –, dann weißt du, was man alles verlieren kann. Gott, Zander …« Ungläubig schüttelt er den Kopf. »Aber du denkst, du hast alles im Griff, ja?«
Hör auf.
»Du brauchst Hilfe.«
Hör auf.
»Du musst mit jemandem reden.«
Hör auf.
»Das ist doch nicht der Sohn, den ich erzogen habe!«
Genug!
»Ich bin verdammt noch mal nicht dein Sohn, also spiel dich nicht als mein Vater auf!«, brülle ich aus vollem Hals und lege alles an Wut und Frustration und Angst hinein, was sich in den vergangenen Wochen aufgestaut hat. Ich will, dass es aufhört. Der Schmerz, die Verwirrung, die schreckliche Furcht. Ich will nicht, dass die Vergangenheit meine Zukunft bestimmt. Dass Lügen zur Wahrheit werden.
Er weicht zurück und starrt mich mit aufgerissenen Augen und offenem Mund an. Ich kann förmlich sehen, wie er sich zusammenreißen muss. Wie er zu begreifen versucht, was ich gerade gesagt habe.
Allein seine Miene müsste mich eigentlich bremsen, aber die Wahrheiten, die er mir eben entgegengeschleudert hat, sind wie Öl aufs Feuer meiner Wut. Es lodert höher, verbrennt Vernunft, Verständnis und Selbstbeherrschung zu Asche.
Doch Colton fasst sich schnell. Er richtet sich zu voller Größe auf. »Wie bitte?« Seine Stimme ist unterkühlt, ruhig, die Warnung darin unmissverständlich. Der lärmende Zorn meines Vaters ist beeindruckend, seine tödliche Ruhe aber wahrhaft beängstigend. Ich sollte einen Rückzieher machen.
Doch ich pfeife auf alle Vernunft.
»Du hast mich sehr gut verstanden.« Unsere Blicke begegnen einander, und die Spannung im Raum lastet schwer auf uns.
»Ja. Laut und deutlich.« Seine Stimme bleibt ruhig, obwohl seine Augen spiegeln, wie sehr ich ihn verletzt habe, und schließlich steckt er sein Handy wieder ein. »Dann lässt du mir keine Wahl.« Er schaut wieder auf, und seine Miene ist reglos, emotionslos, hart. »Du bist gefeuert.«
»Bitte was?« Das wagt er nicht. Ich bin sein bester Fahrer. Amtierender Meister. Man bezeichnet mich nicht ohne Grund in der Branche als Wunderkind.
Doch als das Schweigen andauert und sich seine Haltung nicht ändert, wird der Kloß in meinem Hals immer größer, und plötzlich kann ich kaum noch schlucken.
»Du hast es gehört.«
Mein Lachen ist laut genug, um verächtlich zu klingen. Ich kann es nicht wirklich glauben, doch wenn er ein Mistkerl sein und diesen Weg einschlagen will – bitteschön! Ich brauche ihn und seine Lügen nicht. Ich brauche nichts von ihm.
Es ist ja nicht so, als wäre ich nicht schon früher auf mich allein gestellt gewesen.
Blut. Schere. Pflaster.
Der Selbstschutz kommt zuerst. Der Schmerz durchdringt mich, der Flecken auf der Seele ist schwärzer denn je. »Okay, kapiert.« Wieder starren wir einander an, dann schüttele ich den Kopf. »Ich komme sowieso besser allein klar.«
»Gut, dann viel Glück damit, Junge. Zander«, verbessert er sich, und der beißende Unterton ist unverkennbar. »Und versuch gar nicht erst, bei den anderen Teams unterzukommen. Erstens befinden wir uns mitten in der Saison, und zweitens werden sie sich hüten, dich einzustellen.«
»Das kannst du nicht machen.« Fassungslosigkeit mischt sich in meinen Zorn. Er wird den anderen Rennställen doch wohl nicht drohen.
»Nicht? Dann pass mal auf.« Er schenkt mir sein berühmtes Mistkerl-Grinsen, das seine Konkurrenten fürchten. »Ich bin länger dabei als du. Niemand setzt sich einfach darüber hinweg – nicht einmal für eine derart sichere Bank, wie du sie darstellst. Oh, Moment mal, du bist ja gar keine sichere Bank mehr, wenn deine Sponsoren laufen gehen, weil du nicht zur Trainingsfahrt aufkreuzt und man sich nicht einmal sicher sein kann, dass du das Rennen überhaupt fährst. Es ist ja nicht so, als ob sich dein Privatleben diskret abspielt.« Er lacht spöttisch. »Glaub einem erfahrenen Rennstallbesitzer. Du bist zu einem Risiko geworden, zu einer Belastung. Du magst so gut fahren wie kein Zweiter – ein wandelndes Pulverfass will niemand.«
Ich sehe rot, und obwohl ich weiß, dass ich mir selbst damit schade, ist mein Wunsch, ihn zu kränken, ihn zu verletzen, übermächtig. Mein Selbstschutzprogramm läuft auf vollen Touren.
»Verpiss dich, Colton«, erwidere ich mit vor Verachtung triefender Stimme, um in diesem Moment, in dem meine gesamte Existenz infrage gestellt ist, das Gesicht zu wahren. »Du und dein vermeintlicher Teamgeist. Dir geht es doch immer nur um den nächsten Sieg. Das nächste Preisgeld. Die Fahrer selbst sind dir doch egal. Du beutest sie aus – belügst sie, falls es sein muss –, Hauptsache, sie fahren. Ist es nicht so, Boss?«
»Deine Ansicht lässt mich kalt«, antwortet er und zieht eine Augenbraue hoch. Seine Stimme ist Eis pur. »Und wenn du meinst, dass dir das deinen Job zurückbringt, muss ich dich leider enttäuschen.«
»Fick. Dich.« Obwohl ein Feuer in mir tobt, verursacht mir sein kalter Blick eine Gänsehaut. Denn diesmal ist es ernst. Diesmal versucht er nicht, mir mit irgendeinem Psychogefasel zu kommen, um mich zur Vernunft zu bringen.
Stattdessen schrammt sein leises Lachen über meine Nerven. »Du schadest damit nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die mit deinem Job zusammenhängen. Ich werde deinen Wagen keinem anderen geben und auch niemanden für dich einstellen. Ginge es mir nur um Geld, täte ich das wohl kaum, richtig? Was mir Sorgen macht, bist du. Du hast den Bogen längst überspannt und läufst Amok, und ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du gegen die Wand fährst. Es tut mir leid, dass es so kommen musste, aber ich habe kein Problem damit, ein Arschloch zu sein, wenn ich dich damit wachrütteln kann. Retten kann. Denn darum geht es mir.«
Schweigend stehen wir voreinander – vor den Trümmern einer einst so starken emotionalen Verbindung. Zum ersten Mal, seit er an die Tür gehämmert hat, wird mir bewusst, wie müde er aussieht. Die Sorge hat tiefe Falten in sein Gesicht gegraben, und obwohl ich ihm noch so vieles entgegenschleudern will, wollen mir die Worte plötzlich nicht mehr über die Lippen kommen.
Mit einem letzten Nicken wendet er sich zum Gehen. Mein Blick folgt ihm, obwohl ich wünschte, er wäre schon fort, denn plötzlich wirkt er so besiegt, dass ich es kaum ertragen kann. Er greift nach dem Türknauf. »Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Zee. Versuch zu klären, was immer du für dich klären musst. Und lass jemanden an dich ran, statt alle auszusperren. Es muss nicht ich sein und auch nicht Rylee oder sonst jemand, den wir kennen, aber tu es, vertraue dich jemandem an, öffne dein Herz. Manchmal braucht man einen frischen Blick, eine neue Sichtweise, um die Dinge wieder geradezurücken. Tauch ab für eine Weile, unternimm eine Reise, was auch immer, aber nutz die Zeit, um wieder zu dir zu finden. Ich wünschte, du würdest mit mir reden, aber ich weiß besser als die meisten anderen Menschen, dass man es manchmal nicht kann. Ich bitte dich nur, dich nicht von dem, was dich auffrisst, besiegen zu lassen. Du kannst es schaffen.« Seine Stimme kippt, und er muss sich räuspern, und am liebsten würde ich mir die Hände auf die Ohren pressen. »Ob du es so siehst oder nicht – du bist mein Sohn, und ich liebe dich, was auch immer du anstellst.«
Er öffnet die Tür, schließt sie hinter sich. Wieder tanzen Staubpartikel im Licht. Die Stille ist erdrückend.
Ich kämpfe gegen den Drang an, ihm hinterherzulaufen. Widerstehe dem Bedürfnis, zu brüllen, zu schreien, das Zimmer zu zerlegen, um mich auszutoben. Denn nichts würde danach besser sein.
Ich greife nach der Flasche Jameson auf dem Bett und führe sie an die Lippen, bis mir einfällt, dass sie leer ist. Das Geräusch der Flasche, die gegen die Wand kracht und zerspringt, ist ohrenbetäubend.
Kopfschüttelnd falle ich aufs Bett zurück. Versuche zu begreifen, was gerade passiert ist. Was ich nicht zu verhindern versucht habe. Was ich ohne Gegenwehr habe geschehen lassen.
Am lautesten tönt in meinen Ohren die Zurückweisung aus dem Mund des Mannes, der mir nicht nur Vater, sondern auch Vorbild war und dem ich so viel zu verdanken habe.
Ach ja? Kannst du es ihm verübeln?
Ich schließe die Augen und reibe mir mit den Händen über das Gesicht. Mein Rausch ist abgeebbt, der lindernde Dunst hat sich aufgelöst. Alles, was mir je wichtig war, ist mit einer zugeschlagenen Tür aus meinem Leben verschwunden: meine Familie, mein Job, meine Bodenhaftung. Ich spüre den Schmerz ungefiltert.
Aber meine Wut auch. Genau wie meine Unfähigkeit, die Vernunft einzuschalten. Und zu akzeptieren. Die Fragen zu stellen, die ich stellen muss.
Und mich zu entschuldigen.
Nein, verdammt. Ich denke ja gar nicht daran. Nicht ich bin derjenige, der gelogen hat.
Und ich würde niemals einer Frau drohen, sie zu schlagen, geschweige denn es tun. Das Bild auf Coltons Handy erscheint vor meinem geistigen Auge. Noch eine Lüge.
Der Zorn ist wieder da. Fehlgeleitet, aber zurück. Mein Körper ist rastlos, und ich bin zu aufgewühlt, als dass ich klar denken könnte. Klar denken will. Ich brauche bloß eine weitere Flasche Schnaps, um zu vergessen. Überlegen, was ich nun anstellen soll, kann ich später auch noch. Es scheint ja so, als hätte ich demnächst ziemlich viel freie Zeit zur Verfügung.
Und doch kann ich mich nicht dazu durchringen, aufzustehen und in die Bar zu gehen. Denn irgendwo tief in meinem Inneren meldet sich die Stimme des Zweifels, wird lauter und dringt in mein Herz, ohne dass ich es verhindern kann. Und ich weiß, dass es zwei Wahrheiten gibt, die ich akzeptieren muss, ehe ich wieder nach vorn schauen kann.
Ich bin Coltons Sohn.
Und ich bin derjenige, der meine Mutter umgebracht hat.
Getty
»Alles gut, Getty?«
Alles gut?
Automatisch denke ich an die Situation vor ein paar Stunden zurück. Wie schreckhaft ich reagiert habe, als der Mann von Tisch neun meinen Arm berührte, um eine weitere Runde zu bestellen. Das Krachen, als die Flasche Triple Sec auf dem Holzboden aufschlug. Die sofortige Panik, die Erinnerungen, die in mir hochkamen. Erinnerungen an eine andere Zeit, die meine ohnehin schon angespannten Nerven bis aufs Äußerste strapazierten.
Dabei war es mir bis jetzt so verdammt gut gelungen, meine Gemütsverfassung hinter der Fassade der schnoddrigen Göre zu verstecken.
Aber ich konnte die Blicke der Gäste spüren, als ich stammelnd eine Entschuldigung hervorbrachte. Und war extrem sauer auf mich, weil ich ihnen einen flüchtigen Blick auf mein Innenleben gewährt hatte. Auf Geheimnisse, die niemanden etwas angehen. Und das Leben, das ich hinter mir gelassen habe.
Ist also alles gut? Ganz sicher nicht, aber das muss Liam nicht wissen. Im Übrigen mache ich Fortschritte. Es ist erst drei Monate her, und ich habe bereits einen Job, ein Dach über dem Kopf und mehr persönliche Freiheit als je zuvor.
Es geht voran.
Mühsam, aber es wird.
Ich sammle mich und seufze, ehe ich mich dem Besitzer des Lazy Dog, der neben mir hergeht, zuwende. Nickend setze ich ein Lächeln auf. »Kommt drauf an, worauf sich deine Frage bezieht. Bei mir ist alles gut«, sage ich in selbstironischem Tonfall, weil niemand weitere Fragen stellt, wenn man alles mit einem Scherz überspielt, wie ich schon vor langer Zeit auf die harte Tour gelernt habe. »Aber frag mal die arme Flasche. Du solltest mich besser rauswerfen.«
Das Lachen, das ich mir abringe, klingt selbst in meinen Ohren hohl. Früher gehörte es ganz selbstverständlich zu mir und meinem Leben, doch in dieser neuen Existenz erscheint es mir fehl am Platz.
»Ach was. Ein Missgeschick. Das passiert jedem«, sagt Liam und holt mich wieder in die Realität. »Kein Problem, wirklich.«
»Ich kann demnächst, wenn du bei einem Spiel viel zu tun hast, einfach eine Stunde dranhängen.« Ich drossele mein Tempo, als wir uns der Stelle nähern, an der sich unsere Wege trennen. »Dann kann ich es wiedergutmachen.«
»Nicht nötig, wirklich. Komm lieber als Gast zu einem Spiel. Die meisten hier sind echte Mariners-Fans. Es macht Spaß, mit anderen zuzusehen.«
»Nein, danke, das ist nicht so meins.« Zu viele Menschen auf zu engem Raum. Beim Arbeiten habe ich wenigstens noch die Theke als Barriere, um mich vor unerwünschtem Kontakt zu schützen.
Wem, bitteschön, willst du was vormachen? Im Augenblick ist jeglicher Kontakt unerwünscht.
Er blickt mich gespielt entrüstet an. »Willst du damit sagen, dass du meine Bar nicht magst?« Inzwischen sind wir an der Ampel stehen geblieben.
»Nein, überhaupt nicht«, beeile ich mich zu antworten. »Ich wollte nur sagen …«
»Komm, entspann dich. Ich ziehe dich doch nur auf.« Er streckt die Hand nach meinem Arm aus, und ich erstarre. Und verfluche mich sofort dafür. Es ist ihm offensichtlich aufgefallen, denn er zieht die Hand wieder zurück. Und sieht mich fragend an.
»Also, ich, ähm … na ja, danke, dass du ein Stück mit mir gekommen bist. Ich bin total erledigt und …«
»Getty?«
»Ja?« Verdammt. Ich weiß, was jetzt kommt, und genau das wollte ich vermeiden.
»Wenn es irgendein Problem gibt …« Ich weiß nicht, ob mein Blick ihn unterbricht, aber er lässt den Satz unvollendet und nickt stattdessen verständnisvoll. »Ich meine, wenn du in irgendeiner Hinsicht Hilfe brauchst, bin ich für dich da, okay?«
»Danke«, murmele ich. »Das ist lieb von dir. Bis morgen. Und schlaf gut.«
Ich gehe, spüre aber seinen Blick im Rücken. Liam ist freundlich und gut. So anders als die Menschen, an die ich gewöhnt bin. Daher brauche ich dringend Abstand zu ihm. Es wäre viel zu leicht, mich auf ihn und seine Freundschaft zu stützen, obwohl ich doch weiß, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen darf. Aber die Verlockung, mich ihm anzuvertrauen, ist groß.
Und dagegen werde ich ankämpfen. In diesem neuen Leben muss ich allein zurechtkommen. Das ist das Wichtigste.
Geh weiter, Getty. Du kannst dich richtig mit ihm anfreunden, wenn du selbst weißt, wer du bist.
Ich blicke hinaus aufs Meer, das im Mondlicht glänzt, und mache mir einmal mehr bewusst, warum ich hier bin. Es war wie ein Sechser im Lotto, als die älteste Freundin meiner Mutter mir anbot, in ihrem Ferienhaus unterzukommen, das sie renovieren wollen, um es zu verkaufen, weswegen ich tatsächlich nun eine Bleibe für mich ganz allein habe. Hier kann ich in Ruhe darüber nachdenken, wie es weitergehen soll. Hier kann ich die Fehler der Vergangenheit analysieren und verarbeiten, damit meine Zukunft eine bessere werden kann.
Was ein Fehler ist, weiß man erst, wenn man ihn begangen hat, und nur dann kann man auch daraus lernen. Ich hoffe sehr, dass mir das gelingt.
Ich biege in die mit Hecken gesäumte Auffahrt ein, in der mein Auto steht, und gehe zur Eingangstür. Das Cottage ist alt. Als ich über die kaputte dritte Stufe steige, rufe ich mir in Erinnerung, dass die Treppe die erste auf der langen Liste der anstehenden Reparaturen sein sollte, die ich in die Wege leiten werde.
In Anbetracht der Tatsache, dass ich während der Renovierungsarbeiten hier umsonst wohnen darf, ist es das Mindeste, was ich tun kann.
Meine Erschöpfung macht sich mit Macht bemerkbar, sobald ich im Haus bin. Ich bewege mich so lautlos durch den Flur, als sei ich noch in meinem ehemaligen Zuhause in Palo Alto. In der Küche schalte ich das Licht aus, das ich anscheinend angelassen habe, und ignoriere mein Magenknurren zugunsten der Verlockung einer heißen Dusche. Ich kann nur hoffen, dass sich mein Rücken bald an die Arbeit im Stehen gewöhnt, denn das ständige Ziehen ist ärgerlich.
Aber es zeigt mir auch, dass ich aktiv bin. Dass ich den neuen Weg einschlage. Und die Vergangenheit vorüber ist.
In einem Anflug von Trotz, den nur ich begreife und niemand je mitbekommen wird, ziehe ich auf dem Weg zum Bad meine Sachen aus und lasse sie da fallen, wo ich gerade bin.
Schuhe. T-Shirt. BH. Rock. Höschen. Ich hinterlasse eine Spur aus Kleidungsstücken, während das Licht im Bad, das ich mit Absicht angelassen habe, mir entgegenscheint wie ein verheißungsvolles Leuchtfeuer.
Ich bin todmüde und gedanklich bei der teuren Flasche, die ich heute habe fallen lasse, als ich eintrete. Deshalb dauert es einen Moment, bis ich verarbeite, was ich sehe, doch dann reagiere ich prompt. Ich springe zurück, stoße einen markerschütternden Schrei aus und bedecke Scham und Brüste notdürftig mit meinen Händen.
In meinem Bad steht ein Mann.
Aber nicht einfach so. Und es steht nicht einfach ein Mann da.
Nein.
In meinem Bad steht ein splitternackter, tropfnasser Mann, und in dem teilweise beschlagenen Spiegel glaube ich eine Tätowierung auf seinem Rücken zu erkennen. In einer Hand hält er ein Handtuch, als ob er sich gerade das nasse Haar trocken reiben wollte, was die andere tut, weiß ich nicht, weil ich so auf seine Gegenwart fixiert bin, dass klares Denken gerade keine Priorität hat.
Sobald ich mich aus der Erstarrung lösen kann, schreie ich wieder.
Und obwohl seine Augen verraten, dass er genauso erschrocken ist wie ich, huscht ein träges Lächeln über seine Lippen. »Ich habe durchaus schon mit Frauen zu tun gehabt, die zum Äußersten bereit waren«, sagt er mit einem leisen Lachen, ehe ich zum nächsten Schrei ansetzen kann, »aber das toppt dann doch alles.«
Verwirrt stelle ich fest, dass ich mich weitaus weniger bedroht von ihm fühle, als ich es vermutlich sollte, wenn ich bei Sinnen wäre. Ich bin nackt und versuche, die Schulter nach vorn gezogen, alle einschlägigen Körperteile zu verdecken, während ich hektisch überlege, was sinnvoller ist – in den Flur zu flüchten oder das zuletzt abgelegte Kleidungsstück an mich zu bringen, um mich damit zu verhüllen. Aber natürlich ist mir klar, dass mein Höschen einen jämmerlichen Schutz abgeben würde, und ich denke ja gar nicht daran, mit einem Rückzug den falschen Eindruck zu erwecken, ich hätte Angst vor ihm.
»Wer bist du? Was machst du hier?« Adrenalin flutet meinen Körper, und ich beginne, zu zittern. Mir ist bewusst, dass das helle Badezimmerlicht, das in den Flur strahlt, jedes Röllchen, jede Unvollkommenheit meines Körpers gnadenlos beleuchtet. Verzweifelt versuche ich, die Situation einzuschätzen, über die ich momentan null Kontrolle zu haben scheine. Am liebsten würde ich zur Sicherheit alle Lichter im Haus einschalten, aber andererseits will ich genau das nicht.
»Dieselbe Frage könnte ich dir auch stellen«, sagt er, während er langsam seine Hand senkt, bis das Handtuch an seiner Seite baumelt. Natürlich sehe ich hin.
Und sehe »es« zwangsweise.
Ich springe zurück, als hätte ich mich verbrannt, doch erste Eindrücke lassen sich schwerlich auslöschen. Klar ausgeformte Bauchmuskeln, ein stattliches Sixpack, das V, das den Blick nach unten lenkt, und eine mehr als beeindruckende Männlichkeit. Was zum Teufel ist denn los mit mir? Da steht ein Mann in meinem Haus. Er hat ganz offensichtlich gerade geduscht. Und ich starre seinen Schwanz an?
»Pack das Ding weg«, sage ich und gestikuliere vage in Richtung seiner Körpermitte, bis mir bewusst wird, dass ich meine Hand von meinen Brüsten genommen habe und ihm selbst gerade einiges zum Anschauen biete. Natürlich bedecke ich mich sofort wieder, aber der Mann vor mir wirft den Kopf zurück und beginnt, zu lachen. Sein Adamsapfel hüpft auf und ab, seine Brust hebt und senkt sich und sein Gemächt bewegt sich ebenfalls.
Ich zwinge mich wegzusehen, weil … na ja, weil er ein Fremder ist. In meinem Haus. Nackt. Und, Herrgott nochmal, wieso nehme ich eigentlich nicht Reißaus und rufe die Polizei, wie jeder vernünftige Mensch es tun würde?
Endlich ebbt sein Lachen ab, und er wischt sich die Tränen aus den Augenwinkeln. »Das ›Ding‹ ist mein bestes Stück, und da das hier mein Badezimmer ist und du mich anscheinend in meinem Haus verführen willst, hast du mir wohl kaum zu sagen, was ich tun soll.« Und damit lehnt er sich mit der Hüfte gegen den Waschtisch, verschränkt die Arme vor der Brust und zieht eine Augenbraue hoch. Alles andere baumelt herum.
»Dein Haus? Verführen? Ich dich?«, stammele ich mehr, als dass ich flüssig rede. »Das ist mein Haus. Ich wohne hier.«
Nun zeichnet sich Verwirrung in seiner Miene ab. »Moment mal.« Er hebt die Hände, wodurch mein Blick dummerweise wieder dahin gelenkt wird, wo er nicht hin soll. Wenn die ganze Situation nicht so hanebüchen wäre, müsste ich lachen, nur ist mir danach momentan nicht zumute. »Ich denke, wir haben es hier mit einem Missverständnis zu tun.«
»Ach was.« Sarkasmus war immer meine beste Verteidigung, und sie lässt mich auch jetzt nicht im Stich. Allerdings ist ihre Wirkung stark eingeschränkt, da ich noch immer von einem Fuß auf den andere trete und mich zu bedecken versuche, um irgendwie mit dieser surrealen Situation zurande zu kommen.
Sein geringschätziger Blick macht es nicht besser. »Und obwohl ich zugeben muss, dass ich total auf deine Socken abfahre«, sagt er mit einem Grinsen, während er mich genüsslich von Kopf bis Fuß betrachtet, »solltest du dich vielleicht besser bedecken.« Er wirft mir das Handtuch zu, das ich auffange und sofort um mich schlinge. Ich hatte ganz vergessen, dass ich noch die nicht zusammenpassenden Kniestrümpfe trage, die zum Lazy-Dog-Outfit gehören, und wahrscheinlich denkt er sich seinen Teil. Aber das ist mir im Augenblick vollkommen egal, denn ich bin noch immer allein mit einem fremden, nackten Mann in meinem Haus und habe keine Ahnung, wie all das hier passieren konnte.
Während ich mit einer Hand das Handtuch über meinem Brustbein zusammenhalte, deute ich mit der anderen fahrig auf ihn. »Du auch.«
Wieder das freche Grinsen. »Tut mir leid, aber du hast das letzte Handtuch genommen.«
Findet er das etwa lustig? Also, ich nicht. Ganz und gar nicht. Und lustig finde ich auch nicht, dass ich bisher zu faul war, all die Handtücher, die im Trockner warten, zu falten und ins Regal zu legen. Mist.
Ich sehe mich hastig um, will ihn, um meiner Sicherheit willen, nicht aus den Augen lassen, ihn aber aus offensichtlichen Gründen auch nicht zu sehr anstarren. Mein Instinkt sagt mir, dass er keine Bedrohung darstellt, meine Vernunft sieht das jedoch anders. Also tue ich, was klug ist: Ich suche verstohlen nach etwas, was ich als Waffe benutzen kann.
Aber ich stehe im Flur; die Auswahl ist jämmerlich. Als ich einen Schritt zurücktrete, stoße ich mit dem Hinterteil gegen die alten Jalousien, und bei dem Rasseln fällt mir etwas ein. Ich taste hinter mir auf der Fensterbank und bekomme den abgebrochenen Stab zu fassen, mit dem man die Jalousien öffnet und schließt. Ohne nachzudenken, halte ich ihn verwegen wie ein Schwert vor meinen Körper. »Wie bist du hier reingekommen?«, verlange ich mit grollender Stimme zu wissen.
»Mit dem Schlüssel unter dem Frosch hinten auf der Terrasse.« Er macht nicht einmal den Versuch, sich irgendetwas um die Hüfte zu binden. Nein. Er steht einfach nur nonchalant da und grinst, als sei er daran gewöhnt, dass Frauen seinen nackten Körper anstarren.
Vielleicht ist das ja auch so. Hat er nicht eben geglaubt, dass ich ihn verführen wollte? Ist er vielleicht ein Callboy? Nein, Unsinn, was denke ich denn da? Dann würde er ja mich zu verführen versuchen.
Konzentrier dich, Getty. Denk nach!
»Was für ein Schlüssel?« Wie kommt es, dass ich nichts von einem Schlüssel unter dem Frosch auf der Terrasse wusste? Ich stoße den Stab in seine Richtung, um meinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Das Holz der Terrasse ist morsch. Du musst …«
»Und wie bist du reingekommen?«
»Ich bin hier diejenige, die Fragen stellt.«
Wieder das Lachen. Satt und vergnügt, und ich frage mich unwillkürlich, wie es wohl klingen mag, wenn er wirklich entspannt ist. »Stimmt, ich vergaß. Du in Handtuch, Kniestrümpfen und mit deiner gefährlichen Waffe in der Hand – du hast hier das Sagen.«
Am liebsten würde ich den Stab fallen lassen, aber dann packe ich ihn doch nur fester. Mag ja sein, dass ich albern damit aussehe, aber ich habe keine Ahnung, wer dieser Kerl da vor mir ist. »Antworte!«
»Ist Madame gereizt?«
»Los!« Wieder stoße ich den Stab in seine Richtung, und wieder erscheint das Grinsen auf seinem Gesicht, aber diesmal beißt er sich rasch auf die Unterlippe, damit es nicht zu breit wird und ihm Grübchen beschert.
»Smitty hat mir gesagt, wo der Schlüssel zu finden ist. Ich kann hier bleiben, solange ich ein paar Reparaturen für ihn übernehme.«
Was? »Das ist ein Missverständnis. Smitty muss etwas verwechselt haben. Denn ich wohne hier schon.«
»Wie ich aus deiner kleinen General-Custer-Einlage inzwischen geschlossen habe«, antwortet er mit einem lässigen Schwenk seiner Hand.
»Woher kennst du Smitty?« Mir schwant bereits, dass meine Empörung jeder Grundlage entbehrt, da hier offenbar etwas ziemlich schiefgelaufen ist.
»Er ist wie ein Onkel für mich.« Er zuckt die Achseln. »Und du?«
»Darcy ist wie ein Tante für mich«, kontere ich unter Bezugnahme auf Smittys Frau.
Wir sehen einander stumm an. Anscheinend haben wir beide ein Aufenthaltsrecht.
»Ich schätze, Smitty hat vergessen, dass Darcy das Haus bereits mir überlassen hat. Du wirst dir also eine andere Bleibe fürs Wochenende suchen müssen.« Da. Ich hab’s gesagt. Nimm das.
»Netter Versuch.« Er stolziert in all seiner Mannespracht an mir vorbei und steuert das Schlafzimmer an, das rechts vom Bad liegt. »Dummerweise bin ich nicht nur fürs Wochenende hier. Und ich gehe auch nicht weg.«
»Und ob du das tust.« Ich folge ihm ins Schlafzimmer und – Hilfe! – werde mit dem Anblick einer stattlichen männlichen Kehrseite belohnt, als er sich bückt, um in einer Sporttasche zu wühlen, die am Fußende des Bettes steht.
»Schau noch einmal ausgiebig hin, Socke«, sagt er mit einem Blick über die Schulter, während er sich ohne Hast Boxershorts anzieht. »Denn wenn ich erst einmal mit Smitty telefoniert habe, wirst du vermutlich erkennen müssen, dass du diejenige bist, die seine Gastfreundschaft überstrapaziert hat und ihre Sachen packen muss.«
Er geht an mir vorbei, aber diesmal stehe ich im Türrahmen, sodass er mich leicht berührt und ich den Duft von Duschgel und frisch gewaschener Männlichkeit erhasche. Sein prächtiger Hintern hat mich derart abgelenkt, dass es einen Moment lang dauert, bis die Bedeutung seiner Worte zu mir durchdringt.
»Nur über meine Leiche!«, bringe ich hervor und eile, das Handtuch fest umklammert, hinter ihm her.
»Was bei dem Körper eine echte Verschwendung wäre«, murmelt er. Oder zumindest glaube ich, das verstanden zu haben, aber sicher bin ich mir nicht, zumal er mich ja wohl nicht damit meinen kann.
»Was hast du gesagt?«
»Dass du ganz schön unordentlich bist.«
»Das stimmt überhaupt nicht.« Er schaltet das Licht im Flur an, sodass die Fährte, die ich mit Kleidungsstücken hinterlassen habe, deutlich sichtbar wird, und ich verziehe das Gesicht. Nicht wegen der Unordnung an sich, sondern wegen der Tatsache, dass er sich im Recht glaubt. Dabei hat er doch null Ahnung, was dahintersteckt. »Hör zu, du hast hier nicht einfach in mein Haus zu kommen und mir zu sagen …«
»Es ist nicht dein Haus, sondern Smittys«, verbessert er mich, während er sein Handy hochhält und mit seinem Zeigefinger aufs Display tippt.
»Im Moment nicht, denn …«
»Zander«, erklingt plötzlich Smittys herzliche Stimme aus dem Lautsprecher des Handys.
Schau an, der Kerl hat einen Namen.
»Hey, Smitty.«
Ich will den Mund aufmachen, klappe ihn aber sofort wieder zu, als der Mann namens Zander mir einen warnenden Blick zuwirft.
»Hast du den Schlüssel gefunden? Bist du ohne Probleme reingekommen?«
»Ja, danke, hat alles geklappt. Aber die Terrasse ist eine echte Todesfalle.« Er lacht wieder, und diesmal klingt es so herzlich wie Smittys Stimme eben.
»Tja, ich sagte dir ja schon, dass du dir deinen Aufenthalt verdienen musst.«
»Und das mache ich auch. Verlass dich auf mich.«
Die Stille, die sich plötzlich ausbreitet, ist seltsam aufgeladen.
»Das tue ich«, sagt Smitty schließlich leise. »Genau wie du weißt, dass du dich auf mich verlassen kannst. Ich habe dir versprochen, niemandem zu sagen, wo du bist und …«
»Hör zu, es gibt ein Problem«, unterbricht Zander ihn fast barsch. Ich habe zwar keine Ahnung, worum es geht, aber anscheinend ist es kein Thema, über das Zander reden will. Sein Blick hat sich verfinstert, und mit einem Mal wirkt er angespannt.
»Was ist los?«
»Hier ist eine Frau. Im Haus.«
»Hast du vergessen, was man mit einer Frau anstellt?« Smitty lacht. »Ich dachte, über das Bienchen-und-Blümchen-Alter bist du schon hinaus.«
Ein echtes Lächeln huscht über Zanders Gesicht, und seine Augen blitzen auf, als er mir einen Blick zuwirft. »Keine Angst, ich weiß grundsätzlich, was zu tun wäre, aber, na ja, darum geht es jetzt gerade nicht. Hier im Haus wohnt eine Frau. Sie heißt …?« Er blickt mich erwartungsvoll an.
Einen Moment lang kommt mir kein Wort über die Lippen. Ihm meinen Namen zu nennen ist beinahe wie eine Einladung, einander besser kennenzulernen, und das will ich nicht. Ich will nur, dass dieser fremde, leider durchaus charismatische Kerl das Weite sucht und mich in Frieden lässt.
Ich räuspere mich. »Getty.«
»Getty?« Er bedenkt mich mit einem fragenden Blick, als bezweifle er, dass ich meinen eigenen Namen kenne, und ich nicke. Er hat recht. Getty klingt auch in meinen Ohren noch ein wenig fremd.
Ein neuer Mensch. Ein neuer Name. Ein neues Leben.
»Smitty? Sie heißt Getty. Angeblich hat Darcy …«
»Oh, verdammt.« Smitty lacht erneut.
»Ja. Oh, verdammt«, sagt Zander etwas säuerlich.
»Hm«, macht Smitty nachdenklich. »Darcy ist auf einem Mädelsausflug in den Bergen. Miese bis gar keine Verbindung. Mitte nächster Woche kommt sie zurück, dann frage ich sie.«
»Das ist doch nicht dein Ernst.«
»Durchaus. Es gibt zwei Schlafzimmer, ein Bad kann man sich teilen. Du bist ein großer Junge, du kannst dich arrangieren.« Ein letztes vergnügtes Lachen, dann ist die Leitung tot.
»Smitty? Herrgott nochmal.« Zander lässt sein Handy auf die Küchenarbeitsfläche fallen. Er stützt sich auf und lässt den Kopf hängen, während ich das Handtuch um mich herum fester ziehe und ihn abwartend beobachte. In meinem Nacken prickelt es, aber ich versuche, das aufsteigende Unbehagen zu verdrängen.
Ich sehe mich verstohlen um. Mein Instinkt rät mir, mich irgendwo zu verstecken, falls er einen Tobsuchtsanfall bekommt. Aber wo?
Doch nach einem Augenblick hebt er den Kopf und seufzt. Die Enge in meiner Brust, die Angst, auf die ich konditioniert bin, löst sich, und ich atme behutsam aus.
»Tja, nun. Jetzt wissen wir wohl Bescheid«, sagt er, und damit drängt er sich im Flur an mir vorbei.
Wieder brauche ich einen Moment, um mir klarzumachen, dass die Vergangenheit vergangen und er nicht Ethan ist, und sobald ich es wieder weiß, renne ich ihm hinterher.
»Moment mal! Warte!«
»Worauf?« Zander dreht sich zu mir um, als sei nichts Besonderes. Als stünde er nicht nur in Boxershorts da, einen Zeh gerade zufällig in meinem Rock am Boden, und ich in ein Handtuch gewickelt und mit Kniestrümpfen vor ihm.
»Du bleibst nicht hier.«
Er grinst. »Oh, doch.«
»Nein, tust du nicht. Ein Stück die Straße hinunter gibt es ein Hotel. Und noch eine Pension.«
»Du hast gehört, was Smitty gesagt hat. Zwei Schlafzimmer. Ein Bad kann man sich teilen.«
Herrgott. Der Mann ist wirklich ein Ärgernis. Und bockig. »Du hörst mir nicht zu.«
»Doch, absolut. Ich möchte nur nicht darauf eingehen.« Er schürzt die Lippen und zieht herausfordernd seine Augenbrauen hoch. »Im Übrigen habe ich Smitty versprochen, das Haus instand zu setzen, und da ich seit Kurzem meine Versprechen halte, werde ich genau das tun.«
Der letzte Satz deutet darauf hin, dass mehr hinter seiner Anwesenheit hier steckt, als es den Anschein hat, aber ich bin zu müde von der Arbeit, um die Energie aufzubringen, ihn danach zu fragen.
»Du kannst ja das Haus in Ordnung bringen und trotzdem im Hotel wohnen«, sage ich, während er sich umdreht und zum hinteren Teil des Hauses geht. Mit so viel Enthusiasmus, wie ich aufbringen kann, füge ich hinzu: »Dann hätten wir beide etwas davon.«
»Hast du das große Schlafzimmer genommen?«
»Was?« Meine Gedanken trudeln. Hört er eigentlich überhaupt nicht zu? Er wird nicht hierbleiben. Das hier ist mein Haus. Na gut, eigentlich ist es Smittys und Darcys Haus, aber ich wohne seit fast drei Monaten hier. Es sind meine ersten eigenen vier Wände, und ich komme wunderbar zurecht – zumal ich keine andere Wahl habe –, weswegen ich sie ganz sicher nicht einfach so aufgeben werde.
»Ich frage dich, ob das Zeug im Schlafzimmer ganz hinten deins ist«, sagt er über die Schulter hinweg und greift nach dem Türknauf.
»Hast du etwa was angefasst?« Mein Misstrauen, mein Trotz ist zurück, meine zerstreuten Gedanken finden jäh wieder zusammen. Nach so vielen Jahren, in denen alles, was meine Persönlichkeit betraf, missachtet wurde, ist mir mein Privatleben heilig. Ist er in mein Zimmer gegangen und hat sich umgesehen? Hat er meine Bilder betrachtet und sich bereits ein Urteil gebildet?
»Nein«, sagt er schlicht. Ich bin direkt hinter ihm, und als er sich umdreht, scheint er mir meine Panik anzusehen. Dann plötzlich legt er den Kopf schief und mustert mich eingehend. »Als ich die Tür aufgemacht und die Sachen gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, dass Darcy sie bei ihrem letzten Aufenthalt hier liegen gelassen hat. Da ich nicht versehentlich rumschnüffeln wollte, habe ich meine Tasche ins andere Zimmer gebracht.« Er zeigt auf die Tür neben meiner.
Er ist mir viel zu nah, und als er sich mir wieder zuwendet, trete ich automatisch einen Schritt zurück. Der Raum zwischen uns ist durchdrungen von seiner … seiner … Gegenwart, und es fällt mir schwer, nicht auf ihn zu reagieren.
»Warte, stopp!« Ich nehme die Hände hoch und schüttele den Kopf. »Gib mir einen Moment, ja?« Gib mir vor allem Raum.
»Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, Socke«, sagt er mit einer seltsamen Mischung aus Ernst und Belustigung. Und doch bleibt er stehen und geht mir nicht aus dem Weg, sodass ich zwischen ihm und der Wand hinter mir gefangen bin.
»Dürfte ich?«
»Unbedingt.« Noch immer regt er sich nicht, sondern sieht mich nur an, aber ich kann ihm seinen Unschuldsblick irgendwie nicht so recht abkaufen.
»Schon mal was von persönlicher Distanzzone gehört?«, frage ich und wedele mit der freien Hand, um ihm zu bedeuten, er möge auf Abstand gehen.
»Oh. Klar. Entschuldige.« Er tritt einen winzigen Schritt zurück und kämpft gegen ein Grinsen an. »Aber du wirst dich daran gewöhnen müssen, dir die Zonen mit mir zu teilen, da wir ja offenbar in den nächsten Tagen hier zusammenwohnen werden, bis Darcy zurückkommt und Smitty dir erklärt, dass deine Zeit hier vorbei ist.«
Nun breitet sich angesichts meiner sprachlosen Fassungslosigkeit doch ein Grinsen auf seinem Gesicht aus.
»Du … du bist echt unsäglich, frustrierend und …« Attraktiv und zu nah und zu vieles anderes, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann, da Männer auf meiner gegenwärtigen Agenda keinen Platz haben.
»Und du stehst immer noch nur in ein Handtuch gehüllt da. Oh, und in Strümpfen natürlich. Hör mal, ich habe ein paar anstrengende Wochen hinter mir. Ich bin müde. Und es ist spät.« Er blickt auf seine Uhr. »Warum gehen wir nicht beide ins Bett und überlegen morgen früh, was wir machen?«
»So einfach ist das nicht.«
»Doch, eigentlich schon. Du legst dich ins Bett, machst die Augen zu und schläfst. Du musst dich höchstens entscheiden, ob auf dem Bauch, auf dem Rücken oder auf der Seite. Na? Ist doch nicht schwer.«
Dass er plötzlich auf jungenhaften Charme umgeschaltet hat, geht mir auf die Nerven, denn irgendwie wirkt das verdammt liebenswert auf mich. »Woher soll ich wissen, dass du kein …«
»Ich kann dir versichern, dass ich vieles bin – Mörder, Vergewaltiger oder Psycho allerdings nicht«, sagt er, als hätte er meine Gedanken gelesen.
»Und natürlich würdest du es mir sagen, wenn es anders wäre.«
Er lacht. »Wenn es anders wäre, hätte ich schon die ganze Zeit Gelegenheiten gehabt …« Er zuckt die Achseln. »Im Übrigen bürgt Smitty für mich. Du hast ihn doch gehört. Also schalt dein Hirn aus und schlaf ein bisschen. Wir reden morgen früh.«
Und mit einem letzten, strahlenden Lächeln und einem bekräftigenden Nicken betritt er das Zimmer und macht resolut hinter sich die Tür zu. Ich stehe da, blicke mit offenem Mund auf die verblichene Holztür und weiß nicht, wohin mit den Worten, die eigentlich noch hätten gesagt werden sollen.
»Na, dann … alles klar.« Mehr fällt mir dazu nicht ein, ehe ich in mein eigenes Zimmer gehe, im Dunkeln unschlüssig stehen bleibe und zu kapieren versuche, was in den vergangenen zwanzig Minuten eigentlich passiert ist. Mein Hunger ist vergessen, und die Dusche hat ihren Reiz verloren.
Ich drehe mich um und probiere, ob die Tür tatsächlich verschlossen ist, aber als ich aufs Bett plumpse, frage ich mich unwillkürlich, ob das Schloss nicht genauso hinüber ist wie der Rest des Hauses. Abgeschlossen oder nicht – wahrscheinlich wäre nur ein beherzter Tritt gegen den Knauf erforderlich, um die Tür zu öffnen, wenn er denn in mein Zimmer kommen wollte.
Der Gedanke setzt sich bei mir fest, als ich höre, wie seine Tür sich neuerlich öffnet. Ich halte die Luft an, entspanne mich jedoch wieder ein wenig, als sich seine Schritte in Richtung Küche entfernen.
Soll ich vielleicht vorsichtshalber die Kommode vor die Tür schieben? Ich habe in meinem Leben schon oft genug mit der Angst im Nacken geschlafen; das muss ich ausgerechnet hier nicht haben.
Doch als ich gerade meine Hände auf die Kommode lege, um zu probieren, wie schwer sie ist, klopft es. Ich fahre zusammen und schelte mich augenblicklich dafür. Es ist ja nicht so, dass ich nichts von seiner Anwesenheit wüsste.
»Nur für den Fall, dass du immer noch Angst hast und etwas zu deinem Schutz brauchst«, sagt er mit einem leisen Lachen durch die Tür, was mich noch mehr verwirrt, bis ich sehe, dass er etwas unten durch den Türspalt schiebt. »Nacht, Socke.«
Ich höre, wie seine Tür geht, stehe auf und schalte das Licht an. Vergeblich versuche ich, mir das Lachen zu verkneifen, als ich den abgebrochenen Jalousienstab auf dem Boden sehe.
Blödmann.
Unschlüssig und seltsam unruhig lasse ich das Ding liegen, wo es ist, ziehe mir einen Schlafanzug an und krieche ins Bett.
Aber obwohl ich müde bin, will sich der Schlaf nicht einstellen. Meine Gedanken rasen, während ich darüber nachdenke, was eben geschehen ist.
Die Begegnung im Badezimmer. Mein Bemühen, mich zu bedecken. Mein sehr alberner Versuch, mich mit einem Plastikstab zu verteidigen. Und so weiter.
Und doch spielt nichts davon eine Rolle, weil er noch immer da ist und mir nicht einfallen will, wie ich ihn wieder loswerden kann.
Das Komische daran ist, dass ich vor Entsetzen erstarrt sein müsste – vor allem, nachdem ich heute in der Bar den Aussetzer hatte. Und zuerst war ich es ja auch. Mein Herz raste, das Adrenalin strömte. Doch kein einziges Mal habe ich daran gedacht, wegzurennen und mich zu verstecken, wie ich es bisher immer getan habe. Und das will was heißen.
Auf jeden Fall mache ich Fortschritte.
Getty
Lautes Hämmern lässt mich aufschrecken.
Der Himmel wird gerade erst hell, und ich möchte mich nur wieder unter die Decke kuscheln und noch etwas länger schlafen. Doch als ich meine Füße aneinanderreibe, spüre ich Strümpfe, und ich schlafe nie mit Strümpfen oder Socken.
Nacht, Socke.
Die Wörter wirbeln durch meinen verschlafenen Geist, und die Erinnerung an gestern Abend kehrt live und in Farbe in ihrer ganzen komödiantischen Vielfalt zurück.
Ich muss träumen. Ich werde einfach wieder einschlafen und den Albtraum zum Teufel schicken. Mir beweisen, dass es gar nicht geschehen ist.
Als ich mir die Decke bis zum Kinn hochziehe, setzt der verdammte Hammer wieder ein, und jetzt bin ich hellwach. Und muss mir eingestehen, dass dieser Zander tatsächlich nebenan schläft. Und mein verdammter Nachbar, Nick, offenbar Spaß daran hat, in aller Herrgottsfrühe Heimwerkerarbeiten durchzuführen, ohne sich darum zu scheren, dass ich gestern bis spät abends arbeiten musste.
Verschwinde, Nick, brülle ich ihn in Gedanken an und stöhne laut. Aber was, wenn Zander auch kein Morgenmensch ist? Was, wenn Nick einfach nicht mehr zu hämmern aufhört und ihn damit in den Wahnsinn treibt, sodass er seine Sachen packt und schleunigst ins Hotel zieht?
Mit frischem Optimismus steige ich aus dem Bett, greife nach meinem kuscheligen lila Morgenmantel und knote den Gürtel fest. Ich steige über den Jalousienstab und öffne meine Tür, um nachzusehen, ob Zanders noch geschlossen ist.
Ist sie.
Hämmer weiter, Nick.