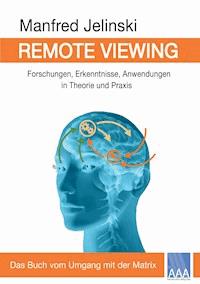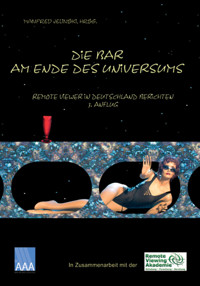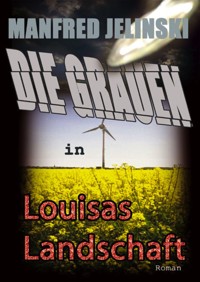Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ahead and Amazing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Worum geht es in diesem Buch? Nun, der Titel sagt es allen Leuten, die gewohnt sind, schnelle Kaufentscheidungen zu treffen: Drogen bis zum Abwinken, Sex bis nicht mehr geht und gute Laune, wenn dafür noch Zeit war. Für den kundigen Literaten und sogar für alle diejenigen, denen das aus Gewohnheit zu einfach ist, sei verraten, dass der Autor natürlich noch mehr im Sinn hatte. Zum Beispiel festzustellen, wie plattgedroschen heutige Ansichten über "die 60er", schlimmer noch: über "die 68er", die Beatnicks, die Hippies, überhaupt die Jugend dieser Zeit in der allgemeinen Betrachtung abgespeichert sind. Es war ganz anders! Und in der Fülle der damals getätigten Aufzeichnungen, der gesammelten Fotos, Filme und Erinnerungsstücke erkannte auch der Aufschreiber dieser Erlebnisse, dass sich überraschende und längst unterdrückt geglaubte Schlüsse ziehen lassen. Zum Beispiel, welche Chancen damals und bei den kommenden Generationen verspielt wurden. Vielleicht gelingt das besser von unten als aus der Sicht eines Popstars oder Politikers. Aber für den schmökerhungrigen Unterhaltungssuchenden genügt eigentlich auch der Titel als Beschreibung. Drogen, Sex und gute Laune eben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Jelinski
Drogen, Sex und gute Laune
30 Jahre Jugend und wie man sie überlebt
Teil 1: die 60er Jahre
1. Auflage 2016
erschienen in der Edition Leuchtfeuer
© Ahead and Amazing Verlag, Ostenfeld 2014
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Covergestaltung: Markus Schäfer | [take shape] media design, Hamburg
Coverfotos: (Portrait: Shirin Baouche, Filmstreifen: Manfred Jelinski, Portrait Vita: Werner Krätzig)
Bildnachweis für den Innenteil im Anschluss an das Fotoalbum.
Abdruck des Covers zu „Der unheimliche Kegel“, UTOPIA Großband Nr. 120,
mit freundlicher Genehmigung der Pabel-Moewig Verlag KG.
Layout: Kristina und Manfred Jelinski | Ahead and Amazing Verlag
Korrektorat: Kristina Jelinski
ISBN (E-Book): 978-3-95990-600-5
Ahead and Amazing Verlag, Jelinski GbR, Magnussenstr. 8, 25872 Ostenfeld
www.aheadandamazing.de
Mitten im Film erlebt man einfach, was passiert.
Nachdenken kommt später.
M. Jelinski
Widmung:Für alle, die dabei waren. Vor allem für die, die es nicht überlebt haben.
Und für meine Kinder, alle.
Geschmack ist so eine Sache, aber bunt ist wenigstens nicht langweilig.
Disclaimer
Fast ist es heute üblich, sich gleich von vornherein von allem zu distanzieren. Das möchte ich hiermit nicht tun.
Ich möchte mich nicht davon distanzieren, dabei gewesen zu sein und mit allem zu tun gehabt zu haben. Wenn irgendetwas gleich zu Anfang festgestellt werden sollte, dann das.
Ich möchte mich aber davon distanzieren, die populistischen Meinungen der Historiker, die größtenteils offenbar nicht dabei waren, mitzutragen, weil ich anderer Meinung bin und das Jahrzehnt anders erlebt habe. „Die 60er Jahre“ waren nicht „die 68er“ und auch nicht unbedingt das „Jahrzehnt der Hippies“. Es war viel komplexer. Es fällt schwer, sich davon zu distanzieren, aber: Damals hatte niemand wirklich einen Plan. Viel naiver als heute machte man alles, was sich so anbot. Dass im Hintergrund, von lokal bis weltpolitisch, diverse Süppchen gekocht wurden, die von der Jugend nicht durchschaut werden konnten, ist richtig. Ich distanziere mich deshalb von allen Ideologen und Ideologien.
Vorwort
In den vergangenen Jahren sagten viele meiner Besucher, als sie mein „Archiv“ betrachteten: „Das ist ja eine kulturgeschichtliche Schatzkammer!“
Als ich nach einigen Diskussionen doch einmal meine alten Tagebucheintragungen las und die tausenden von Bildern und Andenken ansah, war ich mehr und mehr erstaunt, wie meine und vor allem viele öffentlich geäußerte Einschätzungen der damaligen Verhältnisse völlig falsch waren.
Irgendwie hatte ich im Laufe der Zeit auch die Geschichtsinterpretation der Nachgeborenen übernommen, die heute die Beurteilung bestimmt.
Es stimmt, die 60er Jahre waren tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass man den „Muff unter den Talaren“ abwerfen wollte. Die Kluft entstand zwischen der Eltern-(Kriegs-) Generation und der Kinder-(Nachkriegs-) Generation.
Aber die Jugendlichen waren auch nur aufgebrochen, alles zu erkunden, was es Interessantes gab, vor allem aber Drogen, Sex und Lebensformen.
Drogen waren Mittel, um die eingrenzende Elternwelt zu verlassen, auch wenn es beim Alkohol die gleiche Droge war, die auch diese konsumierten. Das änderte sich aber blitzschnell, als Haschisch und Designerdrogen verfügbar waren. Ich weiß noch genau, wie hilflos die Polizei dem gegenüberstand. Razzien waren völlig sinnlos, man traf sich dann eben woanders.
Was Sex angeht, war der Aufbruch ebenfalls bei beiden Geschlechtern gleichermaßen vorhanden. „Verführen“ war das völlig falsche Wort, und wenn, dann machten es beide, Jungen genau wie Mädchen. Aus Neugierde. Und weil es dann die ersten Tanzlokale gab, in denen Jugendliche schon sehr jung ohne Ausweiskontrolle verkehren durften, gab es auch Verhältnisse zwischen 12- und 20-jährigen. Der Unterschied war nur, wenn etwas passierte, kam der (ältere) Junge/Mann vor Gericht. Ich habe tatsächlich Mädchen in diesem zarten Alter erlebt, die sich wie 16 darstellten und aus Spaß und Neugierde die älteren Jungen anmachten. Mehrfachbeziehungen waren nicht selten und von beiden Seiten initiiert. Über allem schwebte die Suche nach neuen Konventionen, die für jeden lebenswert waren.
Die Korrumpierung dieser Naivität kam erst später, ich sage mal höflich: einige Zeit, nachdem Alice Schwarzer den Krieg zwischen den Geschlechtern erklärt hatte. Für mich und meine Altersgenossen war das aber ein nachträglich gepuschter Konflikt der Elterngeneration, der die angeklagten Verhältnisse nicht unbedingt nur sichtbar machte, sondern für meine Generation erst hervorrief.
Nein, tatsächlich, wir waren dafür viel zu naiv. Alle. Wir hatten keinen Plan. Wir waren auf der Suche und haben ausprobiert.
Nachdem ich nun vielen Aufarbeitungen der Vergangenheit gelauscht habe und auch viel davon gelesen, fand ich, dass es wenig Berichte von „unten“ gibt. Von Leuten, die keine Popstars, keine bekannten Politiker wurden und auch nicht als Firmengründer erfolgreich. Ohne dies wird die Historie dünn. Aber ist es nicht vielleicht reizvoller, solche Dinge auch aus der unteren Ebene zu erzählen, die für jeden nachvollziehbar ist und vielleicht die eigenen Erinnerungen auffrischt?
Solche Bücher gibt es noch wenige, und sie bilden teilweise wunderbare Ikonen.
Eines haben nämlich die verfügbaren Berichte (und Beichten) gemeinsam: Irgendwann finden die Geschichten nur noch hinter großen Bühnen, in Luxushotels und auf Privatjachten statt. Oder, im anderen Fall, bei den gestürzten Engeln der Popkultur, im finalen Dialog mit tödlichen Drogen oder im Kampf mit erfolglosen Agenten.
Aber auch die basisorientierten Bücher sind zeitlich meist sehr eingegrenzt. Nach einer Sturm- und Drang-Zeit wurden die Leute entweder doch erfolgreich oder hatten Familie. Und nach wenigen Jahren intensiven Erlebens war dann Schluss mit lustig.
In diesem Moment stellte ich fest, dass ich über dreißig Jahre lang Jugendlicher gewesen war. Und als ich mir die Überschriften ansah, die inzwischen die Historiker an die entsprechenden Jahrzehnte pappten, fiel mir auf: Ich war dabei! Vor der Bühne, hinter der Bühne, zugedröhnt und schrecklich nüchtern, auf den Mädels und darunter, Haussuchungen und Gerichtsverfahren, mit dem Daumen unterwegs und schreiend sesshaft, Filme, Bands und Firmen. Immer passierte etwas. Ja, dachte ich, davon kann man doch erzählen. Auch aus der zweiten oder dritten Reihe. Da muss man kein Prominenter sein.
Und auch deshalb, weil es schön war, weil ich Glück hatte, denn schließlich habe ich es ja überlebt. Obwohl es manchmal knapp war.
Ich habe einige Zeit nachgedacht, ob ich die Geschichte kontinuierlich aufrolle, aber es gab so viele unterschiedliche Ereignisse, die auf der Timeline eng miteinander verzahnt waren, dass ich besser nach Themen sortieren wollte, deren Ereignisse und Inhalte dann unter einer Kapitelüberschrift zusammengefasst werden konnten. Ich bin sicher: Das macht die Zeit und die Vorgänge verständlicher. Und es gibt im Anhang auch eine Zeittafel, wo man sich genau vergewissern kann, wann jedes Kapitel spielt.
Also dann: Hinein in die 60er Jahre, die für mich am 1. Mai 1971 endeten, nach einem Abenteuer, in dem wir praktisch die 80er Jahre in Berlin vorweglebten. Zehn Jahre zu früh ist man nicht der Kopf einer Bewegung sondern Ziel des geballten Unverständnisses.
Die Ersten beißen die Hunde.
Fummeln in der Dunkelkammer
Freitag, 14. Februar 1969.
Der Raum war klein, stockdunkel und roch durchdringend nach Bier. Der Geruch stammte von einem Holzkasten mit vielen leeren und wenigen vollen Flaschen. Und dunkel musste es sein, denn eigentlich war es meine Dunkelkammer. Das war alles völlig in Ordnung.
Nicht in Ordnung war aber, dass der BH klemmte. Peggy kicherte albern und drehte sich ein wenig zur Seite, was das Problem aber nur verschlimmerte. Sie hatte vorhin dreimal aus der Flasche mit dem billigen Weinbrand getrunken, drei Mark fünfzig im Intershop Friedrichstraße, gerade genug, wenn abends wieder eine „Filmbesprechung“ angesagt war.
Mechanik war eines meiner Lieblingsgebiete, also ärgerte mich der klemmende Verschluss umso mehr.
„Kriegsse nicht auf?“, fragte Peggy unnötigerweise und das „st“ verrutschte ihr zu einem flachen Zischlaut.
„Doch, klar, Moment noch!“, gab ich zurück und versuchte die Ursache zu ertasten.
„Vorn is’ kein Verschluss!“, wies sie mich zurecht. „Geschieht dir ganss recht, die Reißverschlüsse von euch geh’n auch imma schwer!“
Der Vorhang am Eingang wurde zurückgeschlagen und ein leichter rötlichgelber Schimmer tastete sich durch die Dunkelheit.
„Lasst euch nich’ stören!“, sagte jemand, den ich als Noppi identifizierte. „War’n hier nich’ noch’n paar Bier?“
Es klimperte ein paar Mal gläsern, dann gab es ein befriedigtes Knurren.
„Öffner ist auf der Bar“, versuchte ich ihn loszuwerden.
„Weissichdoch.“ Noppi hatte auch eine Flasche mitgebracht, die vermutlich jetzt leer war. „Mach weita.“
Dazu kam es aber nicht.
„Was ist denn das hier für eine Sauerei!“, fragte eine kräftige Frauenstimme und es klang bedrohlich nahe. Meine Mutter!
Damit war das mechanische Problem in seiner Bedeutung weit nach hinten gerutscht. Hastig stopfte ich alles, was sich von mir außerhalb meiner Jeans befand, in diese hinein und zog den Reißverschluss hoch. Bei mir ging das immer. Komisch.
Dann ging ich mit einem unglaublich schlechten Gefühl nach draußen. Mitten im angrenzenden Fetenkeller stand meine Mutter, eine knochige, sehr energische Mittfünfzigerin, die Hände in die Seiten gestemmt und funkelte erregt alle an, die sich ebenfalls im Raum befanden. Hinter dem breiten Rücken von Toppi knöpfte sich Silvia gerade eilig die Bluse zu.
„Was macht ihr hier eigentlich?“
Ich war irritiert. War doch völlig klar, was wir hier machten. Nur warum meine Mutter reingekommen war, entbehrte jeglichen Verständnisses.
„Naja“, versuchte ich, „wir haben uns die Filme von letzter Woche durchgeguckt. Willste auch mal sehen? Und dann haben wir besprochen, was als nächstes dran ist! Aber leider ist das Bier alle, ich hab grad geguckt!“
„Es ist zu laut!“, beschwerte sich meine Mutter. Ich bemerkte, dass jemand die Musik abgestellt hatte. Zu laut? Naja, es war immer so laut, ich hatte nichts Besonderes mitgekriegt.
„Und was haben die da gemacht?“ Sie deutete auf Manke und ein Mädchen, von dem ich nur wusste, dass es Elke hieß.
„Aber Mama, das ist doch seine Freundin!“, versuchte ich redlich zu beschwichtigen. Und zu Manke: „Habt ihr wieder geknutscht?“
Der zuckte wortlos die Schultern, wie er es immer machte. Mir war es ein Rätsel, wie er Mädchen aufriss. Er sagte eigentlich nie etwas.
„Aber Mama, ist doch nicht so schlimm, wenn die mal knutschen. Sieht man doch überall!“
„Das ist doch ein Sodom und Gomorrha hier. Zu meiner Zeit hätte man uns windelweich geschlagen!“
„Ja, Mama, ich weiß. Aber heute ist das doch alles anders. Ist doch auch nicht schlimm, so ein bisschen rumknutschen.“
Meine Mutter schwankte. Wahrscheinlich sah ich ziemlich zerknirscht aus.
„Auf jeden Fall ist jetzt Schluss und die verschwinden hier alle! Und wenn du die Bande rausgeschmissen hast, räumst du auf. Sauladen ist das hier!“
Und damit rauschte sie hinaus.
Betretenes Schweigen.
„Toppi hat so aufgedreht!“, sagte Flipper nach einer Weile.
„Isch woll-de dass Lied hörn!“, verteidigte sich Toppi mit unsicherer Stimme. „Das war gegn den Krieg un’ die Imperjalistn! Aber wenn hier nüscht mehr losiss, fahr ick inne Bazille! Kommt wer mit?“
Alle schwiegen und glotzten betreten. Gegen Bob Dylan oder Frère Grignard konnte man wenig sagen, und die Bazille war eine politisch sehr links angesiedelte Kneipe, in der es inhaltlich aber meist um die Unterstützung Berliner Brauereien ging. Das allein war aber den meisten zu wenig.
„Na jut, denn nich!“
Beleidigt verließ er den Raum, rief noch einmal „Un’ die Weltrevoluzjon wird doch siejn!“ und war weg.
„Zwei Promille“, sekundierte Etzel. „Man müsste ihm den Schlüssel abnehmen!“
„Ach was, der hat doch jetzt erst den richtigen Pegel!“, winkte Noppi ab.
„Was hat er denn wieder drin?“, fragte ich.
„Eine Flasche Lambrusco und einen halben Kasten Bier“, konstatierte Etzel.
Alles klar. Und die Mädchenverteilung fand auch immer ohne ihn statt. Man konnte nicht genau sagen, ob erst keine Mädchen da waren, aber Alkohol - und dann keine Mädchen, wegen dem Alkohol. Jedenfalls kriegte Toppi nie eins ab und war irgendwann mal so dick, dass schon deshalb die Mädchen Abstand nahmen, wahrscheinlich aus Angst, er könnte mal oben liegen. Ganz klar, dass er Musik hören wollte. Und die Weltrevolution.
Wir beratschlagten kurz, was zu tun sei. Die Alternativen waren trostlos. Es war gerade erst halb zwölf. Und unsere Entscheidungsfreiheit war begrenzt. Denn die ältesten unter uns brachten es höchstens auf 20 Jahre, so wie ich. Damit waren wir rechtlich gesehen noch Kinder, denn erst mit 21 war man damals volljährig und konnte erst dann allein bestimmen, was man tun wollte.
Natürlich war das ein antiquierter, unhaltbarer Zustand. Heute lacht man darüber. Damals aber hatten wir es auszubaden: den Dissens zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und einer Gesetzesstruktur, die nur sehr vorsichtig reformiert wurde. Von außen draufgeschaut war das verständlich. Nach dem Dritten Reich hatte man sich zwar eilig zur Demokratie bekannt, aber es saßen eben überall in den entsprechenden Instanzen Leute, fast durchgehend Männer, die unter Hitlers umfassender Indoktrination eine stramme Lebenseinstellung inhaliert hatten. (1) Reformen konnten gar nicht von Heute auf Morgen durchgeführt werden. Der gedemütigte Stolz nach dem verlorenen Krieg bestärkte das Gefühl, „damals war ja nicht alles schlecht“ und so gab es eine allgemeine Verunsicherung, was man jetzt wie reformieren sollte. Wenn etwas geschah, dann zögerlich, nur auf Druck von bereits sichtbar unumkehrbaren Entwicklungen.
Deutschland war viele Jahre abgekapselt gewesen, eine Ära, in der die umgebende „freie Welt“ Zeit genug gehabt hatte, alte Muster zu überleben. Nun wurde alles im Eiltempo nachgeholt: Musikstile, Jugendkultur, Lockerung der Sitten. Es ist unbestritten, dass gerade die Musik hier ein Revolutionsanstifter erster Güte wurde.
Rhythmen als Verpackung von politischen Informationen, eine perfide Art der Unterwanderung!
Und mit der aus wirtschaftlichen Gründen sich rasant entwickelnden Technik bekamen immer mehr Menschen die Möglichkeit, an diese Informationen zu gelangen. Die Massenproduktion machte Radioapparate und Schallplattenspieler schnell immer billiger, so konnten sie auch von Jugendlichen erworben werden.
Und so kam es, wie es kommen musste: Indem die Generation der Herrschenden durch Verkauf von Waren Profit machte, sägte sie an ihrem eigenen Ast überkommener Weltanschauungen. Ein wirklich hinterhältiger Schachzug der Evolution, denn die Verpackung der Informationen war auch für Ältere attraktiv. Die konservative Schlagermusik wehrte sich in den 50er Jahren noch tapfer gegen die neuen Rhythmen, aber nachhinein betrachtet war bereits Anfang der 60er klar, dass dieser Kampf verloren war. Das Rückzugsgefecht der überkommenen Kultur dauerte aber noch über zehn Jahre. Bis dahin gebrauchte meine Mutter noch oft den Terminus „Negermusik“.
Es war also kein Wunder, wenn genau die 60er Jahre die Eruption bringen mussten. Und ich war dabei und erlebte das Ganze von Innen.
Natürlich hörte ich in den 50ern das, was meine Eltern hörten. Die Titel werden wahrscheinlich keinem Leser mehr bekannt sein. Die Sprache war Deutsch und die Texte handelten vom Leben, allerdings in einer Wortwahl, wie sie erst Kulturschaffenden jenseits der 50 gelingen. Ich bin jetzt noch viel älter, ich verstehe das.
Viele der darin erzählten Geschichten vom Älterwerden und vom Schicksalsschläge hinnehmen fanden sich später auch in „meiner“ Musik wieder, nur war es eben nicht der Förster oder die Magd, die das ertragen mussten. Was aber fehlte, war der Blick nach vorn und das Aufbegehren gegen die Botschaft, nun sei es eben so, wie es sei.
Der alte Förster, der alles verloren hatte, ging fatalistisch zum Sterben. Rübezahl erzählte inbrünstig, wie es damals war, in der alten Heimat, aus der man vertrieben wurde. Selbst die junge Liebe mündete inhaltlich in der Erkenntnis, „nun angekommen zu sein“. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Woher habe ich das gerade? Naja, man kann es auch anders meinen.
Die Stimmung in den Liedern war nicht unbedingt depressiv. Man sollte vielleicht lieber „getragen“ oder „romantisch“ sagen. Aber die Aufbruchstimmung von Walzer, Foxtrott, Tango oder Polka kam aus Zeiten, in der es revolutionär war, beim Tanz Körperkontakt zu haben und nicht nur heimlich in der Kemenate.
Ich überlegte, dass da mehr sein musste.
In Filmen küssten sie sich schon, das waren aber meist ausländische Streifen. Bei uns auf der Straße war so etwas verpönt … na schön, zum Abschied auf dem Bahnsteig, oder wenn man aus der Krieggefangenschaft wiederkam, dann aber nicht so dauerhaft und möglichst nicht auf den Mund.
Meine Eltern liefen zusammen auch nur untergehakt.
Alles andere grenzte an Pornographie.
Händchenhalten und längere Mund-zu-Mund-Beatmung wurde zu einer Konfrontation mit dem Establishment. I wanna hold your hand von den Beatles war 1963 fast noch obszön. Unglaublich, nicht wahr? Enge Pullover waren zwar nicht sittenwidrig, signalisierten für die Elterngeneration aber sexuelle Verfügbarkeit. „Nutten!“, sagte meine Mutter kurz und klar, wenn Mädchen so in unserer Nähe aufschienen. Ganz so einfach war das aber nicht – ich gab es aber bald auf, ihr das zu erklären.
Ohne Frage hatte die Jugend zu jeder Zeit den Wunsch, voranzugehen, anders zu sein, Neues anzufangen. Die eklatante Tiefe der Kluft zwischen den Generationen entstand in den 60ern aus der langen Einkapselung in strikter Nationalität. Und aus der Verfügbarkeit ausländischer Musik.
Die Versuche mit Rock’ n’ Roll in den 50er Jahren verstanden wir in den 60ern eher als Gymnastikübungen. Der Begriff des „Halbstarken“ hatte die ersten Befreiungsversuche noch wirkungsvoll diffamiert. Nur „halb“-stark wollte niemand sein. Neue Ansätze mussten für die Jugendlichen her, die man nicht so leicht abwürgen konnte.
Zwei Möglichkeiten boten sich an. Aus Amerika kam der Outlaw, der keine Gesetze für sich als gültig anerkannte. Diese Wild-West-Idee lebte fort in den Kriegsheimkehrern, egal ob aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus Korea. Die ausgemusterten amerikanischen Soldaten fanden sich plötzlich nutzlos und entwurzelt. Sie bildeten eine Gegengesellschaft, immer unterwegs, wie es das große, weite Land anbot. Riding on the midnight ghost(2) zusammen mit Jack Kerouac im Güterzug quer durch die Vereinigten Staaten, das konnte mich durchaus reizen.
Die andere Idee, sich aufzulehnen, kam aus England und war viel perfider. Man machte genau das, was die Erwachsenen verlangten. Nur viel besser. Und viel mehr. Man übertrieb, bis es unerträglich wurde.
Unerträglich für die Erwachsenen, die ja ab und zu auch mal fünf gerade sein lassen wollten.
Die Kleidung war überkorrekt, Anzug, Schlips, auch auf dem Fahrrad und dem Mofa. Und das Mofa musste natürlich verkehrssicher sein. Logisch. Dazu gehörten Beleuchtung und Bremsen. Bald gab es Fahrzeuge mit zehn bis zwanzig Lampen vorn und mindestens ebensoviel Rückspiegeln. Die Erwachsenen kochten, weil sie natürlich genau wussten, was gemeint war. Und die Jugendlichen konnten ihr Imponierverhalten physikalisch ausleben.
Ich selbst konnte mich nicht für einen Weg entscheiden. Ich versuchte beides, und noch einen dritten und vierten – doch davon später.
Natürlich war mir nicht bewusst, dass man diese Entwicklungen auch als einen Akt der Kolonisation durch die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs auffassen konnte. Der Stamm von Wilden, in einem tradierten Selbstlauf gefangen, wurde von den Weißen befreit und nun missioniert. Aber es war genau das, worauf die damalige Jugend gewartet hatte, nachdem sie sich viele Jahre Kriegserlebnisse hatte anhören müssen.
Dass Krieg das allerletzte war, was man sich antun sollte, war völlig klar. Ansätze zur Lösung dieses Generalproblems „Nie wieder Krieg!“ kamen von der Elterngeneration aber kaum. Im Gegenteil: Es herrschte der sogenannte „Kalte Krieg“, die großen Mächte der Erde belauerten sich mit Massenvernichtungswaffen. Die Antwort der Jugend war Liebe. Dieser dritte Weg, sich abzugrenzen, war dann, so glaubte ich wenigstens, der erfolgreichste.
Wie es sich für Jugend gehört, ging man wieder einen Schritt weiter. Oder zurück, wie man es sehen will. Die Gammler hatten es vorgemacht, sie bezogen sich bei der Kultivierung der Langhaarfrisur auf den „Freien Mann“ des Mittelalters bis hin zu Jesus. Diese feinsinnigen Rückschlüsse sabotierten extrem jedes Zurechtweisungsgespräch.
Einen Zahn schärfer, wie man damals sagte, wurde es mit dem Liebesbegriff. Natürlich sollten sich alle lieben, Liebe war ja auch der Inhalt der Musikkultur der Elterngeneration. Liebe überwindet Grenzen und verhindert so vielleicht Kriege. Liebe ist gut! Also, machen wir sie doch gleich hier auf der Straße und alle mit jedem, dann ist Friede, oder?
Den Hinweis, dass Sexualität nicht gleichbedeutend mit diesem überhöhten Begriff der Gemeinsamkeit sei, konnte man prima mit Darwin und der modernen Wissenschaft kontern. Sexualität ist die Urform der Liebe, da war man wieder bei Jesus und den langen Haaren, wobei man natürlich nicht sagen durfte, dass Jesus vielleicht unter Umständen eventuell auch Sex gehabt haben könnte, obwohl er Liebe predigte. Das war dann doch ein Schritt zu weit.
Aber ohne Sex keine Fortpflanzung, kein Leben auf der Erde. Schließlich hat doch Gott selbst gesagt: „Seid fruchtbar und mehret Euch!“
„Oh, oh, oh, und wer soll das bezahlen?“, war schon damals die egozentrisch-kapitalistische Antwort, denn man wollte nach Waschmaschine und Fernseher nun auch ein Auto.
„Komm mir ja nicht mit einem Kind an!“ Einige Eltern versuchten es mit Einsperren. Das machte alles aber nur interessanter.
Später sah man achselzuckend ein, dass die einzige Lösung, sich von der immer drückender werdenden Verantwortung zu befreien, die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters und die Einführung der Pille sein musste.(3) Aber so weit waren wir noch nicht. Erst einmal kam Weg Nummer vier: Ihr habt keinen Zugriff mehr auf mich, ich bin auf Droge!
Heute ist Drogeneinnahme sicherlich oft eine persönliche Maßnahme, aus Verzweiflung entstanden und/oder um auf sich aufmerksam zu machen, um Hilfe oder Liebe zu erlangen. Damals war es Ausdruck eines Experimentierdranges.
Natürlich, wenn man deswegen aufgegriffen wurde, mussten sich die alten Herrschaften auch um einen kümmern! Und hatten damit den Salat! Sie mussten nun nett sein und sich fragen, was sie falsch gemacht hatten.
Aber das war zu dieser Zeit nicht die Absicht! Man wollte gar nicht, dass sich die Eltern kümmerten, denn das hätte bei aller Liebe bedeutet, dass man in die geistig beengten Verhältnisse hätte zurückkehren müssen, die man gerade mühevoll verlassen hatte! Und bei manchen endete der Schrei nach Liebe in Prügel.
So war das. Ich kann mich gut erinnern.
Und alles, was damals passierte, muss man unter diesem Aspekt betrachten.
Wir wollten hinaus, weg von der Bevormunderei, neue Wege suchen, selbst entscheiden, was angegangen wurde und vor allem, wie man mit etwas umging. Und das Interessante war, dass (jedenfalls in meinem Umkreis) es keinen Unterschied gab, ob es Jungen oder Mädchen waren, die sich damit auseinandersetzten. Es war nur so, dass die Mädchen meist strikter von den Eltern an die Leine genommen wurden, denn schließlich und im Ernstfall “kamen sie mit einem Kind nach Haus“.
Natürlich hatte sich dieses Bewusstsein langsam herausgebildet, der Drang nach Freiheit musste eine ganze Weile wachsen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass alles vielleicht völlig anders angesehen worden wäre, wenn man damals schon mit 18 volljährig gewesen wäre und wie heute von allen Seiten bedrängelt; mit Fragen bombardiert, wie das so mit Beruf, eigenen Beinen, erfolgreichem Lebensmanagement aussähe!
Wenn ich den heutigen Druck auf die eigentlich noch Jugendlichen (Jugendstrafrecht kann immer noch bis 21 angewendet werden) betrachte, muss ich eingestehen, dass ich unter diesen Bedingungen vielleicht auch alles getan hätte, um das „Hotel Mama“ nicht aufgeben zu müssen. Dunkle Hinterzimmer betrachtet man nicht als das Hauptproblem, wenn man ständig angehalten wird, sich gefälligst jetzt schon um seine Rentenversicherung zu kümmern.
Und so bedauere ich letztlich die Nachgewachsenen. Diese hoffnungsfrohe Aufbruchsmentalität von damals mit den kleinen Sensationen der vielfältigen Verbote, aber auch der Sicherheit, selbst mit wenig Geld über die Runden zu kommen, hat mir Erlebnisse gestattet, die heute nicht nachholbar sind. Das ist schade. Na, immerhin kann man noch davon erzählen.
***
Fußnoten:
(1) Laut offizieller Untersuchung vom Oktober 2016 auch von der hohen Politik wahrgenommen!
(2) Jack Kerouac wurde nach seiner Heimkehr aus dem Koreakrieg Landstreicher und schrieb viele beachtete Bücher „on the road“. Er fuhr in Güterwagen kreuz und quer durch die USA auf der Suche nach einer Heimat, spirituell fand er sie im Zen.
(3) Die Mädchen von damals gaben später ihren 15-Jährigen Töchtern die Pille und die Jungs wurden später die ersten Streetworker. Wir aber waren zu dieser Zeit gerade erst 18/19 und mit 21 wurde man erst volljährig.
Der Blitz der Erinnerung
Wenn ich Memoiren oder Biographien anderer Leute lese, frage ich mich oft, wie genau die wiedergegebenen Erlebnisse sind. Und woher sie die Daten haben. Ob sie vielleicht nur rekonstruiert sind.
Bei mir weiß ich es sicher. Ich habe Tagebuch geführt und Andenken aufgehoben. Fotos, Zettel, Sachen, um mich zu erinnern. Weil es schön war. Aufregend. Nacherlebenswert. Konnte ich einfach nicht wegschmeißen. Ich dachte immer, dann würde auch das Erlebte auf den Müll fliegen. Und irgendwie stimmte das auch.
Denn wenn man alle diese Dinge in die Hand nimmt, passiert etwas Erstaunliches: Plötzlich werden die Erinnerungsbilder scharf, Szenen, die vergessen schienen, tauchen wieder auf.
Mit einem Mal gibt es wieder Namen, Orte, Eindrücke, ganze Sätze. Das ist schon irre. Und ich genieße es, detailliert in mein Leben hineinschauen zu können.
Damit das alles nicht durcheinanderkommt, habe ich Ordner angelegt. Manche Inhalte sogar von Hand gebunden. Die Jahre 1965 bis 1979 sehen aus wie Bücher. Leider nicht so pedantisch, wie ich es manchmal dann gewünscht hätte. Aber dazu hätte man viel mehr Platz benötigt, und nicht nur ein Regal. Und natürlich Zeit, in der man auch durchaus andere Dinge tun konnte.
Nein, ich war nicht hyperaktiv, wie man heute mutmaßen würde. Ich habe nur nicht herumgesessen oder –gelegen. „Abchillen“, sagt mein erwachsener Sohn dazu. Nein, das war nichts für mich. Auch Fernsehen war indiskutabel, das Programm etwas für die Elterngeneration.
Ich brauchte alles live. Filme musste ich selbst machen. Etwas abzubilden und zu manipulieren, das war sehr spannend. Vielleicht trifft mich heute der Blitz der Erinnerung, weil alles so intensiv war.
Und ich weiß ja, es ging gut aus. Nicht für jeden, aber für mich letztlich schon. Sonst würde ich das heute nicht schreiben können. Andere dagegen …
Ja, gut, handeln wir das schnell ab. Ich behalte Menschen lieber lebendig in Erinnerung als tot. Aber einige dieser Schicksale führen zu Rückschlüssen für die eigene Lebensführung. Die Erkenntnis ist einfach: Um etwas erzählen zu können, muss man es erleben. Das Geheimnis, viel zu erleben ist, dass man alt genug wird. Dazu muss man alle gefährlichen Situationen überleben. Man benötigt das Glück, sich nicht beim ersten Stolperer den Hals zu brechen. Auch nicht beim zweiten, beim dritten … und so weiter.
Einer meiner besten Freunde war Jacki.
Wir haben eine Menge zusammen ausgeheckt, seit ich ihn auf dem Gymnasium kennengelernt habe. Im Sandkasten machten wir chemische Experimente. Wo sonst? Dort konnte wenigstens nichts abbrennen. Jacki war auch der Star meiner frühen Filme. Die ungelenke Art, mit der er sich bewegte, wie er seinen viel zu langen, schmalen Körper zu beherrschen versuchte, ergab manchmal eine sehr unfreiwillige Komik. Aber er war hochintelligent und vor allem – witzig. Nie laut, immer bescheiden, hintergründig und konnte über den Dingen stehen. Leider war er, wie ich erst später erfuhr, Epileptiker. Und einer dieser Anfälle wurde ihm zum Verhängnis.
Er war 19, hatte Abitur gemacht und wollte studieren. Und wie es viele taten, nahm er auch einen Nebenjob an. In einer Fabrik für Leitz-Ordner. Man fand ihn leblos in einem Lagerkeller. Niemand war im entscheidenden Moment da gewesen, um Hilfe zu organisieren. Ich war sehr angefressen über die Art, wie es passiert war. So beiläufig, einfach knips! Und weg.
Dabei kannte ich das schon. Sieben Jahre vorher war mein Vater nach Feierabend nicht nach Hause zurückgekehrt. Stunden später klingelte ein Zeitungsreporter und erzählte, er wäre mit seinem Moped gegen einen Baum gefahren und sofort tot gewesen. Ich konnte das nicht glauben. Mit 40 km/h gegen einen Baum und sofort tot, was für ein Blödsinn! Auch, dass der gerade herrschende Sturm nachgeholfen hätte, war dafür nicht plausibel genug. Später stellte sich heraus, dass es genau umgekehrt war. Der Baum war auf ihn gefallen, als er gerade vorbeifuhr, genau aufs Genick.
Das war meine erste Lektion in Sachen Wahrscheinlichkeit. Dieser Fall hatte mathematisch gesehen kaum eine Existenzberechtigung. Aber es war passiert.
Nun gut, er war zu diesem Zeitpunkt 51, hatte den Russlandfeldzug im Zweiten Weltkrieg überlebt und dort auch viel erlebt. Aber es waren keine Inhalte, an die man sich gern erinnert. Krieg, Gefangenschaft, und dann die harten Jahre des Wiederaufbaus. Er starb, nachdem er ein paar Wochen vorher gesagt hatte: „Und dieses Jahr machen wir mal Urlaub. Die ganze Familie, zum ersten Mal!“ Und dafür hatte er extra ein Auto gekauft. Aber das Benzin für das Moped war billiger. Hätte er einfach nur das Auto genommen, wo doch das Wetter sowieso keine Freude für Zweiradfahrer gewesen war!
Man kann also selbst etwas tun, um sein Leben zu verlängern. Ich bin dann auch nie Motorrad gefahren und ehe ich mich entschloss, den Schein für die gefährlichste aller frei verfügbaren Waffen, das Auto, zu bekommen, wurde ich 25. Diese gefährliche Lebensphase – jung und motorisiert – ging also folgenlos an mir vorüber.
Von Rockstars kennt man spektakuläre Abgänge im Drogenrausch. Haben sie deshalb besonders viel erlebt, wenn sie an einer Überdosis von allem Möglichen sterben? Wahrscheinlich nicht! Zu schnell zu viel von allem, das ist auch nicht das Konzept, dachte ich nach dem Tod von Janis Joplin und Jimi Hendrix. Und als Toppi, den ich schon im ersten Kapitel vorgestellt habe, starb, war er auch erst 25. Als seine durch übermäßigen Alkoholgenuss erworbene Leberzirrhose sein nahes Ende andeutete, sagte er: „Tut mir einen Gefallen, ja? Schreibt auf meinen Grabstein: Er lebte, so schnell er konnte!“
Er hatte es genau auf den Punkt gebracht. Eigentlich muss man das Leben nicht auffordern, sich zu beeilen. Man kann es passieren lassen.
Oder Yogi, der sich aus Langeweile auf Heroin einließ. Wir kriegten ihn nicht wieder von der Nadel runter. Viel älter war er auch nicht, als er daran draufging.
Also dachte ich, man kann viel machen, aber man muss sich nicht in die erste Reihe vordrängeln. Dort, wo die fetten Ereignisse versteigert werden. Besser ist es, sich erst einmal anzuschauen, was dort angeboten wird, und wie es sich auswirkt. Also sozusagen sich in die zweite Reihe zu stellen. Dort kann man immer noch viel erleben.
Natürlich ist es unmöglich, immer Zurückhaltung zu üben. Manchmal kann man einfach nicht Nein! sagen. Dann braucht man etwas Glück.
Und manchmal passt man einfach nicht auf. Dann wird es kritisch.
Das kenne ich auch.
Ich glaube, ich war 27 oder 28, jedenfalls fuhr ich einen Renault R4, da geschah eines jener Ereignisse, über die man später immer wieder den Kopf schüttelt.
Ich hatte getankt, die Tankstelle existiert inzwischen nicht mehr, Ringbahnstraße in Berlin-Tempelhof, und wollte bezahlen gehen. Ich zog also mein Portemonnaie und stiefelte los. Das nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich mitten im Kassenraum stand. Um mich herum ein Haufen kleiner Glasscherben. Die Frau hinter dem Tresen hatte die Augen aufgerissen und schrie. Dann sagte sie sehr unsicher: „Sind Sie verletzt?“
Ich schaute sie ausgesprochen dumm an. Ich weiß schon, wann ich dumm dreinblicke!
Das war einer jener Momente.
Ich war einfach durch die frisch geputzte, aber leider geschlossene Glastür gelaufen. Ein Kung-Fu-Trainer wäre stolz auf mich gewesen, aber solch einen Lehrgang hatte ich nie absolviert. Ich hatte die Tür einfach nicht ernstgenommen. Kann ja mal vorkommen.
„Nein“, sagte ich, „ich habe nichts. Keine Schramme. Es tut mir auch sehr leid. Ich bin aber versichert!“
Die Kassiererin hatte ihre Fassung wiedergefunden. Sie versuchte, mich zu beruhigen, aber ich war ja ruhig. Ich bedauerte lediglich mein Missgeschick. Ich gab ihr meine Adresse, aber es kam nichts. Keine Rechnung, kein Brief. Als ich dort eine Woche später wieder vorbeikam, hatte man neu verglast – und zwei von den beliebten Raubvogelschatten drauf geklebt. Ich habe die Tür auch nie wieder übersehen.
Aber kurze Zeit später schlug der Echo-Effekt zu. Sie wissen ja, alles im Leben passiert zweimal. Wahrscheinlich, damit man merkt, dass da was Wichtiges war.
Die Fenster in meinem Haus gingen nach innen auf und es war noch immer Sommer. Irgendetwas fiel mir auf den Boden. Ich bückte mich und suchte, krabbelte auf dem Teppich herum, und schließlich fand ich es. Also konnte ich mich wieder aufrichten.
Es gab ein paar undefinierbare Geräusche, ein heftiges Klirren und ich saß schon wieder inmitten von Glassplittern, diesmal aber mit einem Rahmen um mich herum.
Meine damalige Langbeziehung stürmte herein und rief – na, was wohl?
Nein, ich war nicht verletzt. Lediglich ein kleiner Splitter steckte in meinem Unterarm. Ich zog ihn heraus und betrachtete den winzigen Tropfen Blut, der aus der Wunde drang. Dann stieg ich aus dem Rahmen und beruhigte meine etwas panische Liebste.
Soll ich weiter erzählen? Ja, klar, dazu habe ich ja dieses Buch angefangen.
Zwei Jahre später, ich fuhr inzwischen einen Lieferwagen Marke „Hanomag“, Hochkasten und „zum drin Wohnen“ ausgebaut, passierte das nächste „Wunder“ oder wie man es nennen sollte.
Wir waren auf dem Weg nach Hause, nachmittags um kurz vor sechs. Es war wieder Sommer. Ich hatte meine Freundin von der Arbeit abgeholt und mit ihr kam eine Kollegin, die mit einem Freund von mir verbandelt war. So ein Lieferwagen hat oft vorn drei Sitze und sie saß in der Mitte, aus irgendeinem Grund nicht angeschnallt. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen.
Wir fuhren im Berufsverkehr, vor uns tauchte die Ampel auf, an der wir rechts abbiegen mussten, zweihundert Meter von zu Hause. Die Ampel sprang auf rot, die Fahrzeuge um uns herum und vor allem vor uns bremsten. Ich tat es auch – und mein Fuß erreichte ungebremst den Wagenboden. Keine Bremsreaktion.
Die Situation war klar. Es würde einen furchtbaren Unfall geben. Wenn mir nicht etwas wirklich Gutes einfiel.
Mir war sofort klar, dass die Handbremse auch keine Hilfe bringen würde. Nicht bei dieser Geschwindigkeit. Ich sah mich um. Rechts gab es Straßenbäume und bis zum Gebäude der Gesamtschule erstreckte sich mindestens zwanzig Meter weit ein mit Büschen und Bäumchen bepflanzter Grünstreifen.
Ich passte genau die Abstände der Straßenbäume ab, riss das Steuer nach rechts und jagte über den niedrigen Bewuchs. Klonk – klonk! machte es unter dem Wagen. Jetzt zog ich die Handbremse. Der Wagen wühlte sich durch den Acker, weitere Büsche nahmen ihren Weg unter dem Boden durch, dann stand die Kiste still, kurz vor der Ecke auf dem Bürgersteig.
Ich schaute nach rechts. „Martina, Sigi, alles okay?“
Noch etwas bleich und wackelig stiegen wir aus.
„Jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps!“, sagte Martina.
Weder Insassen noch der Wagen hatten etwas Bemerkenswertes abbekommen. Nur aus der vorderen rechten Radkappe rieselte etwas Dunkles, Öliges.
Ganz klar: Der Radbremszylinder war geplatzt.
Die letzten 200 Meter fuhr ich im ersten Gang und mit Handbremse.
Noch ein paar Kostproben dieser Art? Da hätte ich einiges zu bieten, vielleicht mache ich es später noch, aber es genügt bis jetzt schon als Illustration für meine Aussage: Man muss schon überleben, um etwas erzählen zu können.
Vielleicht hat das Schicksal es gewollt, dass ich dieses Buch schreibe …
Nein, keine Angst, so will ich das Ganze gar nicht überfrachten. Machen wir die Kausalität ganz einfach: Weil ich überlebt habe, kann ich dieses Buch schreiben. Warum sollte ich es also nicht tun?
Um den Faden vom Beginn dieses Kapitels wieder aufzunehmen: Es ist alles da und sortiert. Aber wie soll ich es erzählen? Womit beginnen? Am Anfang, wie Sherlock Holmes sagen würde? Oder immer etwas thematisch?
***
Wenn einen alle Lehrer kennen
"In der Schule haben wir dich immer für einen Paradiesvogel gehalten!“, sagte Klaus zu mir, mehr als 30 Jahre später, anlässlich eines Klassentreffens. Seit dem Abitur machten wir jedes Jahr ein Klassentreffen. Die meisten habe ich besucht.
„Wieso?“, fragte ich erstaunt zurück. Es war das erste Mal, dass einer meiner Mitschüler so etwas sagte. Hatte ich etwas versäumt?
„Du hast immer solche Sachen gemacht. Immer irgendwas losgetreten. Ich habe nie begriffen, warum du das gemacht hast.“
Ich starrte ihn an und ich kann mich erinnern, dass es bei mir irgendwie „Klick“ machte. Er hatte recht. Aber es war doch so einfach. Ich begriff nicht, warum er das nicht begriff.
„Warum hätte ich diese Sachen nicht tun sollen?“, fragte ich zurück. „Sie lagen doch förmlich auf der Straße. Man musste sie nur aufheben.“
Er sah mich prüfend an.
„Eben. Mir wäre das alles zu viel gewesen. So ein Leben hätte ich nicht führen können. Ich hab dir immer zugeguckt, und das hat mir gereicht.“
Klaus hatte nach dem Abitur eine Lehre in einer Bank begonnen und es zum Zeitpunkt des Gespräches schon seit einiger Zeit zu einer leitenden Position gebracht. Wenn der gewusst hätte, wie es mir danach weiter ergangen ist! Manchmal hatte ich mich schon gefragt, ob er nicht alles viel richtiger machte als ich, der ich immer irgendwie in der Luft hing. Kein geregeltes Einkommen, ständig mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, die so wahnsinnig viel Zeit brauchten, wenn man sie ordentlich machen wollte.
„Ja“, stimmte Achim zu, den ich in der Schulzeit immer bewundert hatte, weil er so cool war und Gitarre spielte – sogar in einer eigenen Band. Er hatte in Physik promoviert und forschte in den USA, kam also seltener zum Klassentreffen. „Du warst immer vorn, du hast immer was losgemacht!“
Naja, irgendwie stimmte das ja. Aber Paradiesvogel? In meiner Vorstellung musste ein Paradiesvogel wissen, dass er einer war. Mir war etwas derartiges nie bewusst geworden. Erst in dem Moment, als Klaus das sagte, kriegte ich ein kleines inneres Filmkaleidoskop meines Lebens. Möglich, dass ich tatsächlich während der Schulzeit ziemlich interessante Dinge erlebt hatte. Aber warum hatten die anderen dann nicht?
Vielleicht hatten sie immer ein Ziel vor Augen. Sie wollten etwas werden. Lehre machen, Studium abschließen, Geld verdienen. Dabei eine Familie gründen, Sicherheit finden. Irgend so etwas rumorte auch in meinem Hinterkopf. Es traf nur nicht ein. Irgendwie passierte immer etwas anderes.
Und das war schon in der Schule so. Auf dem Gymnasium, das ich besuchte, kannte mich wirklich jeder Lehrer. Auch die, bei denen ich keinen Unterricht hatte. Ganz nebenbei habe ich erfahren, dass ich sogar zu manchen Zeiten Diskussionsstoff im Lehrerzimmer abgeliefert habe. Und als wir 30 Jahre nach dem Abitur auch während eines Klassentreffens unsere Schule besuchten, kam das noch mal kurz zur Sprache. Unser ehemaliger Klassenlehrer, nun Direktor kurz vor dem Ruhestand, führte uns herum und sagte zwischendurch, als wir so darüber parlierten, wie viele Schülergenerationen er nun schon erlebt hatte und wie viele Schüler so in Erinnerung bleiben: „Natürlich erinnere ich mich an Sie, Jelinski, was glauben Sie denn?“
Ich muss gestehen, ich zuckte wieder einmal zusammen. Wie früher. Er hatte eine gewisse kaltschnäuzig-trockene Art, Bemerkungen zu machen, die öfter sehr humorvoll war, vorher aber schon getroffen hatte. Bevor man schmunzeln konnte.
Seine Fächer waren Geschichte, heute würde man sagen: politische Weltkunde und Sport. In beiden Fächern war ich weniger als mittelmäßig, wenn man den Zensuren trauen darf.
Aber ich passte auf, nicht zwischen die Mühlsteine zu kommen. Es gelang mir immer, Leistungen abzuliefern, die weder Angst vor einem Absturz aufkommen ließen, noch die Bemühung um Förderung.
Schularbeiten machte ich in den letzten Jahren fast nur noch in der Pause. Wobei ich nicht immer nur abschrieb, sondern gewisse Variationen einbaute. Bei Mathe war das natürlich selten möglich, aber ich weiß noch, wie ich dem einen oder anderen Mädchen von uns sagte, ihre Arbeit sei so schlecht, da müsste ich mir wirklich etwas selbst ausdenken. Und ob ich ihnen nicht ein paar Tipps geben dürfe. Das war nicht weiter schlimm, wir waren eine sehr kompakte Klassengemeinschaft, hielten zusammen und fast alle schrieben von irgendjemandem ab. Die Mädchen Mathe und Physik von den Jungs. Vielleicht ging das auf unsere beiden Klassenfahrten zurück. Je eine fand in der zehnten und in der zwölften Klasse statt.
Die erste Fahrt ging in die Asse. Ja, genau dorthin, wo später ein Atommüll-Endlager errichtet wurde. Die Begleiter waren unsere Deutschlehrerin und unser Kunstlehrer. Eine sehr denkwürdige Kombination. Frau Benser, oder „Tante Helga“, wie wir sie intern nannten, lotste uns zu einer Besichtigung ins VW-Werk und unser Kunstlehrer drehte einen Film mit uns. Damals gab es (bezahlbar) nur den 8mm-Film, der aus der Halbierung des 16mm-Films entstanden war. Super-8 gab es noch nicht. (Und der war dann erstmal noch teurer.)
Wir mussten richtige Spulen in die Kamera einlegen und dabei aufpassen, dass sich dabei nichts unbeabsichtigt abrollte, denn diese Teile wären ja dann belichtet gewesen.
Der Inhalt des Films war sowohl anspruchslos als auch geeignet, das Teamwork zu fördern. Ein gewisser Herr Brandes machte sich an die Frau eines anderen heran, was dieser aber nicht tolerieren wollte und nun Gangster engagierte, den Nebenbuhler umzubringen.
Diese entführten ihn aus einer lasziven Tanzveranstaltung und wollten ihn besinnungslos auf die Schienen legen, damit es so aussah, als sei er überfahren worden. Natürlich wird er von der Partygesellschaft im letzten Moment gerettet und die Gangster stürzen auf der Flucht in eine Schlucht, wo sie jämmerlich verenden. Man kann im Film deutlich sehen, wie der „tote“ Bernd aus dem Grinsen nicht herauskam.
Dieses Projekt stärkte den Klassenzusammenhalt ungemein. Alle machten mit, jeder hatte eine Aufgabe. Am interessantesten war es aber, zuzusehen, wie die Mädchen sich von unserer auch recht attraktiven Deutschlehrerin zu leicht bekleideten Vamps herausstaffieren ließen. Und das Drehbuch sah Engtanz vor. Spannenderweise wiederholte sich die Paarzuordnung des Films bei der Abschiedsparty am letzten Abend. Wir hatten natürlich viel weniger Mädchen in der Klasse als Jungs, das war damals so, und so kam es, dass kaum eines ungeküsst nach Hause fuhr. Die Beziehungen hielten sogar über die Klassenfahrt hinaus und die ganze Team-Stimmung verschwand auch nicht wieder. Die Folge war dann auch die beschriebene „Zusammenarbeit“ bei den Hausaufgaben.
Ich gehörte zum Kamerateam und das gefiel mir so sehr, dass ich nach der Fahrt die Film-AG in der Schule ins Leben rief. Wir saßen noch einige Wochen am Schnitt und an der Vertonung, dann kam die große Vorführung und ich hatte eine sensationelle Erkenntnis: Filme machen war die optimale Möglichkeit, Beziehungen zu Mädels anzubahnen und in jeder Hinsicht Aufmerksamkeit zu erringen. Besonders gut gefiel mir der Umstand, viele Menschen in einen dunklen Raum zusammensperren zu können, die dann gezwungen waren, sich alles anzutun, was man sich ausgedacht hatte.
Wahrscheinlich war dies der Startimpuls für meine Filmerlaufbahn.
Aber bis dahin passierten erstmal andere Dinge.
Heutzutage gibt es eine Menge von Angeboten, Workshops, Arbeitsgemeinschaften mit vielfältigen Themen, in denen sich die Schüler engagieren können. Das gab es damals nicht. Dass sich auf meine hartnäckige Verfolgung des Filmprojektes eine Film-AG bildete, war fast ein kleines Wunder. Gut, es gab Handball und Fußball, was meist in der Aufstellung einer Schulmannschaft gipfelte.
Obwohl ich sowohl in der Handball-Auswahl als auch in der Fußballmannschaft der Schule spielte, war das kein wirklicher Kick. Es war eigentlich nur nett. Früher, als ich im Verein spielte, war ich gern im Tor. Es stellte sich aber heraus, dass ich der Einzige im Altersbereich war, der rechts und links schießen konnte. Ich fand das nicht ungewöhnlich. Nur war halt der linke Fuß nicht so kräftig. Beim Elfmeter schoss ich doch lieber rechts, da konnte ich die Bälle besser anschneiden. Aber mit links Flanken schlagen zu können, verbannte einen auf die ungeliebte Linksaußen-Position. Die hatte ich dann sicher. Ich glaube, ich war immer in der Start-Elf, saß nie auf der Bank.
Nee, das war langweilig.
Viel spannender fand ich interaktive soziologische Prozesse im Alltag. Und weil ich ein Einzelkind war, musste ich mir eine Menge erst erarbeiten. Unter Umständen war das eine wichtige Triebfeder.
Nachdem der Film, den wir auf der Klassenfahrt gedreht hatten, endlich fertig war, bekam ich zum Geburtstag eine eigene Kamera. Und zu Weihnachten den Projektor. Weil die beiden Termine keine zwei Wochen auseinander liegen, war das eine logische Folge. Und sehr praktisch. Die ersten Rollen kehrten genau Heiligabend aus dem Entwicklungslabor in meinen Briefkasten zurück.
Ein neuer (Spiel-)Film war damit unausweichlich. James Bond erlebte damals gerade seine erste Blütezeit, ein weithin bekannter Knaller im Kino, also machten wir das auch. Wir, das war wieder einmal die ganze Klasse. Fast alle machten mit, sodass es heute eine prima Erinnerung darstellt. Die Handlung war dem allgemeinen Erwartungsniveau angemessen. Ein Agent sollte wichtige Papiere aus Moskau holen, was leider aufgedeckt wird. Nachdem er sich mit diesen Unterlagen trotz aller Widrigkeiten zurück nach Hause durchgeschlagen hat, erfährt er, dass er nur als Ablenkungsmanöver benutzt wurde. Die richtigen Schriftstücke hatte man auf einem anderen Weg außer Landes gebracht.
Das Drehbuch gab einem Mitautor die Gelegenheit, den Unterschied zwischen CIA und sowjetischem Geheimdienst in flammenden Reden gegenüberzustellen. Fazit: Beide Ideologien sind bescheuert und mit ihnen deren Protagonisten. Der amerikanische Dienststellenleiter las in der Besprechung Comics und überließ den Rest seinem Untergebenen, sein sowjetischer Kollege benötigte eine Sekretärin, die ihm die politisch korrekten aber komplizierten Redewendungen vorsagen musste Wir hatten viel Spaß dabei. Am besten fand ich immer die Idee, den Agenten durch meinen besten, aber auch unsportlichsten Freund spielen zu lassen. Jacki war ungewöhnlich groß, dafür aber auch ungewöhnlich schlank und bewegte sich so liebenswert ungeschickt, dass ich daran nicht vorbei konnte.
Wir drehten im Winter, weswegen ich keine leicht bekleideten Szenen einbauen konnte. Dafür wirkte aber Schnee in einer Szene in Moskau glaubwürdiger, und Schnee hatten wir zum Jahresbeginn 1966 reichlich in Berlin. Das passte also. Und was ich sehr mochte, war, dass man als Regisseur unheimlich wichtig war.
Wenn ich nebenbei begann, Geschichten zu schreiben, lag es allerdings nicht daran, irgendeinem Mädchen imponieren zu wollen. Eigentlich war die Ursache, dass ich ein Heftklammergerät in die Finger bekam. Das ist natürlich kein ungewöhnliches Stück einer Büroausstattung, aber man muss bedenken, dass es Mitte der 60er Jahre nicht üblich war, so etwas im Privathaushalt zu haben. Die Technik, selbst Papiere zusammenzuklammern, kam gerade erst auf.
Ich suchte schon lange nach einer wirklich guten Möglichkeit, bei einer Klassenarbeit zu schummeln. Bücher unter der Bank waren zu auffällig, Tätowierungen auf dem Arm leicht nachweisbar. Die Toiletten wurden schon damals kontrolliert, Handtelefone waren noch ein feuchter Traum der Zukunft. Wenn man aber ein winziges Buch hätte, das man beim Schreiben in der linken Hand verstecken konnte …?
Bereits der erste Test verlief erfolgreich, Zwei mal drei Zentimeter genügten vollauf, komplexe Matheformeln aufzuschreiben, besonders, wenn man viele Seiten zur Verfügung hatte. Und alles wurde von einer einzigen Heftklammer zusammengehalten!
Die Idee kam auch bei anderen an. Ich stellte so einige der kleinen Bücher her. Und weil das so prima lief, dachte ich daran, dass man vielleicht auch andere Dinge in diesem Format verbreiten konnte. Aus der Lehrerposition war ja nur zu erkennen, dass jemand in seine Hände starrte. Das war kein unüblicher Vorgang, wenn man darauf wartete, dass die Stunde vorbei ging. Manche starrten auch in dieser Art vor sich hin, wenn sie interessiert den Ausführungen des Lehrers lauschten. Und im Fall des Falles konnte man ein so winziges Buch schnell im Ärmel verschwinden lassen. So viel Geschicklichkeit hatte man damals noch.
Die erste Geschichte war ein Agenten-Krimi-Thriller, was sonst. Held war wieder 009, mein Freund Jacki. Ich kannte ja seine Eigenarten auch aus dem Film und musste mir deshalb kein eigenes Personalprofil ausdenken; das war sehr schön einfach. Spätere Werke nahmen dann andere Klassenkameraden aufs Korn und karikierten deren Vorlieben.
Die minimale Größe des Datenträgers veranlasste den Autor, zu einer kurzen, prägnanten Sprache zu finden. Die Titel mussten reißerisch sein. Das erste „Buch“ trug den Titel: „Nachts ist es dunkel“. Die Fortsetzung hieß: „Der schielende Diamant“. Auch der Sex kam nicht zu kurz, was aber damals noch ein Tanz auf dem Drahtseil war. Besonders mit 16 oder 17, denn älter war ich noch nicht. Vier Jahre vor der Volljährigkeit nahm einen in diesem Alter kaum jemand ernst.
Als die Geschichten umfangreicher wurden, musste ich leider auch das Format vergrößern. Über die Vokabelheftgröße ging ich aber nie hinaus. Ich fühlte mich tief in der Trivial- und Schundromankultur verwurzelt. Für mich war eine Handlung immer nur Aufhänger für – genau: soziologische Interaktionen. Liebe, Hass und Egoismus. Das war stets unterhaltsam.
Schön war, dass ich eine alte Schreibmaschine geschenkt bekam, eine Continental von 1926. Ich habe sie immer noch. Leider hat mein ältester Sohn im zarten Alter von vier eine Taste abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ich schaffte das nie. Das Gerät ist unglaublich robust.
Eine Schreibmaschine ergibt ein lesbares Schriftbild, egal, welche Note man in Handschrift hatte. Endlich konnte man alles lesen. Nur ein bisschen aufpassen musste man beim Anschlag – zuviel Kraft hinterließ einen tiefen Eindruck. Wenn ich richtig gut drauf war, machte ein O jedes Mal ein kleines Loch in das Papier. Kein guter Ansatz für zweiseitige Beschriftung.
Aber noch etwas anderes gefiel mir an diesem Gerät: man konnte nicht mehr sehen, wer etwas geschrieben hatte. Das kam mir in der folgenden Zeit öfter zugute.
Meine Lieblingsillustrierte war zu dieser Zeit die „Pardon“, das einzige Satiremagazin damals. Ich übernahm viele formale Vorlagen für Geschichten, Artikel oder Karikaturen.
Weil in der Schule die Lehrer die Instanz waren, mit der man sich mit größtem Interesse auseinandersetzte, mussten sie als Zielgebiet meiner satirischen Versuche herhalten. Besonders gut kamen fingierte Protokolle von Gesprächen im Lehrerzimmer an. Die meistgelesene war betitelt: „Zensurenkonferenz“. Selbstverständlich habe ich alle bekannten Eigenarten der beteiligten Personen gnadenlos übersteigert und mit pädagogischem Unvermögen sowie speziellen Affinitäten zum Drogenkonsum kombiniert. Zitate und Verhaltensweisen waren aber wieder erkennbar aus dem Alltag entlehnt.
An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Was ich logischerweise erst viele Jahre später erfuhr, war die Sichtweise der Lehrer im Hinblick auf meine Klasse. Unser früherer Klassenlehrer sagte uns bei einem Klassentreffen:
„Ihr wart eine unheimlich kompakte Klasse. Die erste, die irgendwie zusammenhielt. Man kam einfach nicht dazwischen. Es war wie ein massiver Block, der einem als Lehrer gegenüber stand. Ihr wisst nicht, wie oft darüber im Lehrerzimmer geklagt wurde! Und solch eine Klasse gab es später auch nicht mehr.“
Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere von uns bereits selbst Lehrer. Einer an genau dieser Schule, ein anderer wurde dann Direktor einer Grundschule in Buckow, auch dort, wo er selbst beschult worden war. Diese Klassenkameraden nickten nachdenklich und wissend, mir war das völlig neu.
Damals aber war die Position als Schüler sehr genau definiert.
Die politische Stimmung, wenn man es einmal so nennen darf, die an dieser Schule herrschte, war eine Art unwillige Ergebenheit in die nicht zu ändernden Gegebenheiten. Was ein Lehrer entschied, musste man widerspruchslos hinnehmen. Persönliche Gespräche zwischen Lehrern und Schülern spielten sich immer mit erheblichem Gefälle ab, eine devote Haltung und grundsätzliche Zustimmung waren erforderlich, wollte man seine Noten nicht gefährden. Die ersten Lehrkräfte mit moderneren Ansichten kamen gerade erst in der Schule an. Bis zu diesem Zeitpunkt etwa hatten wir noch Pädagogen „vom alten Schrot und Korn“.
Man kann durchaus sagen, dass ich in der ersten Jahrgangsstufe war, die diesen Generationswechsel konkret zu spüren bekam. Erstens weil man um die zehnte Klasse herum die Weichen für den Abschluss stellen musste und zweitens, weil kulturelle Umbrüche in der umgebenden Gesellschaft ebenfalls gerade die ersten Eruptionen hervorriefen. Und das kam, weil es plötzlich im Musikbusiness erfolgreiche und damit auch gut verdienende aufsässige Jugendliche gab, und man deshalb deren unorthodoxe Meinung abdrucken musste. Ein James Dean machte noch keinen Sommer, aber die Flut an Beatgruppen, die mit den Rolling Stones und Beatles über den gesellschaftlichen Wahrnehmungshorizont gespült wurde, änderte die Verhältnisse in wahnsinnig kurzer Zeit. Ich glaube, hier hat die profitorientierte Elterngeneration genau durch ihr Gewinnstreben den eigenen Abgang beschleunigt. Davon an anderer Stelle mehr.
An der Schule war eine offene Diskussion dieser Umbrüche noch sehr riskant. Besser, man hielt diesbezüglich den Mund und erklärte, dass man selbstverständlich der alten Oma Müller die Kohlen hochtrug und auch sonst um gute Taten nicht verlegen war. Die Schülermitverwaltung, kurz SMV, hatte im Prinzip nur zwei Funktionen: nach Tagesordnungspunkten zu suchen und sich selbst zu verwalten. Gewiss gab es einige, die sehr löblich die Meinung vertraten, gerade die Aufmüpfigen müssten dort einziehen, damit man etwas bewegen könnte.
„Hmm, die Zeugniszensur nach unten!“, war mehr oder weniger die allgemeine Ansicht. Keiner hatte wirklich eine Vorstellung davon, was „man bewegen könnte“. Also lieber nicht sagen, was man dachte.
Im Innern aber zwickte der Aufruhr.
Als Ventil schrieb ich also Zettel-Satire auf der Schreibmaschine für die manuelle Verbreitung. Eines Tages sah ich so etwas Ähnliches am Schwarzen Brett, der offiziellen Mitteilungstafel der Schule.
Hohoho, dachte ich, am Schwarzen Brett, was für eine Frechheit! Das hatte ich noch nicht gewagt, obwohl einzusehen war, dass man hier ein großes Maß an Aufmerksamkeit erfahren konnte. Ich fand diese Aktion bewundernswert; das Einzige, das mich störte, waren Abkupferungen meiner eigenen Satireinhalte. Nach einem ersten Grimm wurde mir ein Treffen mit dem Täter vermittelt, und siehe da: wir funkten auf der gleichen Frequenz. Reinhard war vielleicht ein noch etwas feinsinnigeres Gemüt als ich, und so einigten wir uns auf einen ziemlich kunstvollen Namen für unser Tun: SubDhaG. Ausgeschrieben bedeutete es: Schüleruntergrundbewegung im Dienste der heiligen ausgleichenden Gerechtigkeit. Und es gab noch weitere Mitstreiter.
Fortan fand sich jeden Tag etwas Neues am Schwarzen Brett. Und nicht nur dort: überall an den Flurwänden fanden sich Plakate und Aufkleber.
Schülertrauben standen jetzt darum herum, Lehrer ebenfalls. Ziemlich bald wurde es sehr gefährlich, Pamphlete anzubringen. Aber irgendwie gelang es immer wieder, ohne dass jemand dabei überführt wurde. Überall wurde darüber diskutiert.
Bald nahm die Aktionsgeschwindigkeit erheblich zu. Wer etwas lesen wollte, musste sich beeilen, denn die Zettel wurden von den Lehrkräften sofort entfernt.
„Das“, so sprach mich eines Tages Wolfgang an, „könnte man doch auch in einer Schülerzeitung bringen!“ Er war unser Klassensprecher und von Politikbegeisterung infiziert.
„Welche Schülerzeitung?“, gab ich zurück.
„Wenn es eine gäbe!“, beharrte er unerschütterlich. Ich weiß noch genau, wie er mich anschaute, von der Tragweite seiner Idee überwältigt. Ich schüttelte den Kopf.
„Wir haben aber keine!“
„Dann müssen wir eben eine haben. Früher gab es auch schon eine!“
„Ach, und warum gibt es sie nicht mehr?“
„Weiß ich nicht. Vielleicht, weil zu wenige dafür schrieben. Aber das wär’ doch was für dich!“
Ich starrte ihn an und ich erinnere mich, ich wünschte, er würde recht haben. Vielleicht erst nach einiger Zeit, aber ja, eine Schülerzeitung, das fand ich angemessen.
„Wie geht so was? Wer muss sich dafür einsetzen?“, fragte ich mit vorsichtiger Sympathie.
„Na, die SMV! Ich werde das da mal vortragen!“
„Der Schlafmützenverein? Und wer soll dem zustimmen?“
„Die Lehrer, der Direx. Und der Vertrauenslehrer, der dann auch dabei eine Funktion hätte. Denn irgendjemand muss das ja überwachen.“
Genau, dachte ich. Überwachen. Da könnt ihr mich schon mal gleich streichen. Laut aber sagte ich ungefähr: „Ja, dann macht das doch. Eine ist besser als keine. Vielleicht schreib ich dann auch dafür!“
Im Stillen schloss ich das aber schon aus, denn es würde bedeuten, jede Idee durch den Filter vorauseilenden Gehorsams oder möglicher Restriktionen schicken zu müssen. Das wird doch nix, dachte ich. Genau so ist bestimmt auch die letzte Schülerzeitung gescheitert.
Aber ich sollte mich irren.
Lehrerseits befürwortete man die Schülerzeitung sehr, allerdings unter der Maßgabe, dass dann „diese Zettelkleberei aufhörte!“
Und so geschah es. War mir sowieso zu gefährlich geworden.
Es entwickelten sich schon mal spontane Verhöre auf dem Gang: „Jelinski, das waren doch Sie?“
„Ich? Bestimmt nicht! Haben Sie mich denn gesehen?“
Nein, hatte sie nicht, unsere Mathelehrerin. Sie rückte sich die Brille grade, schaute mich scharf an und wir beide wussten, was wahr war. Aber zum Glück konnte man es nicht nachweisen.
Die Schülerzeitung erschien wirklich. Natürlich dauerte alles ein wenig, die Elternvertreter mussten auch noch zustimmen, aber schließlich gab es eine erste Ausgabe.
Nach reiflicher Überlegung hatte ich keinen Beitrag eingereicht. Mittlerweile bereitete ich mich nämlich auf das Abitur vor.
„Wir wollen diese unsere neue Schülerzeitung nicht als Repräsentationsblatt, nicht als Tummelplatz, „um es den Lehrern zu geben“, auch nicht als Spielerei ansehen, sondern als Aufgabe!“, schrieb unser Direktor im Vorwort.
„Aha“, dachte ich, „gut, dass ich das weiß.“
Direktor Segner war auch unser Deutschlehrer und ich wusste wirklich, was er meinte. Für eine Klassenarbeit hatte ich von ihm gerade eine Sechs bekommen, und zwar tatsächlich am Freitag, den 13. Oktober 1967, kurz, nachdem ich in einem Essay über eine Zensurenkonferenz besonders den Direktor als Alkoholiker entlarvte. Ich hätte nie gedacht, dass sich ein Lehrer einmal mit solchen Mitteln „rächen“ könnte. Ehrlich gesagt, war ich maßlos enttäuscht, als ich das Heft öffnete und die Realität der Zensur akzeptieren musste. Ich weiß noch, wie die anderen in der Klasse scharf einatmeten, denn meine Klausur davor war eine Eins gewesen. Natürlich hatte man mich wegen der Satirezettel nicht überführen können, „obwohl es natürlich jeder wusste“. Ich fand diese Rache unter der Würde eines Direktors aber ich lernte meine Lektion. Ich schrieb dann noch ein paar Zweien und hielt mich in Äußerungen, besonders in schon diesbezüglich vorverurteilten Medien zurück.
Ein halbes Jahr vorher musste ich mein Abitur nicht unbedingt durch einen unbedachten Artikel in Gefahr bringen. Auf dem Abschlusszeugnis stand dann eine Drei in Deutsch.
„Schade“, sagte der Direx, „es hätte eine Eins sein können.“
Was ich antwortete, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, mit großer Mühe ohne besondere Emotionen in der Stimme: „Tja, so kann’s gehen!“
Und eigentlich berührte mich die Geschichte nicht besonders, denn es gab genug andere Bereiche, in denen ich ohne Probleme meinen Lustgewinn beziehen konnte. Ich muss sagen, langweilig war es wirklich nie; neue Filmideen mussten realisiert werden und Mädels gab’s schließlich auch noch.
So war ich dann auch in der zweiten Ausgabe der Schülerzeitung nicht vertreten, nur ein paar Ideen wurden von anderen verarbeitet, wie zum Beispiel absurde Eignungstests. Dann, nach der Abiturprüfung, wagte ich doch noch den Schritt: Einen Bericht über zwei „Beatlokale“ in Berlins Innenstadt innerhalb der Artikelreihe zum Thema „Tanzen gehen“.
Das eine Lokal war das PopCorn, das andere das Closed Eye. Wolfgang, jetzt ganz rege in der neu erwachten SMV, schrieb sicherheitshalber eine Einleitung dazu, in der er sich von diesen Lokalen distanzierte. Und sicherheitshalber auch gleich vom Autor.
„Heute stelle ich zwei Beatschuppen vor, die sich ohne Weiteres mit dem Titel “Extravagant“ schmücken können. Da ich jedoch diese Art von Lokalen ablehne und diese auch nicht betrete, war ich auf die Mitarbeit anderer angewiesen. So hat sich freundlicherweise Manfred Jelinski, 13b, bereit erklärt, zwei Berichte zu schreiben, die ich hier ungekürzt veröffentliche …“
Verräter, dachte ich.
„Das ist toll, dass du darüber schreibst!“, hatte er vorher getönt. Aber irgendwie warnte mich mein Bauchgefühl und ich schrieb am Ende ganz vorsichtig: „… einige (Gäste) starren in die Luft, an die Decke, ins Leere … Weil sie high sind. Wer die Leute kennt, scheint unter Umständen etwas Hasch und LSD abstauben zu können. Zu erreichen ist das Closed Eye mit dem A81 …“
Obwohl ich quasi mein Abitur schon in der Tasche hatte, gab es dann tatsächlich eine Diskussion zu diesem Thema. Allerdings versandete diese in Mutmaßungen, die man schlecht als Begründung irgendwohin schreiben konnte.
Schließlich hatte ich mit Bedacht „Wer die Leute kennt, scheint unter Umständen …“ geschrieben. Es stand nicht da, dass ich selbst jemanden in dieser Form kannte und deshalb auch keine weiteren Handlungen, wie beschrieben, vollzogen hätte. Und der ganze Artikel war auch künstlerisch angelegt, mit experimentellen Sätzen. Aber man kannte mich ja. Und die Zweifel an der Zulässigkeit meiner „Reifeprüfung“ waren auch noch anderweitig fundiert.
Dazu ein Beispiel, dessen Brisanz heute kaum noch erklärt werden kann.
Weil ich mit meiner jeweiligen Freundin Samstagabends „ausging“, brauchte ich Geld. Als Schüler war Jobben damals nicht einfach. Ich verdingte mich bei einer Zeitarbeitsvermittlung, die man hinter vorgehaltener Hand „Sklavenhändler“ nannte (antreten um halb sechs morgens!). Ich machte Lagerarbeiten, lud LKW ab oder reinigte Baustellen. Egal, Hauptsache bezahlt. Mehrmals trug ich Prospekte aus oder verteilte diese auf der Straße.
Eines Tages sagte Peti, mit dem ich solche Torturen oft gemeinsam durchstand: „Hier sieh mal, drei Stunden für zehn Mark!“