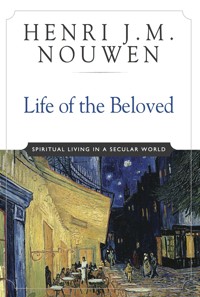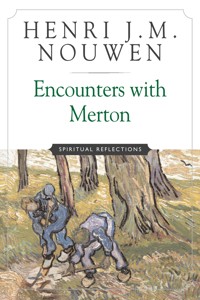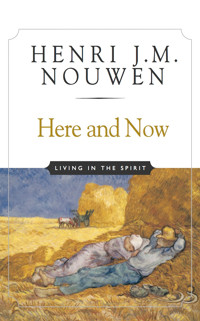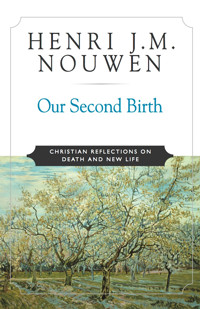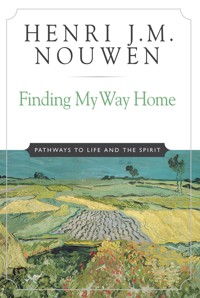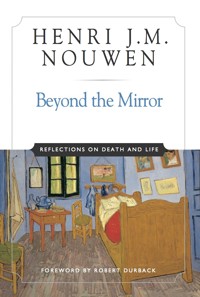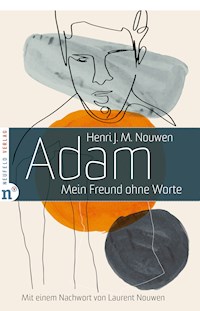Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Ein junger, kritischer Journalist stellte Henri Nouwen die Frage: Wie kann ich inmitten einer von Hektik, Flexibilität und Leistungszwang geprägten Welt spirituell leben? Henri Nouwens Antwort, die er in diesem Buch mit seinen Lesern teilt, ist so einfach wie befreiend: "Alles, was ich dir sagen möchte, ist in dieser Zusage zusammengefasst: "Du bist der geliebte Mensch". Mein einziger Wunsch ist, dass diese Worte in jeder Zelle deines Wesens widerhallen mögen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HENRI NOUWEN
Du bistder geliebte Mensch
Heute spirituell leben
Aus dem Amerikanischenvon Bernardin Schellenberger
Impressum
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2013
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: wunderlichundweigand, Stefan Weigand
Umschlagmotiv: © Leonardo Patrizi – iStock
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (Buch) 978-3-451-06752-5
ISBN (E-Book) 978-3-451-80718-3
INHALT
Vorwort: Eine Freundschaft beginnt
Du bist der geliebte Mensch
Wie du der geliebte Mensch wirst
I. Genommen
II. Gesegnet
III. Gebrochen
IV. Hergegeben
Lebe als der geliebte Mensch
Nachwort: Eine Freundschaft vertieft sich
VORWORTEine Freundschaft beginnt
Dieses Buch ist die Frucht einer lang andauernden Freundschaft. Ich glaube, Sie werden es mit mehr Gewinn lesen, wenn ich Ihnen zuerst einmal erzähle, wie es zu dieser Freundschaft gekommen ist.
Vor knapp zehn Jahren war ich Dozent an der Yale Divinity School. Da betrat eines Tages ein junger Mann mein Büro, der von mir ein Interview für den Connecticut-Lokalteil der Sonntagsausgabe der »New York Times« wollte. Er stellte sich als Fred Bratman vor. Wir setzten uns zu einem Gespräch zusammen, und ich fühlte mich recht schnell von einem Gefühl erfasst, das eine Mischung aus Verunsicherung und Faszination war.
Verunsichert war ich, weil dieser Journalist offensichtlich an allem anderen als an dem Interview interessiert war. Irgendjemand hatte ihm den Tipp gegeben, es könnte sich lohnen, einen Artikel über mich zu schreiben. Er hatte den Tipp aufgegriffen, aber ich konnte bei ihm keine allzu große Neugier entdecken, mich kennenzulernen, noch den lebhaften Wunsch, über mich etwas zu schreiben. Es war eine journalistische Pflichtübung, die er meinte, mit links erledigen zu können.
Dennoch war ich auch irgendwie fasziniert, denn ich spürte hinter der Maske der Gleichgültigkeit einen Geist voll sprühenden Lebens, der begierig darauf aus war, etwas zu lernen und sich kreativ zu betätigen. Irgendwie wusste ich, dass ich einem Menschen gegenübersaß, der über eine große Begabung verfügte und begierig auf eine Möglichkeit wartete, sie einzusetzen.
Nachdem mir Fred eine halbe Stunde lang Fragen gestellt hatte, die weder ihn noch mich sonderlich interessierten, wurde es offensichtlich, dass sich das Interview im Sand verlaufen hatte. Er würde einen Artikel daraus machen, einige wenige Leute würden ihn lesen, und herauskommen würde dabei, wenn überhaupt etwas, recht wenig. Das war uns beiden bewusst, und beide hatten wir das Gefühl, dass wir unsere Zeit hätten sinnvoller verwenden können.
Fred war gerade im Begriff, seinen Notizblock in seiner Aktentasche zu verstauen und das übliche »Ich danke Ihnen für das Gespräch« zu sagen. Da schaute ich ihm in die Augen und stellte ihm die Frage: »Sagen Sie mir, macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?«
Zu meiner Überraschung gab er ohne langes Nachdenken die Antwort: »Nein, eigentlich nicht, aber das ist halt mein Job.«
Ich erwiderte etwas naiv: »Aber wenn er Ihnen keinen Spaß macht, warum machen Sie das dann?«
»Irgendwie muss man ja sein Geld verdienen«, entgegnete er, und ohne dass ich weitergefragt hätte, setzte er hinzu: »Das heißt, ich schreibe wirklich gern, aber diese kleinen Zeitungsartikel hängen mir zum Hals heraus. Immer ist der Platz zu knapp, und nie kann man über eine Person oder eine Sache etwas tiefergehend schreiben. Wie kann ich zum Beispiel wirklich etwas mehr als nur Äußerlichkeiten über Sie und Ihre Gedanken sagen, wenn mir dafür nicht mehr als 750 Wörter zugestanden werden? … Aber was soll ich machen … Von irgendetwas muss man ja leben. Ich muss froh sein, dass ich wenigstens das tun kann!« Aus seiner Stimme hörte ich Ärger und Resignation heraus.
Plötzlich wurde mir klar, dass Fred kurz davor war, seine Träume sterben zu lassen. Er kam mir vor wie ein Häftling, den die Gesellschaft hinter Gitter gesteckt und zu einer Arbeit gezwungen hatte, zu der er keinerlei Beziehung hatte. Als ich ihn so anschaute, überkam mich eine große Sympathie für ihn, ja – ich wage es kaum zu sagen – eine große Liebe zu diesem Menschen. Hinter seinem Ärger und seiner Resignation spürte ich ein wunderbares Herz, ein Herz, das etwas geben, das kreativ sein und ein fruchtbares Leben führen wollte. Sein scharfer Verstand, seine Offenheit sich selbst gegenüber und das spontane Vertrauen, das er mir schenkte, gaben mir das Gefühl, dass unser Treffen nicht bloß reiner Zufall sein konnte. Was zwischen uns geschah, scheint mir vergleichbar mit der Szene, als Jesus den reichen jungen Mann lange ansah und »von Liebe zu ihm bewegt wurde« (Markus 10,21).
Spontan fühlte ich in mir den Wunsch, ihn aus seinem Gefängnis zu befreien und ihm einen Weg zu zeigen, wie er seine sehnlichsten Wünsche erfüllen konnte.
»Was wollen Sie wirklich?« fragte ich ihn.
»Ich möchte einen Roman schreiben … Aber dazu werde ich nie die Möglichkeit haben.«
»Haben Sie wirklich ernsthaft diesen Wunsch?« fragte ich weiter.
Er schaute mich ganz überrascht an und sagte mit einem Lächeln: »Ja, den habe ich … Aber mir ist auch unwohl bei diesem Gedanken, denn ich habe noch nie einen Roman geschrieben, und vielleicht habe ich gar nicht das Zeug zum Romanschriftsteller.«
»Wie sollen Sie denn herausfinden, ob Sie das Zeug dazu haben oder nicht?« fragte ich zurück.
»Ach, wahrscheinlich werde ich das nie herausfinden. Dazu braucht man Zeit und Geld, und beides habe ich nicht.«
An dieser Stelle unseres Gesprächs hatte mich eine richtige Wut gepackt – auf ihn, auf unsere Gesellschaft und auch ein Stück weit auf mich selber –, eine Wut darüber, dass wir diese Zustände einfach so hinnehmen. Ich fühlte in mir den starken Drang, all diese Mauern der Angst, der Konvention, der sozialen Erwartungen und der Selbstgeringschätzung niederzureißen, und ich platzte heraus:
»Warum werfen Sie dann nicht Ihren Job hin und schreiben Ihren Roman?«
»Das kann ich nicht«, sagte er.
Ich drang weiter in ihn: »Wenn Sie wirklich einen Roman schreiben wollen, dann können Sie das auch tun. Wenn Sie wirklich an sich glauben, müssen Sie sich ja nicht unbedingt dem Diktat der Zeit und des Geldes beugen.«
Jetzt wurde mir klar, dass ich mich unversehens in eine Schlacht gestürzt hatte, die ich um jeden Preis gewinnen wollte. Er spürte meine Entschlossenheit und sagte:
»Ich bin nun einmal bloß ein kleiner Zeitungsschreiber, und damit sollte ich wohl zufrieden sein.«
»Nein, das sollten Sie nicht«, sagte ich. »Sie sollten Ihrem tiefsten Wunsch folgen und das tun, was Sie wirklich wollen … Zeit und Geld sind nicht die Hauptsache.«
»Was ist dann die Hauptsache?« entgegnete er.
»Das sind Sie selbst«, gab ich zur Antwort. »Sie haben nichts zu verlieren. Sie sind jung, haben Energie, haben eine gute Ausbildung … Alle Türen stehen Ihnen offen … Warum lassen Sie sich von der Welt in ein enges Schema pressen? … Warum wollen Sie ein Opfer werden? Sie haben die Freiheit, das zu tun, was Sie wollen – wenn Sie es wirklich wollen!«
Er schaute mich mit immer größerer Überraschung an und wusste gar nicht mehr, wie er sich in diese merkwürdige Auseinandersetzung hatte verwickeln lassen. »Na gut«, sagte er, »ich gehe jetzt besser … Vielleicht schreibe ich doch irgendwann meinen Roman.«
Ich hielt ihn zurück, denn so leicht sollte er mir nicht entwischen. »Nein, warten Sie, Fred. Das, was ich gerade gesagt habe, habe ich wirklich so gemeint. Folgen Sie Ihrem tiefsten Wollen.«
Mit einem Anflug von Sarkasmus in seiner Stimme entgegnete er: »Das klingt ja großartig!«
Ich wollte ihn nicht gehen lassen. Ich spürte, dass hier meine eigenen Überzeugungen auf dem Spiel standen. Denn ich glaube, dass jeder Mensch bestimmte Entscheidungen treffen kann, und zwar Entscheidungen, die seinen eigenen besten Antrieben entsprechen. Ich glaube allerdings auch, dass es wenige Menschen sind, die diese Entscheidungen wirklich treffen; die anderen entscheiden sich nicht, machen dann der Welt, der Gesellschaft und anderen ihr »Schicksal« zum Vorwurf und vergeuden einen großen Teil ihres Lebens damit, sich zu beschweren.
Aber nach unserem kurzen Hin und Her im Gespräch spürte ich, dass Fred imstande war, seine eigenen Ängste zu überspringen und das Risiko zu wagen, auf sich selbst zu vertrauen. Jedoch wusste ich auch, dass ich vorausspringen musste, damit er das auch wagte, und so sagte ich: »Fred, kündigen Sie Ihren Job, kommen Sie ein Jahr hierher und schreiben Sie Ihren Roman. Irgendwie werde ich das Geld dafür schon auftreiben.«
Später – viele Jahre später – gestand mir Fred, ihm sei nach diesen meinen Äußerungen ziemlich unwohl geworden und er habe sich gefragt, was wohl der Grund dafür sein mag. Er habe gedacht: Was will dieser Mensch eigentlich von mir? Warum bietet der mir Geld und Zeit an, damit ich etwas schreibe? Ich traue dem nicht. Da muss irgendetwas anderes dahinterstecken!
Aber statt etwas in dieser Richtung zu sagen, entgegnete er nur: »Ich bin Jude, und das hier ist eine christliche Lehranstalt.«
Ich schob seinen Einwand beiseite: »Wir werden Ihnen einen Studien-Freiplatz einräumen, und Sie können hier wohnen … Sie können dann tun, was Sie wollen … Die Leute hier werden das gut finden, einen Romanschriftsteller im Haus zu haben, und dabei können Sie etwas über das Christentum und das Judentum dazulernen.«
Wenige Monate später zog Fred in die Yale Divinity School ein und widmete ein ganzes Jahr dem Versuch, seinen Roman zu schreiben. Der Roman kam nie zustande, aber wir wurden gute Freunde, und heute, viele Jahre danach, schreibe ich dieses Buch als Frucht dieser Freundschaft.
In den etwas mehr als zehn Jahren nach unserer gemeinsamen Zeit in Yale lebten sowohl Fred als auch ich in Lebensformen, die sich völlig von dem unterschieden, was wir uns bei unserer ersten Begegnung vorgestellt hatten.
Fred musste eine schmerzliche Scheidung durchstehen, heiratete wieder, und er und seine Frau Robin erwarten jetzt ihr erstes Kind. Er arbeitete an verschiedenen Stellen, die zunächst nicht sehr befriedigend waren, bis er einen Beruf fand, der ihm ein reiches Feld für die Entfaltung seiner Kreativität bot. Auch meine eigene Lebensreise hätte niemand vorhersehen können. Ich verließ die akademische Welt, ging nach Lateinamerika, versuchte es dann noch einmal in der Universität und ließ mich schließlich in einer Gemeinschaft mit geistig behinderten Menschen nieder. Im Leben eines jeden von uns gab es Zeiten mühsamen Ringens, gab es manche Leiden und Freuden, und vieles davon konnten wir miteinander besprechen, weil wir uns regelmäßig gegenseitig besuchten. Im Lauf der Jahre kamen wir uns immer näher, und es wurde uns immer bewusster, wie wichtig unsere Freundschaft für uns beide war, obwohl uns unsere Tätigkeiten, die Entfernung und die persönlichen Lebensstile davon abhielten, uns so oft zu treffen, wie wir es uns eigentlich gewünscht hätten.
Schon vom Anfang unserer Freundschaft an waren wir uns dessen ziemlich deutlich bewusst, dass wir aus radikal unterschiedlichen religiösen Welten kamen. Zunächst schien es, als erschwere uns das die Möglichkeit, eine gemeinsame geistige Wellenlänge zu finden. Fred respektierte mich als katholischen Priester und zeigte aufrichtiges Interesse an meinem Leben und meiner Arbeit. Gleichwohl waren das Christentum ganz allgemein und die katholische Kirche im Besonderen lediglich einige von vielen anderen Dingen, die ihn höchstens beiläufig interessierten.
Ich meinerseits konnte ziemlich mühelos Freds säkularisiertes Judentum verstehen, hatte aber dennoch das Gefühl, dass es für ihn ein großer Gewinn gewesen wäre, wenn er sich mehr auf sein eigenes spirituelles Erbe eingelassen hätte. Ich erinnere mich lebhaft daran, dass ich zu Fred einmal sagte, es täte ihm sicher gut, wenn er die hebräische Bibel lesen würde. Er wollte davon absolut nichts wissen:
»Sie sagt mir nichts. Das ist eine fremde, ferne Welt für mich …«
»Na ja«, sagte ich, »dann lies wenigstens das Buch Kohelet, das ist das Buch, das anfängt mit ›Nichtigkeit, Nichtigkeit, … alles ist Nichtigkeit‹.«
Am nächsten Tag sagte Fred zu mir: »Ich habe das Buch gelesen … Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass in der Bibel ein Skeptiker etwas zu suchen hat … einer wie ich … Das gibt mir Auftrieb!«
Und ich erinnere mich auch, dass ich mir dachte: »In dir steckt viel mehr als ein Skeptiker.«
Im Lauf der Jahre, als wir älter wurden und die Aufmerksamkeit auf Erfolg, Karriere, Ruhm, Geld und Zeit abflaute, traten mehr die Fragen nach Sinn und Zweck in den Mittelpunkt unserer Beziehung.
Angesichts all der vielen Umbrüche in unserem Lebenslauf wurden wir beide mehr und mehr sensibel für unsere tieferen Bedürfnisse. Obwohl wir in sehr unterschiedlichen Verhältnissen lebten, hatten wir uns doch beide mit der Not des Abgelehntwerdens und der Trennung herumzuschlagen, und jedem von uns beiden wurde immer deutlicher unser Bedürfnis nach Nähe und Freundschaft bewusst. Beide mussten wir aus unseren tiefsten geistlichen Quellen Trost schöpfen, um nicht in Bitterkeit und Groll zu versinken. Die Unterschiede zwischen uns wurden immer unwesentlicher, die Gemeinsamkeiten immer deutlicher. Unsere Freundschaft nahm an Tiefe und Stärke zu, während wir immer lebhafter den Wunsch nach einem gemeinsamen geistlichen Fundament verspürten.
Als wir eines Tages miteinander in New York City die Columbia Avenue entlanggingen, wandte sich Fred mir zu und sagte: »Du könntest doch einmal für mich und meine Freunde etwas über das geistliche Leben schreiben!« Fred kannte das meiste, was ich geschrieben hatte. Oft hatte er mir wertvolle stilistische und sprachliche Hinweise gegeben, aber selten eine innere Beziehung zum Inhalt meiner Bücher gefunden. Als Jude, der in der weltlichen Stadt New York City lebte, konnte er nicht viel Trost oder Hilfe aus Worten schöpfen, die so ausdrücklich christlich waren und so eindeutig von jemandem stammten, der seiner Lebtag bewusst in der katholischen Kirche gelebt hatte.
»Das sind ganz gute Sachen«, sagte er oft, »aber für mich ist das nichts.« Fred hatte das starke Empfinden, dass seine eigene Erfahrung und die seiner Freunde einen anderen Klang, eine andere Sprache, eine andere geistliche Wellenlänge gebraucht hätten.
Nach und nach lernte ich Freds Freunde kennen und bekam ein Gespür für ihre Interessen und Sorgen. Das half mir, Freds Äußerungen besser zu verstehen, dass es eine Spiritualität geben müsste, die die Männer und Frauen in einer säkularisierten Gesellschaft anspricht. Mein Denken und Schreiben setzte weithin die Vertrautheit mit Begriffen und Bildern voraus, die jahrhundertelang das geistliche Leben von Christen und Juden genährt hatten; aber heutzutage haben diese Begriffe und Bilder für viele Menschen die Kraft verloren, ihnen ihre geistliche Mitte zu erschließen.
Freds Anregung, ich solle eine Anleitung zum geistlichen Leben schreiben, die seine Freunde und er verstehen könnten, ging mir nach. Er hatte mir die Aufgabe gestellt, auf den geistlichen Hunger und Durst einzugehen, der sich in zahllosen Menschen regt, die die Straßen der großen Städte durcheilen. Er hatte mich herausgefordert, ein Wort der Hoffnung an die Menschen zu richten, die nicht mehr in die Kirchen und Synagogen kamen und die nicht mehr ganz selbstverständlich die Priester und Rabbiner als ihre Ratgeber in Anspruch nahmen.
»Du hast etwas zu sagen«, redete mir Fred ständig zu, »aber du sagst es immer wieder bloß den Leuten, die das am wenigsten brauchen … Wer sagt uns jungen, ehrgeizigen, verweltlichten Männern und Frauen etwas, die wir uns doch auch die Frage stellen, welchen Sinn das Leben überhaupt hat? Kannst du uns mit der gleichen Überzeugungskraft etwas sagen, wie du das denen sagst, die in deiner Tradition stehen, deine Sprache sprechen und deine Weltanschauung vertreten?«
Fred war nicht der einzige, der mir solche Fragen stellte. Was Fred so ausdrücklich ins Wort gebracht hatte, wurde mir auch von vielen anderen Seiten gesagt. Ich hörte es von Leuten in meiner Gemeinschaft, die ohne religiösen Hintergrund waren und die die Bibel für ein seltsames, verwirrendes Buch hielten. Ich hörte es von eigenen Familienangehörigen, die schon lange die Kirche verlassen hatten und ganz und gar nicht den Wunsch verspürten, in sie zurückzukehren. Ich hörte es von Juristen, Ärzten und Geschäftsleuten, die ihre Energie völlig in ihren Beruf gesteckt hatten und für die der Samstag und Sonntag wenig mehr als eine kurze Atempause war, um genügend Kraft dafür zu sammeln, am Montagmorgen wieder in die Arena zu steigen. Ich hörte es auch von jungen Männern und Frauen, die den vielen Ansprüchen einer Gesellschaft ausgeliefert waren, die sie völlig in Beschlag nahm, und die doch allmählich mit Sorge spürten, dass ihnen diese Gesellschaft nicht viel wirkliches Leben anzubieten hatte.