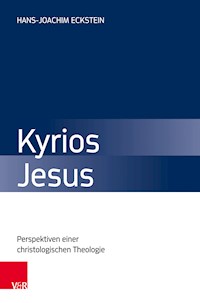Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler im SCM-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Grundlagen des Glaubens
- Sprache: Deutsch
In dieser stark erweiterten Ausgabe von »Wenn die Liebe zum Leben wird« lädt der bekannte Tübinger Professor und Liedermacher zu einem lebensbejahenden und beziehungsgewissen Glauben ein. Wenn die Beziehungen, die unser Leben begründen, stärken und erfüllen, für uns persönlich erfahrbar werden, dann entwickelt sich in uns zunehmend die Fähigkeit, unser eigenes Leben in der Realität der Liebe zu erkennen und zu entfalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Joachim Eckstein
Du bist geliebter,als du ahnst
Zur Beziehungsgewissheit
Grundlagen des Glaubens 3
Der SCM Verlag ist ein Imprpint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
Dr. Hans-Joachim Eckstein ist Professor für Neues Testament, Referent und Autor von Sachbüchern und Meditationen, von Aphorismen und Gemeindeliedern.
www.ecksteinproduction.com
ISBN 978-3-7751-5923-4 (E-Book)
ISBN 978-3-7751-5896-1 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck
2., neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage 2018 von »Wenn die Liebe zum Leben wird«, zuvor erschienen unter der ISBN 978-3-7751-5180-1
© Copyright 2018: Hans-Joachim Eckstein Verlagsrecht dieser Ausgabe:
SCM Verlag in der SCM-Verlagsgruppe GmbH, 71087 Holzgerlingen
Die Bibelstellen wurden eigenständig übersetzt, wo möglich, in Anlehnung an die Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, zitiert.
Umschlaggestaltung: JoussenKarliczek, Schorndorf, www.J-K.de
Titelbild: Ruth Black/stocksy.com
Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
Gedruckt in Deutschland
GELIEBT UND ERKANNT
Wir haben erkannt und geglaubtdie Liebe, die Gott zu uns hat.Gott ist die Liebe;und wer in der Liebe bleibt,der bleibt in Gott und Gott in ihm.1. Johannes 4,16
Wenn jemand Gott liebt,der ist von ihm erkannt.1. Korinther 8,3
Nachdem ihr aber Gott erkannt habt,ja vielmehr von Gott erkannt seid …Galater 4,9
Das ist das ewige Leben,dass sie dich,den allein wahren Gott,und den du gesandt hast,Jesus Christus, erkennen.Johannes 17,3
BEZIEHUNGS-GEWISSHEIT
Nur die Liebe kann unsglaubhaft vermitteln,dass wir einzigartigund bedeutsam sind.
Kennen wir diese Liebe,dann können wir unserGegenüber und unsselbst erkennen.
Aber wie schwer ist es,andere anzuerkennen,wenn wir selbst nichterkannt worden sind.
INHALT
Vorwort
Glaube und Erfahrung
Von der Realität des Geglaubten
Gott als Vater
Das zentrale christliche Gottesverständnis?
»Mein Herr und mein Gott!«
Wie ein Zweifler den Auferstandenen »begreift«
Geliebt, erkannt und anerkannt
Zum Wesen der Liebe
»Gerechtigkeit erhöht ein Volk«
Von dem realistischen Ideal der Beziehung
Christus ist mein Leben – Was kommt nach dem Sterben?
Von der Tragfähigkeit und Gewissheit der Beziehung
Tolerant aus Glauben
Glaubensgewissheit und Anerkennung anderer
»Dienet einander in der Liebe«
Zu Gaben, Aufgaben und Ämtern in der Gemeinde
Anmerkungen
Fach- und Fremdwörter
Der Autor
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
VORWORT
Ob wir selbst uns und unser Leben als bedeutsam und wertvoll empfinden, hängt weniger von unserem Reichtum, gesellschaftlichen Status oder Schätzwert ab als von der Wertschätzung, die wir persönlich durch andere erfahren. Wenn die Beziehungen, die unser Leben begründen, stärken und erfüllen, für uns wirklich und erfahrbar werden, dann entwickelt sich in uns zunehmend die Fähigkeit, unser eigenes Leben in der Realität der Liebe zu erkennen und zu entfalten. Denn unsere vertrauensvolle Lebensperspektive und unsere zuversichtliche Lebensgestaltung sind vor allem die Früchte unseres eigenen Erlebens von Zuwendung und Wertschätzung. So erwächst unsere Befähigung zu persönlichen Beziehungen aus unserer eigenen Beziehungsgewissheit, und unsere Beziehungsgewissheit gründet in unserer selbst erfahrenen Beziehungswirklichkeit.
Die Einführungen in die »Grundlagen des Glaubens« wenden sich sowohl an diejenigen, die sich aus einer interessierten Distanz mit den Wurzeln des Christentums beschäftigen wollen, als auch an die, die das Fundament ihres eigenen Glaubens und persönlichen Erlebens gedanklich noch klarer zu entdecken suchen. Ob es um die Grundbestimmung und Erfahrbarkeit des Glaubens geht oder um das zentrale Gottesverständnis, ob es sich um das »Begreifen« der Bedeutung Jesu Christi handelt oder um das Erfassen dessen, was Liebe überhaupt ist und sein kann – jeweils kommt der Glaube als zum Leben befähigende und ermutigende Beziehung in den Blick.
Die Tragfähigkeit und Gewissheit einer Beziehung bewährt sich vor allem dann, wenn Vertrauen, Liebe und Hoffnung in der Krise und in der Angst des Verlustes auf die Probe gestellt werden. Was bedeutet die Glaubensgewissheit, dass Christus und die Beziehung zu ihm mein Lebensinhalt ist, für die Grenzsituation des Sterbens und für die Perspektive eines Lebens danach?
Bei dem biblischen Glaubensverständnis handelt es sich um ein durchaus realistisches Ideal, und die gewonnene Beziehungsgewissheit führt als solche auch zur Wahrnehmung und Anerkennung anderer, wie die beiden Beiträge zu Gerechtigkeit und Toleranz entfalten. Wie dieses wechselseitige Dienen in der Liebe sich vorbildlich und konkret bei den ersten Christen gestaltete, klären abschließend die Ausführungen zu den Gaben, Aufgaben und Ämtern in neutestamentlicher Zeit.
Wer weitere Grundlegungen des Glaubens und elementare Zugänge zu zentralen theologischen Fragen sucht, der wird in »Zur Wiederentdeckung der Hoffnung«, in »Glaube als Beziehung« und in »Wie will die Bibel verstanden werden?« fündig werden. Wer sich anschauliche und persönliche Texte zu einem von Hoffnung und Liebe bestimmten Glauben wünscht, der wird zum Beispiel in »Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat« oder in »Ich schenke deiner Hoffnung Flügel« eine sinnvolle Ergänzung sehen. Sie alle – die sachlich-theologischen wie die lyrisch-meditativen Bücher – laden auf ihre je eigene Weise zur Entdeckung eines lebensbejahenden und beziehungsgewissen Glaubens ein.
Hans-Joachim Eckstein
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
GLAUBE UND ERFAHRUNG
VON DER REALITÄT DES GEGLAUBTEN
Mehr denn je wird heute von Glaubenden die Frage nach der Erfahrung des Glaubens gestellt. Einerseits liegt dies gewiss daran, dass wir in einer Zeit leben, die auf das eigene Erleben und die persönliche Glückserfahrung konzentriert ist, andererseits gewiss auch daran, dass wir als Kinder der Neuzeit allem gegenüber kritisch sind, was wir nicht selbst vernünftig erklären oder unmittelbar wahrnehmen und empfinden können. Gegenüber Traditionen sind wir zunächst einmal misstrauisch; und das, was Institutionen vertreten, genießt an sich noch keinen Vertrauensvorschuss. Dass unsere Vorfahren etwas geglaubt haben, macht es für viele noch nicht an sich glaubwürdiger; und dass etwas in unserer Kirche seit Jahrhunderten verkündigt und bekannt wird, berührt und verpflichtet selbst die nicht unbedingt, die sich einer Gemeinde zugehörig fühlen.
Freilich muss man zugleich auch einräumen, dass das Verständnis des »Glaubens« in Theologie und Kirche manchmal sehr wirklichkeitsfern und lebensarm entfaltet worden ist. Als kritischer Beobachter könnte man den Eindruck gewinnen, dass der Glaube für viele Christen nur von unwesentlicher Bedeutung sein kann, da er ihr Leben kaum sichtlich beeinflusst. Zudem verwundern viele die Versuche in Lehre und Verkündigung, die Verlegenheit unseres Alltags auch noch zu verklären und dem Glauben seinen Realitätsbezug und seine Erfahrbarkeit wortgewaltig abzusprechen. Aber mit einem Generalverdacht gegenüber allem »Religiösen« und »Emotionalen« oder mit einem rein formalen Wort- und Predigt-Verständnis werden wir wohl weder der Realität des Geglaubten noch den Menschen gerecht, die wir doch gewinnen wollen.
Da kann es nicht wundern, dass vor allem junge Gläubige immer wieder neu nach Wegen der Erfahrbarkeit des Glaubens suchen. Sie wollen sich nicht einfach mit den Inkonsequenzen anderer und mit den Widersprüchen ihrer eigenen Lebenserfahrung abfinden. Sie wollen nicht nur theoretisch und rein verkopft, sondern ganzheitlich glauben. Ihnen genügen konventionelle Gottesdienstformen nicht mehr, wenn sie dabei das Gemeinschaftsmoment, die emotionale Wärme und das zeitgemäße Erleben und Gestalten vermissen. Bei der Verkündigung fehlt es ihnen oft an der gedanklichen Durchdringung und der soliden theologischen Grundlage, die das im Glauben Erfahrene auch für die Zeiten der Zweifel und Krisen bewahren können. Wollen sie doch als Gemeinde für die Bezeugung ihres Glaubens nach außen wie nach innen sprachfähig werden.
Wie gehören also Glaube und Erfahrung zusammen? Glauben wir, weil wir erfahren, oder erfahren wir, weil wir glauben? Trägt der Glaube die Erfahrung oder die Erfahrung den Glauben? Worin gründet die Gewissheit des Glaubens? Und wie äußert sie sich im eigenen Leben? Gibt es eine Form des Glaubens, bei der die unglücklichen Gegensätze unserer Frömmigkeitserfahrungen überwunden werden können und Kopf, Bauch und Herz zugleich angesprochen sind? Und vor allem – was meinen wir als Christen denn genau, wenn wir vom Glauben reden?
BESINNUNG AUF DEN AUSGANGSPUNKT DER ZIELE
Es mag als naheliegend, für viele vielleicht als selbstverständlich erscheinen, dass wir unser Thema »Glaube und Erfahrung« im Gespräch mit den neutestamentlichen Schriften – und hier speziell mit Paulus als einem der bedeutendsten Theologen unter den neutestamentlichen Verfassern – entfalten wollen. Lässt uns nicht schon die Rede vom »Urchristentum« und der »Urgemeinde« an das Ideal und Vorbild unserer christlichen Tradition denken?
In Situationen der Krise und der Orientierungslosigkeit kann der sicherste Fortschritt für uns als Individuen wie als Gemeinschaften in der Tat darin bestehen, dass wir nicht unbedacht weiterlaufen, sondern anhalten und uns auf den Ausgangspunkt unserer Ziele besinnen. Gleich einem Wanderer im Moor, der spürt, dass der Boden unter ihm nachgibt, ziehen wir uns unwillkürlich zurück zu dem Punkt unseres Weges, an dem wir noch sicheren Boden unter den Füßen hatten, um uns neu zu orientieren. Dabei darf es nicht um ein zurückgewandtes und lebensängstliches Flüchten in die Vergangenheit gehen, sondern vielmehr um eine Wiedergewinnung der Perspektive, die uns vormals motivieren und unsere Wirklichkeit verändern konnte.
Die Rückbesinnung auf die Wurzeln unseres Glaubens führt ohnehin nicht zu einem verklärten Bild der ersten Christen und Gemeinden, bei denen alles noch dem Ideal entsprach und in Ordnung war. Vielmehr wird sich sehr schnell zeigen, dass es gerade der Umgang der ersten Christen mit den außergewöhnlichen Herausforderungen und Schwierigkeiten ist, der uns bei der eigenen Bewältigung unserer Aufgaben noch heute Orientierung und Motivation sein kann.
DIE ZENTRALE BEDEUTUNG DES GLAUBENS
In der Tat bilden das Substantiv »Glaube« und das Verb »glauben« nicht erst neuzeitlich, sondern von Anfang an einen – wenn nicht den – Zentralbegriff zur Beschreibung des rechten Gottesverhältnisses und zur Bezeichnung des Wesentlichen der christlichen Religion überhaupt. Dies zeigt sich schon rein formal an der Häufigkeit der Verwendung des Glaubensbegriffs im Neuen Testament: »Glaube« und »glauben« sind je 243-mal belegt,1 und nur in den beiden kürzesten neutestamentlichen Schriften, dem 2. und 3. Johannesbrief, findet sich der Begriff nicht. Allein in den Paulusbriefen kommt der Glaubensbegriff insgesamt 196-mal vor.2
Entscheidender als die reinen Zahlen ist freilich die programmatische und umfassende Weise der Verwendung des Glaubensbegriffs in den frühchristlichen Schriften. So kann Paulus in Galater 3,23.25 vom »Gekommensein des Glaubens« reden, um das mit Christus gekommene Heil und Leben insgesamt zu umschreiben; und in Römer 12,6 nennt er als verbindlichen Maßstab für jede Predigt der christlichen Propheten »die Übereinstimmung mit dem Glauben«. Die ersten Christen bezeichneten sich schlicht als »die Glaubenden«3; und wollten sie das Christ-Werden, den Übertritt zur christlichen Religion und den Eintritt in die christliche Gemeinschaft treffend benennen, sprachen sie vom »Zum-Glauben-Kommen«4. Doch was verstanden die ersten Christen genau unter »Glaube«? Was sind Bedeutung und Wesensmerkmal dieses Zentralbegriffs der christlichen – allemal der reformatorischen – Kirche bis heute?
GLAUBEN HEISST »FÜR-WAHR-HALTEN«
Bis in die Gegenwart hinein verbreitet ist erstens die Wendung »glauben, dass …« in der Bedeutung »für wahr halten«. Hier ist der Glaube also konkret auf einen Glaubensinhalt bezogen: Er bezeichnet etwas, was geglaubt wird. Die Geretteten »glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist« (1. Thessalonicher 4,14), »glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat« (Römer 10,9). In diesem Sinne lässt sich der Inhalt des Glaubens auch von Beginn an in Bekenntnissen formulieren – wie wir in unseren Gottesdiensten bis heute das Apostolische Glaubensbekenntnis gemeinsam bekennen. So wurde den Korinthern nach 1. Korinther 15 in der Verkündigung bezeugt und so haben sie geglaubt (V. 11), »dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er erschienen ist Kephas, dann den Zwölfen« (1. Korinther 15,3-5).
Umgangssprachlich wird der Begriff »glauben« heute oft verwendet, um hervorzuheben, dass sich etwas nur »annehmen« und »vermuten«, aber eben gerade nicht mit Gewissheit sagen lässt – wie in der Redewendung: »Glauben heißt nicht wissen.« Im Neuen Testament hingegen wird eine Erkenntnis nicht etwa deshalb als Glaubensaussage bezeichnet, weil ihr Wahrheitsgehalt dem Bekenner ungewiss oder zweifelhaft wäre. Der Glaubende darf und soll sich seiner Überzeugung durchaus gewiss sein. Was seine Glaubenserkenntnis vom sonstigen menschlichen Wissen unterscheidet, ist nicht etwa ein Mangel an Gewissheit, sondern lediglich die Weise, in der diese Gewissheit zustande kommt.
Zum Glauben an Gottes Existenz, an seine Zuwendung und sein Handeln kommt es nicht aufgrund von »Beweisen« und »eigenen Erfahrungen«, sondern vielmehr dadurch, dass der Mensch von Gott angesprochen und das Evangelium von Christus ihm zugesprochen wird. Der Glaubende wird von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt, ohne dass er selbst Zeuge der beschriebenen Ereignisse gewesen ist. Er kann sich darauf einlassen und verlassen, ohne dass er sie wie andere Tatsachen seines Lebens persönlich nachprüfen und belegen könnte. So versteht auch Paulus als Gegensatz zum »Glauben« nicht etwa das »Wissen«, denn der Glaube ist von Wissen, Erkenntnis und Gewissheit erfüllt – er würde in diesem Sinne wohl eher formulieren: »Glauben heißt wissen!« Für ihn besteht der Gegensatz zum gegenwärtigen Glauben der Christen vielmehr im zukünftigen »Schauen« – in der »Anschaulichkeit«, »dem Sichtbaren« der für uns noch zukünftigen himmlischen Welt. »Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, im Sichtbaren« (2. Korinther 5,7). Damit bedeutet Glauben, sich an das zu halten, was man nicht sieht, als würde man es sehen.
Die Glaubenden sind also durchaus davon überzeugt, dass Gott ist und dass er für sie ist; aber sie können dieses Wissen nicht eindeutig aus der Geschichte und Erfahrung – unabhängig und außerhalb von Christus – ableiten. Sie können ihre Glaubensüberzeugung anderen gegenüber wohl bezeugen und vernünftig erklären, aber eben nicht »beweisen«. Ihr Glaube gründet in Gottes Selbstvorstellung und Reden in Jesus Christus – in der Verkündigung und dem Wirken Jesu Christi sowie in dessen Lebenshingabe und Auferstehung zu unseren Gunsten. Ohne diese Offenbarung in Christus blieben ihre Erkenntnis von Gott und ihre Erfahrung mit der Welt und mit dem eigenen Glauben mehrdeutig und widersprüchlich – und damit gerade nicht vertrauenerweckend und glaubengründend.
Aufgrund der Zusage des Evangeliums vertrauen sie allerdings fest darauf, dass sich Gott dieser widersprüchlichen Welt gegenüber bereits behauptet hat und sich endgültig in Liebe und Gerechtigkeit durchsetzen wird. Sie nennen diese Gewissheit aber noch »Hoffnung«, weil sie eben noch nicht für jeden »augenscheinlich« und »offensichtlich« ist. – »Denn zu solcher Hoffnung sind wir gerettet; die Hoffnung aber, die man sieht [das heißt, die man schon erfüllt sieht], ist nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld« (Römer 8,24f).
Der christliche Glaube schließt somit durchaus »Wissen« und »Erkenntnis«, »Für-wahr-Halten« und »Bekenntnis« ein. Jedoch wird diese »Überzeugung« nicht durch einen »historischen Beweis« herbeigeführt. Schon gar nicht wird er als losgelöster »Faktenglauben« dem Menschen selbst vorweg abgefordert – im Sinne von: »Das musst du eben glauben!« Wenn man es mit neuzeitlicher Begrifflichkeit ausdrücken will, lässt es sich so auf den Punkt bringen: Die Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist für die ersten Christen sehr wohl »historisch« – das heißt, in Zeit und Raum hinein geschehen –, aber eben nicht »historisch verifizierbar« – das heißt mit wissenschaftlichen Mitteln auch außerhalb des Glaubens nachzuweisen. Und die Glaubensüberzeugung gilt sehr wohl als »objektiv begründet« und nicht nur als »subjektiv vermutet«, aber sie lässt sich gegenüber dem Unglauben zur jetzigen Zeit eben noch nicht »objektiv« und unwidersprechlich beweisen.
GLAUBENSLEBEN UND GLAUBENSGEHORSAM
Nun wird sowohl in den alttestamentlich-jüdischen wie in den neutestamentlichen Traditionen durchgängig vorausgesetzt, dass das, was der Glaube »erkennt« und »für wahr hält«, zugleich das Leben der Glaubenden bestimmen und prägen soll. Der Glaube bleibt nicht rein theoretisch und unverbindlich, sondern hat Konsequenzen für die eigene Existenz und das persönliche Denken und Handeln. Dies kann als das zweite grundsätzliche Merkmal des biblischen Glaubensverständnisses angesehen werden. Diejenigen, die in ihrem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, die erkennen, anerkennen und bekennen diesen zugleich als den von Gott eingesetzten »Herrn« – den Kyrios der Welt und ihres eigenen Lebens. So beschreibt es Paulus in Römer 10,9 als die Grundlage des Glaubenslebens: »Denn wenn du mit deinem Munde bekennst Jesus, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.«
Die Verkündigung des Evangeliums zielt also auf Glaube und Zustimmung im Gehorsam – oder um es mit Römer 1,5 zu formulieren: Sie zielt auf den »Gehorsam des Glaubens«. Dies ist nun nicht so gedacht, dass der »Gehorsam« als ein Weiteres und etwas Anderes zum Glauben erst hinzutreten müsste. Sondern der Glaube stellt selbst den zustimmenden Gehorsam dar, der Gehorsam besteht im Erkennen, Anerkennen und Bekennen des Glaubens. Wenn die »Heiden« das von Paulus verkündete Evangelium von Jesus Christus »hören« und Gott »aufs Wort glauben«, dann kommt es damit zu dem »Gehorsam des Glaubens«, um dessentwillen sich der Apostel nach Römer 1,5 und 16,26 von Gott gesandt weiß. Und kommt es umgekehrt trotz der Verkündigung nicht zum Glauben, dann ist dieses »Nicht-Hören« und »Nicht-hören-Wollen« in umfassender Bedeutung »Ungehorsam« (Römer 11,30-32)5.
Somit gründet der »Gehorsam des Glaubens« in dem »Zu-Gehör-Bringen des Glaubens«. Der Gehorsam, der im zustimmenden Glauben besteht, gründet in der Verkündigung des Evangeliums, die den Glauben weckt.6 Der Gehorsam verdankt sich dem Hören! So folgert es Paulus selbst einprägsam in Römer 10,17: »So kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi [das heißt das Evangelium].«
GLAUBE ALS VERTRAUEN UND SICH-ANVERTRAUEN
Sosehr die beiden bisherigen Bestimmungen des Glaubens als »Für-wahr-Halten« und als »Anerkennen« bzw. »Gehorsam« für das biblische Verständnis insgesamt zutreffend und wichtig sind, sowenig können sie doch schon als hinreichend gelten. Es ist nämlich als ganz wesentlich festzuhalten, dass der Glaube sich nicht nur auf eine Idee, eine Mitteilung oder einen Sachverhalt bezieht, sondern zunächst und vor allem auf eine Person!
Rein sprachlich spiegelt sich das darin wider, dass nicht nur die Wendungen »glauben, dass«7 und »etwas glauben«8 gebraucht werden, sondern vor allem »jemandem glauben«9 und »an jemanden glauben«10. Es geht beim Glauben also nicht nur um Überzeugungen und Tatsachen, sondern vor allem und zuerst um Personen. Indem das Moment des »Vertrauens«, des »Sich-Anvertrauens« und des »Sich-Verlassens« auf ein Gegenüber in den Vordergrund tritt, erweist sich das Wort »Glaube« als ein Beziehungsbegriff – ein Begriff also, der nicht nur die Überzeugung eines Einzelnen für sich, sondern das Verhältnis einer Person zu einer anderen beschreibt. So wie der Begriff der »Liebe« eine personale Beziehung voraussetzt, so wird hier mit »Glaube« nicht nur die individuelle Haltung, Überzeugung und Zustimmung bezeichnet, sondern das »Sich-Verhalten« und »Sich-bestimmen-Lassen« hinsichtlich eines persönlichen Gegenübers11.
Wer dem Vater Jesu Christi seine Zusage und Verheißung glaubt und ihn beim Wort nimmt, der »vertraut« auf ihn und seine Treue. Wer an den Gott glaubt, »der die Gottlosen gerecht macht« – das heißt begnadigt und freispricht (Römer 4,5) –, der hat sich selbst, so wie er ist, diesem Gott vorbehaltlos »anvertraut«. Wer an Jesus Christus als den für ihn gestorbenen und auferstandenen Herrn glaubt und sich fortan im Leben und Sterben von ihm her versteht und auf ihn bezogen leben will, der verlässt sich – in des Wortes doppelter Bedeutung – mit seiner ganzen Existenz auf ihn.
Die Beispielhaftigkeit des Glaubens Abrahams kann Paulus in Römer 4 gerade darin sehen, dass er Gott dessen Verheißung glaubte »auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war« – wörtlich übersetzt: »auf Hoffnung wider alle Hoffnung« (Römer 4,18). »Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste: Was Gott verheißt, das kann er auch tun« (Römer 4,20f).
Von hier aus wird deutlich, dass die zunächst skizzierten Aspekte des Glaubens erst von dieser Perspektive des persönlichen »Vertrauens« und »Zutrauens« her ihre wesentlichen Umrisse und ihre Eindeutigkeit gewinnen. Nur wenn der Glaube als vertrauender und sich anvertrauender Glaube – also als positive personale Beziehung – erfasst wird, erscheinen die Gesichtspunkte der Glaubenserkenntnis und des Glaubenswissens, des Anerkennens und der Zustimmung im rechten Licht. Denn sowohl ein Verständnis von »Glauben« allein als »Für-wahr-Halten« als auch die Betonung des »Glaubensgehorsams« und des »Auslebens« von Glaubensüberzeugungen könnten für sich genommen – wie wir aus der Frömmigkeitsgeschichte wissen – einerseits zu ganz unverbindlichen, andererseits zu ganz zwanghaften und lebensfeindlichen Formen von Religiosität führen.
GESCHENKWEISE – IM GLAUBEN
Selbst die Betonung dieses personalen und persönlichen Gesichtspunktes des Glaubens bewahrt allerdings noch nicht vor allen Missverständnissen. Wir sprechen in der Verkündigung und Seelsorge gerne davon, dass das Vertrauen zu Gott unsere »Antwort« auf Gottes »Wort« sei, dass wir nur den Willen aufzubringen und uns zu entscheiden hätten, ja, dass unser Glaube an Gott der eine Schritt sei, den wir nach Gottes vielen Schritten des Entgegenkommens nun unsererseits zu tun hätten. Wenn wir so sprechen, dann erfahren manche diese Form des Wechsels von den »Werken des Gesetzes« hin zu der Forderung nach »dankbarer Liebe« nicht etwa als Erleichterung, sondern als eine lediglich indirektere Form der religiösen Überforderung. Gesetzesforderungen kann man studieren und zu »guten Werken« kann man sich überwinden, aber wie bringt man sich selbst dazu, das Unglaubliche zu glauben und aus Notwendigkeit freiwillig zu lieben?
Stellt der Glaube dabei nicht doch eine neue, wenn auch feinsinnigere Form der »Leistungsforderung« und der »Vorbedingung« dar, die der Mensch nun seinerseits anstelle der »Gesetzeswerke« zu erfüllen hat? Richtig gesehen wird bei der Betonung der Notwendigkeit des Glaubens sicherlich, dass die Gemeinschaft mit Gott und das neue Leben in Christus im Neuen Testament durchgängig mit dem Glauben verbunden werden: Es gibt danach keine christliche Identität ohne Glauben!
Zutreffend ist auch, dass es der Mensch ist, der glaubt, denn der »Glaubensbegriff« wird als solcher in unserer Sprache nicht in Hinsicht auf Gottes Haltung der Welt gegenüber gebraucht. Gottes Haltung wird vielmehr mit Begriffen wie »Liebe«, »Erbarmen«, »Gerechtigkeit« und »Treue« umschrieben.12 Hingegen ist es unzutreffend, dass der »Glaube« bei Paulus als menschliche Möglichkeit oder als vom Menschen selbst zu erbringender eigenständiger Beitrag dargestellt wird. Ob es heißt, dass der rettende Freispruch »auf der Grundlage des Glaubens«13 empfangen wird, oder ob betont wird, dass das Heil »vermittels des Glaubens«, »durch den Glauben«14 erlangt wird – in jedem Fall versteht Paulus den Glauben nicht als Voraussetzung und Vorbedingung, die der Mensch von sich aus zu erfüllen hätte, um anschließend dafür das Heil zu erlangen. Vielmehr beschreibt er den Glauben als die Art und Weise, in der Gott dem Menschen schon gegenwärtig Anteil an seiner Gerechtigkeit gibt.
Der Mensch muss nicht zuerst glauben, damit Gott ihm infolgedessen das Leben schenkt, sondern indem der Mensch glaubt, hat er bereits das Leben. Der Glaube selbst ist schon Geschenk,15 denn er ist die gegenwärtige Gestalt der Gottesbeziehung. Der Glaube ist gerade nicht die vom Menschen zu erfüllende Vorbedingung und Kondition, sondern die Gestalt der gegenwärtigen Heilserfahrung. Die Gerechtigkeit wird dem Menschen nicht »wegen seines Glaubens«, sondern »durch den Glauben«, »in Gestalt des Glaubens« zugesprochen.16
Unter diesen Voraussetzungen wird es auch nachvollziehbar, dass der Apostel in der Auseinandersetzung mit der Position seiner judenchristlichen Gegner die Rechtfertigung im Glauben konsequent der göttlichen Gnade zuordnet17 und sie dem menschlichen »Verdienst« und »Anspruch« (Römer 4,4) oder dem menschlichen »Rühmen« (Römer 3,27)18 entgegensetzt. Er stellt sogar die durch Gottes Liebe im Glauben geschenkte Begnadigung dem faktisch gelebten Leben der Menschen überhaupt und grundsätzlich gegenüber!19 – »Denn es gibt keinen Unterschied: Alle haben sie gesündigt und entbehren der Herrlichkeit Gottes. Sie werden aber geschenkweise in seiner Gnade gerechtfertigt durch die Erlösung in Christus Jesus« (Römer 3,23f). Nur unter diesen Voraussetzungen wird verständlich, warum das Evangelium selbst schon als wirkmächtige Kraft Gottes erfahren wird20 und weshalb schon das Zustandekommen des Glaubens auf das Wirken des Geistes und der Kraft Gottes zurückgeführt wird21.
VON DER GEWISSHEIT DES GLAUBENS
Nur wenn der Glaube tatsächlich als Geschenk Gottes erkannt wird, gibt es auch Grund zu echter Zuversicht. Nur wenn das menschliche Vertrauen zu Gott als durch sein Wort erweckt und hervorgerufen verstanden wird,22 ist es auch möglich, feste Gewissheit im Glauben zu gewinnen. Der Glaube darf sich der Liebe und Zuwendung Gottes gewiss sein,23 denn er darf Gott »aufs Wort glauben«. Der Unterschied zwischen einer berechtigten und für den Glauben unentbehrlichen »Heilsgewissheit« und einer oft kritisierten unangemessenen »Heilssicherheit« liegt nach der paulinischen Darstellung der Rechtfertigung aus Gnaden nicht im Grad des Wissens und der Stärke der Überzeugung, sondern allein in deren Begründung und Voraussetzung.
Insofern die Gewissheit nicht im eigenen »Ergreifen«, sondern im »Ergriffensein« und »Gehaltenwerden« gründet (Philipper 3,12)24, nicht im »Erkennen«, sondern im »Erkannt-Sein«25, ist der Unterschied zwischen einer berechtigten »Gewissheit« und einer unberechtigten »Sicherheit« klar zu bestimmen: Es geht um den Gegensatz von in Gottes Zuspruch begründeter »Christusgewissheit « und in Überheblichkeit gründender »Selbstsicherheit«. Der Gläubige selbst kann seine eigene Treue nicht für alle Zeiten garantieren, er hat aber die Verheißung, dass Gott ihm – und sich selbst – in Christus immer treu bleiben wird. – »Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn« (Römer 8,38f).26
GLAUBENSSCHRITTE
Einer solchen Betonung der Liebe und Gnade Gottes bei Paulus – oder auch später bei den Reformatoren – wird häufig entgegengehalten: »Der Mensch hat aber doch den einen Schritt des Glaubens selbst zu gehen!« Die Antwort lautet: Er soll nicht nur einen, sondern sogar unzählige Schritte im Glauben gehen! Entscheidend ist aber, dass er keinen einzigen Schritt seines Lebens fortan allein und ohne Gott zu gehen braucht. Wir sollen wohl selbst Schritte des Glaubens machen, aber nicht isoliert und alleingelassen. Denn wäre es anders und der Mensch hätte den ersten – oder wenn man will: den letzten – Schritt des Glaubens von sich aus und allein zu machen, dann würde das neue Leben mit genau dem Problem erneut beginnen, von dem es den Menschen erlösen soll: der Unabhängigkeit von Gott.
Wir sollten uns in Verkündigung und Lehre davor hüten, die Unverzichtbarkeit des Glaubens auf eine Weise zu beschreiben, die andere nur auf die Unerreichbarkeit des Glaubens schließen lässt. Man kann den Vorgang des »Beschenktwerdens« auch so verkomplizieren, dass das Annehmen des »bedingungslosen« Geschenkes für den Empfänger zum eigentlichen Problem wird. Dann gewinnt der Beschenkte den Eindruck, als hätte er sich durch sein Verhalten die »voraussetzungslose« Zuwendung erst zu verdienen, als müsse er durch seine Haltung auf eine ganz hintersinnige Weise die Kosten für das »kostenlose« Geschenk selbst aufbringen.
»Ist damit aber der Mensch nicht zu völliger Passivität verurteilt?«, wird oft eingewandt. – Von »Passivität« im Glauben kann man wohl sprechen, wenn man den Aspekt des Empfangens und des Beschenktwerdens durch Gott betonen will. Der Glaubende weiß, dass er sein ganzes Leben der voraussetzungslosen Liebe Gottes verdankt, und lässt sich das Beschenktwerden durch Christus gefallen. Der Begriff der »Passivität« ist aber dann irreführend, wenn man damit den Gedanken an ein untätiges, duldendes und teilnahmsloses Verhalten verbindet. Der von Gottes Geist bewegte Mensch (Römer 8,14) wird im Gegensatz dazu gerade als zielstrebig, willensstark, belastbar, liebesfähig und lebensorientiert beschrieben27 – und in diesem Sinne dann wohl als ausgesprochen »aktiv«.
»Wie kann man denn dann den Glauben noch als freie Entscheidung verstehen, wenn der Mensch dazu von Gott überwunden werden muss?« – Der »freie Wille« des Menschen wird bei Paulus nicht als Vorbedingung, sondern – wenn man es überhaupt so nennen will – als Folge der Erlösung dargestellt. Im Unterschied zu mancher individualistischen Sicht des Menschen weiß die neutestamentliche »Lehre vom Menschen« um das Eingebunden- und Bestimmtsein des Menschen durch die ihn prägenden Einflüsse. Dass Paulus die »Freiheit« des Menschen nicht als Voraussetzung zum Glauben denkt, sondern vielmehr als dessen Konsequenz, macht er durch die Rede vom »Versklavtsein« und »Gefangensein« des Menschen unter der Herrschaft der lebensabträglichen Sünde anschaulich.28 Die Befreiung in Christus wird dementsprechend als Auslösung aus der Sklaverei und als Adoption zur Gotteskindschaft beschrieben.29 In Hinsicht auf die Töchter und Söhne Gottes spricht Paulus dann in der Tat von einer herrlichen Freiheit der Kinder Gottes (Römer 8,21) – nämlich der Freiheit innerhalb der erlösten und lebensfördernden Beziehung.
DIE UNVERGLEICHLICHKEIT DES GLAUBENS UND DIE GRENZE ALLER BILDER
»Wen soll man sich bei einem so konsequent durchgeführten Verständnis von Gottes Liebe und Gnade denn dann als Subjekt des Glaubens denken?« – In der Tat stoßen wir an diesem Punkt an die Grenze einer durch menschliche Analogien und Bilder bestimmten Argumentation. Durch den Vergleich mit einer Eltern-Kind-Beziehung30 oder mit einer partnerschaftlichen Liebe31 lassen sich die Momente einer positiven personalen Beziehung und einer bedingungslosen und umfassenden Zuwendung eindrücklich veranschaulichen. Die Grenze dieser bildhaften Rede liegt freilich darin, dass keines der angeführten menschlichen Beispiele wirklich die Ganzheitlichkeit und Umfänglichkeit der Gottesbeziehung illustrieren kann.
Denn Kinder sollen erwachsen werden, Schüler von ihren Lehrern unabhängig; und selbst – bzw. gerade – in einer partnerschaftlichen Liebe besteht das Ideal keineswegs in der Abhängigkeit und dem bleibenden Angewiesensein des einen Partners auf den andern. Insofern kann es hilfreich sein, Gott nicht nur in Analogien zu menschlichen Autoritäten wie Eltern und Lehrern zu denken, sondern sich darauf zu besinnen, dass er nach der biblischen Tradition als »Schöpfer« und »Bewahrer der Welt« zugleich in grundsätzlicher Unterschiedenheit von seinen »Geschöpfen« gedacht wird.
Gott wird nicht nur als ein »Lebender« unter anderen beschrieben, sondern als der Ursprung des Lebens und als das Leben selbst; er wird nicht nur als ein Liebender unter anderen erkannt, sondern als die Liebe in Person. Gott selbst ist die Liebe und das Leben.32 Ein Geschöpf kann durch die Zuordnung zu seinem Schöpfer nur gewinnen; und ein Lebender kann sich nichts mehr wünschen, als dass das Leben sich in ihm uneingeschränkt und dauerhaft entfaltet. Wer wäre zu stolz, sich von der Liebe überwältigen zu lassen, oder fühlte sich bevormundet, nur weil er auf das Leben bleibend angewiesen ist?
Im Kontext einer solchen – alle menschlichen Bilder überschreitenden – Rede von der Ganzheitlichkeit und Unbedingtheit der Gottesbeziehung lässt sich gedanklich nachvollziehen, warum Paulus davon sprechen kann, dass nicht er selbst Subjekt seines Glaubens ist, sondern letztlich der für ihn gestorbene und auferstandene Sohn Gottes und dass er gerade die Zuordnung zu dem ihn liebenden Christus als das Wesen seines christlichen Glaubens versteht. Wer nämlich an Christus glaubt, der »verlässt sich« mit seiner ganzen Existenz auf ihn.
»Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was aber nun mein Leben in der irdischen Existenz anbelangt, so lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat« (Galater 2,19-21).
GLAUBE UND ERFAHRUNG
Wenden wir diese Entfaltung des Glaubens nach Paulus – als eines leidenschaftlichen Zeugen des Glaubens – nun auf unsere Ausgangsfragen an, so kommen wir zu ganz grundlegenden – vielleicht auch überraschenden – Ergebnissen: Der Glaube macht Erfahrungen, aber er gründet nicht allein auf Erfahrungen. Der Glaube bezieht auch unsere Gefühlswelt mit ein, aber er basiert nicht auf Gefühlen. Unser Glaube will gelebt werden, aber er lebt nicht nur vom Erleben – er hat nicht, was er sieht, im Blick! Grundlage unseres Glaubens ist der Zuspruch Gottes. Verlassen können wir uns ausschließlich auf sein Wort – dass er unbedingt zu uns steht und dass er das vollenden wird, was er in uns begonnen hat. So gilt es, an Gottes Zusage festzuhalten, auch da, wo sie gegen alle Erfahrung steht, und sich an seine Verheißung zu klammern, auch wenn unsere Gefühle das Gegenteil behaupten. Es ist unsere Unerfahrenheit, die uns dazu verleitet, die eigene Erfahrung überzubewerten. Ein erfahrener Glaube weiß, dass er sich von Erfahrungen nicht abhängig machen darf.33
Noch grundlegender kann man sogar sagen: Der Glaube macht nicht nur Erfahrungen, der Glaube selbst ist schon eine Erfahrung. Denn der Glaube ist nicht die Voraussetzung, die wir von uns aus erfüllen müssen, um Gottes Wirken zu erleben, sondern die Art und Weise