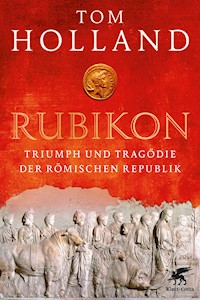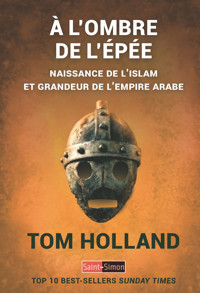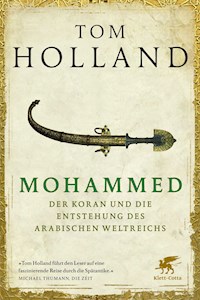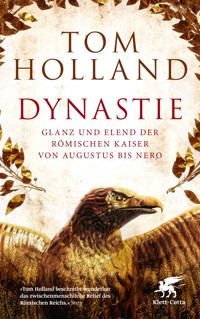
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Lebendig, spannend und dramatisch wie in einem Historienroman erzählt Tom Holland das Leben und Wirken der ersten römischen Kaiser. Ein großartiges und packendes Porträt der julisch-claudischen Dynastie, die die römische Welt grundlegend verwandelte. Aufstieg und Niedergang eines römischen Kaiserhauses: Blutige Hofintrigen, die große Politik, atemberaubende Bauprojekte, die großen Eroberungszüge, nächtelange Orgien und exotische Gladiatorenkämpfe – das ist die Bühne, auf der Kaiser agieren, ihre Macht etablieren und das Imperium nach dem Zusammenbruch der Republik neu ordnen. Glänzend entlarvt der Autor zugleich manche Klischees von dekadenten römischen Herrschern und weiß doch das »Menschlich-Allzumenschliche« der politischen Akteure meisterhaft in Szene zu setzen: Tiberius, der große Feldherr, der sich verbittert auf Capri zurückzog, berüchtigt für seine perversen Neigungen, Caligula, ein Meister der Grausamkeit und Provokation, der sein Pferd zum Konsul machte, Nero, der sich als Künstler sah, einen Eunuchen heiratete und einen gigantischen Palast im Zentrum Roms bauen ließ. Wie nie zuvor ist dieses Kapitel der Weltgeschichte zu einer atemberaubenden Erzählung verdichtet worden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 994
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
TOM
HOLLAND
DYNASTIE
GLANZ UND ELEND DER RÖMISCHEN KAISER VON AUGUSTUS BIS NERO
Aus dem Englischen von Susanne Held
Klett-Cotta
Aufstieg und Niedergang eines römischen Kaiserhauses: Blutige Hofintrigen, die große Politik, atemberaubende Bauprojekte, die großen Eroberungszüge, nächtelange Orgien und exotische Gladiatorenkämpfe – das ist die Bühne, auf der Kaiser agieren, ihre Macht etablieren und das Imperium nach dem Zusammenbruch der Republik neu ordnen. Glänzend entlarvt Tom Holland zugleich manche Klischees von dekadenten römischen Herrschern und weiß doch das »Menschlich-Allzumenschliche« der politischen Akteure meisterhaft in Szene zu setzen: Tiberius, der große Feldherr, der sich verbittert auf Capri zurückzog, berüchtigt für seine perversen Neigungen, Caligula, ein Meister der Grausamkeit und Provokation, der sein Pferd zum Konsul machte, Nero, der sich als Künstler sah, einen Eunuchen heiratete und einen gigantischen Palast im Zentrum Roms bauen ließ. Wie nie zuvor ist dieses Kapitel der Weltgeschichte zu einer atemberaubenden Erzählung verdichtet worden.
Tom Holland, geboren 1968, studierte in Cambridge und Oxford Geschichte und Literaturwissenschaft. Er ist Bestsellerautor für Fiction und Historisches Buch. 2004 erhielt er den »Hessel-Tiltman Prize for History« für »Rubicon« und 2006 den »Runciman Award« der Anglo-Hellenic League für sein Buch »Persisches Feuer« (jeweils erschienen bei Klett-Cotta). Im Frühjahr 2024 wurde »PAX«, der abschließende dritte Band seiner meisterhaften Rom-Trilogie, veröffentlicht.
Impressum
Hinweis für die Leser: Um die Lektüre und das Verständnis der Dynastie von Augustus bis Nero zu erleichtern, sei an dieser Stelle auf den Stammbaum der Julier und Claudier, auf die Zeittafel und die Dramatis Personae im Anhang verwiesen.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Dynasty: The Rise and Fall of the House of Caesar«
im Verlag Little, Brown Book Group, London 2015
© 2015 by Tom Holland
Für die deutsche Ausgabe
© 2016, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung der Originalillustration von Gareth Blayney. Römische Goldmünze: © akg-images/Bible Land Pictures/Z. Radovan/BibleLandPictures.com
Datenkonvertierung: Eberl & Koesel Studio, Kempten
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98767-6
E-Book: ISBN 978-3-608-10032-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
VORWORT
Teil I
PADRONE
1
WOLFSKINDER
Zeugung einer Supermacht
Das Große Spiel
Hoffnung auf einen Helden
2
ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
»Der Strom der menschlichen Geschäfte wechselt«
Römischer Frühling
Die höchsten Spolien
The Godfather
3
DIE ERSCHÖPFUNG DER GRAUSAMKEIT
Back to the Basics
Familienstammbäume
Ars amandi – Die Liebeskunst
Herz der Finsternis
Cherchez la femme
Teil II
COSA NOSTRA
4
DER LETZTE RÖMER
Den Wolf bei den Ohren packen
Der Prinz des Volkes
Il Consigliere
Caprice
5
SOLLEN SIE MICH DOCH HASSEN
It’s Showtime
Den Scherz zu weit getrieben
6
IO SATURNALIA! – EIN HOCH AUF DIE SATURNALIEN!
Der Herr des Hauses
Brot und Britannier
Kabale und Liebe
7
WELCH EIN KÜNSTLER!
Mamma Mia
Die ganze Welt ist meine Bühne
Die Verbrämung der Finsternis
Der Showdown
ANHANG
Zeittafel
Dramatis Personae
Anmerkungen
Vorwort
1 Wolfskinder
2 Zurück in die Zukunft
3 Die Erschöpfung der Grausamkeit
4 Der letzte Römer
5 Sollen sie mich doch hassen
6 Io Saturnalia!
7 Welch ein Künstler!
Liste der Karten
Bibliographie
Danksagungen
Personen- und Sachregister
Für Katy
»at simul heroum laudes et facta parentis iam legere . . .«
»Wenn du aber den Ruhm der Heroen und deines Vaters Taten nun lesen kannst . . .«
Vergil, Eklogen 4,26 – 27
VORWORT
40 n. Chr. Das Jahr ist noch jung. Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus(1) sitzt auf einem hohen Podest am Meeresufer. Die Wellen branden gegen die Küste, Gischt erfüllt die Luft. Der Kaiser blickt hinaus aufs Meer. Zahlreiche römische Schiffe sind im Lauf der Jahre hier untergegangen. In den grauen Wassern, so heißt es, lauern fürchterliche Meeresmonster, und hinter dem Horizont liegt eine Insel, auf der es von wilden, schnauzbärtigen Kopfjägern – den Britanniern – nur so wimmelt. Gefahren wie diese, die an den Rändern der zivilisierten Welt dräuen, stellen selbst noch für den kühnsten, entschlossensten Helden eine Herausforderung dar.
Doch die Geschichte des römischen Volkes war schon seit je von einer Aura des Sagenhaften umgeben. Die Römer arbeiteten sich aus verschwommener, provinzieller Dunkelheit zu Weltherrschern empor: eine in der Geschichte einzigartige Leistung. Aus sämtlichen Gefahren und Herausforderungen ging Rom(1) siegreich hervor und war so für die Weltherrschaft gut gewappnet. Und nun, 792 Jahre nach der Gründung Roms, verfügt der Mann, der als Kaiser über dieses Reich herrscht, über eine Machtfülle, die derjenigen eines Gottes gleichkommt. Hinter ihm an diesem nördlichen Strand ist Reihe an Reihe die beste Streitmacht des Planeten aufgestellt: geharnischte Legionäre, Katapulte, Geschütze. Kaiser Gaius lässt seinen Blick über die Menge schweifen. Er erteilt einen Befehl, Fanfaren erschallen. Das Signal für den Kampf. Dann Schweigen. Der Kaiser hebt an zu sprechen. »Soldaten!«, ruft er. »Ich befehle euch, Muscheln aufzulesen. Füllt eure Helme und Kleider mit den Beutestücken des Ozeans.«[1] Und die Legionäre gehorchen dem Befehl ihres Kaisers und fangen an, Muscheln zu sammeln.
So jedenfalls wird es erzählt. Aber stimmt das? Lasen die Soldaten tatsächlich Muscheln auf? Und wenn ja – aus welchem Grund? Die Episode ist eine der bekanntesten im Leben eines Mannes, dessen gesamte Laufbahn bis heute als Ausbund an Schändlichkeit gilt. Caligula(1), der Name, unter dem man Kaiser Gaius eher kennt, ist eine der wenigen Personen aus der Antike, die unter Pornographen ebenso bekannt ist wie unter Historikern. Die skandalösen Einzelheiten seiner Regierungszeit haben seit je lüsterne Faszination erregt. »So viel vom Kaiser Caligula – im Folgenden haben wir vom Scheusal zu sprechen.«[2] Das schrieb Gaius Suetonius(1) Tranquillus, kurz Sueton(1), ein Gelehrter und Archivar im kaiserlichen Palast, der sich in seiner Freizeit als Biograph der Caesaren(1) betätigte. Er verfasste die älteste heute noch existierende Vita des Caligula. Der Text entstand fast ein Jahrhundert nach dem Tod des Kaisers, und er listet ein wahrhaft sensationelles Aufgebot an Untaten und Perversionen auf. Er schlief mit seinen Schwestern! Er trat als Göttin Venus(1) auf! Er hatte die Absicht, die höchste Magistratur(1) Roms seinem Pferd zu verleihen! Vor dem Hintergrund solch abgründiger Schrulligkeiten verliert Caligulas Benehmen an der Kanalküste einen Gutteil seines Verblüffungspotentials. Sueton war jedenfalls um eine Erklärung für das Verhalten des Kaisers nicht verlegen: »Er war sowohl körperlich als auch seelisch krank.«[3]
Aber wenn Caligula(2) krank war, dann galt das für Rom(2) genauso. Die unumschränkte Macht über Leben und Tod, über die ein Kaiser gebot, wäre für frühere Generationen unvorstellbar gewesen. Fast ein Jahrhundert, bevor Caligula seine Legionen am Ufer des Ärmelkanals Stellung beziehen ließ und nach Britannien hinüberspähte, hatte sein Ururururgroßonkel Gaius Julius Caesar, besser bekannt als Julius Caesar, dasselbe getan – und den Ärmelkanal dann auch tatsächlich überquert. Die Leistungen des Julius Caesar(1) waren spektakulärer als fast sämtliche Taten in der Geschichte seiner Stadt: Nicht genug damit, dass er zwei Mal in Britannien einmarschiert war, er hatte darüber hinaus auch Gallien, wie die Römer das heutige Frankreich nannten, auf Dauer annektiert. Allerdings hatte er als Bürger(1) einer Republik(1) gehandelt, einer Staatsform also, in der es schon fast als selbstverständlich galt, dass die einzige Alternative zur Freiheit der Tod ist. Als Julius Caesar(2) diese Vorstellung einfach in Grund und Boden stampfte und Anspruch auf die Herrschaft über seine Mitbürger(2) erhob, resultierte daraus erst ein Bürgerkrieg(1); und später, nachdem er seine internen Feinde ebenso vernichtet hatte wie zuvor die Gallier, Caesars(3) Ermordung. Erst nach zwei weiteren mörderischen Phasen, in denen sich die Römer gegenseitig abschlachteten, konnte das Volk endlich befriedet werden. Die Unterwerfung unter die Herrschaft eines einzigen Mannes hatte ihre Stadt und das von Rom beherrschte Reich vor der Selbstzerstörung gerettet – doch war die Kur ihrerseits eine Art Krankheit.
Augustus(1) hatte sich ihr neuer Herr genannt, »Der göttlich Erhabene«. Der Großneffe von Julius Caesar(4) war durch Blut gewatet, um die Herrschaft über Rom(3) und das gesamte von Rom beherrschte Imperium zu erringen – und dann, nachdem er sich seiner Rivalen entledigt hatte, posierte er unverfroren als Friedensfürst. Augustus(2) war ebenso clever wie skrupellos und ebenso geduldig wie entscheidungsfreudig. So schaffte er es, seine Vormachtstellung über Jahrzehnte hinweg zu behaupten und schließlich in seinem Bett zu sterben. Entscheidend dafür war seine Fähigkeit, mehr in Übereinstimmung mit den römischen Traditionen zu herrschen als in Absetzung von ihnen: Indem er nämlich vorgab, kein Alleinherrscher zu sein, ermöglichte er seinen Mitbürgern(3), sich vorzumachen, dass sie nach wie vor frei waren. Ein Schleier flirrender, raffinierter Subtilität war über die brutalen Umrisse seiner Dominanz gebreitet. Mit der Zeit wurde dieser Schleier allerdings zunehmend fadenscheinig. Beim Tod des Augustus(3) im Jahr 14 n. Chr. trat klar zutage, dass die Befugnisse, die er im Lauf seiner langen, verlogenen Laufbahn angehäuft hatte, durchaus keine zeitlich begrenzten, sich aus Sachzwängen ergebenden Maßnahmen gewesen waren, dass sie vielmehr Werkzeuge der Macht waren, die nach einem Erben verlangten. Augustus(4) wählte als Nachfolger einen Mann, der von Kindesbeinen an in seinem Haus gelebt hatte, einen Aristokraten namens Tiberius(1). Die zahlreichen Qualitäten des neuen Caesar – ein mustergültiger aristokratischer Stammbaum, eine Erfolgsgeschichte als Roms bester Feldherr – hatten eine geringere Rolle gespielt als der Umstand, dass er der adoptierte(1) Sohn des Augustus(5) war – und das war auch allen klar.
Tiberius(2), der sein Leben lang mit den Tugenden der verschwundenen Republik(2) verheiratet(1) blieb, war ein unglücklicher Monarch(1) gewesen; Caligula(3) hingegen, der ihm nach 23 Jahren als Herrscher nachfolgte, fühlte sich überhaupt nicht angefochten. Dass er die römische Welt weder aufgrund seines Alters noch seiner Erfahrungen, sondern lediglich als Urenkel des Augustus(6) regierte, störte ihn nicht im Geringsten. »Die Natur schuf ihn, so meine ich, um zu zeigen, wie weit grenzenloses Laster in Verbindung mit grenzenloser Macht gehen kann.«[4] Die Worte stammen aus dem Nachruf, den der Philosoph Seneca(1), der Caligula gut kannte, über ihn verfasst hat. Das Urteil beschränkte sich allerdings nicht auf Caligula, sondern schloss auch Senecas Standesgenossen mit ein, die kriecherisch vor dem Kaiser gebuckelt hatten, und auf das römische Volk insgesamt. Es war ein verkommenes Zeitalter: krank, lasterhaft, würdelos.
Jedenfalls sahen es viele so. Aber nicht jeder konnte dem zustimmen. Das von Augustus(7) begründete Herrschaftssystem hätte keinen Bestand haben können, wenn es dem römischen Volk nicht das geschenkt hätte, wonach es nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs(2) so sehnlichst verlangte: Frieden und Ordnung. Die zahlreichen von Rom(4) regierten Provinzen(1), die sich von der Nordsee bis zur Sahara, vom Atlantik bis zum Fruchtbaren Halbmond in Vorderasien erstreckten, profitierten ja auch durchaus vom Regime der Kaiser. Drei Jahrhunderte später, als klar wurde, dass während der Herrschaft des Augustus bereits ein anderer berühmter Herrscher geboren worden war, vermochte ein Bischof namens Eusebius(1) in den Leistungen der Kaiser die lenkende Hand von Gott(1) selbst zu sehen. »Es war nicht lediglich die Folge menschlichen Handelns«, so Eusebius, »dass der größte Teil der Welt genau zu dem Zeitpunkt unter römischer Herrschaft befriedet wurde, als Jesus(1) zur Welt kam. Dass unser Herr und Heiland seine Mission ausgerechnet vor diesem Hintergrund zu erfüllen begann, ging zweifellos auf göttliches Wirken zurück. Denn wenn die Welt sich noch im Kriegszustand befunden hätte und nicht unter einer einzigen Regierung vereint gewesen wäre – wie viel schwieriger wäre es dann für die Apostel gewesen, das ganze Gebiet des Imperiums zu durchziehen und das Evangelium zu predigen.«[5]
Eusebius(2) vermochte aus der zeitlichen Distanz heraus zu erkennen, wie erstaunlich die von Augustus(8) und seinen Nachfolgern erbrachte Globalisierungsleistung gewesen war. Zwar wurde mit brutalen Methoden vorgegangen, doch die Ausdehnung der von römischen Waffen befriedeten Regionen war völlig beispiellos. Ein altes Sprichwort lautete: »Ein Geschenk annehmen heißt seine Freiheit verkaufen.« Rom(5) zog Steuern(1) von den eroberten Provinzen(2) ein, doch der im Gegenzug garantierte Friede war nicht unbedingt zu verachten. Ob in den Außenbezirken der Hauptstadt selbst, die unter den Caesaren(2) zur größten Stadt wurde, die die Welt je gesehen hatte, oder im Mittelmeerraum, der erstmals unter einer einzigen Macht vereint war, oder an den äußersten Enden eines Reichs, dessen Ausdehnung alles bisher Dagewesene übertraf – die Pax Romana war für Millionen Menschen ein Segen. Die Bewohner der Provinzen hatten allen Grund, dankbar zu sein. »Er(5) säuberte das Meer von Piraten und füllte es mit Handelsschiffen.« Das schrieb ein begeisterter Jude(1) aus Alexandria, der bedeutenden ägyptischen Metropole, in einer Lobschrift auf (9)Augustus. »Er brachte jeder Stadt Freiheit, führte Ordnung ein, wo zuvor Chaos geherrscht hatte, und zivilisierte wilde Völker.«[6] Ähnliche Lobeshymnen hätte man an Tiberius(3) und Caligula(4) richten können, was auch tatsächlich geschah. Die Verworfenheit, für die beide Männer später so verschrien waren, hatte auf die Welt insgesamt so gut wie keinen Einfluss. In den Provinzen spielte es kaum eine Rolle, wer als Kaiser herrschte – solange nur das Zentrum stabil blieb.
Dennoch war der Caesar(3) selbst in den entferntesten Regionen des Imperiums ständig präsent. Wie konnte es anders sein? »Nichts auf dieser Welt entzieht sich seinem wachsamen Auge.«[7] Das war natürlich eine Übertreibung, brachte aber zugleich jene Mischung aus Furcht und Ehrfurcht zum Ausdruck, die ein Kaiser bei seinen Untertanen unweigerlich hervorrief. Er allein hatte die Kontrolle über das Gewaltmonopol Roms: über die Legionen ebenso wie über den gesamten bedrohlichen Apparat der Statthalterschaften in den Provinzen(3), die sicherstellten, dass Steuern(2) gezahlt, Aufrührer abgeschlachtet und Übeltäter wilden Tieren vorgeworfen oder ans Kreuz geschlagen wurden. Um die Furcht vor seiner schrankenlosen Macht auf der ganzen Welt zu verbreiten, musste ein Kaiser gar nicht überall selbst seine Hand im Spiel haben. Es genügte, auf subtilere Weise Präsenz zu zeigen. Kein Wunder also, dass Caesars(6) Antlitz für Millionen seiner Untertanen zum Gesicht Roms wurde. Kaum eine Stadt, die nicht stolz mit einem Kaiserbildnis aufwarten konnte: sei es mit einer Statue, einer Porträtbüste oder einem Fries. Und selbst in der hintersten Provinz war Caesars(4) Profil jedem vertraut, der mit Geld umging. Dabei war es vormals gar nicht üblich gewesen, einen noch lebenden Römer auf Münzen(1) abzubilden.1 Sobald (10)Augustus jedoch die Weltherrschaft errungen hatte, tauchte sein Konterfei überall auf den Münzen(2) auf, ob aus Gold, Silber oder Bronze. »Wessen Bild und Aufschrift ist das?« Selbst ein Wanderprediger in den unzivilisierten Gebieten Galiläas, der eine Münze(3) hochhielt und die Frage stellte, wessen Gesicht darauf abgebildet war, konnte sicher sein, die Antwort »Des Kaisers« zu erhalten.[8]
Nicht umsonst waren der Charakter eines Kaisers, seine Leistungen, seine Beziehungen, seine Eigenheiten und Schwächen für seine Untertanen Gegenstand höchster Faszination. »Euer Schicksal ist es, zu leben wie auf einer Bühne, und Euer Publikum ist die ganze Welt.«[9] So lautete die Warnung, die ein römischer Historiker dem Maecenas(1) zuschrieb, einem Mann, dem Augustus(11) besonders vertraute. Ob dieser Satz tatsächlich von Maecenas stammt, sei dahingestellt – jedenfalls macht er deutlich, in welchem Maße das Auftreten seines Herrn von Theatralik geprägt war. Augustus(12) selbst soll, so berichtet Sueton(2), seine Freunde auf dem Sterbebett gefragt haben, ob er die Komödie des Lebens bis zum Ende gut gespielt habe; und nachdem ihm das bestätigt wurde, bat er nun, da er von der Bühne abtrat – um ihren Beifall. Ein guter Kaiser hatte keine andere Wahl, als auch ein guter Schauspieler zu sein – und das galt auch für alle anderen, die in dem Drama mitwirkten. Caesar(5) stand ja nie allein auf der Bühne. Seine potentiellen Nachfolger waren allein deshalb Figuren des öffentlichen Interesses, weil sie mit ihm verwandt waren. Selbst die Ehefrau, die Nichte oder die Enkelin eines Kaisers hatte die ihr zugedachte Rolle zu spielen. Wenn ihr das nicht gelang, musste sie einen schrecklichen Preis bezahlen, aber wenn sie es gut machte, konnte es sein, dass ihr Gesicht am Ende neben dem des Kaisers auf Münzen(4) erschien. Nie zuvor in der Geschichte hatte eine Familie so stark im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden wie diejenige des (13)Augustus. Die Moden und Frisuren ihrer bedeutendsten Mitglieder wurden in allen Einzelheiten von den Bildhauern im gesamten Imperium reproduziert und gaben von Syrien bis Spanien Trends vor. Ihre Taten wurden mit spektakulären, prunkvollen Denkmälern gefeiert, ihre Skandale eifrig von Hafen zu Hafen weitererzählt. Propaganda und Klatsch schaukelten sich gegenseitig hoch und verliehen der Dynastie des (14)Augustus eine Berühmtheit, die erstmals in der Geschichte der Menschheit Kontinente überspannte.
Aber inwieweit entsprachen die in protzigen Marmor gehauenen Ruhmestaten und die Gerüchte, die auf Marktplätzen und in Kneipen hinter vorgehaltener Hand weitererzählt wurden, dem, was im Palast des Caesar(6) tatsächlich geschah? Als Sueton(3) seine Kaiserviten verfasste, konnte er sich über einen Mangel an verfügbarem Material nicht beklagen: Es reichte von offiziellen Inschriften bis hin zu verworrenem Klatsch. Wer jedoch tiefer schürfte und verstehen wollte, was Augustus(15) und seine Nachfolger tatsächlich umtrieb, stieß im Herzen der Geschichte dieser Dynastie auf eine Finsternis, die aller Bemühungen spottete und sich ihnen widersetzte. In den Tagen der Republik(3) wurden die Angelegenheiten des Staates noch öffentlich debattiert, und die Ansprachen von Roms führenden Politikern wurden schriftlich festgehalten, auf dass sie von den Historikern studiert werden konnten. Aber das änderte sich mit der Machtübernahme des Augustus(16) grundlegend. Denn »von nun an geschah das Meiste im Verborgenen, ohne dass darüber noch offen gesprochen wurde«.[10] Die alten Rhythmen des politischen Jahres, der jährliche Zyklus von Wahlen und Magistraturen(2), der einst, in den Tagen der Republik, ehrgeizigen Römern eine echte Möglichkeit geboten hatte, das Schicksal ihrer Stadt zu beeinflussen, war zwar beibehalten worden, verkam aber zu einem unbedeutenden Nebenschauplatz. Das Schaltzentrum der Macht lag nun woanders. Die Regierungsgeschäfte spielten sich nicht mehr in den Versammlungen der Großen und Guten ab, sondern in Privatgemächern. Worte, die eine Frau einem Kaiser ins Ohr flüsterte, oder ein Dokument, das ihm heimlich von einem Sklaven(1) zugeschoben wurde: Beides vermochte größeren Einfluss auszuüben als die eindringlichste öffentliche Ansprache. Was das für die Biographen der Caesaren(7) bedeutete, war ebenso betrüblich wie unausweichlich: »So unsicher bleibt gerade das Wichtigste, da die einen das, was sie irgendwo gehört haben, für sicher halten, die anderen aber das, was wahr ist, ins Gegenteil verkehren, und beides dann im Laufe der Zeit an Glauben gewinnt.«[11]
Der Geschichtsschreiber, aus dessen Feder diese Warnung stammt, war ein Zeitgenosse Suetons(4), im Gegensatz zu ihm aber auch ein begnadeter Pathologe der Autokratie – möglicherweise der größte, der je gelebt hat. Cornelius Tacitus(1) konnte sich auf genaue Kenntnis der Funktionsmechanismen Roms und seines Imperiums stützen. Im Laufe seiner glänzenden Karriere brachte er es als Gerichtsredner zu Ansehen, diente als Statthalter in den Provinzen(4) und bekleidete die höchsten Ämter, die ein Bürger(4) anstreben konnte. Allerdings legte er dabei einen ebenso schlauen wie unrühmlichen Überlebensinstinkt an den Tag. Die Dynastie, die in Rom(6) herrschte, als Tacitus das Erwachsenenalter erreichte, war nicht mehr die des (17)Augustus – diese war im Jahr 68 n. Chr. mit Neros Tod in einer Woge von Blut untergegangen –, stand der alten jedoch an mörderischem Potential in nichts nach. Statt seine Einstellung öffentlich kundzutun, beschloss Tacitus, den Kopf einzuziehen und wegzuschauen. Doch die Unterlassungssünden, derer er sich mitschuldig fühlte, lasteten offenbar schwer auf seinem Gewissen. Je mehr Abstand er zum öffentlichen Leben gewann, desto zwanghafter bemühte er sich darum, die Niederungen des Regierungssystems auszuloten, unter dem er leben musste, und seine Entwicklung nachzuvollziehen. Zunächst berichtete er von den Ereignissen, die sich seit seiner Jugend abgespielt hatten; dann, in seinem letzten, bedeutendsten Werk, einer historischen Abhandlung, die seit dem 16. Jahrhundert als die Annalen bezeichnet wird, wandte er seinen Blick zurück auf die Dynastie des (18)Augustus. Tacitus beschloss, Augustus(19) und dessen verhängnisvolle Vormachtstellung auf indirekte Weise zu analysieren, indem er sich nicht auf den Mann selbst, sondern vielmehr auf dessen Nachfolger konzentrierte. Vier Caesaren(8) rückten daher nacheinander in das Zentrum der Aufmerksamkeit: zuerst Tiberius(4), dann Caligula(5), dann Caligulas Onkel Claudius(1), und schließlich, als letzter Herrscher aus dieser Dynastie, Nero(1), der Ururenkel des (20)Augustus. Sein Tod war das Ende des gesamten Geschlechts. Wieder und wieder hatte sich die Zugehörigkeit zur kaiserlichen Familie als tödlich erwiesen. Im Jahr 68 war nicht ein einziger Nachfahr des (21)Augustus mehr am Leben. So sah das Gesetz der Geschichte aus, die Tacitus erzählen musste.
Aber es ging um mehr als nur um den Inhalt der Geschichte: Die eigentliche Herausforderung bestand darin, sie überhaupt zu erzählen. Mit ätzender Schärfe formuliert Tacitus(2) im ersten Abschnitt der Annalen das Problem: »Die Geschichte des Tiberius(5), Gaius, Claudius(2) und Neros(2) ist zu deren Lebzeiten aus Furcht in falschem Licht geschildert worden, und nach ihrem Ableben erzählte man sie unter dem Einfluss von schwelender Verbitterung im Lichte der Gehässigkeit.«[12] Hier war sorgfältigste Recherche und die Objektivität des Wissenschaftlers gefordert. Bei seiner Analyse der offiziellen Aufzeichnungen aus der Regierungszeit der einzelnen Kaiser ging Tacitus äußerst gewissenhaft vor, achtete aber zugleich darauf, diese Zeugnisse nie für bare Münze zu nehmen.2 Unter den Caesaren(9) waren Worte zu einer heimtückischen, schwer fassbaren Angelegenheit geworden, bei der man leicht ins Schlingern geriet. »In Wahrheit waren jene Zeiten durch Schmeichelei vergiftet und entwürdigt.«[13] Dieses kalt-trostlose Urteil, das ja auf persönlicher Erfahrung beruhte, hatte zur Folge, dass die bittere Skepsis des Tacitus letztlich alles zersetzte, womit er in Berührung kam. In den Annalen ist jeder Caesar(10), der behauptet, einzig und allein den Interessen des römischen Volkes zu dienen, ein Heuchler; jeder Versuch, den Traditionen der Stadt treu zu bleiben, ist nur Lug und Trug; jede schön klingende Empfindung eine Lüge. Roms Geschichte wird als terrorgeschüttelter, blutgetränkter Alptraum dargestellt, aus dem es für die Bürger(5) kein Erwachen gab. Es ist das Portrait einer Despotie, in dem sich viele spätere Generationen, die erleben mussten, wie ihre eigenen Freiheiten schwanden, unmittelbar wiedererkannten. Wo auch immer eine Tyrannei auf die Ruinen eines zuvor bestehenden freien Regierungssystems gepflanzt wurde, und wann immer fadenscheinige Parolen benutzt wurden, um staatlich sanktionierte Verbrechen zu maskieren, wurde die Erinnerung daran lebendig. Bis heute ist die augusteische Dynastie ein Sinnbild für despotische Machtausübung.
Kein Wunder also, dass sie noch immer in der Vorstellung der Menschen herumgeistert. Wer an das Rom(7) der Kaiserzeit denkt, dem kommt vermutlich die Stadt der ersten Caesaren(11) in den Sinn. Kein anderes Zeitalter der Antike kann mit einer derart verstörenden und zugleich faszinierenden Galerie illustrer Charaktere aufwarten. Ihr greller Zauber hat sie zu Archetypen sich bekämpfender, mörderischer Dynasten gemacht. Ungeheuer, wie sie uns bei Tacitus(3) und Sueton(5) begegnen, scheinen Fantasy-Romanen und -Fernsehserien entsprungen zu sein: Tiberius(6), düster und paranoid, der die Angewohnheit hatte, sich im Swimmingpool von kleinen Jungen die Hoden lecken zu lassen; Caligula(6), der bedauerte, nicht dem gesamten römischen Volk mit einem einzigen Hieb den Nacken durchhauen zu können; Agrippina die Jüngere(1), die Mutter Neros, die alle Mittel einsetzte, um ihren Sohn, der sie dann später umbrachte, an die Macht zu bringen; und Nero(3) selbst, der seine schwangere Frau mit Fußtritten tötete, einen Eunuchen(1) heiratete(2) und einen Vergnügungspalast im Zentrum Roms errichtete, für den zuvor durch einen Großbrand Platz geschaffen worden war. All jenen, die Storys erfinden und sie durch Gift und exotisch-krasse Perversionen aufpeppen wollen, bietet die Geschichte der Caesaren(12) praktisch alles. Mörderische Matriarchinnen, inzestuöse Powerpaare, geknechtete Beta-Männchen, denen letztlich dann doch eine Machtposition zufällt, von der aus sie über Leben und Tod entscheiden können: All diese Motive aus gegenwärtig beliebten Fernsehserien finden sich in den historischen Quellen jener Zeit. Mehr als jede andere vergleichbare Dynastie sind und bleiben die ersten Caesaren(13) ein Begriff. Die Faszination, die von ihnen ausgeht, ist ungebrochen.
Für Historiker, die auf diese Epoche spezialisiert sind, bringt das alles zweifellos auch eine gewisse Verlegenheit mit sich. Gerade weil sie so melodramatisch sind, haben Geschichten von Gift und Sittenlosigkeit die Tendenz, Wissenschaftlern Unbehagen zu bereiten. Je sensationeller eine Geschichte ist, desto weniger plausibel wirkt sie auch. Ob die Behauptungen über die Julio-Claudier(1)(1) – wie die Dynastie des Augustus(22) üblicherweise in der Geschichtswissenschaft genannt wird – tatsächlich zutreffen, wurde aus diesem Grund auch immer wieder bezweifelt. War Caligula(7) wirklich so wahnsinnig, wie Sueton(6) und andere antike Autoren behaupten? Vielleicht erscheinen seine extravaganten Aktionen nur deshalb so verrückt, weil sie im Laufe ihrer Überlieferung verzerrt wurden? Wäre es beispielsweise nicht denkbar, dass es für seinen scheinbar irrsinnigen Befehl, Muscheln zu sammeln, eine absolut nachvollziehbare, rationale Erklärung gab? Viele Fachleute haben etwas in dieser Richtung vorgeschlagen, und im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Theorien aufgestellt. Vielleicht hatte es eine Meuterei gegeben (nicht dass irgendeine Quelle etwas dergleichen erwähnen würde), und Caligula wollte seine Soldaten bestrafen, indem er ihnen einen erniedrigenden Auftrag erteilte? Oder vielleicht wollte er, dass sie nach Perlen suchten, und wenn sie keine fanden, nach Muscheln, die er dann als Schmuckelement in Wasserspielen verwenden konnte? Oder vielleicht wollte Caligula mit concha, dem lateinischen Wort für »Muschel«, etwas ganz anderes bezeichnen: eine Art Boot, oder womöglich sogar die Geschlechtsteile einer Hure(1)? Keine dieser Hypothesen ist gänzlich auszuschließen; keine ist definitiv belegbar. Wie ein lebhafter Traum scheint die Episode von einer abgründigen Logik durchwirkt zu sein, von einer Bedeutung, welche sich all unseren Bemühungen, sie zu verstehen, letztlich immer wieder entzieht. Aber gerade in der Alten Geschichte müssen wir uns manchmal damit abfinden, dass es Dinge gibt, die wir nie mit letzter Sicherheit verstehen werden.
Das muss kein Grund zur Verzweiflung sein. Bekannte Unbekannte sind für denjenigen, der sich mit den ersten Caesaren(14) befasst, keineswegs wertlos. Die Frage, was Caligula(8) an jenem gallischen Strand tatsächlich umgetrieben hat, wird nie endgültig beantwortet werden können, aber eines wissen wir immerhin sicher: Römische Historiker waren der Ansicht, diese Episode bedürfe keiner besonderen Erklärung. Für sie war ausgemacht, dass der Befehl, Muscheln zu sammeln, typisch war für einen bösen, verrückten Kaiser. Die Geschichten, die über Caligula erzählt wurden – dass er die Götter(2) beleidigte, dass Grausamkeit ihm Vergnügen bereitete, dass er sich in allen möglichen sexuellen(1) Perversionen erging –, betrafen ja nicht nur ihn. Vielmehr waren sie Teil einer allgemeinen Gerüchteküche, in der es immer besonders heftig brodelte, wenn ein Caesar(15) gegen die Gepflogenheiten seiner Zeit verstieß. »Lassen wir solche Missgestalten im Abgrund ihrer Schande liegen«:[14] Diese grimmige Ermahnung, vorgebracht von einem Mann, der während der Regierungszeit des Tiberius(7) eine Sammlung von Exempla – Lehrstücke über mehr oder weniger vorbildliche Personen und Taten – verfasste, stieß bei den meisten seiner Mitbürger(6) auf taube Ohren. Dafür hatten sie viel zu viel Freude an Klatschgeschichten. Die Anekdoten, die über die kaiserliche Dynastie im Umlauf sind, spiegeln die tiefsten Vorurteile und Ängste derer wider, die sie weitererzählten, und sie versetzen uns mitten hinein in die römische Seele. Daher darf sich eine Untersuchung der augusteischen Dynastie nie auf deren Mitglieder beschränken, sondern muss immer auch das römische Volk mit einbeziehen.
Eine erzählende Darstellung der gesamten julisch-claudischen(2) Ära eröffnet somit am ehesten einen Mittelweg zwischen Skylla(1) und Charybdis(1), zwischen passiver Gutgläubigkeit und einem allzu muskelbepackten Skeptizismus. Natürlich sollte man nicht alle Geschichten glauben, die über die ersten Caesaren(16) erzählt werden. Andererseits bieten uns viele Geschichten einen Zugang zu dem, was sie sehr wahrscheinlich inspirierte. Anekdoten, die für sich genommen völlig verstiegen wirken, ergeben im Kontext einer Erzählung häufig Sinn. Die Evolution der Autokratie in Rom(8) war ein langwieriger, von vielen Zufällen beeinflusster Prozess. Augustus(23) wird zwar von Historikern als erster Kaiser der Stadt eingestuft, doch er wurde nie offiziell als Monarch(2) eingesetzt. Stattdessen herrschte er aufgrund von Rechten und Ehren, die ihm Stück für Stück zuerkannt wurden. Nie gab es ein offizielles Verfahren zur Regelung der Nachfolge, und aus diesem Grund blieb jedem Kaiser, wenn er an die Macht kam, kaum etwas anderes übrig, als die Grenzen seines Handlungsspielraums auszutesten. Infolgedessen stellt die Herrschaft der Julio-Claudier(2) auch einen langen, fortwährenden Prozess des Experimentierens dar. Daher habe ich beschlossen, in diesem Buch die gesamte Geschichte der Dynastie nachzuzeichnen, von ihrer Gründung bis zu ihrem blutigen Ende. Die Regentschaft der einzelnen Kaiser sollte nicht isoliert betrachtet werden; sie erschließt sich einem erst im Zusammenhang mit den Ereignissen, die ihr vorausgingen, und denen, die ihr folgten.
Und das gilt umso mehr, als die Untersuchung jener Zeit – der Alten Geschichte an sich – mitunter an die Schwierigkeiten mit alten Autoradios erinnert, bei denen die verschiedenen Sender streckenweise deutlicher und dann wieder überhaupt nicht zu empfangen waren. So wäre es beispielsweise sicher äußerst aufschlussreich, wenn wir von Tacitus(4) eine Darstellung dessen hätten, was an jenem Strand am Ärmelkanal geschehen ist – aber das ist leider nicht der Fall. Alles, was die Annalen über die Jahre zwischen dem Tod des Tiberius(8) und der Halbzeit der Regentschaft des Claudius(3) zu erzählen hatten, ist verloren gegangen. Dass Caligula(9), jenes Mitglied der Dynastie mit dem übelsten Ruf, auch derjenige Julio-Claudier(3) ist, für dessen Regentschaft die Quellen am lückenhaftesten sind, ist mit großer Wahrscheinlichkeit kein Zufall. Man könnte meinen, dass nach zweitausend Jahren alles über diese Ära erzählt worden ist und nichts mehr zu berichten bleibt, doch das trifft durchaus nicht zu. Wenn wir uns mit Alter Geschichte befassen, müssen wir eingestehen, was wir nicht wissen, aber ebenso wichtig ist es, weiterhin zu versuchen, so viel wie möglich herauszubekommen. Der Leser möge sich darüber im Klaren sein, dass ein Großteil der in diesem Buch erzählten Geschichte stürmische Untiefen überspannt – genau wie jene Pontonbrücke, die Caligula einst zwischen zwei Landzungen im Golf von Neapel errichten ließ. Kontroversen und Meinungsverschiedenheiten sind auf diesem Forschungsgebiet weit verbreitet. Doch genau das macht natürlich auch seine Faszination aus. In den letzten Jahrzehnten haben Umfang und Vitalität der Forschung zu den Julio-Claudiern unser Verständnis ihrer Zeit revolutioniert. Wenn es diesem Buch gelingt, seinen Lesern auch nur eine Ahnung davon zu vermitteln, wie spannend die Auseinandersetzung mit der ersten Kaiserdynastie Roms ist, dann hat es sein Ziel nicht verfehlt. Diese ersten Beispiele und Inbegriffe von Tyrannei im Abendland können auch zwei Jahrtausende später noch ebenso sehr belehren wie aufwühlen.
»Nichts ist düsterer als jene Fackeln, die nicht zulassen, dass wir die Dunkelheit durchdringen, sondern die Dunkelheit lediglich als solche erkennbar machen.«[15] Das schrieb Seneca(2) kurz vor seinem Tod im Jahr 65 n. Chr., kurz nachdem er auf einer Reise entlang des Golfs von Neapel eine Abkürzung durch einen finsteren, staubigen Tunnel genommen hatte. »Nichts ist länger und dunkler als jener Kerker.« Als jemand, der viele Jahre damit zugebracht hatte, den Hof der Caesaren(17) zu beobachten, kannte sich Seneca mit Dunkelheit aus. Caligula(10), der ihm seine Brillanz neidete, konnte gerade noch davon abgehalten werden, ihn töten zu lassen; Claudius(4), empört über Senecas ehebrecherische Affäre mit einer der Schwestern des Caligula, hatte ihn nach Korsika verbannt; und als Agrippina die Jüngere nach jemandem Ausschau hielt, der die lasterhaften Neigungen ihres Sohnes in Zaum hielt, engagierte sie ihn als (4)Neros Erzieher. Seneca, der dann am Ende von seinem früheren Schüler gezwungen wurde, sich die Pulsadern aufzuschlitzen, machte sich keinerlei Illusionen über die Natur des Regimes, dem er diente. Selbst der Friede, den es der Welt gebracht hatte, gründete sich ihm zufolge letztlich auf nichts anderem als auf der »Erschöpfung der Grausamkeit«.[16] Von Anfang an hatte Herrscherwillkür zum Wesen der neuen Ordnung gehört.
Doch was Seneca(3) verabscheute, bewunderte er gleichzeitig. Seine Verachtung für die Macht hielt ihn nicht davon ab, von ihr zu profitieren. Die Dunkelheit Roms glänzte golden. Zweitausend Jahre später können auch wir im Rückblick auf Augustus(24) und seine Erben in dieser Mischung aus Tyrannei und Triumph, Sadismus und Glamour, Machtgier und Ruhm eine goldene Leuchtkraft wahrnehmen, die keine Dynastie seither mehr erreicht hat.
»Caesar(18)ist der Staat.«[17]
Wie es dazu kam – das ist eine Geschichte, die in den vergangenen zweitausend Jahren nichts von ihrem bemerkenswerten, fesselnden, lehrreichen Charakter verloren hat.
Beschützt, bewahrt und behütet diese Staatsordnung, diesen Frieden und diesen Princeps, und nachdem er möglichst lange seine irdische Stellung gehalten hat, schenkt ihm möglichst spät Nachfolger, aber solche, deren Schultern ebenso stark sind, die Last eines Weltreichs zu tragen, wie wir es bei ihm erlebt haben.
Velleius Paterculus (ca. 20 v. Chr. – ca. 31 n. Chr.)
Der Makel der Schandtaten, die diese Männer in alten Zeiten begangen haben,
Wird in den Geschichtsbüchern niemals verblassen. Bis ans Ende der Zeit
Wird man die abscheulichen Taten des Hauses der Caesaren verurteilen.
Claudian (ca. 370 – 404 n. Chr.)
Teil I
PADRONE
1
WOLFSKINDER
Zeugung einer Supermacht
Die Geschichte Roms beginnt mit einer Vergewaltigung. Eine Prinzessin, eine geweihte Jungfrau, wird überrascht und missbraucht. Von dem fatalen Zwischenfall gibt es unterschiedliche Darstellungen. Einige sagen, es sei geschehen, während sie schlief und von einem Mann wundersamer Schönheit träumte, der sie zu einer dunklen Stelle am Flussufer führte und dort verloren und allein zurückließ. Andere behaupten, sie sei während eines Gewitters heimgesucht worden, als sie in einem heiligen Hain Wasser schöpfte. Eine Geschichte weiß sogar von einem mysteriösen Phallus, welcher der Asche der königlichen Feuerstelle entsprang und nicht die Prinzessin, sondern ihre Sklavin nahm. Immerhin sind sich alle bezüglich der daraus resultierenden Schwangerschaft einig; und die meisten – abgesehen von einigen wenigen miesepetrigen Revisionisten – bezweifeln nicht, dass der Vergewaltiger ein Gott(3) gewesen sein muss.3 Mars(1), der Blutvergießer, hatte seinen Samen in einen sterblichen Schoß gepflanzt.
Die Folge war die Geburt zweier göttergleicher Knaben. Diese Zwillinge, Ergebnis der Schändung ihrer Mutter, waren noch kaum auf der Welt, da wurden sie auch schon in den nahen Fluss Tiber geworfen. Doch noch hatte es mit den Wundern nicht sein Bewenden. Der Korb mit den beiden Babys wurde von den Fluten des Flusses mitgenommen und dann am Fuß eines steilen Abhangs, der den Namen Palatin(1) trug, an Land gespült. Dort, in der Mündung einer Grotte, unter einem Feigenbaum, von dessen überbordenden Ästen reife Früchte niederfielen, entdeckte eine Wölfin die Zwillinge; und anstatt sie zu verschlingen, leckte die Wölfin sie sauber und bot den hungrigen Mäulchen der Kleinen ihre Zitzen an. Ein Schweinehirt wurde Zeuge der wundersamen Szene. Er kletterte den Abhang des Palatins hinunter und rettete die Jungen. Die Wölfin machte sich davon. Die beiden geretteten Jungen erhielten die Namen Remus(1) und Romulus(1), und sie wuchsen zu einzigartigen Kriegern heran. Einige Jahre später sah Romulus vom Gipfel des Palatin zwölf Adler: ein sicheres Zeichen der Götter(4), dass er dort auf dem Hügel die Stadt gründen sollte, die für alle Zeiten seinen Namen tragen würde. Er war der Erste, der als König über Rom(9) herrschte.
Das war jedenfalls die Geschichte, die Jahrhunderte später vom römischen Volk erzählt wurde, um die Ursprünge Roms und das einfach wundersame Ausmaß seiner kriegerischen Erfolge zu erklären. Wenn Nicht-Römer diese Geschichte hörten, dann fanden sie sie mit Sicherheit nur allzu einleuchtend. Dass Romulus(2) von Mars(2), dem Gott(5) des Krieges, gezeugt und von einer Wölfin gesäugt wurde, erklärte denjenigen, die mit seinen Nachfahren in empfindlich unmittelbaren Kontakt kamen, vieles über den Charakter der Römer.[1] Sogar ein Volk wie die Makedonier, die unter Alexander dem Großen(1) selbst ein riesiges Reich erobert hatten, das sich fast bis zum Aufgang der Sonne erstreckte, wussten, dass die Römer ein Menschenschlag waren, der sich deutlich von anderen unterschied. Eine kurzer Eröffnungskampf mit unentschiedenem Ausgang, ausgetragen im Jahr 200 v. Chr., hatte gereicht, um das klarzumachen. Fünf Jahrhunderte und mehr waren seit der Zeit des Romulus vergangen – und dennoch haftete den Römern, so der Eindruck ihrer Gegner, etwas von der schaurigen Qualität von Kreaturen an, die vom Mythos ausgebrütet waren. Als die Makedonier ihre Toten vom Schlachtfeld bargen, waren sie völlig entsetzt von dem Gemetzel, das sich dort abgespielt haben musste. Von römischen Schwertern verstümmelte, zerstückelte Leichen hatten die Erde mit Blut getränkt. Arme mitsamt Schulter, abgeschlagene Köpfe, in stinkenden Pfützen schwimmende Eingeweide: Alles zeugte von einem Ausmaß an Gewalttätigkeit, das mehr tierisch als menschlich war. Man kann es den Makedoniern nicht verdenken, dass sie an jenem Tag »angesichts der Art von Waffen und dem Menschenschlag, dem sie sich entgegenstellen mussten«, in Panik gerieten.[2] Die Angst vor Werwölfen war schließlich für zivilisierte Völker etwas völlig Normales. Die Wolfsnatur der Römer, die Andeutung von Klauen unter ihren Fingernägeln und das gelbe Glitzern in ihren Augen, war etwas, das die Völker im Mittelmeerraum und darüber hinaus als Tatsache hinzunehmen gelernt hatten. »Sie geben ja selbst zu, dass ihre Gründer mit der Milch einer Wölfin genährt wurden!« So der verzweifelte Schlachtruf eines Königs, bevor auch sein Reich dem Untergang anheimfiel. »Was kann man anderes erwarten, als dass sie alle in der Brust das Herz eines Wolfs haben. Ihr Blutdurst und ihre Habgier sind unersättlich. Ihre Gier nach Macht und Reichtümern kennt keine Grenzen!«[3]
Naturgemäß sahen die Römer die Sache etwas anders. Sie waren überzeugt, dass die Götter(6) selbst ihnen die Herrschaft über die Welt in die Hand gegeben hatten. Der römische Genius war geschaffen, um zu herrschen. Natürlich gab es andere, die auf anderen Gebieten Herausragendes leisteten. Wer konnte es beispielsweise mit den Griechen aufnehmen, wenn es um die Bearbeitung von Bronze oder Marmor, die Erkundung der Sterne(1) oder die Abfassung von Sexhandbüchern(2) ging? Die Syrer waren hervorragende Tänzer; die Chaldäer brillierten als Sterndeuter(2), und die Germanen als Leibwächter. Aber nur das römische Volk verfügte über die Gaben, die nötig waren, um ein Weltreich zu erobern und an der Macht zu bleiben. Was sie vollbracht hatten, hatte keine Argumente nötig. In der Kunst, die Unterdrückten zu verschonen und die Hochmütigen zu vernichten, konnte ihnen keiner das Wasser reichen.
Die Wurzeln dieser Größe, davon waren sie überzeugt, reichten zurück bis zu ihren frühesten Anfängen. »Das Wesen Roms liegt in den alten Gebräuchen der Stadt und in der Qualität ihrer Männer begründet.«[4] Von Anbeginn war der Maßstab für die Tapferkeit der Stadt die Bereitschaft ihrer Bürger(7), alles für das Gemeinwohl zu opfern – auch ihr Leben. Als Romulus(3) um seine Gründung eine Mauer gebaut und eine Furche – das pomerium – gezogen hatte, um alles innerhalb dieses Bereichs als dem Jupiter(1), König der Götter(7), geweihten Boden zu heiligen, da wusste er, dass mehr nötig war, um Rom(10) wahrhaft unüberwindbar zu machen. Remus(2), sein Zwillingsbruder, hatte sich bereitwillig selbst als Menschenopfer dargebracht. Er übersprang die Grenze und wurde mit einem Spaten erschlagen; »und dadurch, mit seinem Tod, hatte er die Befestigungen der neuen Stadt eingeweiht«.[5] Die Urerde, der erste Mörtel zur Errichtung Roms, war gedüngt mit dem Blut des Sohns des Kriegsgottes.
Remus(3) war der Erste, der sein Leben hingab für das Wohl der Stadt – und natürlich nicht der Letzte. Fünf Könige folgten Romulus(4) auf dem römischen Thron nach; und als der sechste, Tarquinius(1) der Stolze, sich als grausamer Tyrann entpuppte, der seinem Beinamen nur allzu gerecht wurde, setzten seine Untertanen ihr Leben aufs Spiel und empörten sich gegen ihn. Im Jahr 509 v. Chr. wurde die Monarchie(3) ein für allemal abgeschafft. Der Anführer der Rebellion, Brutus(1), ein Neffe des Tarquinius(2), nötigte das Volk von Rom(11), einen kollektiven Eid zu schwören, »dass sie es niemals mehr einem Mann allein erlauben würden, in Rom zu herrschen«. Von diesem Zeitpunkt an war »König« das verpönteste Wort in ihrem politischen Vokabular. Nun waren sie nicht länger Untertanen, sondern sie galten als cives, »Bürger(8)«. Endlich stand es ihnen frei zu zeigen, was in ihnen steckte. »In der nun folgenden Zeit fingen alle an, sich hervorzutun und ihre geistigen Fähigkeiten freier zu entfalten. Einem Alleinherrscher ist ja der Tüchtige stets verdächtiger als der Untaugliche, und immer ist ihm fremdes Verdienst Grund zu Befürchtungen.«[6] In einer Stadt, die vom eifersüchtig-argwöhnischen Blick des Monarchen befreit war, war es nicht mehr nötig, die Sehnsucht der Bürger(9) nach Ruhm zu verbergen. Nun war der Ruhm des römischen Volkes der Maßstab wahren Erfolgs. Wollte er nicht die Verachtung seiner Mitbürger(10) auf sich ziehen, war noch der niedrigste Bauer verpflichtet, seine Aufgaben als Bürger(11) zu schultern und sich als Mann – als vir – zu beweisen.
Virtus, die Qualität eines vir, war das höchste römische Ideal: diese glänzende Verschmelzung von Tatkraft und Mut, in der die Römer selbst ihre größte Stärke sahen. Dem pflichteten sogar die Götter(8) bei. Im Jahr 362 v. Chr., eineinhalb Jahrhunderte nach dem Sturz von Tarquinius(3) dem Stolzen, ereignete sich im Zentrum Roms ein grauenhaftes Omen(1). Unterhalb des Palatin(2), auf dem gepflasterten Platz des sogenannten Forums(1), tat sich eine gähnende Erdspalte auf. Nichts hätte geeigneter sein können, um die Herzen der Römer in Angst und Schrecken zu versetzen. Das Forum war Dreh- und Angelpunkt des Lebens der Bürger(12). Hier richteten Staatsmänner ihre Reden an das Volk, hier sprachen Magistrate(3) Recht, hier verkauften Händler ihre Waren, hüteten Jungfrauen, die dem Dienst der Vesta(1), Göttin des Herdfeuers, geweiht waren, eine ewige Flamme. Dass sich an einem für das römische Leben so fundamental bedeutsamen Ort ein Tor zur Unterwelt auftat, kündigte eindeutig Fürchterliches an: den Zorn der Götter(9).
Und tatsächlich – ein Opfer wurde gefordert: »Das Kostbarste, was Ihr besitzt.«[7] Und was war Roms kostbarster Besitz? Die Frage hatte allgemeines Kopfzerbrechen zur Folge – bis schließlich ein junger Mann namens Marcus Curtius(1) das Wort ergriff. Mannhaftigkeit und Mut, so seine Worte an seine Mitbürger(13), seien die größten Reichtümer, die das römische Volk besitze. Und dann bestieg er in voller Rüstung sein Pferd, gab ihm die Sporen und stürmte auf den Abgrund zu. Galoppierte über den Rand. Und er und sein Pferd stürzten zusammen in die Tiefe. Wie nicht anders zu erwarten, schloss sich der Spalt. Ein Teich und ein einzelner Olivenbaum blieben zurück, die den Ort markierten und die Erinnerung an einen Bürger(14) bewahrten, der sich geopfert hatte, damit seine Mitbürger(15) weiterlebten.
Das römische Volk hielt dieses Ideal des Gemeinwohls so hoch, dass der entsprechende Begriff – res publica – als Kürzel für seine gesamte Regierungsform diente. Es inspirierte die brennende Sehnsucht des einzelnen Bürgers(16) nach Ehre, seine Entschlossenheit, Körper und Geist im Schmelztiegel von Widrigkeiten zu erproben und aus jeder Feuerprobe triumphierend hervorzugehen. Verbunden damit war ein eisernes Pflichtbewusstsein. Für die Nachbarn der Republik(4) waren die Folgen durchweg verheerend. 200 v. Chr., als die Makedonier zum ersten Mal die wölfische Wildheit kennenlernten, derer die römischen Legionen fähig waren, war Rom(12) bereits die Herrin des westlichen Mittelmeerraums. Zwei Jahre zuvor hatten Roms Truppen der einzigen Macht, die sich angemaßt hatte, ihr diesen Rang streitig zu machen, den finalen Schlag versetzt: Karthago, ein Zentrum von Handelsfürsten an der Küste Nordafrikas. Roms Sieg war ein epochaler Triumph gewesen. Der tödliche Kampf zwischen den beiden Städten hatte sich in wechselnder Intensität über mehr als sechzig Jahre hingezogen. Der Krieg war bis vor die Tore der Stadt Rom selbst vorgedrungen. Italia schwamm in Blut. »Die ganze Welt erbebte, vom Kriegsgeräusch erschüttert.«[8] Letztlich aber, nach einer Zeit der Prüfung, die jedes andere Volk dazu getrieben hätte, inständig um Frieden zu betteln, waren die Sieger aus dem Geschehen so kampfgestählt hervorgegangen, als bestünden sie gänzlich aus Eisen. Es konnte von daher auch nicht überraschen, dass selbst die Erben Alexanders des Großen(2) es nicht schafften, sich den Legionen zu widersetzen. Ein König nach dem anderen im Bereich des östlichen Mittelmeers war vor den römischen Magistraten(4) in die Knie gezwungen worden. Im Vergleich zu einer freien, disziplinierten Republik war die Monarchie(4) offensichtlich in einen beträchtlichen Rechtfertigungszwang geraten. »Unsere Gefühle werden von unserem Geist beherrscht.« Das teilte man den Gesandten eines besiegten Königs mit strengem Ernst mit. »Dieser ändert sich nie – gleichgültig, was uns das Schicksal beschert. Widrigkeiten ist es nicht gelungen, uns zu bedrücken, und genauso wenig wurden wir von Erfolg aufgeblasen.«[9]
Der Mann, der diese Worte äußerte, Publius Cornelius Scipio(1), wusste aufgrund seiner Position natürlich, wovon er sprach. Er war ein Ausbund an Erfolg. Sein Beiname »Africanus(1)« legte überdeutlich Zeugnis von der Rolle ab, die er als Sieger über Roms tödlichsten Feind gespielt hatte. Er war es gewesen, der den Karthagern Spanien entwunden, sie in ihrem eigenen Hinterhof geschlagen und schließlich so weit gebracht hatte, entwürdigendste Friedensbedingungen anzunehmen. Wenige Jahre später erschien der Name des Scipio als glänzender Erster auf der Liste der bedeutendsten Bürger(17). Das war in einer Gesellschaft wie der römischen eine unvergleichliche Ehre. Das römische Volk war geradezu besessen von hierarchischer Ordnung. Jeder wurde entsprechend einer gleitenden Rangskala eingestuft. Der Status eines Bürgers(18) wurde mit strenger Präzision bestimmt. Anhand von Vermögen, Familie und Leistung wurde genau festgelegt, wo jeder einzelne Römer innerhalb des anspruchsvollen Klassensystems der Republik(5) stand. Selbst in den obersten gesellschaftlichen Rängen wurden Statusfragen akribisch kontrolliert. Die höchstrangigen Bürger(19) gehörten einer eigenen exklusiven Ordnung an: dem Senat(1). Die Mitgliedschaft setzte außer Reichtum und sozialem Ansehen eine gewisse Anzahl von Jahren im Amt als Magistrat(5) voraus; erst dann war ein Mann qualifiziert, auch als Schiedsrichter über Roms Schicksal zu befinden. Die Entscheidungen der Senatoren(2) waren so heikel und so einflussreich, dass »viele Jahrhunderte lang kein Senator(3) ein Wort davon in der Öffentlichkeit verlauten ließ«.[10] Wenn also ein Politiker sich in diesem Kreis nicht Gehör verschaffen konnte, hätte er genauso gut stumm sein können. Doch das Recht eines Senators(4), das Wort an seine Kollegen zu richten, verstand sich nicht von selbst. In einer Debatte wurden als erstes die Männer aufgerufen, die sich aufgrund ihrer Herkunft, ihres moralischen(1) Rufs und dessen, was sie im Dienst des Staats geleistet hatten, das meiste Ansehen verschafft hatten. Diese Qualität bezeichneten die Römer als auctoritas(1), und indem die Republik Scipio auf dem ersten Platz der Rangliste ihrer Bürger(20) einordnete, stützte sie das an sich schon gewaltige Gewicht seiner Autorität. Der Eroberer Karthagos hatte, so die einhellige Meinung, »einzigartigen, überwältigenden Ruhm erlangt«.[11] Man war sich einig, dass Scipio Africanus selbst unter den leistungsstärksten Männern Roms keinen Rivalen hatte. Er war der Princeps Senatus(1), »der erste Mann des (5)Senats«.
Doch in dieser Vorrangstellung lauerte Gefahr. Es war unvermeidlich, dass der Schatten, den Scipio(2) über seine Mitbürger(21) warf, Feindseligkeit provozierte. Die Devise der Republik(6) lautete nach wie vor: Kein einzelner Mann sollte als Oberster in Rom(13) herrschen. Für das römische Volk weckte allein schon der öffentliche Auftritt eines Magistrats(6) Erinnerungen an die gefährlichen, verführerischen Fallstricke der Monarchie(5). Das Purpur, das seine Toga säumte, war ursprünglich die Farbe des Königtums gewesen. »Liktoren(1)« – Leibwächter, deren Pflicht es war, dem Magistrat den Weg durch die Menge seiner Mitbürger(22) freizumachen – hatten einst ebenso Tarquinius(4) den Stolzen eskortiert. Das Rutenbündel mit Beil, das jeder Liktor auf der Schulter trug – es wurde als fascis bezeichnet –, symbolisierte Autorität(2) in einem einschüchternd königlichen Ausmaß: das Züchtigungsrecht und das Recht, die Todesstrafe zu verhängen.4 Eine solche Machtfülle war furchterregend und heimtückisch. Nur wenn äußerste Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, konnte man einer Person in einer freien Republik eine solche Machtfülle überlassen. Deshalb waren nach dem Sturz der Monarchie die Befugnisse des vertriebenen Königs nicht auf einen einzigen, sondern auf zwei Magistrate übertragen worden: auf die Konsuln(1). Wie starker Wein musste der Glanz des Konsulamts und der unsterbliche Ruhm, den es demjenigen eintrug, der es innehatte, zunächst einmal vorsichtig verdünnt werden. Nicht nur konnte man sich darauf verlassen, dass jeder Konsul ein wachsames Auge auf seinen Kollegen hatte, sondern das Konsulamt war auch auf ein einziges Jahr beschränkt. Der Ruhm, den Scipio genoss, konnte dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er solche Beschränkungen geflissentlich ignorierte. Selbst die bedeutendsten unter den gewählten Magistraten der Republik konnten nicht umhin, sich im Verhältnis zu ihm herabgesetzt zu fühlen. Und so kam es, dass sich im Senat(6) ein immer deutlicheres Murren gegen den Princeps(1) vernehmen ließ.
Tatsächlich stieß solch verführerischer Glanz in der Republik(7) immer auf tiefsten Argwohn. Was das römische Volk von seinen Politikern erwartete, waren Falten im Gesicht und Abgeklärtheit im Auftreten. Allein schon der Begriff »Senator« leitete sich von dem lateinischen Wort für »alter Mann« ab. Der kometenhafte Aufstieg Scipios(3) dagegen hatte bereits in skandalös jugendlichem Alter begonnen. Er war erst 26 Jahre alt gewesen, als man ihm das Oberkommando gegen die Karthager in Spanien übertragen hatte. Nur fünf Jahre später wurde er zum ersten Mal Konsul(2). Selbst seine Erhebung zum Princeps Senatus(2) war in einem Alter erfolgt, in dem andere Senatoren(7), die weit unter ihm in den Niederungen des Erfolgs herumkrebsten, sich noch um Juniormagistraturen(7) bemühten. Eine blendende Eroberungskarriere hinzulegen, bevor die Wangen erschlafften, war natürlich genau das, was Alexander so eindrücklich vorgemacht hatte. Gekränkte Senatoren(8) konnte diese Parallele kaum beruhigen. Schließlich war Alexander nicht nur ein Ausländer, sondern darüber hinaus auch noch ein König gewesen. Das übermenschliche, geradezu göttliche Ausmaß seines Ehrgeizes war berühmt, doch für viele Senatoren(9) war es ein unerfreulicher Gedanke, dass der selbstgemachte Aufstieg einer so verstörenden Gestalt von einem Mann aus den eigenen Reihen nachgeäfft wurde. Man behauptete, Scipio sei von einer Schlange gezeugt worden; er habe seinen Sieg in Spanien dem rechtzeitigen Beispringen eines Gottes zu verdanken; er müsse nachts nur das Forum(2) überqueren, und sämtliche Hunde würden aufhören zu bellen. Vielleicht war er der Princeps(2), aber Geschichten dieser Art ließen auf einen Status schließen, der den Rahmen ganz klar sprengte.
Und der insofern natürlich untragbar war. Im Jahr 187 v. Chr., als Scipio(4) von einem Feldzug im Osten zurückkehrte, warteten seine Feinde schon auf ihn. Man beschuldigte ihn der Unterschlagung. Scipio zerfetzte vor den Augen des Senats(10) seine Rechnungsunterlagen und erinnerte seine Ankläger empört an all die Reichtümer, die er für Rom(14) erworben hatte. Bewirken konnte er damit nichts. Statt die Demütigung eines Schuldspruchs zu riskieren, zog der Princeps(3) es vor, sich endgültig auf sein Landgut zurückzuziehen. Dort starb er im Jahr 183 v. Chr. als gebrochener Mann. Das Grundprinzip des politischen Lebens in der Republik(8) war an seinem Beispiel unbarmherzig statuiert worden: »Kein Bürger(23) darf ein so hohes Ansehen gewinnen, dass er nicht mehr von den Gesetzen in Frage gestellt werden kann.«[12] Nicht einmal ein Mann von der Größe eines Scipio Africanus(2) hatte es letztlich geschafft, dieses Prinzip anzutasten.
Wolfsbrut hin oder her – die Zukunft der Römer, ihrer Republik(9) und ihrer Freiheiten schien jedenfalls gesichert.
Das Große Spiel
Aber stimmte das überhaupt?
Scipio(5) hatte sich den Gesetzen der Republik(10) unterworfen – so weit, so gut. Allerdings deutete allein schon die Wirkmächtigkeit seines Charismas darauf hin, dass die Entwicklung der Republik zur Supermacht womöglich nicht frei von Fallstricken war. Scipios Gegner hatten sich in halsstarrigem Provinzialismus(5) gefallen. Für sie stand außer Frage, dass die alten römischen Sitten die besten waren. Allerdings zeichneten sich bereits die Grenzen einer derart konservativen Einstellung ab. Insofern war Scipio lediglich ein Vorreiter. Das zunehmende Gewirr der diplomatischen Verpflichtungen Roms, die unüberbietbare Schlagkraft seiner Legionen und seine strikte Weigerung, auch nur die geringsten Anzeichen mangelnden Respekts zu dulden, all das brachte für seine führenden Bürger(24) auch Versuchungen von buchstäblich globalem Ausmaß mit sich. Gut ein Jahrhundert nach Scipios Tod erlangte ein neuer Liebling des römischen Volkes so viel Ruhm und Reichtum, dass er damit noch die kühnsten Träume früherer Generationen bei Weitem übertraf. Pompeius Magnus(1) – »Pompeius der Große« – konnte sich eines Werdegangs rühmen, in dem sich ungesetzliches Tun und Selbstverherrlichung zu unerhörter Wirkung verbanden. Im Alter von 23 verfügte er bereits über eine eigene Privatarmee. Es folgten mehrere glanzvolle und einträgliche Führungsaufträge. Der Mann, der früher den Beinamen »der jugendliche Schlächter« geführt hatte,[13] musste sich nicht mit den Mühsalen einer herkömmlichen Laufbahn abgeben. Zur allgemeinen Verblüffung hatte er es geschafft, im zarten Alter von 36 Jahren zum ersten Mal Konsul(2)(3) zu werden, ohne je dem Senat(11) angehört zu haben.
Und weitere Ungeheuerlichkeiten sollten folgen. Die Anstandsregeln der Republik(11) wurden nonchalant ignoriert. Im Jahr 67 v. Chr. wurde Pompeius(3) ein Kommando übertragen, das erstmals den gesamten mediterranen Raum umfasste. Ein Jahr später legte er noch eins drauf, indem er carte blanche erhielt, direkt über immense Gebiete zu bestimmen, die verlockenderweise noch gar nicht annektiert worden waren. Der Osten von Kleinasien beziehungsweise Asia Minor – so nannten die Römer den vorderasiatischen Teil der heutigen Türkei – und ganz Syrien wurden eingenommen. Pompeius(4) wurde als »Eroberer sämtlicher Völker« gepriesen.[14] Als er im Jahr 62 v. Chr. schließlich nach Italia zurückkehrte, brachte er mehr mit als nur Ruhm. Könige standen unter seinem Schutz, und Königreiche mussten sich von ihm ausbeuten lassen. Seine Legionen waren nicht der Republik treu, sondern dem Mann, der ihnen den Osten zum Ausschlachten überlassen hatte: ihrem triumphierenden Feldherrn, ihrem Imperator. Pompeius(5) selbst war kein Mann falscher Bescheidenheit: Bei seinem Ritt durch die Straßen Roms präsentierte und brüstete er sich im Umhang Alexanders des Großen(3).
Keiner, auch nicht der halsstarrigste Konservative, konnte seine Vorrangstellung leugnen. »Ein jeder billigte seinen unangefochtenen Status als Princeps(4).«[15] Im Unterschied zu Scipio(6) verdankte Pompeius(6) diesen Titel nicht irgendeiner Wahl des Senats(12). Vielmehr hing seine auctoritas(3) wie der Weihrauch, den er in knarrenden Wagenzügen aus dem Osten mitgebracht hatte, gleich einem dichten, wohlriechenden, ungreifbaren Nebel über Rom(15). Die Länge und Reichweite der Feldzüge des Pompeius hatten die traditionellen Rhythmen des politischen Lebens der Republik(12) ad absurdum geführt. Der Gedanke, seine Befehlsmacht mit einem anderen zu teilen oder sie auf jeweils nur ein Jahr beschränken zu lassen, war Pompeius(7) nie in den Sinn gekommen. Was war denn schon der Senat(13), dass er sich anmaßte, den »Weltenbändiger« zu behindern?[16] Pompeius hatte seine Siege nicht trotz, sondern aufgrund seiner Gesetzesübertretungen errungen. Was daraus folgte, war höchst verstörend. Gesetze, die Rom in den Jahren seines Provinzialismus(6) gute Dienste geleistet hatten, begannen nun, da Rom die Welt beherrschte, merklich zu wackeln. Die Könige, die gebeugten Hauptes im Triumphzug(1) des Pompeius vorgeführt wurden, machten deutlich, welch schwindelerregende Aussichten sich dem Bürger(25) boten, der bereit war, die altehrwürdigen Sicherheitsvorkehrungen gegen die Monarchie(6) über Bord zu werfen. Roms Größe wurde von seinen Bürgern(26) lange Zeit als Frucht ihrer bürgerlichen(27) Freiheit angesehen und geschätzt, doch nun schien eben diese Größe die Republik mit der Zersetzung ihrer Freiheiten zu bedrohen.
Aber Pompeius(8) hatte trotz seiner offensichtlichen Stärke überhaupt nicht die Absicht, sich seinen Mitbürgern(28) mit vorgehaltenem Schwert aufzuzwingen. Zwar hatte er schon immer nach Macht und Ruhm gegiert, doch es gab Grenzen, die nicht einmal er überschreiten wollte. Eine Herrschaft, die nicht auf der Zustimmung seiner Standesgenossen beruhte, war eine Herrschaft, die anzustreben sich nicht lohnte. Militärische Willkür kam nicht in Frage. In der Republik(13) gab es Größe nur im Rahmen der Anerkennung durch den Senat(14) und das Volk von Rom(16). Pompeius(9) wollte alles. Und das machte ihn angreifbar. Zwar waren seine Feinde zu eingeschüchtert von den Mitteln, die dem neuen Princeps(5) zur Verfügung standen, als dass sie Anklage gegen ihn erhoben hätten. Aber sie konnten ihm ihre Mitarbeit verweigern. Das Ergebnis war Stillstand. Zu seinem Schreck und seiner Entrüstung sah Pompeius(10), wie seine Vorstöße im Senat(15) blockiert, seine Abmachungen nicht ratifiziert, seine Leistungen belächelt und kleingeredet wurden. Die übliche Politik? Die Feinde des Pompeius wagten zu hoffen. Die alte Konstante der Republik hatte offenbar immer noch ihre Gültigkeit: Mochte einer auch noch so anmaßend sein, früher oder später würde er einen Dämpfer bekommen.
Ein paar der schärfsten Rivalen des Pompeius(11) nahmen die Krise wahr, in der sich ihre Stadt befand, wenngleich sie nicht weniger skrupellos und gierig dagegen vorzugehen gedachten. Genau wie bei den anderen Senatoren(16) rief der Auftritt eines Mitbürgers, der sich den prächtigen Osten als Lehen unter den Nagel gerissen hatte, bittere Gefühle der Eifersucht und Sorge bei ihnen hervor. Sie sahen allerdings darüber hinaus ein neues Zeitalter berauschender Möglichkeiten heraufdämmern. Der Gipfel des Ehrgeizes eines Römers war nicht mehr nur das Konsulat(1)(4). Es entstand nun der Wunsch, die Kapazität, welche die Institutionen der Republik(14) boten, zu überschreiten. Belohnungen von schwindelerregendem Ausmaß rückten in verführerische Nähe: »das Meer, das Land, der Lauf der Sterne«.[17] Man brauchte nur den Mut, die Hand auszustrecken und nach ihnen zu greifen.
Im Jahr 60 v. Chr., als die Feinde des Pompeius(12) nicht aufhörten zu fauchen und nach den Fersen des großen Mannes zu schnappen, planten zwei der begnadetsten Strippenzieher Roms ein Manöver von monumentaler Kühnheit. Marcus Licinius Crassus(1) und Julius Caesar(7) waren Männer, deren Neid auf den Princeps(6) nur von ihrer Entschlossenheit übertroffen wurde, ihm nachzueifern. Beide hatten gute Gründe, sich Großes vorzunehmen. Crassus(2) saß schon seit langer Zeit wie eine Spinne im Herzen eines monströsen Netzes. Die auctoritas(4) des erfahrenen Feldherrn und ehemaligen Konsuls(5) hatte bei aller Brillanz auch ihre Schattenseiten. Wie Pompeius(13) hatte er erkannt, dass die sichersten Quellen der Macht in Rom(17) nicht mehr dieselben waren wie früher. Obwohl er auf der Bühne des öffentlichen Lebens durchaus zu Hause war, lag seine eigentliche Begabung darin, hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen. Er war reicher, als man sich das in Rom überhaupt vorstellen konnte, und sein einziger beständiger Charakterzug war sein grenzenloser Opportunismus. Crassus(3) hatte seinen anscheinend unerschöpflichen Reichtum dafür verwendet, eine ganze Generation karrieresüchtiger Männer zu umgarnen. Die meisten mussten, wenn sie seinen Kredit erst einmal angenommen hatten, später feststellen, dass es unmöglich war, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Es musste schon ein Mann von seltenem politischen Talent kommen, um diesen Fängen zu entkommen und sich als eigenständiger Akteur zu profilieren.
Ein solcher Mann war Caesar(8). Im Jahr 60 v. Chr. war er vierzig Jahre alt: Nachkomme einer alten Familie, deren Ruhm allerdings verblasst war, berüchtigt für seinen üppig-dandyhaften Lebensstil und massiv verschuldet. Niemand – nicht einmal seine Feinde, und derer gab es viele –, konnte seine Talente leugnen. Charme verband sich mit Rücksichtslosigkeit, Elan mit Zielstrebigkeit zu einer wirkungsvollen Mischung. Zwar war er Crassus(4) – von Pompeius ganz zu schweigen – an Mitteln und Ansehen unterlegen; was Caesar(9) den beiden Männern allerdings bieten konnte, war sein Zugriff auf die offiziellen Zügel der Macht. Im Jahr 59 wurde ihm die Aufgabe übertragen, als einer der beiden gewählten Konsuln(6) der Republik(15) zu dienen. Natürlich fiel es ihm aufgrund der Rückenstärkung durch Pompeius und Crassus(5) und aufgrund seiner eigenen unglaublichen Fähigkeit zu cooler Gelassenheit nicht schwer, seinen Konsulskollegen kaltzustellen, und sei es noch so illegal. Das Konsulat(2) entwickelte sich faktisch zu dem von »Julius und Caesar(10)«.[18] Er und seine beiden Verbündeten waren in der Lage, einen ganzen Maßnahmenkatalog in ihrem Sinne durchzudrücken. Pompeius(14), (6)Crassus, Caesar(11): Es war absehbar, dass sie allesamt prächtig von ihrem Dreierbund profitieren würden.
Und so kam es dann auch. Nachfolgende Generationen sahen in der Geburt dieses »Triumvirats(1)« den Anfang einer verhängnisvollen Entwicklung, die auf »die Bildung einer Verschwörung« hinauslief, mit dem Ziel, »die Republik(16) mattzusetzen«.[19] Tatsächlich taten die drei Dynasten nichts anderes, als was politische Schwergewichte seit Jahrhunderten betrieben hatten. Schon immer war es bei den politischen Angelegenheiten Roms um die Bildung von Bündnissen und das Niedermachen von Rivalen gegangen. Dennoch stellte das Konsulat(3)(7) von »Julius und Caesar«(12) eine fatale Wegmarke in der Geschichte Roms dar. Als Caesars Schergen einen Eimer mit Exkrementen über den Rivalen im Konsulsamt ausgossen, seine Liktoren(2) verprügelten und den erniedrigten Mann praktisch in den Ruhestand zwangen, da läutete das ein Jahr von so unverfrorenen Gesetzeswidrigkeiten ein, dass es unter den Konservativen niemanden mehr gab, der das je würde vergessen oder vergeben können. Dass Caesars(13)